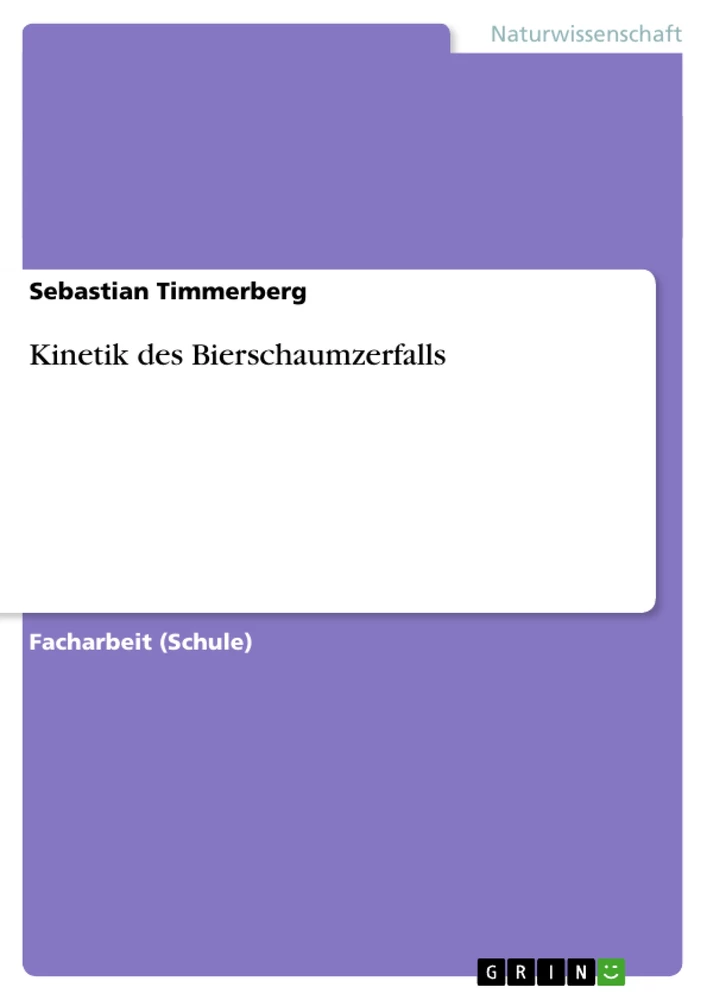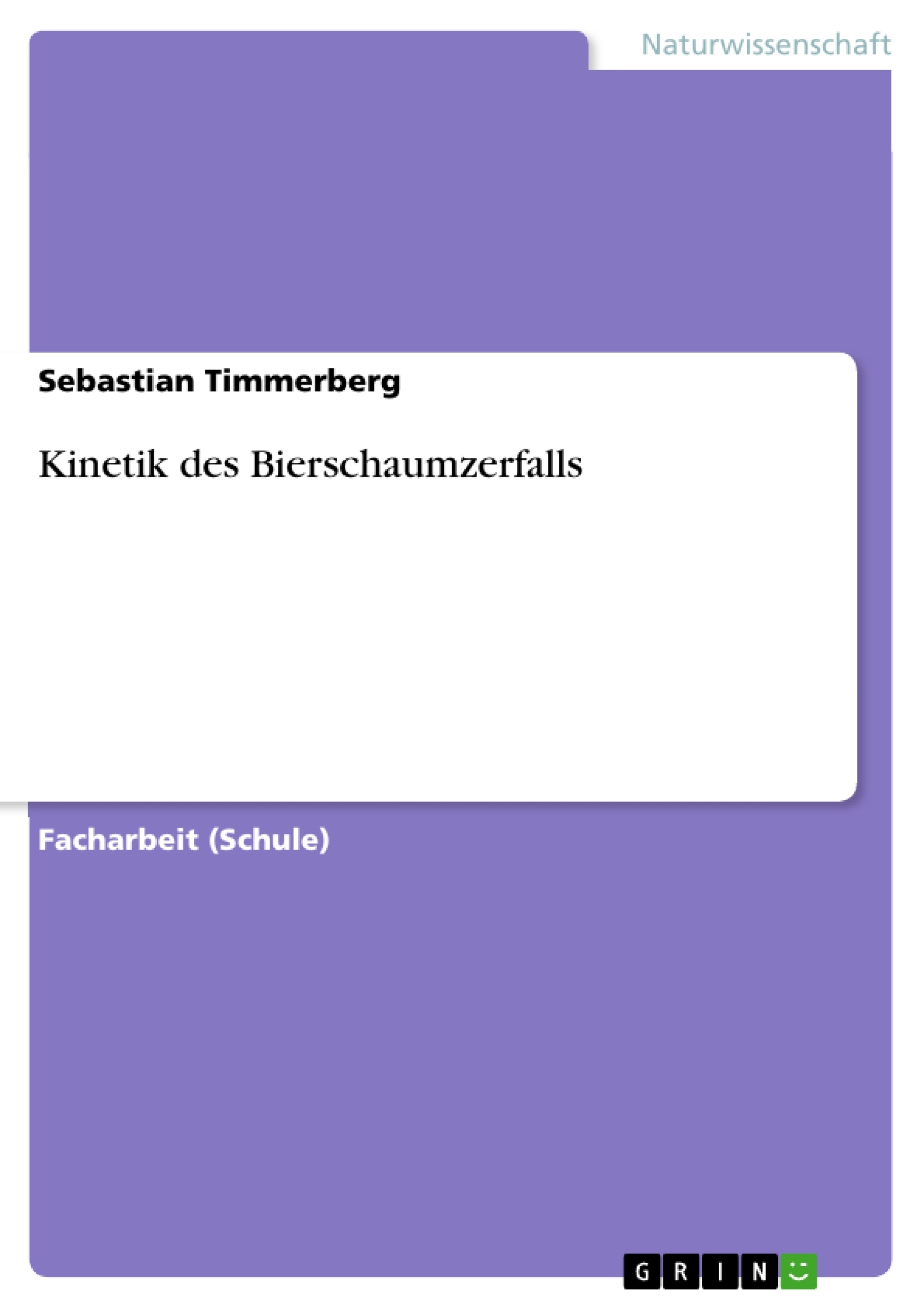Was macht ein Bier zu einem wirklich guten Bier? Mehr als nur Geschmack und Alkoholgehalt – es ist die Kunst der Brauerei, die Wissenschaft des Schaums und die flüchtige Schönheit einer perfekten Krone. Dieses Buch taucht ein in die faszinierende Welt des Bieres, von den antiken Ursprüngen in Sumer und Babylon bis zu den modernen Brautechniken, die unser heutiges Biererlebnis prägen. Entdecken Sie die Geheimnisse des Mälzens, Maischens, Läuterns, Würzekochens und der Gärung, die jeden Schluck zu einem einzigartigen Genuss machen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Bierschaum, diesem vergänglichen, aber entscheidenden Element, das nicht nur das Auge erfreut, sondern auch die Qualität des Bieres widerspiegelt. Anhand wissenschaftlicher Experimente wird die Kinetik des Bierschaumzerfalls untersucht, um die Faktoren zu entschlüsseln, die seine Stabilität beeinflussen. Lernen Sie, wie Temperatur, Kohlendioxidgehalt und die Anwesenheit von Proteinen und Hopfenbitterstoffen das Schicksal jeder einzelnen Blase bestimmen. Doch was passiert, wenn das Bier schal wird? Erfahren Sie, wie der Verlust von Kohlensäure den erfrischenden Charakter des Bieres beeinträchtigt und wie man diesem Prozess entgegenwirken kann. Dieses Buch ist eine Hommage an die Braukunst, eine wissenschaftliche Analyse des Bierschaums und ein praktischer Leitfaden für alle Bierliebhaber, Hobbybrauer und Experten, die tiefer in die Materie eintauchen möchten. Es bietet einen umfassenden Einblick in die komplexen Prozesse, die ablaufen, bevor das goldene Getränk mit seiner perfekten Schaumkrone vor uns steht – ein Muss für jeden, der Bier nicht nur trinken, sondern auch verstehen will. Die Analyse der Bierschaumstabilität, unter anderem am Beispiel des Jever Pilseners, offenbart interessante Einblicke in die Qualität verschiedener Biere und bietet eine Grundlage für die Bewertung des perfekten Biererlebnisses. Tauchen Sie ein in die Welt der Braukunst und entdecken Sie die Wissenschaft hinter dem Genuss!
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Historie des Bierbrauens
2.1 Antike
2.2 Mittelalter
2.3 Neuzeit
3 Prozess der Bierherstellung
3.1 Mälzen
3.2 Maischen und Läutern
3.3 Würzekochen und Gärung
3.4 Lagerung
4 Bierschaum und seine Entstehung
5 Versuch zur Kinetik des Bierschaumzerfalls
5.1 Durchführung
5.2 Beobachtungen
5.3 Auswertung
5.3.1 Bestimmung der Momentangeschwindigkeiten
5.3.2 Zusammenhang von Geschwindigkeit und Volumen
5.3.3 Bestimmung der Halbwertszeit
6 Schales Bier
7 Zusammenfassung
8 Abschlussblatt
9 Literaturverzeichnis
10 Anhang I
Einleitung
In dieser Facharbeit soll die Kinetik des Bierschaumzerfalls untersucht werden.
Das Thema ist alleine deshalb interessant, weil Bier ein häufig konsumiertes Genussmittel ist. Im Durchschnitt trinkt jeder Bürger 115,8 Liter pro Jahr, das entspricht ungefähr einer Flasche Bier pro Tag (0,33L). Damit liegt Deutschland weltweit nach Tschechien an zweiter Stelle[1].
Unter Bierkonsumenten ist der Bierschaum ein beliebtes Thema. Diskutiert wird der Schaumzerfall, Schaumkonsistenz und vor allem die Schaumhaltbarkeit.
Bevor auf die Kinetik des Bierschaumzerfalls eingegangen wird[2], ist es sinnvoll zuerst einen Einblick in die Geschichte und den Prozess des Bierbrauens zu geben.
Historie des Bierbrauens
Antike
Die genauen Anfänge des Bierbrauens sind bis heute nicht bekannt. Einer Legende nach haben wir das Bier dem Zufall zu verdanken: Einem Kranken legte man Brot in Wasser ein, um diesem das Schlucken zu erleichtern. Das eingelegte Brot wurde jedoch vergessen, es vergor und wurde erst Tage später verkostet. Da der Alkoholgehalt im „Bier“ den Kranken in einen angenehmen Rauschzustand versetzte und dieser zufällig auch noch schnell genas, verbreitete sich das Rezept über das ganze Land[3].
Erste Funde über Bier stammen aus der Zeit der Sumerer. Tontafeln aus der Zeit zwischen 4000 und 3000 v. Chr. zeigen Sumerer beim Brauen eines bierähnlichen Getränkes. Bier der damaligen Zeit wurde wie in der Legende dargelegt hergestellt, hatte aber im Vergleich zum heutigen einen geringen Alkoholgehalt. Ob Gärung stattfand, blieb dem Zufall überlassen.
Das Brotwasser war natürlich ungefiltert und hatte deshalb einen bitteren Geschmack. Um ungeliebte Fest- und Bitterstoffe nicht mit in den Mund zu bekommen, wurde Bier häufig mit einer Art Strohhalm getrunken. Beliebt wurde Bier durch die berauschende Wirkung des Alkohols.
Im 17. Jahrhundert v. Chr. übernahmen die Babylonier Sumer und damit ihre Braukunst. Sie entwickelten etwa 20 verschiedene Biersorten. Im antiken Babylon galt Bier als wichtiges Grundnahrungsmittel. Jedem Untertan stand ein bestimmtes Bierdeputat zu, Arbeitern zwei Liter, Beamten drei und Priestern sogar fünf Liter[4].
Die Ägypter kauften zuerst das Bier der Babylonier, brauten aber schon kurz darauf ihr eigenes. Der Gerstensaft schmeckte zu dieser Zeit wahrscheinlich abscheulich, was die Zugabe von Datteln, Anis, Zimt oder Baumrinde erklärt.
Um 2500 v. Chr. hieß das ägyptische Schriftzeichen für Mahlzeit wörtlich übersetzt „Brot-Bier“[5]. Das Bierbrauen wurde um Brauabschnitte wie das Mälzen ergänzt und lebensmittelrechtlichen Bestimmungen unterworfen. Zudem führten die Pharaonen die erste Getränkesteuer der Welt ein um zum einen der Trinklust der Bürger entgegenzuwirken, zum anderen die geplanten Pyramiden zu finanzieren.
In der Zeit des römischen Reiches war Bier als Getränk der Barbaren bekannt. Die gestandenen Weintrinker verabreichten Bier lediglich als Medizin. Die Germanen hingegen hatten eine Schwäche für das Gebräu. So schreibt ein römischer Historiker: „Sie könnten wohl Hunger und Kälte ertragen, nicht aber den Durst.“[6] Die Fähigkeit des Bierbrauens erwarben sie ca. 800 Jahre v. Chr..
2.2 Mittelalter
Bier galt in unseren Regionen als Nahrungsmittel, weshalb seine Herstellung Frauensache war. Rund 800 Jahre n. Chr. entdeckten die Mönche das Bier für sich. Für sie galt: „Liquida non frangunt ieunum“ – Flüssiges bricht das Fasten nicht.[7] Durch die Energie des Bieres konnten Mönche auch in der Fastenzeit schwere körperliche Arbeit verrichten. Viele Klöster begannen Bier zu brauen und verfeinerten es immer weiter. So verwendeten sie z.B. als erstes Hopfen, welcher dem Bier Würze und Haltbarkeit verleiht. Mit dem Erhalt des Ausschankrechtes entwickelten sich Klöster zu regelrechten Wirtschaftsbetrieben, deren qualitativ hochwertigen Biere immer beliebter wurden.
In Städten bildete sich zudem ein neuer Berufszweig – der Brauer – denn auch hier wollte man auf gutes Bier nicht verzichten. Einige Fürsten führten aufgrund des steigenden Bierkonsums Biersteuern ein, um die Staatskassen zu füllen. Bier der Klosterschenken war von der Besteuerung nicht betroffen. Dies führte zu Steuereinbußen der Fürsten, die darauf einige Klöster schließen ließen.
Im Jahre 1516 erließ der bayrische Herzog Wilhelm IV. in Ingoldstadt das Bayrische Reinheitsgebot. Der Erlass legte Preise und Inhaltsstoffe für Bier fest um u.a. die Qualität des Bieres zu erhalten. Dass heute ein Bier in Deutschland nur aus Malz, Hopfen und Wasser gebraut werden darf, geht auf dieses bayrische Reinheitsgebot zurück.
Neuzeit
In der Neuzeit wurde das Bierbrauen durch Erfindungen einiger Wissenschaftler weiterentwickelt.
Grundlage für die Erfindung zweier wichtiger Errungenschaften ist die Präzision des Mikroskops von van Leeuwenhoek im 17. Jahrhundert. Louis Pasteur erkannte, dass durch Erhitzen Zellen absterben.
Das Wissen benutzen zuerst die Brauer, die durch das Pasteurisieren Bier keimfrei und somit haltbarer machten.[8] Zudem entdeckte Pasteur, dass Hefe für die Gärung verantwortlich ist. Darauf aufbauend schaffte es der dänische Physiologe Emil Hansen einzelne Hefezellen zu isolieren. In einer Zuckerlösung vermehrten sich die Zellen zu Hefekulturen. Die Verwendung reiner Hefekulturen sichert seitdem die konstante Qualität des Gärungsprozesses.
War es bis zur Erfindung der Kältemaschine durch Carl von Linde im Jahr 1873 nur möglich ganzjährig obergäriges[9] Bier zu brauen, war man nun in der Lage jederzeit das etwas herbere untergärige Bier herzustellen, dessen Hefe eine Gärtemperatur von ca. 6°C benötigt. Es folgte ein Siegeszug der untergärigen Biere. Besonders das 1842 von Josef Groll zum ersten Mal in Pilsen gebraute Pilsener war und ist bis heute sehr beliebt.
Auch die industrielle Revolution zog am Bierbrauen nicht vorbei. Die Prozesse wurden zunehmend mechanisiert. So ist es möglich, dass 2003 deutschlandweit 93,9 Mill. Hektoliter Bier konsumiert wurden[10].
Prozess der Bierherstellung
Aufgrund des bereits erwähnten Reinheitsgebotes sind deutsche Brauereien verpflichtet keinerlei Zusatzstoffe zu verwenden[11]. Um das Bier zu beeinflussen, müssen sie auf technologische Verfahren zurückzugreifen.
Viele Produktionsschritte sind notwendig, bis aus den Zutaten das „Goldene mit der Krone“ entsteht.
Mälzen
Der Mälzprozess verlangt Fingerspitzengefühl und wird meist von unabhängigen Mälzereien für Brauereien durchgeführt.
Die gereinigte Rohgerste[12] wird in Mälzereien in ein Wasserbad gegeben, die Weiche. Durch Osmose ziehen sich die Gerstenkörner voll mit Wasser. In Keimkästen beginnt die feuchte Braugerste zu keimen. Nach rund sechs Tagen wird der Keimvorgang gestoppt, indem das Grünmalz durch den Einsatz von heißer Luft getrocknet oder fachsprachlich abgedarrt wird. Ob dunkles oder helles Malz entsteht, das für die typische Farbe des Bieres verantwortlich ist, kann durch Dauer und Temperatur des Darrvorganges reguliert werden.
Aus der Rohgerste ist nun Malz geworden. Malz ist süß, verhältnismäßig mürbe und unterscheidet sich in seiner Farbe von der Gerste. Mälzen bewirkt, dass Enzyme in der Gerste freigesetzt werden, die wichtig für die weitere Bierbereitung sind.
Maischen und Läutern
In der Brauerei beginnt der Brauprozess erst beim Maischen. Vor Beginn des Maischens wird das Malz geschrotet und beim Einmaischen in heißes Wasser gegeben. Dabei lösen sich verschiedene Stoffe im Wasser. Die Temperatur des Wassers wird reguliert um ideale Arbeitsbedingungen für die Enzyme des Malzes zu schaffen. Diese bauen bei ihren Temperaturoptima hochmolekulare Stoffe in niedermolekulare ab. So wandelt z.B. bei 62°C bis 65°C das Enzym ß-Amylase die Getreidestärke in vergärbaren Malzzucker um. Bei der Länge der Temperaturrast der Proteasen muss drauf geachtet werden, dass es nicht zu einem zu starken Abbau der hochmolekularen Eiweiße des Malzes kommt. Diese Eiweiße sind wichtig für den Bierschaum.
Durch eine positive Jodprobe, die ein Nachweis für eine vollständige Verzuckerung ist, wird das Maischen beendet.
Die Maische wird im Läuterbottich von den nichtlöslichen Überresten des Getreides, dem so genannten Treber, getrennt.
Der Treber hat keinen weiteren Nutzen mehr für das Bier und wird häufig als Viehfutter verwendet. Durch das Läutern erhält man die klare Würze.
Würzekochen und Gärung
Wie der Name schon sagt, wird in diesem Brauschritt die Würze gekocht. Zudem wird der Würze Hopfen zugegeben, der sich z.T. in der Würze löst. Hopfen beeinflusst später die Haltbarkeit sowie den Geschmack des Bieres. Die Hitze des Kochvorganges zerstört die noch anwesenden Enzyme, sterilisiert die Würze und kocht sie ein.
Die Bierwürze wird anschließend von den nicht gelösten Hopfenresten getrennt, abgekühlt und mit Sterilluft belüftet.
Der Würze wird nun Hefe beigemischt, die sich unter diesen kühlen, sauerstoff- und zuckerreichen Bedingungen vermehrt und den ganzen Sauerstoff verbraucht. Steht ihr kein Sauerstoff mehr zur Verfügung, beginnt die Hefe den Zucker in Kohlendioxid und Ethanol umzuwandeln. Am Ende der Gärung setzt sich die Hefe ab und wird dem entstandenen Jungbier entnommen.
Lagerung
Das Jungbier wird zur geschmacklichen Reifung noch ca. drei Wochen gelagert. Zudem wird hier der CO2-Gehalt eingestellt; noch enthaltene Schwebstoffe setzten sich am Boden ab.
Nach der Lagerung wird das Bier gefiltert. Dabei werden noch restliche Eiweiße entfernt, was Vorteile für die Haltbarkeit hat, aber nachteilig für die Schaumstabilität ist. Schlussendlich folgt die Abfüllung in Flaschen, Dosen oder Fässer.
4 Bierschaum und seine Entstehung
„Das Auge isst mit“, dieser Grundsatz gilt auch für den Bierkonsum. Neben einem leckeren Geschmack sollten Biere natürlich auch ein gutes Aussehen besitzen. Deshalb achten viele Brauereien neben der Farbe des Bieres besonders auf den Bierschaum.
Erwünscht ist ein sahniger, feinporiger Schaum mit einem guten Haftungsvermögen und einer hohen Halbwertszeit.
Bier ist ein kohlesäurehaltiges[13] Getränk mit einem Kohlendioxidgehalt[14] zwischen 4 bis 5 Gramm Kohlendioxid (CO2) pro Liter Bier[15].
Das gelöste CO2 steht bei einer Bierflasche im Gleichgewicht mit dem CO2 im Flaschenhals. Öffnet man die Flasche, entweicht aus dem Flaschenhals das Kohlendioxid und Luft tritt ein. Luft hat einen geringeren CO2-Gehalt mit ca. 0,03 Volumenprozent. Es stellt sich erneut ein Gleichgewicht zwischen dem im Bier gelösten CO2 und dem CO2 der Luft ein. Kohlendioxid tritt bläschenförmig auf.
Durch die mechanische Arbeit – dem Einschenken – wird die CO2-Entbindung begünstigt und es steigt vermehrt CO2 auf. Die Gasbläschen treffen auf im Bier vorhandene oberflächenaktive Substanzen. Zu diesen Stoffen gehören vor allem höhermolekulare Eiweißabbauprodukte und Hopfenbitterstoffe.[16] Sie weisen eine geringe Oberflächenspannung auf und können so um das austretende CO2 eine elastische Hülle bilden. Viele dieser umschlossenen Kohlendioxidbläschen ergeben die Schaumkrone.
Zerfall von Bierschaum ist zum einen auf das Zurückfließen der Flüssigkeit, die das CO2 umgibt, zurückzuführen. Die Wand einer Blase wird im oberen Teil immer dünner, da aufgrund der Schwerkraft die Flüssigkeit nach unten fließt, bis die Blase oben einreißt und somit zerplatzt. Zum anderen diffundiert Kohlendioxid von kleineren in größere Blasen, weil in kleineren Blasen höhere Drücke herrschen. Folglich schrumpfen kleine Blasen bis in ihnen kein CO2 mehr vorhanden ist, große Blasen platzen, wenn sie ein zu großes Gasvolumen enthalten[17].
5 Versuch zur Kinetik des Bierschaumzerfalls
Bierschaum wird besonders durch seine Haltbarkeit definiert. Zur Bestimmung der Bierschaumstabilität des Jever Pilseners[18] wurde folgender Versuch durchgeführt:
Durchführung
In einen Messzylinder V = 1000mL wird Jever Pilsener (Biertemperatur: 8°C, Umgebungstemperatur: 20°C) gegossen. Ziel ist es über möglichst wenig Bier eine hohe Schaumkrone zu erzeugen, der Messzylinder sollte ausgefüllt sein. Es wird ca. eine Minute abgewartet, sodass die größten Blasen zerplatzt sind. In Zeitintervallen von 30 Sekunden wird fünf Minuten lang das Volumen des Bierschaums ermittelt. Gemessen wird vom unteren Rand des Bierschaums bis zum Meniskus.
Beobachtungen
Das Volumen des Bierschaums verringert sich mit der Zeit. Mit kleiner werdendem Bierschaumvolumen vergrößert sich das Volumen des Bieres. Gas entweicht dem Bier.
Tabelle 1: Messwerte der Bierschaumzerfallsreihe Jever Pilsener
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auswertung
Bestimmung der Momentangeschwindigkeiten
Zur genauen Ermittlung der Momentangeschwindigkeit des Bierschaumszerfalls wird ein Regressionsgraph r durch die aus dem Versuch ermittelten Werte gelegt. Die erste Ableitung dieser Funktion nach der Zeit gibt die Steigung des Graphen zu jeder beliebigen Zeit Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten an, die die Momentangeschwindigkeit beschreibt.
Der Kinetik des Bierschaumzerfalls liegt ein Zeitgesetzt erster Ordnung zugrunde
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(V = aktuelles Volumen des Bierschaums; V0 = Anfangsvolumen des Bierschaums; k = Geschwindigkeitskonstante; t = Zeit)[19]
Deshalb bietet sich es an auch eine e-Funktion als Regressionsfunktion
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
zu benutzen.
Man kann das Problem der exponentiellen Regression auf eine lineare Regression transformieren, indem man die Funktionswerte der Messung und gleichzeitig die Regressionsfunktion logarithmiert. Dadurch wird die Regressionsfunktion zu einer Geraden
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Durch die Transformation können die Formeln für eine Augleichsgerade[20] verwendet werden[21]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um die Gleichungen (4a), (4b) und (4c) verwenden zu können, wird bei der Versuchsreihe Tabelle 1 für Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten und Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten verwendet. Es ergeben sich folgende Zahlenwerte Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten,Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[22].
Die Umformung der Gleichung (4a) führt mit Gleichung (3) zu
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Damit ist die exponentielle Regressionsfunktion
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
berechnet.
Zur Beurteilung der Güte einer Regression kann man das Bestimmtheitsmaß[23],[24] Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten verwenden. Liegen alle Punkte auf der Regressionsgraden, dann ist das Bestimmtheitsmaß R2 =1 = 100 %, Je niedriger der Wert, desto geringer ist die Aussagekraft der Regressionsgraden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Für die Werte der Tabelle 1 und der Regressionsfunktion (5) berechnet sich das Bestimmtheitsmaß zu Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten; d.h. die Messwerte liegen nahezu exakt auf dem errechneten Regressionsgraphen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diagramm 1: Versuchsergebnisse und Regressionsgraph
Die Funktion Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenbeschreibt die Steigung des Graphen der FunktionAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten. Die Steigung entspricht der Momentangeschwindigkeit des Bierschaumzerfalls v[25].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Ausgangsgeschwindigkeit des Bierschaumzerfalls v0 ist die Momentangeschwindigkeit bei Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wird Gleichung (9) in Gleichung (8) eingesetzt, erhält man die übliche Form der Geschwindigkeitsgleichung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Für den Bierschaumzerfall von Jever Pilsener berechnet sich Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltennach Gleichung (9) und folgend die Geschwindigkeitsgleichung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hinweis zu den Einheiten
Der Exponent einer e-Funktion muss frei von Einheiten sein. Um dies für die benutzen Gleichungen des Bierschaumzerfalls zu erfüllen, ist die Maßeinheit für die Geschwindigkeitskonstante Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, da die Zeiten in Sekunden gemessen wurden. Damit ergibt sich die Maßeinheit für die Geschwidigkeit des Bierschaumzerfalls aus Gleichung (9) zu Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, da das Volumen in Millilitern gemessen wurde.
Aus der Geschwindigkeitsgleichung (11) ergeben sich folgende Werte für die Momentangeschwindigkeit:
Tabelle 2: Momentangeschwindigkeit des Bierschaumzerfalls
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zusammenhang von Geschwindigkeit und Volumen
Aus den Erkenntnissen zur Berechnung der Momentangeschwindigkeit lässt sich ein Zusammenhang zwischen dem Volumen des Bierschaums und der Geschwindigkeit des Zerfalls finden.
Löst man die Gleichungen (1) und (8) nach der e-Funktion auf und setzt sie gleich, erhält man
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Daraus folgt, dass die Momentangeschwindigkeit proportional zum Volumen ist, damit ist die Proportionalitätskonstante Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten.
Bei der Versuchsreihe des Jever Pilseners entspricht Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diagramm 2: Abhängigkeit der Momentangeschwindigkeit vom Volumen
Bestimmung der Halbwertszeit
Die Halbwertszeit Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenentspricht der Zeit, in der sich der Wert einer exponentiellen Abnahme halbiert.
Bezogen auf den Bierschaumzerfall gibt daher die Halbwertszeit einen einfachen vergleichbaren Wert für die Schaumstabilität.
Es gilt für jeden Zerfall von Bierschaum die Gleichung (1). Ist das aktuelle Schaumvolumen V auf die Hälfte des Ausgangsvolumen V0 zerfallen, ist die sich ergebene Zeit t die Halbwertszeit:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zur Bestimmung der Halbwertszeit für Jever Pilsener wurden zwei weitere Versuche[26] nach dem beschriebenen Verfahren durchgeführt[27]. Dadurch soll die Wahrscheinlichkeit verringert werden, dass es sich bei dem ersten Versuch um ein Zufallsergebnis handelt. Auch für die weiteren Messreihen wurden Regressionsgraphen mit ihren Koeffizienten errechnet. Erfreulicherweise ergibt sich Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten. Daraus erhält man für die Halbwertszeit des Jever Pilsner Schaums:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach einer Einteilung von Hudson sollte ein sehr gutes Bier Bierschaum mit einer Halbwertszeit >110 Sekunden bilden[28]. Mit einer Halbwertszeit von 407 Sekunden liegt die Schaumstabilität des Jever Pilseners deutlich über den geforderten Werten für ein sehr gutes Bier. Aus dem Blickwinkel der Schaumhaltbarkeit ist Jever Pilsener in die Kategorie eines sehr guten Biers einzustufen.
Zum Vergleich ergaben Halbwertszeiten anderer Biere[29]:
Erdinger Weißbier Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Oettinger Hefeweißbier Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schales Bier
Bier erhält seinen erfrischenden Charakter durch seinen hohen Kohlensäuregehalt zwischen vier und fünf Gramm CO2 pro Liter. Von schalem Bier spricht man, wenn es aufgrund eines geringen Kohlensäuregehaltes nicht mehr zu Entbindung von Kohlendioxid kommt. Einen wesentlichen Einfluss auf das Schalwerden hat die Temperatur, da die Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten mit steigender Temperatur abnimmt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diagramm 3: Löslichkeit von Kohlendioxid in Wasser3
Das Diagramm 3 zeigt, dass in 20°C warmen Wasser im Vergleich zu Wasser von 0°C ungefähr 50% weniger CO2 gelöst werden kann. Nach eben diesem Schema verläuft die CO2-Löslichkeit in Bier.
Ein eben geöffnetes, warmes Bier schmeckt jedoch noch nicht schal, obwohl sein Kohlendioxidanteil gesunken ist. Ein weiterer Faktor beim Schalwerden des Bieres ist die Zeit, da sich ein Gleichgewicht zwischen gelöstem und gasförmigem Kohlendioxid einstellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Hals einer ungeöffneten Bierflasche befindet sich fast reines CO2, wodurch ein Kohlendioxidgehalt von vier bis fünf Gramm pro Liter Bier bestehen kann. Ein geöffnetes Bier ist jedoch von Luft umgeben, die besitzt einen geringen Kohlendioxidanteil von ca. 0,03 % Vol.. Damit beträgt der Partialdruck von Kohlendioxid nur ca. 0,03 kPa und ist erheblich geringer als der Partialdruck von CO2 in einer geschlossenen Flasche (ca. 1013hPa). Die Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten ist proportional zum Partialdruck des Gases[30].
Der geänderte CO2 –Partialdruck des Gasgemisches, das das Bier umgibt, beeinflusst das chemische Gleichgewicht so, dass CO2 dem Bier entweicht, bis sich erneut ein Gleichgewicht zwischen gelöstem und gasförmigem Kohlendioxid eingestellt hat[31].
Ist der Kohlensäuregehalt im Bier soweit abgesunken, dass merklich kein Kohlendioxid mehr dem Bier entweicht, schmeckt das Bier schal.
Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde mit einfachen Mitteln der Nachweis geführt, dass sich der Bierschaumzerfall gut mit einer e-Funktion beschreiben lässt. Das Bestimmtheitsmaß der Messreihe zum Regressionsgraphen liegt erfreulicherweise bei allen Messreihen über 97%.
Die Geschwindigkeitskonstante ergab für Jever Pilsener den Wert Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, was einer Halbwertszeit von Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten entspricht. Nach Hudson steht das für eine sehr gute Bierschaumstabilität.
Abschlussblatt
Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Facharbeit selbständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel genutzt und die Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe.
Jever, den 29.März 2006
(Sebastian Timmerberg)
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass diese Facharbeit der schulinternen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann[32].
Jever, den 29.März 2006
Sebastian Timmerberg)
Literaturverzeichnis
Bücher, Broschüren und Dissertationen:
Anger, H.-M. Dr.-Ing.: Schaummessungen mittels Lg-Foamtester, Maßstab für künftige DLG-Prämirungen…
Burkert, Johannes: Beurteilung der Bierqualität anhand unterschiedlicher Reduktonklassen, Weihenstephan 2005
Die deutschen Brauer (Hg.): Vom Halm zum Glas, wie deutsches Bier gebraut wird
Dröge, Jan Christian: Untersuchung der Kinetik des Bierschaumzerfalls
Eisner, Werner, u.a.: Elemente Chemie 2 Gesamtband, Unterrichtswerk für die Sekundarstufe 2, Stuttgart 2000
Erbrecht, Rüdiger Prof. Dr., u.a.: Das große Tafelwerk interaktiv Formelsammlung für die Sekundarstufe 1 und 2, Berlin 2003
Evans, D. Evan und Sheehan, Marian C: Don’t Be Fobbed Off. The Substance of Bear Foam – A Review, Australien 2002
Gesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Brauwirtschaft e.V.(Hg.): Beruf klar, alles klar!
Gesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Brauwirtschaft e.V.(Hg.): Was für ein Genuss! Tipps zur Bierverkostung
Heyse, Karl-Ullrich Dr.-Ing.: Handbuch der Brauerei-Praxis. Nürnberg, 2.Aufl. 1989
Kausen, Ernst: Numerische Mathematik mit TURBO-PASCAL, Heidelberg 1989
Komet Verlag (Hg.): Lexikon der Biere, Köln 1999
Kunze, Wolfgang: Technologie Brauer und Mälzer. 8., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1998
Schmidt, Hans: Katechismus der Brauerei-Praxis: ein Frage- und Antwortbuch für die grundlegende Ausbildung im Braugewerbe sowie zur Verwendung bei Meister- und Gesellen-Prüfungen. Nürnberg, 15.Aufl. 1989
Stamm, Marc: Enzymchemische und technologische Untersuchungen über den Einfluss von Hefeenzymen – speziell Hefeproteinasen auf den Bierschaum, München 2000
Internetquellen:
http://www.bier.de/ (in den Rubriken: Geschichte des Bieres, Basics, Arten und Gattungen, Rohstoffe des Bieres, Der Brauprozeß, Zahlen, Fakten und die größten Irrtümer, dreizehn häufig gestellte Fragen, Tipps zum Biergenuss, Mit Testen geht’s am besten, etc.)
http://de.wikipedia.org/ (unter den Themen: Bier, Schaum, Kohlenstoffdioxid, Geschwindigkeit, Bestimmtheitsmaß, Korellationskoeffizient, Regressionsanalyse, Kinetik, Geschichte des Bieres, Brauprozess, obergärig, untergärig, Reinheitsgebot, Pils, Pasteur, Guinness, u.v.m.)
http://www.foodnews.ch/allerlei/20_historisches/Bier_Geschichte_1.html (Stand 30.01.2004)
http://www.bier-lexikon.lauftext.de/ober-untergaerig.htm (Stand 17.02.2006)
http://www.familie-wischnewski.de/bier/ (Stand 19.03.2006)
http://www.hobbybrauer.info/index.html (Stand 14.03.2006)
http://www.brauerei-huebner.de/lexikon01.html#s (Stand 29.04.2001)
http://www.media-aetas.de/bibliothek/bier.html (Stand 21.02.2006)
http://www.karlsberg.de/unternehmen_747.htm (Stand 15.03.2006)
http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/ern/8793.html (Stand 03.03.2006)
http://www.media-aetas.de/bibliothek/bier.html (Stand 28.02.2006)
http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2004/p4650064.htm (Stand 08.11.2004)
http://www.wissenschaft-technik-ethik.de/wasser_loesung.html (Stand 07.03.2006)
10. Anhang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Bier (Stand 12.02.2006)
[2] Abweichungen über Herangehensweisen an die Arbeitsaufträge sind mit dem Aufgabensteller abgesprochen.
[3] Weitgehend nach: http://www.bier.de/cms/startordner/wissen/1568_a6058u2.php (Stand 11.02.2006)
[4] Komet Verlag (Hg.): Lexikon der Biere, Köln 1999
[5] http://www.bier-lexikon.lauftext.de/aegypter.htm (Stand 11.02.2006)
[6] http://www.media-aetas.de/bibliothek/bier.html (Stand 13.02.2006)
[7] http://www.bier.de/cms/startordner/wissen/1568_a6059u3.php (Stand
20.02.2006)
[8] Erst später diente dieses Verfahren auch in der Milchindustrie zur Abtötung von Bakterien.
[9] Der Name rührt daher, dass obergärige Hefe nach der Gärung oben auf dem Jungbier schwimmt. Obergärige Hefe benötigt zur Gärung eine Temperatur von 15°C-20°C. Diese Eigenschaft hatte zur Folge, dass obergäriges Bier das ganze Jahr über gebraut werden konnte. Typische Vertreter der obergärigen Biere sind heute Kölsch, Weizen- und Altbier. Charakteristisch ist der milde und süffige Geschmack.
[10] www.destatis.de/presse/deutsch/pm2004/p4650064.htm (Stand 01.03.2006)
[11] Streng betrachtet kann nach deutschem Reinheitsgebot kein Bier gebraut werden, da Hefe zum Brauprozess zugeführt werden muss. Die Hefebakterien sind für die Gärung verantwortlich. Ohne sie kann bekanntlich kein Alkohol entstehen.
[12] Bei Weizenbier wird Gerste durch Weizen ersetzt.
[13] Folgend dem allgemeinen Sprachgebrauch wird im Kommenden in Wasser eingeführtes Kohlendioxid zur Vereinfachung als Kohlensäure bezeichnet. Naturwissenschaftlich betrachtet ist dies nicht richtig. Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Über 99% des Kohlendioxids sind bei Normalbedingungen physikalisch gelöst, somit liegt das Gleichgewicht stark auf der Seite der Edukte. (http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlendioxid, Stand 25.02.2006)
[14] In einigen Biersorten ist neben Kohlendioxid Stickstoff gelöst wie z.B. im Guinness.
[15] Kunze, Wolfgang: Technologie Brauer und Mälzer. 8., völlig neu bearb. Aufl., Berlin 1998, S. 221
[16] Kunze, S. 309
[17] http://de.wikipedia.org/wiki/Schaum (Stand 12.02.2006)
[18] Jever Pilsener wurde gewählt, weil es sich um eine ortsansässige, international bekannte und qualitativ hochwertige Marke handelt. Da dieses Bier in meinem Freundeskreis häufiger konsumiert wird, ist es naheliegend gerade die Qualität dieses Schaums zu überprüfen.
[19] Dröge, Jan Christian: Untersuchung der Kinetik des Bierschaumzerfalls
[20] Erbrecht, Rüdiger Prof. Dr., u.a.: Das große Tafelwerk interaktiv Formelsammlung für die Sekundarstufe 1 und 2, Berlin 2003
[21] Kausen, Ernst: Numerische Mathematik mit TURBO-PASCAL, Heidelberg 1989, S.39
[22] Rechnung kann im Anhang S.I verfolgt werden.
[23] Erbrecht, S.39
[24] http://de.wikipedia.org/wiki/Bestimmtheitsma%C3%9F (Stand 01.03.2006)
[25] http://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeit (Stand 02.03.2006)
[26] Ergebnisse der Messreihen s. S.II
[27] Es wurde darauf geachtet, dass beim Versuch ein ähnlicher Luftdruck herrschte und die Bier- und Raumtemperatur den Werten des ersten Versuchs ähnelten.
[28] Dröge
[29] Messreihen anderer Biersorten s. Anhang S.IIIf. 3 Werte des Diagramms nach: http://www.wissenschaft-technik-ethik.de/wasser_loesung.html (Stand 20.02.2006)
[30] Henry-Gesetz, Gesetz zur Löslichkeitsverhalten flüchtiger Substanzen in Wasser (http://de.wikipedia.org/wiki/Henry-Gesetz, Stand 22.03.2006)
[31] Le Chatelier, Gesetz des kleinsten Zwanges
[32] Mariengymnasium Jever (Hg.): Kurzer Leitfaden zur formalen Gestaltung von Facharbeiten, Jever,
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Facharbeit über Bier?
Diese Facharbeit untersucht die Kinetik des Bierschaumzerfalls, also wie schnell der Schaum auf einem Bier zerfällt.
Warum ist Bierschaum ein wichtiges Thema?
Bierschaum ist für Bierkonsumenten ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Diskutiert werden Schaumzerfall, Schaumkonsistenz und Schaumhaltbarkeit.
Welche Aspekte der Bierherstellung werden in der Facharbeit behandelt?
Die Facharbeit gibt einen Einblick in die Geschichte des Bierbrauens (Antike, Mittelalter, Neuzeit) sowie den Prozess der Bierherstellung (Mälzen, Maischen und Läutern, Würzekochen und Gärung, Lagerung).
Was wird über die Geschichte des Bierbrauens gesagt?
Die Facharbeit behandelt die Anfänge des Bierbrauens bei den Sumerern, Babyloniern, Ägyptern, Römern und Germanen sowie die Rolle der Klöster im Mittelalter und die Entwicklungen in der Neuzeit durch wissenschaftliche Entdeckungen und die industrielle Revolution.
Was beinhaltet der Prozess der Bierherstellung laut Facharbeit?
Der Prozess beinhaltet Mälzen (Umwandlung von Gerste in Malz), Maischen und Läutern (Extraktion der Würze), Würzekochen und Gärung (Zugabe von Hopfen und Hefe) sowie Lagerung (Reifung des Biers).
Wie entsteht Bierschaum?
Bierschaum entsteht durch Kohlendioxid, das aus dem Bier entweicht und von oberflächenaktiven Substanzen (Eiweißabbauprodukte, Hopfenbitterstoffe) umschlossen wird. Diese bilden eine elastische Hülle um die CO2-Bläschen.
Welche Faktoren beeinflussen den Zerfall von Bierschaum?
Der Zerfall von Bierschaum wird durch das Zurückfließen der Flüssigkeit aus den Blasen und die Diffusion von Kohlendioxid von kleineren in größere Blasen beeinflusst.
Was wird im Versuch zur Kinetik des Bierschaumzerfalls untersucht?
Der Versuch untersucht die Bierschaumstabilität von Jever Pilsener, indem das Volumen des Bierschaums über einen Zeitraum von fünf Minuten gemessen wird.
Wie wird die Momentangeschwindigkeit des Bierschaumzerfalls bestimmt?
Die Momentangeschwindigkeit wird durch Anlegen eines Regressionsgraphen an die Messwerte und Berechnung der ersten Ableitung dieser Funktion nach der Zeit bestimmt.
Was ist die Halbwertszeit des Bierschaums und wie wird sie bestimmt?
Die Halbwertszeit ist die Zeit, in der sich das Volumen des Bierschaums halbiert. Sie wird experimentell ermittelt und dient als Vergleichswert für die Schaumstabilität.
Was bedeutet "schales Bier"?
Schales Bier hat einen geringen Kohlensäuregehalt, wodurch es nicht mehr erfrischend wirkt. Dies wird durch Temperatur und den Partialdruck von Kohlendioxid beeinflusst.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Zusammenfassung gezogen?
Der Bierschaumzerfall lässt sich gut mit einer e-Funktion beschreiben. Die Geschwindigkeitskonstante und Halbwertszeit für Jever Pilsener deuten auf eine sehr gute Bierschaumstabilität hin.
Was besagt das Reinheitsgebot?
Das Reinheitsgebot von 1516 besagt, dass Bier nur aus Malz, Hopfen und Wasser gebraut werden darf.
Was wird in der Neuzeit erfunden, dass das Bierbrauen beeinflusst hat?
Die Präzision des Mikroskops von van Leeuwenhoek, das Pasteurisieren, Hefekulturen, Kältemaschine.
- Quote paper
- Sebastian Timmerberg (Author), 2006, Kinetik des Bierschaumzerfalls, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110071