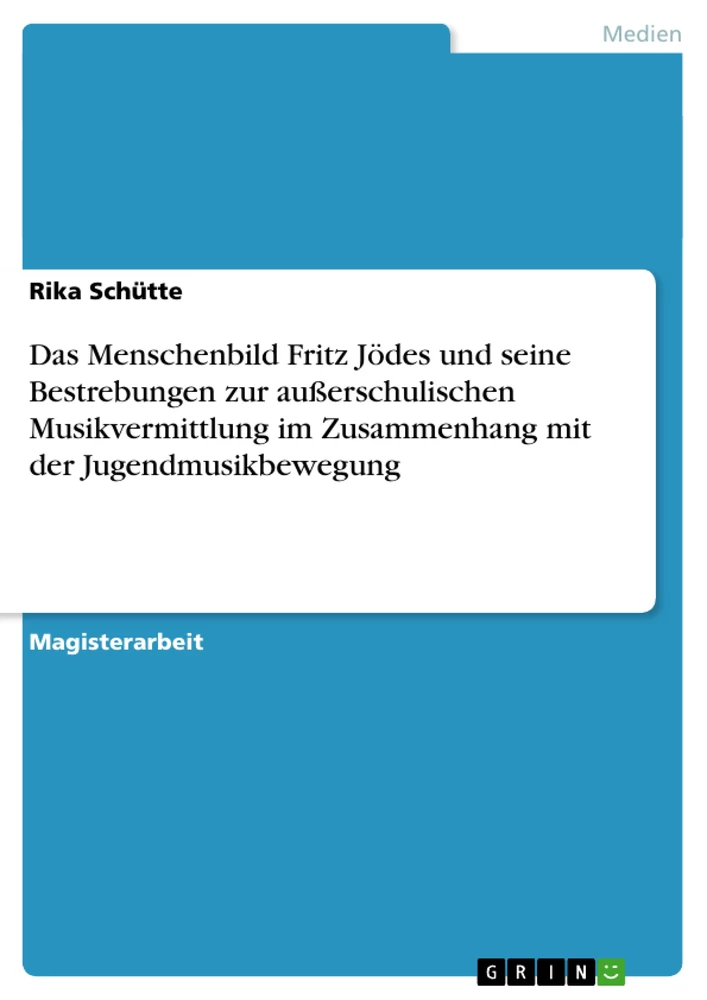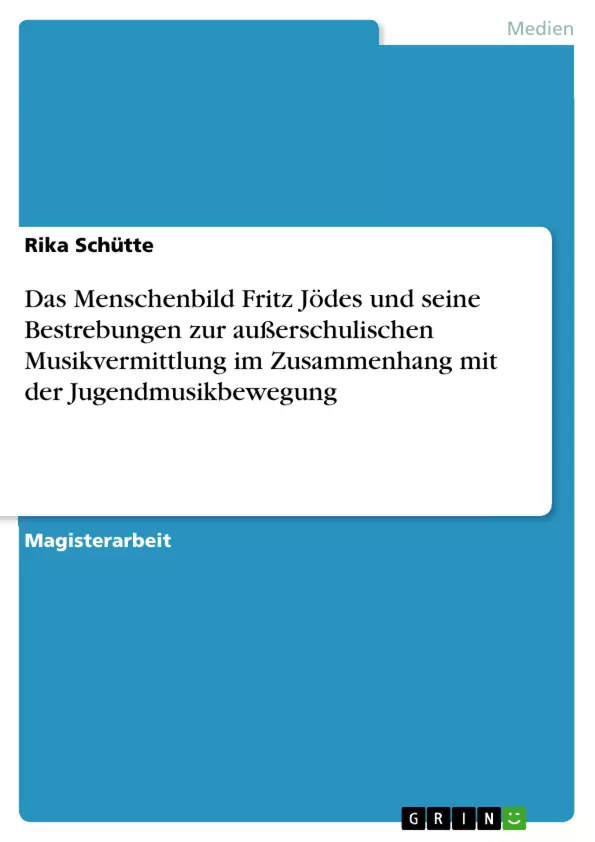Die deutsche Jugendmusikbewegung, die sich im ersten Drittel des zwanzigsten Jahr- entwickelte, ist außerhalb von Fachkreisen erstaunlich unbekannt, und mit ihr einer ihrer wichtigsten Protagonisten: Fritz Jöde, von Haus aus Musikpädagoge, später einflußreicher Professor an der staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik, erfolgreicher Organisator und Impulsgeber auf dem Gebiet der schulischen Musikpädagogik und der außerschulischen Vermittlung von Musik, von Zeitgenossen viel gelobt und heftig kritisiert. Erstaunlich und auch bedauerlich ist diese Unkenntnis deshalb, weil ausschlaggebende Impulse aus dieser Bewegung bis heute für das musikalische Leben und die Anschauungsweise von Musik in unserer Gesellschaft wirksam sind. Ziel der Jugendmusikbewegung war die Neubelebung der Laienmusik bzw. die Schaffung einer neuen Volksmusik. Viele inzwischen selbstverständlich scheinende Dinge stammen aus der Jugendmusikbewegung: Die Blockflöte - heute eines der üblichsten Instrumente für die musikalische Früherziehung - wurde damals neu entdeckt; die musikalische Früherziehung selbst entspringt Bemühungen Jödes. Auch die Gitarre als Gebrauchsinstrument für jedermann wurde damals aus der Laute entwickelt. Die Vorstellung, daß Musizieren dem Menschen förderlich sei und die Möglichkeit dazu kein Statussymbol höherer Klassen, sondern jedem erreichbar sein sollte, entstand in jener Zeit und ist heute eine fast allgemeingültige Forderung, inzwischen sogar gestützt von neueren Erkenntnissen aus der Hirnforschung. 1 Jöde gründete auf der Basis dieser Ideen unter anderem die ersten Volks- und Jugendmusikschulen, aus denen sich die heutigen Musikschulen entwickelten.
Die Jugendmusikbewegung wurde zu ihrer Zeit nicht nur von ihren Anhängern, sondern durchaus auch von ihren Kritikern für wichtig genug gehalten, um einer ernsthaften Auseinandersetzung würdig zu sein. Daß sie heute gar nicht mehr im öffentlichen Bewußtsein vorhanden ist, hängt zum Teil wahrscheinlich mit der heftigen Kritik zusammen, die ab den fünfziger Jahren an ihr geübt wurde; der prominenteste dieser Kritiker war Theodor W. Adorno. 2
Es wurden zudem immer mehr Stimmen laut, die der Jugendmusikbewegung bzw. ihren Protagonisten vorwarfen, der nationalsozialistischen Bewegung zugearbeitet zu haben, [...]
Inhaltsverzeichnis
Die Problemstellung der vorliegenden Arbeit
1 Historischer Überblick
1.1 Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts
1.1.1 Politisch-gesellschaftliche Grundlagen
1.1.2 Musikunterricht
1.1.3 Reformbewegungen
1.1.4 Jugendbewegung
1.2 Jugendmusikbewegung
1.2.1 Begriffsklärung
1.2.2 Musikalische Grundideen
1.2.3 Anfänge
1.2.4 Chorbewegung
1.2.5 Instrumentalmusik
1.2.6 Jugendmusikbewegung und Schulmusik
1.2.7 Jugendmusikbewegung und Politik
2 Menschenbild und Musikverständnis Fritz Jödes
2.1 Der ‚neue Mensch’
2.2 Musik als Lebendiges
2.3 Theoretische Hauptwerke
2.3.1 Organik
2.3.2 Elementarlehre der Musik
2.3.3 Das schaffende Kind in der Musik
2.3.4 Zusammenfassung
3 Jödes außerschulische Musikvermittlung
3.1 Die Musikantengilde
3.1.1 Idee und Organisation
3.1.2 Musikwochen
3.1.3 Zusammenarbeit mit Hindemith
3.1.4 Die ‚Schwarze Hand von Oberhof’
3.2 Jugend- und Volksmusikschulen
3.2.1 Jugendmusikschule Berlin Charlottenburg
3.2.2 Volksmusikschule Hamburg
3.2.3 Weitere Entwicklung
3.2.4 Fortbildung der Lehrkräfte
3.3 Wiederbelebung alter Instrumente
3.3.1 Blockflöte
3.3.2 Laute und Gitarre - ein Streitfall
3.4 Offenes Singen
3.5 Neue Musik-Literatur
3.5.1 Die Wiederentdeckung alter Musik
3.5.2 Neue Kompositionen
3.5.3 Liederbücher und Heftreihen
3.5.4 Zeitschriften
3.6 Neue Medien
3.6.1 Rundfunk
3.6.2 Schallplatte
3.6.3 Rundfunk und Gemeinschaftsbegriff
4 Fazit
Anhang: Zeittafel (Auswahl)
Literaturverzeichnis
Erklärung
Die Problemstellung der vorliegenden Arbeit
Die deutsche Jugendmusikbewegung, die sich im ersten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte, ist außerhalb von Fachkreisen erstaunlich unbekannt, und mit ihr einer ihrer wichtigsten Protagonisten: Fritz Jöde, von Haus aus Musikpädagoge, später einflußreicher Professor an der staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik, erfolgreicher Organisator und Impulsgeber auf dem Gebiet der schulischen Musikpädagogik und der außerschulischen Vermittlung von Musik, von Zeitgenossen viel gelobt und heftig kritisiert. Erstaunlich und auch bedauerlich ist diese Unkenntnis deshalb, weil ausschlaggebende Impulse aus dieser Bewegung bis heute für das musikalische Leben und die Anschauungsweise von Musik in unserer Gesellschaft wirksam sind.
Ziel der Jugendmusikbewegung war die Neubelebung der Laienmusik bzw. die Schaffung einer neuen Volksmusik. Viele inzwischen selbstverständlich scheinende Dinge stammen aus der Jugendmusikbewegung: Die Blockflöte - heute eines der üblichsten Instrumente für die musikalische Früherziehung - wurde damals neu entdeckt; die musikalische Früherziehung selbst entspringt Bemühungen Jödes. Auch die Gitarre als Gebrauchsinstrument für jedermann wurde damals aus der Laute entwickelt. Die Vorstellung, daß Musizieren dem Menschen förderlich sei und die Möglichkeit dazu kein Statussymbol höherer Klassen, sondern jedem erreichbar sein sollte, entstand in jener Zeit und ist heute eine fast allgemeingültige Forderung, inzwischen sogar gestützt von neueren Erkenntnissen aus der Hirnforschung.[1] Jöde gründete auf der Basis dieser Ideen unter anderem die ersten Volks- und Jugendmusikschulen, aus denen sich die heutigen Musikschulen entwickelten.
Die Jugendmusikbewegung wurde zu ihrer Zeit nicht nur von ihren Anhängern, sondern durchaus auch von ihren Kritikern für wichtig genug gehalten, um einer ernsthaften Auseinandersetzung würdig zu sein. Daß sie heute gar nicht mehr im öffentlichen Bewußtsein vorhanden ist, hängt zum Teil wahrscheinlich mit der heftigen Kritik zusammen, die ab den fünfziger Jahren an ihr geübt wurde; der prominenteste dieser Kritiker war Theodor W. Adorno.[2]
Es wurden zudem immer mehr Stimmen laut, die der Jugendmusikbewegung bzw. ihren Protagonisten vorwarfen, der nationalsozialistischen Bewegung zugearbeitet zu haben, einerseits durch ihre teils völkisch-national gefärbte Gemeinschafts- und Führer-Ideologie, andererseits auch dadurch, daß sie sich widerstandslos habe politisch vereinnahmen und ab 1933 gleichschalten lassen. Viele Anhänger der Jugendmusikbewegung, so auch Jöde, gingen politische Kompromisse ein, um unter der Herrschaft der Nationalsozialisten weiterarbeiten zu können. Die Kritik daran, so berechtigt sie zum Teil sein mag, sollte aber nicht dazu führen, die positiven Impulse der Jugendmusikbewegung zu übersehen, besonders auch, was die Möglichkeit der heutigen Nutzung angeht, da hier durchaus noch ein interessantes Potential liegt. Diese Problematik kann in dieser Arbeit nur angerissen werden.[3] Ich beschränke mich zudem auf die Zeit bis 1933, da es mir vorrangig um Jödes ursprüngliche Ideen und deren Umsetzung in weitgehender Freiheit geht.
Viele von Jödes Verdiensten in Bezug auf die schulische Musikpädagogik werden heute in Fachkreisen anerkannt, zumindest als Grundlagen für weitere Entwicklungen: Er hat für viele Neuerungen in der Lehrerausbildung gesorgt, er begann, die musikalischen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ernstzunehmen und darauf einzugehen, anstatt sie den bürgerlichen Vorstellungen der Erwachsenen anzupassen.
Auch seine Ideen und Errungenschaften in Bezug auf eine Musikvermittlung außerhalb der Schule sind immer noch bedeutend, wobei man schulische und außerschulische Bereiche nicht vollständig getrennt betrachten kann, da Jöde in beiden pädagogisch zu wirken und seine Ziele auf allen ihm offenstehenden Wegen zu verwirklichen suchte. Es ging ihm nicht primär um eine Verbesserung des Unterrichts, sondern er strebte nach einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung mit und durch Musik. Der Musikunterricht in der Schule war nur interessant als Mittel, die breite Bevölkerung früh in der gewünschten Art mit Musik in Berührung zu bringen; Schule sollte kein Selbstzweck sein. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, teilweise auch auf seine Aktivitäten innerhalb des Schulwesens näher einzugehen.
Jödes Menschenbild bildete die Grundlage all seiner Bestrebungen. Aus seiner Anschauung der menschlichen Natur schlußfolgerte er deren Bedürfnisse, vor allem die musikalischen, die er zu erfüllen versuchte bzw. für deren Erfüllung er bessere Voraussetzungen schaffen wollte.
Problematisch und mit Recht oft kritisiert worden sind in dieser Hinsicht Jödes theoretische Schwächen. Vieles in seinen Abhandlungen bleibt unklar, richtet sich auf oft polemische Art nur an das Gefühl der Leser, gleitet ab „in die Vagheit bloßer Rhetorik und modischer Schlagworte“ [4] , und kann in wissenschaftlicher Hinsicht heute nicht mehr ernstgenommen werden. Freundlicher formuliert
„findet sich [...] der hohe Selbstanspruch [Jödes] nicht immer in einer entsprechend differenzierten und genauen Sprachlichkeit und Begrifflichkeit wieder.“[5]
Ein wirklicher Verlust auch für unsere heutigen Möglichkeiten von ‚Volksmusik’ wäre es aber, aus diesem Grund seine Ideen und Impulse von vornherein nicht ernst zu nehmen. In vieler Hinsicht spricht seine praktische Arbeit für sich und gibt die Möglichkeit, theoretische Ungenauigkeiten und Lücken zu konkretisieren und zu ergänzen. Jöde selbst gab dem Handeln vor der Theorie den Vorzug, wenngleich man ihm nicht gerade tätige Schweigsamkeit nachsagen kann - Heinz Lemmermann nannte ihn freundlich-ironisch „verkündigungsfreudig“ [6] . Dieser Schwäche scheint Jöde sich aber bewußt gewesen zu sein, als er bereits 1918 - wenngleich mit etwas Koketterie - schrieb:
„Und wenn ihr das verflixte Reden wie ich nun mal nicht lassen könnt, dann laßt euer Gewissen Stunde für Stunde ängstlich darum besorgt sein, daß allein Arbeit [...] aus eurem Wort erblüht. [...] das eine unterlaßt: Vorträge zu halten über das, was man tun müßte. Dabei kommt erfahrungsgemäß nichts weiter heraus, als daß der, der’s hört, nach Hause geht mit dem glücklichen Gefühl: Ganz meine Meinung! - und weiterschläft.“[7]
Unter diesen Umständen halte ich es für sinnvoll, Jöde stärker an seiner praktischen Arbeit als an seinen theoretischen Abhandlungen zu messen, ohne deren Unzulänglichkeiten verschweigen zu wollen.
In der vorliegenden Arbeit sollen daher Jödes Bestrebungen zur außerschulischen Musikvermittlung daraufhin untersucht werden, wie erfolgreich und gezielt sie waren bzw. wie weit sie den von ihm gesteckten Zielen wirklich gerecht wurden. Entsprechende Ergebnisse könnten nicht zuletzt auch für heutige Bestrebungen innerhalb der Laienmusik interessant sein.
Der erste Teil der Arbeit besteht aus einem historischen Überblick über die Grundlagen für die Entstehung der Jugendmusikbewegung in Deutschland, sowie deren kurzgefaßtem Verlauf. Der Fokus liegt dabei teilweise bereits auf den Jöde betreffenden Personenkreisen und den von ihm mitgestalteten Ereignissen.
Im zweiten Teil werden die theoretischen Grundlagen von Jödes Arbeit beleuchtet, auf denen seine praktische Arbeit aufbaute.
Der dritte Teil befaßt sich schließlich mit Jödes konkreten Bestrebungen zur Musikvermittlung außerhalb der Schule, wobei es weniger um eine zahlenmäßig genaue Erfassung aller Einzelaktivitäten geht, als vielmehr um einen Überblick über seine unterschiedlichen Herangehensweisen und Impulse, wobei einige beispielhafte eingehender behandelt werden.
1 Historischer Überblick
1.1 Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Im folgenden sollen einige Aspekte der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse Deutschlands zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts näher beleuchtet werden - besonders in Bezug darauf, welchen Einfluß sie auf das allgemeine Musikverständnis und die Musikpädagogik hatten -, um nachzuvollziehen, auf welchem Nährboden die Jugendmusikbewegung entstand.
1.1.1 Politisch-gesellschaftliche Grundlagen
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führten das starke Bevölkerungswachstum und die rasante Industrialisierung in Deutschland zu einer starken Urbanisierung und der Herausbildung neuer Schichten, insbesondere einer Industrie- und Fabrikarbeiterschaft. Von der extremen wirtschaftlichen und technischen Entwicklung in ganz Europa versprach man sich Fortschritt und Wohlstand, der allerdings den unteren Schichten keineswegs zugute kam, da die Löhne niedrig und die Arbeitsbedingungen schlecht waren. Zudem führte die Durchrationalisierung der Arbeitswelt, die Unselbständigkeit des Menschen in den Arbeitsprozessen und die Anonymität in den Städten zu psychischen Unsicherheiten und Orientierungslosigkeit, zu einem ‚Unbehagen in der Kultur’, das bald zu einer Suche nach neuen inneren Heimaten und Orientierungspunkten, aber auch äußeren Feindbildern führte.[8]
Im Einklang damit war das deutsche Kaiserreich um 1900 stark geprägt durch die imperialen Bestrebungen Wilhelms II, der Deutschland zur zweitstärksten Seemacht und auf diesem Weg zur Weltmacht machen wollte. Damit zusammen hing eine oft selbstherrliche nationalistische Kulturauffassung, eine „ständige Hochwertfixierung und Selbstbeweihräucherung, [...] kennzeichnend für die drastischen Selbstbestätigungswünsche einer Nation, die spät zur staatlichen Einheit kam.“[9]
Auch auf das Schulsystem hatte die Industrialisierung Auswirkungen: Im Herbst 1900 wurden Realgymnasien und Oberrealschulen formal den humanistischen Gymnasien gleichgestellt, was letzteren nach und nach ihre elitäre Dominanz nahm und die Wichtigkeit der Naturwissenschaften und neueren Fremdsprachen - Erfordernisse des industriellen Zeitalters - betonte.[10]
1.1.2 Musikunterricht
Die deutsche Schule des beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts war im allgemeinen eine Pauk- und Drillschule, in der der Lernstoff durch Wiederholung und mit einem System, das mehr Strafen als Belohnungen kannte, den Schülern oft im wahrsten Sinne des Wortes ‚eingebleut’ wurde. Der Musikunterricht war in der Regel ein reiner Gesangsunterricht, in dem durch Vor- und Nachsingen einstimmige Lieder gelernt wurden, an höheren Schulen auch zweistimmige. Dazu kamen Stimmbildung, verschiedene Systeme des ‚Treffens’ von Noten, d. h. des Singens vom Blatt oder nach Handzeichen; das Notenlernen stand ansonsten im Hintergrund. Lediglich in Einzelfällen - abhängig von einzelnen Lehrern oder Schuldirektoren - wurde auch Musikgeschichte erteilt. Wie wenig wichtig der Musikunterricht als Fach genommen wurde, zeigte sich unter anderem in der ungenügenden Ausbildung der Musiklehrer, die lediglich im Lehrerseminar bestand anstatt in einem Studium. Zudem waren sie den akademisch ausgebildeten Gymnasiallehrern weit untergeordnet und mußten oft zusätzliche Fächer wie Zeichnen, Rechnen, Schreiben und Religion geben. Auch pädagogische Lehrwerke wie für andere Fächer gab es für den Musikunterricht kaum.
An der Volksschule war der Gesangsunterricht lediglich mit ein bis zwei Wochenstunden obligatorisch, an den höheren Schulen überhaupt nicht durchgehend gewährleistet. Die Schulchöre erfüllten in erster Linie repräsentative Zwecke bei Feiern, deren es viele gab, denn Wilhelm II., der einen starken Selbstdarstellungsdrang besaß und eine sehr umfassende und systematische Polit-Propaganda betrieb, hatte diverse vaterländische Feiertage neu eingeführt.[11]
Die Schule diente allgemein der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die sehr kleine Schicht der Gebildeten reproduzierte sich selbst,[12] die unteren Schichten erlernten auf der Volksschule lediglich elementare Kulturtechniken und wurden zudem auf nationale Loyalität eingeschworen. 1890 forderte Wilhelm II., das Schulsystem stärker auf den nationalen Gedanken, auf Untertanenerziehung und Gehorsamkeitstraining auszurichten. Dazu erschien neben dem Turnen und den Jugendspielen besonders das Singen geeignet.[13] So bestand das Repertoire des Gesangsunterrichts üblicherweise aus Chorälen, tugendorientierten Schulliedern, volkstümlichen Gesängen und zunehmend patriotischen Liedern. Nach dem 2. Flottengesetz im Juni 1900 kamen noch ‚markige Flottenlieder’ dazu, um bereits bei den Kindern die später für den Krieg erwünschte Begeisterung zu wecken.[14]
1.1.3 Reformbewegungen
Im Zusammenhang mit der extremen Industrialisierung entstand um die Jahrhundertwende eine Kulturkritik, die „neuromantisch geartet, zum Widerstand gegen die industrielle Unkultur, gegen die Vermassung aufrief und sich gegen naturfremde Lebensart und lebenstötenden Intellektualismus wandte.“[15]
Im Zusammenhang mit den Zwängen in der Drillschule entstanden pädagogische Reformbewegungen wie die Kunsterziehungs- und Arbeitsschulbewegung, die „die Zivilisation der technisierten Gegenwart durch eine Regeneration des ‚natürlichen’ Lebens zu bewältigen“ [16] suchten und für den einzelnen mehr Freiheit erreichen wollten. Dies geschah teils auf institutionalisierten Wegen wie bei Landerziehungsheimen,[17] freien Schulen und Volkshochschulen, teils in freien Zusammenschlüssen und Bünden der Jugendbewegung, deren größter und bekanntester der Wandervogel war. Die nationalchauvinistische Haltung in Sachen Kultur und die Idee der besonderen Musikalität des Deutschen Volkes wurde in den Reformbewegungen zum Teil beibehalten.
Grundlage der Reformideen war der musische Gedanke,[18] den man für in der Lage hielt, den Menschen, und zwar den ganzen bzw. ganzheitlichen Menschen, zu erneuern, im Gegensatz zur einseitigen Betonung von Verstand und Vernunft des 19. Jahrhunderts. Man wollte zurück zu einer Einheit der Künste, insbesondere von Bewegung, Sprache und Musik, was dem Umgang von Kindern mit diesen Bereichen entsprechen sollte. Auf das Kind, das noch unverbildet Künste und Leben spielerisch als Einheit erlebe, konzentrierten sich daher in der Reformpädagogik die Bemühungen, den gewünschten ‚neuen Menschen’ zu schaffen.[19]
Ein richtungsweisendes Buch war ‚Das Jahrhundert des Kindes’ der schwedischen Pädagogin Ellen Key, das 1902 erstmalig auf Deutsch erschien und wichtige Impulse gab. Erziehung sollte - im Rückgriff auf Rousseau - nicht aktiv formen und beherrschen, sondern lediglich dem natürlichen Wesen jedes Menschen bei seiner Ausprägung helfen, vor allem durch das Mittel des Spiels. Das Buch erfuhr eine enorme Ausbreitung[20] und war ein wichtiger Anstoß für Jödes pädagogischen Bestrebungen.
Hermann Kretzschmar, einer der führenden deutschen Musikwissenschaftler seiner Zeit, reichte bereits 1900 die ‚Denkschrift zur Notwendigkeit einer Schulmusikreform’ beim Preußischen Kultusministerium ein. Von 1909 bis 1920 bemühte er sich - inzwischen Direktor des ‚Akademischens Instituts für Kirchenmusik’ in Berlin - um die Umsetzung seiner Reformideen in den Preußischen Lehrplänen. Dies scheiterte allerdings an der zu geringen Stundenzahl für den Musikunterricht und der ungenügenden Ausbildung der Lehrkräfte.[21] Seine Ideen blieben in Fachkreisen aber in der Diskussion und wurden von Kestenberg in den zwanziger Jahren wiederaufgenommen und weitergeführt.[22]
1.1.4 Jugendbewegung
Ähnliche Beweggründe wie die Reformer hatte die deutsche Jugendbewegung, die um 1900 mit dem Wandervogel ihren Anfang nahm.[23] In ihr „äußert sich erstmals das Bewußtsein einer eigenen Jugendkultur zwischen Kindheit und Erwachsensein.“ [24] Es fanden sich Jugendliche - in erster Linie Mitglieder des Bürgertums, vor allem Studenten - zusammen, die in eigenen gemeinschaftlichen Bindungen einen Weg aus der Enge der bürgerlichen Erwachsenenwelt und der das jugendliche Gemüt vergewaltigenden und lebensfernen Schule suchten. Nach dem romantisierend verklärten Vorbild mittelalterlicher Scholaren und reisender Handwerksburschen wanderten in erster Linie Jungengruppen ohne erwachsene Aufsichtspersonen in die Natur hinaus und übernachteten unterwegs im Freien oder auf Heuböden. Auch Mädchen kamen in den Genuß zumindest eines Teils dieser neuen, freieren Freizeitgestaltung, obwohl ‚Mädchenfahrten’ - gemischtgeschlechtliches Wandern war so gut wie unmöglich - umstritten waren und nach Ansicht der meisten männlichen Wandervögel nach anderen, ‚weiblicheren’ Maßstäben zu verlaufen hatten.[25]
Eine gewisse 'Bürgerschreck'-Tendenz war zwar vorhanden und zeigte sich etwa in der unbürgerlich-unordentlichen Kleidung der Jugendlichen,[26] neben dem Protest stand aber von Anfang an das Bemühen um das bewußte Gestalten eigener, als wahrhaftig empfundener Lebensformen im Vordergrund. Der Begriff der ‚Selbsterziehung’, der eigenverantwortlichen, aktiven Lebensgestaltung war zentral, was 1913 in der ‚Meißnerformel’ zum Ausdruck kam: Verschiedene jugendbewegte Gruppen kamen auf dem Hohen Meißner bei Kassel zur Feier des hundertsten Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig zusammen und begründeten den ‚Verband freideutscher Jugend’, der - trotz großer Unterschiede der Gruppen - die gemeinsamen Ideale als sein ‚sittliches Gesetz’ formulierte:
„Die freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung vor eigener Verantwortung mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein. Zur gegenseitigen Verständigung werden freideutsche Jugendtage abgehalten. Alle gemeinsamen Veranstaltungen sind alkohol- und nikotinfrei.“[27]
Dennoch blieb die Jugendbewegung in unterschiedliche Bünde gespalten. Besonders nach dem ersten Weltkrieg, in den viele Anhänger der Jugendbewegung begeistert zogen, und der jene, die ihn überlebten, meist desillusioniert zurückließ, verschrieben sich die Gruppen unterschiedlichen politischen oder religiösen Idealen.[28]
Im Wandervogel wie auch in weiteren entstehenden Bünden spielte das gemeinsame Singen, Tanzen[29] und Musizieren von Anfang an eine zentrale Rolle, wobei das Gemeinschaftserlebnis dabei im Vordergrund stand und zumindest in den ersten Jahren die Auswahl der musikalischen Literatur nicht nach qualitativen, sondern ideologisch-praktischen Gesichtspunkten erfolgte: Man brauchte Musik, die nicht zu kunstvoll, sondern gemeinsam leicht umzusetzen war und wollte sich außerdem vom Individualismus der bürgerlichen Ära des 19. Jahrhunderts absetzen. Sowohl deren Salon- und Konzertmusik als auch das volkstümelnde Kunstlied wurden abgelehnt, einerseits weil man gerade der von ihnen repräsentierten bürgerlichen Enge entfliehen wollte, andererseits weil deren individualistische Sicht und Darstellungsweise den neuen Gemeinschaftsidealen widersprach:
„der einzelne wollte sich nicht verlieren in feinen Nervenschwingungen - eine Gefahr, an der ja die Romantik z. T. Schiffbruch litt - nein, er wollte mit und an den andern sein Lebensgefühl erhöhen.“[30]
Bevorzugt wurden Volkslieder mit Helden wie Soldaten, Landsknechten, Seeräubern oder Zigeunern. Das Bedürfnis nach mehr und passenderem Musizier-Material führte zur Suche nach alten unbekannten Volksliedern. 1905, im ersten eigenen Liederbuch des Wandervogels,[31] waren neben den üblichen Studenten- und Turnerliedern bereits einige Lieder dieser Art enthalten.
1909 erschien die erste Ausgabe des bis heute bekannten 'Zupfgeigenhansl', herausgegeben vom Leiter des Wandervogels Hans Breuer.[32] Für ihn war das alte Volkslied, das seine Güte durch seine „unverwüstliche Lebenskraft bewiesen, [...] Jahrhundert um Jahrhundert im Volke fortgelebt“ [33] hatte, programmatisch für den Ausdruck des ganzheitlichen Lebensgefühls der Wandervögel, das nach einer ursprünglichen Natürlichkeit und Echtheit verlangte im Gegensatz zum als unnatürlich und zersplittert empfundenen Stadtleben. Das Volkslied war das Symbol für eine imaginierte, vorindustrielle 'gute alte' Zeit, nach deren ganzheitlichem Lebensgefühl man sich zurücksehnte:
„Im Volkslied, da hat der Wandervogel Umgang mit einem natürlichen Menschen, der sehnt sich, und träumt noch ein volles ganzes Menschentum, das noch mit markigen Wurzeln aus dem Boden seiner Allverwandtschaft Nahrung trinkt. Und alle, die heutzutage aus den öden Häusermauern hinaus ins Freie strömen [...], denen gibt das Volkslied über die Maßen viel, einen - ihren - Ideal-Menschen. [...] Das Volkslied ist der vollendete Ausdruck unser Wandervogel-Ideale.“[34]
Dem ‚Zupfgeigenhansl’ folgten weitere Liederbücher. Viele Wandervögel begannen auf ihren Fahrten, selbst alte Volkslieder zu sammeln - im ‚Zupf’ waren unter ‚Selbstgehörtes’ eigens einige freie Seiten mit Notensystemen dafür vorgesehen - und weiterzuverbreiten. Neue Kompositionen im alten Stil wurden versucht - nicht immer mit künstlerischem Geschick -, und es gab Versuche, ein neues lebendiges Volkslied zu schaffen, das ähnlich dem alten aus den Gefühlen des modernen Menschen sprießen sollte, aber bodenständig und ‚natürlich’ zu sein hatte, was man der üblichen Unterhaltungsmusik absprach. Auch dies erwies sich in den meisten Fällen als nicht erfolgreich.[35]
Die Wandervögel begleiteten ihren einstimmigen Gesang in der Regel auf der ‚Klampfe’, was entweder die als ‚Zupfgeige’ bezeichnete Gitarre oder die sogenannte Laute war, über deren genaue Beschaffenheit noch zu sprechen sein wird.[36] Dieses Instrument war gut zu transportieren, und die Liedbegleitung unterlag anfangs nicht allzu hohen musikalischen Ansprüchen. Grundlage waren die sogenannten ‚Zupfgeigenakkorde’ Tonika und Dominantseptakkord, die auch musikalisch nicht allzu begabte Jugendliche schnell lernen konnten.[37] Der ‚Zupfgeigenhansl’ wurde zur leichteren Benutztung ab der 1911 erscheinenden vierten Auflage mit Gitarrenakkorden versehen.[38] Als weitere Vorzüge des Instruments galten der weiche Klang und die vollen Akkorde, die es den Wandervögeln angetan hatten und gut zu ihren gefühlvollen Liedern paßten bzw. zu der gewünschten gefühlvollen Darbietungsweise.[39] Daneben tauchten auch andere Instrumente auf wie Mandoline, Geige, Flöte, Balalaika und Banjo; die Gitarre blieb aber vorherrschend.
Auf den Wanderungen wurde nicht nach Noten gespielt, einerseits weil es unpraktisch war, vor allem aber weil es der Idee widersprach, mit den Volksliedern spontan und authentisch seine Gefühle oder eine in der Natur vorhandene Stimmung auszudrücken.[40] So wurde aus dem Gedächtnis oder nach Gehör gespielt, Methoden, denen keineswegs alle musizierenden Wandervögel ausreichend gewachsen waren, was dazu beitrug, daß stärker musikalisch interessierte Mitglieder mehr und mehr Kritik übten an der sogenannten ‚Schrumm-Schrumm-Begleitung’ und der unzulänglichen musikalischen Ausführung insgesamt. Teilweise versuchte man, dem Übel durch ausgeschriebene Begleitsätze beizukommen,[41] was von vielen begrüßt wurde, aber auch zu neuer Kritik führte.
Jöde bezeichnete die festgelegte Gitarrenbegleitung 1918 in dem von ihm herausgegebenen Sammelband ‚Musikalische Jugendkultur’ lediglich als Übergang von der ‚Schrumm-Schrumm-Begleitung’ zu einer höheren musikalischen Stufe, die es noch zu erreichen gelte. Er forderte von den Musizierenden einen ernsthafteren Umgang mit der Musik, ein „gründliches Studium der harmonischen Zusammenhänge und ihres Sprachrohrs, der Gitarre“ [42] , denn die
„Bezifferung setzt allemal ein gewisses Maß musikalischer Bildung voraus, indem sie das Verlangen stellt, nur angedeutete Gedanken zu Ende zu führen.“[43]
Erst wenn die entsprechenden Kenntnisse im Unterbewußtsein verankert und dem Spielenden völlig geläufig wären, könnte man wieder - auf einer höheren Stufe - spontan und authentisch musizieren und sich in der Musik ausdrücken. Die Hauptschuld an der Unzulänglichkeit der allgemeinen musikalischen Kenntnisse und Fähigkeiten gab er dem schulischen Gesangsunterricht,[44] der ja über das Auswendiglernen von Liedern kaum hinausging.
Jöde stellte damit eine Verbindung zwischen der musikalischen Volkskultur und der Musikpädagogik her. Letztere sollte in die Pflicht genommen werden, erstere zu erneuern und zu veredeln. Dieser Ansatz bedeutete etwas Neues, was über die Wandervogel-Ideen in Bezug auf Musik hinausging, dieser eine noch ernstzunehmendere Bedeutung verlieh und damit die Jugendmusikbewegung einläutete.
1.2 Jugendmusikbewegung
1.2.1 Begriffsklärung
Die Jugendmusikbewegung war im Gegensatz zur von Jugendlichen selbst organisierten Jugendbewegung eine größtenteils von Erwachsenen geführte Jugendorganisation[45] bzw. eine jugendpflegerische Bewegung mit vorrangig pädagogischem Anspruch. Teils synonym gebrauchte Begriffe sind ‚musikalische Jugendbewegung’, ‚Laienmusikbewegung’, ‚Singbewegung’ u. a..
Die Jugendmusikbewegung war keine klar in sich geschlossene Gemeinschaft. Vielmehr beinhaltete sie viele unterschiedliche Strömungen, die sich im Laufe der Jahre zudem veränderten,[46] so daß nicht immer eindeutig zu klären ist, welche Gruppierungen ihr zuzuschreiben sind, ob man z. B. als Jugendmusikbewegung nur den engeren Kreis um Jöde sieht, wie es teilweise geschieht, oder alle, die den entsprechenden Ideen nahestanden. Aus heutiger Sicht betrachtet hatten Gruppierungen, die damals heftig aneinander Kritik übten, oft ähnliche Intentionen und könnten historisch gesehen derselben Bewegung zugeordnet werden.
Am treffendsten und praktikabelsten erscheint mir daher die Definition Antholz’, der unter dem Begriff der Jugendmusikbewegung „das hochgemute kulturkritische Programm einer Regeneration jugendlichen Lebensgefühls und -stils aus dem Geist der Musik“[47]
zusammenfaßt. Jöde, der selbst den Begriff der Jugendmusik propagierte, verstand darunter auch keineswegs eine sich auf die Jugend beschränkende Musik, sondern prinzipiell die Erneuerung des gesamten Musiklebens. Nichtsdestotrotz beschränkte sich die Bewegung in erster Linie auf Jugendliche und junge Erwachsene.
Als wichtigste große Organisationen der Jugendmusikbewegung gelten die Musikantengilde um Jöde sowie der Finkensteiner Bund unter Walther Hensel, die trotz Auseinandersetzungen zwischen ihren Führern und unterschiedlichen Einstellungen z. B. zum bestehenden Staatswesen[48] in Organisationsform und Musikvorstellungen weitgehend übereinstimmten.
Der Beginn der Jugendmusikbewegung wird gewöhnlich in die Jahre 1917 bis 1919 gelegt mit dem ersten entsprechenden Schrifttum und der Organisation von Musikgruppen. Das Ende wird i. d. R. 1933/34 im Beginn des Dritten Reiches und der Gleichschaltung der jugendmusikalischen Organisationen gesehen. Kritische Stimmen setzen das Ende bereits 1929, als bei einer Führerkonferenz der Musikantengilde in Oberhof die Krise der Bewegung diskutiert wurde.[49] Andere wiederum betonen den Fortbestand der Jugendbewegung auch während des Dritten Reichs und der Zeit danach.[50] Die Zeit bis 1933 wird in dem Zusammenhang dann auch als ‚klassische’ oder ‚historische’ Jugendmusikbewegung bezeichnet.
Ab der Zeit des Dritten Reiches kann man allerdings kaum noch von einer Bewegung sprechen, da jugendmusikalische Gruppierungen, wenn sie sich nicht auflösten, von nationalsozialistischen Einrichtungen übernommen wurden. Zwar wurde auch der Gemeinschaftsgedanke übernommen, das aber in pervertierter Form. In der Zeit nach 1945 hatten die Ideen der Jugendmusikbewegung sicher noch großen Einfluß und wurden, besonders was den schulischen Musikunterricht betrifft, verstärkt umgesetzt, aber gerade das bedeutete ja ihre weitgehende Institutionalisierung. Jöde selbst war bis in die sechziger Jahre hinein noch äußerst aktiv, sowohl im Bereich der Schulmusik als auch des Laienmusizierens.
1.2.2 Musikalische Grundideen
Die Jugendmusikbewegung folgte der Jugendbewegung[51] und der allgemeinen Kulturkritik der Zeit in ihrer Ablehnung der industrialisierten, zersplitterten und intellektualisierten Welt, wobei sie ihre Kritik und ihre Heilserwartungen zentral auf die Musik ausrichtete. Grundlage sowohl für das Musikleben als auch für die musikalischen Inhalte war dabei die Ablehnung des Individualismus der Romantik und der Gegenentwurf einer neuen Gemeinschaft nach altem Vorbild. Im folgenden werden die musikalischen Ideale der Jugendmusikbewegung größtenteils an der Chormusik abgehandelt, da diese lange Zeit im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stand.
Idealbild war die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts sowohl in ihrer sozialen Eingebundenheit als auch in ihrer ästhetischen Ausprägung, denn in dieser Zeit
„stand die Musik [...] vornehmlich im Dienste der Gottesverehrung, in dem sich noch alle Ausstrahlungen des Lebens als in ihrem Brennpunkte zusammenfanden. Da wußte sie [...] noch nichts Höheres für sich, als hier dienend ihre Aufgabe zu erfüllen.“[52]
Musik war also nach Jöde zu dieser Zeit noch fest mit dem Leben verbunden und betonte dadurch zugleich das Gemeinschaftliche zwischen den Menschen.
Die Musikgeschichte wurde seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert bzw. ‚seit Bach’ als Verfallsentwicklung betrachtet, dadurch daß die Musik mit der Entstehung des Konzertwesens von einer über ihr stehenden Aufgabe entbunden wurde, nicht länger Gottesdienst war oder in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen z. B. bei Hofe stand. Die Entwicklung zur selbständigen, zweckfreien Musik entsprach für Jöde einer Entfremdung,[53] da sie die Zuhörer von der aktiven Teilnahme ausschloß, was zur Trennung von Musik und Volk und damit von Musik und Leben führte. Jödes Ideal war die Gebrauchsmusik, an der alle teilnahmen.[54] Der vorhandene bürgerliche Konzertbetrieb galt dagegen als industrielle Produktion von Massenartikeln. Musik war zur Ware geworden, die für ein anonymes, lediglich konsumierendes Publikum hergestellt wurde. Ziel Jödes war, die Musik vom Industrieprodukt wieder zu einem handwerklichen werden zu lassen. Hausmusik sollte auf breiter Fläche stattfinden, Musik wieder Volksgut werden, anstatt die Menschen in ausführende Spezialisten und Konsumenten zu trennen.
In der Musikliteratur wandte sich die Jugendmusikbewegung gegen den Ausdruck der „brünstigen Gefühlswelt der Spätromantiker“ [55] , die dem romantischen Prinzip der Subjektivität folgend ganz auf die Darstellung individueller Empfindungen ausgerichtet war. Im Bestreben einer Steigerung des persönlichen Ausdrucks waren im 19. Jahrhundert die musikalischen Grenzen ausgelotet worden: In Dynamik, Klangfarben, Tonalität und Harmonik, aber auch in der Dauer und Besetzung von Musikwerken ging man ins Extreme, Bombastische.
Die Kadenzharmonik bildete das nach außen abgeschlossene harmonische System, das in sich aber immer stärker ausgereizt und ‚aufgeblähter’ wurde:
„Neue Funktionen dringen in die Grundkadenz ein, Alterationen und melodische Klangverbindungen (Vorhalte, Wechsel- und Durchgangstöne) verschleiern die Klarheit der Folge. Nun dringt mit der Terzverwandtschaft ein Übergewicht der Farbwerte über die Logik der Verbindungen ein. [...] Daneben [...] tritt die Chromatik. Diese verstärkt das Übergewicht der Farbe“.[56]
Mit den Mitteln der harmonischen Verdichtung und damit Verschleierung der Form, der Klangfarbe immer größerer Orchester und der dynamischen Extreme sollte der Zuhörer in einen Sinnesrausch versetzt werden. Ein Höhe- bzw. aus Sicht der Kritiker Tiefpunkt dieser Entwicklung lag in Wagners Opern und den Werken Brahms, Liszts und Bruckners.[57]
Ebenfalls abgelehnt wurde das Virtuosentum des 19. Jahrhunderts: Artistische, speziell für ein Instrument geschriebene Stücke rückten das Können des Solisten in den Vordergrund, mitunter auf Kosten der musikalischen Substanz der Komposition. Der Personenkult um Virtuosen und als Genies verehrte Komponisten entsprach wiederum dem ausgeprägten Individualismus der Zeit. Außerdem warf man dem „übersteigerten Professionalismus und der einseitig vollzogenen Musikdarbietung durch Virtuosen“ [58] vor, die Laien vom eigenen Musizieren abzuhalten bzw. sie auszuschließen, da sie diesen Ansprüchen natürlich nicht genügen konnten.
Gegen großes Orchester und Virtuosentum setzte die Jugendmusikbewegung das kleine Ensemble, bevorzugt die menschliche Stimme, und das gemeinsame, gleichberechtigte Musizieren. Der Individualismus der Romantik drückte sich für sie auch in der homophon orientierten Kadenzharmonik aus. Im Nachwort zum Liederbuch ‚Alte Madrigale’, das Jöde 1921 herausgab und das Chormusik aus Renaissance und Frühbarock enthielt, kritisierte er die Chorliteratur des 19. Jahrhunderts wegen „ihrer ausschließlich harmonisch gedachten Schreibweise, die, analog der Musikentwicklung im ganzen, der Oberstimme allein die Führung und damit den eigentlichen musikalischen Gehalt anvertraute, alle übrigen Stimmen aber zu Größen minderen Grades degradierte.“[59]
Die oft chromatisch überladene, akkordisch orientierte Homophonie der üblichen Chorsätze sollte durch schlichte Einstimmigkeit oder polyphone Lieder ersetzt werden.[60] Die Musik des 15. bis 17. Jahrhunderts wurde zum Ideal, nicht nur in musikalischer Hinsicht, sondern auch als „Ausdruck für ein inneres Sichverbundenfühlen mit einer anderen Zeit im musikalischen und soziologischen Sinne.“ [61] Daher griff man zunächst auf die Musik der Renaissance und des Barock zurück.[62] Der ‚neue alte Meister’ war Johann Sebastian Bach. Wiederentdeckt wurde neben anderen Altmeistern in diesem Zusammenhang auch die polyphone Chormusik von Heinrich Schütz, der in der Musikwissenschaft bis dahin lediglich die Rolle eines Vorläufers von Bach innehatte. Es kam zu einer regelrechten Schütz-Renaissance, die besonders vom musikalisch anspruchsvollen ‚Heinrich-Schütz-Kreis’ vorangetrieben wurde. [63] In dieser alten Musik sah man den „grundsätzliche[n] Verzicht auf eine einzelne individuelle Gefühlsäußerung und das alleinige Gestalten aus dem Zusammenklang von allen Kräften, deren jede in ihrer organischen Entwicklung erfüllt wird.“[64]
So wurde die Polyphonie als ‚Blüte der Vokalkunst des Volkes’ wiederentdeckt. Sie wurde hochstilisiert zum Bild für eine gleichberechtigte Gemeinschaft, in der jede Stimme ihren eigenen (melodischen) Wert in sich trägt und alle Stimmen nur zusammen wirken können:[65]
„jetzt - und das ist eben die Idee der Polyphonie - stehen alle nebeneinander, Geübte und Ungeübte, Junge und Alte, Führer und Geführte, bauen gemeinsam an demselben Bau.“[66]
Davon versprach sich die Jugendmusikbewegung die Heilung des Bruches, das Gegenmittel zur Entfremdung in der industrialisierten Welt.
1.2.3 Anfänge
Die ‚Freie Schulgemeinde Wickersdorf’ oder auch ‚Wickersdorfer Bewegung’ wird nur von einigen Autoren zur Jugendmusikbewegung gerechnet,[67] gab aber für diese zumindest wichtige Anstöße und hatte großen Einfluß auf Jöde. Sie war auch Vorbild für weitere freie Schulen.
Der Reformpädagoge Gustav Wyneken gründete 1906 zusammen mit Paul Geheeb die ‚Freie Schulgemeinde Wickersdorf’ im Thüringer Wald. Er führte sowohl Koedukation als auch Sexualkunde ein, wodurch er sich heftigen Anfeindungen aussetzte. Wynekens Schwerpunkt lag auf der künstlerisch-musischen Erziehung. Sein Ziel war außerdem ein auf Kameradschaft und Führertum basierendes Lehrer-Schüler-Verhältnis. Schülermitbestimmung erhielt einen hohen Stellenwert. Der umstrittene und streitfreudige Wyneken wurde zwar 1910 vom Ministerium entlassen, behielt aber seinen Einfluß auf Wickersdorf. Auf musikalischem Gebiet wirkte in der Wickersdorfer Schulgemeinde Wynekens Schwager, der Komponist, Musikschriftsteller und Musiklehrer August Halm, später sein Schüler Ernst Kurth. Halm hatte starken Einfluß auf Jöde und regte ihn zu neuen Gedankengängen an, etwa mit seiner Harmonielehre und seiner Schrift: ‚Von zwei Kulturen der Musik’. Wichtig war Halm wie auch Jöde die Qualitätsfrage in der Musik, die Abwehr von ‚Kitsch’, wobei es durch seine persönlichen Vorlieben für bestimmte Komponisten - seine Ideale waren Bach, Beethoven und Bruckner - leider zu gewissen Blickverengungen kam.[68]
In Wickersdorf war die Musikerziehung wesentlich auf die Erweckung des Gemeinschaftsgefühls ausgerichtet, allerdings nicht nur auf das der miteinander Musizierenden, sondern auch auf jenes zwischen Musizierenden und Hörenden. Konzerte und andere Vorführungen von Musik wurden nicht abgelehnt, wohl aber das rein passive Konsumieren derselben.
August Halm kritisierte das Verhältnis der Wanderbünde zur Musik. Er warf ihnen vor, sie als reine Gebrauchs- bzw. Bedarfskunst zu benutzen, wobei sie ihren eigenen Bedarf an Musik offenbar als ausreichendes Auslesekriterium ansähen.[69] Halm forderte dagegen, man müsse „die Musik als ein geistiges Wesen verstehen und ehren, als eine geistige Angelegenheit pflegen [...] lernen.“ [70]
Der Beginn der eigentlichen Jugendmusikbewegung wird im Zusammenhang mit drei unterschiedlichen Ereignissen in die Jahre 1917 bis 1919 gelegt: 1917 erschien erstmalig das spätere Organ der Bewegung ‚Die Laute. Monatsschrift zur Pflege des deutschen Liedes und guter Hausmusik’. Das zweite Ereignis war 1918 Jödes Herausgabe des Sammelbandes ‚Musikalische Jugendkultur’, in dem musikalisch engagierte Mitglieder aus Jugend- und Reformbewegungen wie Breuer, Jöde, Wyneken und Halm erstmals gebündelt ihre Standpunkte zum Musikleben veröffentlichten.
1919 geschah schließlich das, was der mehr auf Praxis als auf Theorie ausgerichtete Jöde selbst als Beginn der Jugendmusikbewegung ansah: Es bildeten sich auf seine Anregung über einen Aufruf in der ‚Laute’ hin Laien-Musiziergruppen, später ‚Musikantengilden’ genannt, die zur Organisation der übergeordneten ‚Musikantengilde’ führten.[71]
1.2.4 Chorbewegung
Der Begriff der Chor- oder auch Singbewegung ist in der Literatur nicht klar umrissen. Einige, vor allem kritische Stimmen, benutzen ihn synonym für die gesamte Jugendmusikbewegung, wie um dieser eine über ein paar schwärmerische Gesangskreise hinausgehende Wirkung abzusprechen,[72] was sicher zu kurz gegriffen ist und den vielen Einflüssen der Jugendmusikbewegung auf das gesamte Musikleben nicht gerecht wird.[73] Oft wird sie auch nur am Rande und unter dem Oberbegriff ‚Singen in der Jugendmusikbewegung’ abgehandelt, was ihrer Ausprägung und ihrem Einfluß auch nicht gerecht wird, da sie die damalige Chorlandschaft sehr verändert und bereichert hat und ihre Auswirkungen bis heute zu spüren (und zu hören) sind.[74] Wieder andere Autoren verstehen darunter eher eine Bewegung des Wandervogels, die dann in die Jugendmusikbewegung führte.[75] Wenn die Chorbewegung auch aus der Jugendmusikbewegung hervorging und auf deren ideologischen Grundsätzen aufbaute, kann und sollte sie durchaus als eigenständiger und einflußreicher Teil der Jugendmusikbewegung behandelt werden. Ich verwende hier den Begriff Chorbewegung, worunter ich alle unterschiedlichen Chöre und Singkreise verstehe, deren Bestreben die Erneuerung des Musiklebens nach Ideen der Jugendmusikbewegung war, wobei sich ihre konkreten Zielsetzungen teils voneinander unterschieden und sich im Laufe der Zeit, wie bei Bewegungen üblich, auch wandelten.
Neues Chorbild
Die ersten dieser Chöre entstanden nach dem ersten Weltkrieg in bzw. aus den Jugendbünden heraus, in denen gemeinsamer Gesang von Anfang an eine wichtige gemeinschaftsstiftende Rolle spielte. Anfangs waren es vor allem Gymnasiasten und Studenten, die sich zum Singen und Musizieren in Gruppen zusammenfanden, deren Namen bereits darauf hinwiesen, daß es hier nicht um ein nach außen gerichtetes Vortragen von Musik ging, sondern um ein introvertiertes mit- und füreinander Musizieren. Sie hießen ’Sing- und Spielgemeinde’, ‚Spielkreis’ oder, im Falle der von Jöde ins Leben gerufenen Gruppen, ‚Musikantengilden’. Die Mitglieder standen oft auch konkret im nach innen gerichteten geschlossenen Kreis, und der Dirigent wurde, wenn er nicht ganz wegfiel, zum ‚Chorführer’, der die anderen Sänger statt mit striktem Taktschlag lediglich mit ‚Ausdrucksgebärden’ leitete.[76]
In den traditionellen, oft berufsständisch zusammengesetzten Gesangsvereinen und Liedertafeln der Zeit spielten bürgerlich-biedere Geselligkeit in festen hierarchischen Formen (mit vielerlei Ämtern wie dem des Vorstands, des Liedervater und Kassenwarts etc.) und die Vorbereitung auf Konzerte, Sängerfeste und -wettstreite eine große Rolle. Die neuen jungen Chöre wollten dagegen in gleichberechtigter Gemeinschaft ohne starre Vereinsstruktur und möglichst ohne Leiter durch die Musik zum ganzheitlichen Leben zurückfinden. Statt festgeschriebener Literatur, die man sich ‚einpaukte’, um sie dann vorzuführen, kam man auf die alte Aufführungspraxis offener Besetzungsformen zurück, die das gemeinsame Musizieren dahingehend erleichterten, daß man die Instrumente und Gesangsstimmen nutzte, die man hatte, und das Stück daran anpaßte anstatt umgekehrt. Neue ‚Gebrauchsmusiken’ wurden geschrieben in Form von Satzanlagen als musikalisches Grundmaterial, das von den Ausführenden noch fertig gestaltet werden mußte.[77] Dies betonte den Vorrang des gemeinsamen Musizierens und Ausprobierens, stellte das Tun und den Weg zum Ergebnis über dieses selbst. Außerdem forderte es von den Ausführenden mehr eigene Aktivität in der Auseinandersetzung mit der Musik sowie höhere musikalische Fähigkeiten, die man in manchen Chören auch zu fördern begann, indem man sich gemeinsam mit der Theorie befaßte.
Fahrtenchöre
Es blieb aber nicht in allen Chören beim Musizieren nur für sich selbst. Georg Götsch gründete 1921 in Berlin den Jugend- und Studentenchor ‚Märkische Spielgemeinde’, der Singfahrten durch Deutschland und bald auch ins Ausland unternahm und der als Vorbild für weitere Fahrtenchöre diente.[78] Diese traten zwar auch vor Publikum auf, betrachteten diese Auftritte aber nicht als Konzerte im herkömmlichen und abgelehnten Sinn, sondern stellten das gemeinsame musische Tun in den Vordergrund, das Erleben und Nachvollziehen der Musik anstatt des möglichst perfekten Darbietens. Die Solisten wurden aus ihren Virtuosen- und Vorzugsrollen herausgeholt, indem sie auch als Chorsänger fungierten. Die Singfahrten wurden, anders als herkömmliche Konzertfahrten, im Sinne gemeinsamen Lebens und Arbeitens gestaltet, den jugendbewegten Idealen entsprechend. Die Chöre wollten eine echte menschliche Lebensgemeinschaft bilden anstatt einer temporären Zweck-Gemeinschaft. Durch die Fahrten in andere Gegenden und Länder wurde außerdem das alle Menschen verbindende Moment betont.
Musikalische Qualität
Im Laufe der Zeit gab es innerhalb der Chorbewegung eine zunehmende Hinwendung zur Musik, die nicht mehr - wie in der Anfangszeit - in erster Linie den Zweck der Gemeinschaftsbildung hatte. Zum Was des Musizierens kam immer stärker das Wie, die richtige und gute Ausführung der Musik, womit aber nicht die überkommene Virtuosität des 19. Jahrhunderts gemeint war, die den Künstler mit seinem technischen Können vorführte und in den Mittelpunkt stellte, sondern ein der Musik gerecht werdendes Darbieten und Erleben ihrer selbst. Jöde schrieb bereits 1919 hierzu:
„Wir glauben nicht mehr, daß man an Musik herankommen könne durch Verfeinerung, Überreizung seiner eigenen Stimmungen, sondern durch immer tieferes Eindringen in ihren Willen [...] Wir glauben, daß sie, wo sie der Mensch einmal aus sich herausgestellt hat, nach eigenen, über ihm stehenden Gesetzen dahinschreitet. Dieses ihr innerstes Wesen, ihr Gesetz am tiefsten zu erfassen, halten wir für unsere Aufgabe, für unseren Dienst“.[79]
Finkensteiner Singbewegung
Neben der Musikantengilde um Jöde entstand in den zwanziger Jahren als zweiter Hauptflügel der Jugendmusikbewegung die böhmische Finkensteiner Singbewegung unter Walther Hensel, die hier nur kurz erwähnt werden soll. Sie breitete sich schnell über ganz Deutschland aus; in ihrem Fokus standen in erster Linie die Volksliedpflege, das Kirchenlied und der Chorgesang. Ab 1923 fanden regelmäßig die ‚Finkensteiner Singwochen’ mit intensiver Chorarbeit statt, und Hensel gab die ‚Finkensteiner Blätter’ heraus, eine Liederblattsammlung, die entsprechende Literatur bereitstellte. Später kamen Instrumentalwochen dazu, das Lied und der Gesang blieben aber im Mittelpunkt der Bestrebungen. Auch den Finkensteinern ging es um die Veredelung der Hausmusik, um die „Reinigung der Musik von ‚Operetten- und Salonkitsch’“ [80] und die Wiederentdeckung der Musik des Mittelalters und der Renaissance, allerdings verbanden sie damit weniger pädagogische Intentionen als Jöde, sondern betrachteten sich stärker als Volksbewegung. Beim Finkensteiner Bund war außerdem das völkisch-nationale Pathos stärker ausgeprägt. Neuer Musik öffneten sie sich kaum, sondern blieben weitestgehend den Komponisten des 15. bis 17. Jahrhunderts verhaftet.[81]
Ab 1928 gab es zudem den Lobeda-Bund unter Carl Hannemann, dessen Arbeitsgebiet in erster Linie Männerchorliteratur betraf.
1.2.5 Instrumentalmusik
Neben dem besonders anfangs zentral stehenden Gesang nahm auch die Instrumentalmusik für die Jugendmusikbewegung immer mehr an Bedeutung zu und warf die Frage auf, welche Instrumente für die Hausmusik geeignet seien.[82] Ein wichtiger Punkt war die leichte Spiel- und Erlernbarkeit, dazu kamen aber klangliche und ideologische Kriterien. Laieninstrumente standen gegen Virtuosen- oder Konzertinstrumente, die allerdings teilweise im Laufe der Zeit umgedeutet wurden. Die Geige beispielsweise wurde von Beginn der Jugendmusikbewegung an zum Laieninstrument erklärt und fast nur als Melodieinstrument eingesetzt.
Die Entfremdung der industrialisierten Welt wurde in dem Sinne auf die Instrumente übertragen, als sich möglichst wenig Technik zwischen den Spieler und die erzeugte Musik schieben sollte. Instrumente wurden in organische wie beispielsweise Horn, Geige und Flöte und in (abzulehnende) mechanische wie Klavier, Saxophon und Bandoneon unterteilt. Das Klavier, das bereits die Wandervögel wegen seiner Bedeutung als Statussymbol für das Bürgertum abgelehnt hatten, galt der Jugendmusikbewegung zusätzlich wegen seiner industriellen Fertigung und vor allem wegen seines Status’ als Konzertinstrument als ungeeignet. Ebenso hing die Ablehnung der Gitarre mit ihrer Rolle als Soloinstrument und anderen ideologischen Beweggründen zusammen.[83] Auch mit dem Klang wurde argumentiert: Der des Klaviers gab angeblich zu sehr individuellen Gefühlen Ausdruck anstatt des gewünschten leicht distanzierten Klanges. Man verstieg sich sogar dazu, daß am poetischen Klang des Instrumentennamens bereits dessen Geeignetsein ablesen sei:
„Schon die Namen der Instrumente verraten hier mancherlei, wenn man sie aufmerksam anhört. Geige, Flöte, Horn - das sind bestimmte Namen, die gelegentlich ‚poetischen’ Klang haben [...] Klavier, Saxophon, Bandonion - das klingt in keinem Fall ‚poetisch’“[84]
Der Gesamtklang eines Ensembles sollte sich - da das gemeinsame häusliche Musizieren angestrebt wurde - am durchsichtigen Klangbild des Streicherchores des 16. und 17. Jahrhunderts orientieren.[85] Insgesamt wollte man weg vom Orchesterklang, „vom dicken, lauten, schwammigen, zum klaren, präzisen, scharfen Ton, von der Farbe zur Linie.“ [86]
Dies entsprach den Erfordernissen der Polyphonie, in der die horizontalen Strukturen, d. h. der melodische Verlauf der einzelnen Stimmen klar voneinander unterscheidbar mitvollzogen werden soll, im Gegensatz zum homophonen Satz, in dem gerade die vertikale Verschmelzung der Stimmen zur als Einheit empfundenen Harmonie gewünscht ist. Nach der anfänglichen Ablehnung vieler Orchesterinstrumente wurden daher nach und nach jene wieder zugelassen, dessen Klang doch wünschenswert erschien. Die Auswahl folgte allerdings auch dem Klangprinzip nicht immer sachlich, wie in der Jugendmusikbewegung oft ein Nebeneinander aus sachlich, ideologisch und praktisch begründeten Prinzipien zu finden ist. So wurde selbst das Klavier ab etwa 1927 wiederentdeckt, als Laieninstrument deklariert und in neu erscheinenden Klavierschulen quasi als Melodieinstrument eingesetzt, bis es langsam und unauffällig wieder in seine ursprüngliche Rolle als Harmonieinstrument zurückkehrte.
Ein weiteres Argument für das Geeignetsein eines Instruments war dessen Fähigkeit, ‚singen’ zu können, wobei dies etwas uneindeutig einerseits ein Charakteristikum eines Instruments zu sein schien, andererseits als Forderung an den Musizierenden gestellt wurde. Die Idee stammte ursprünglich aus der Finkensteiner Bewegung, die Instrumentalmusik als Gesang mit Instrumenten betrachtete.[87] Auch vom ‚Mitatmen’ und vom innerlichen Mitsingen beim Musizieren wurde gesprochen.
Sowohl vom Klang als auch durch die Vorherrschaft der Polyphonie wurden die linearen Instrumente den Akkord- und Harmonie-Instrumenten vorgezogen. Dadurch ging die Bewegung leider an den im Volk beliebtesten Laieninstrumente vorbei, ohne sie sich nutzbar zu machen: Mundharmonika, Akkordeon, Gitarre und Mandoline wurden gern und viel gespielt, kamen aber für die Jugendmusikbewegung als ‚Volksinstrumente’ nicht in Frage, da sie zudem noch als mechanisch galten.[88]
1.2.6 Jugendmusikbewegung und Schulmusik
Die Jugendmusikbewegung beeinflußte auch die schulische Musikerziehung bzw. die entsprechende Gesetzgebung in den zwanziger Jahren, besonders in Form der ‚Kestenberg-Reform’, die zum Teil auf Kretzschmars Arbeit zu Beginn des Jahrhunderts aufbaute.
Leo Kestenberg war Referent des preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volkspflege. Bereits als Student begann er sich für die Bildungsarbeit der SPD zu engagieren und entwickelte sich zum musikalisch-politischen Spezialisten seiner Partei, wobei seine Aktivitäten stark durch jugendmusikalische Ideen beeinflußt waren.[89]
Grundlage seiner Reform war die Hinwendung zum Kind, dessen schöpferische Kräfte sich durch Selbsttätigkeit und eigenes Entdecken entfalten sollten, anstatt durch reine Stoffübernahme vom Lehrer verschüttet zu werden,[90] sowie die Erteilung eines breit angelegten Musikunterrichts anstelle des bisherigen Gesangunterrichts. Dazu war eine qualifizierte Lehrerausbildung nötig, die unterteilt werden sollte in eine wissenschaftliche, künstlerische und pädagogische Ausbildung.[91]
1922 erweiterte Kestenberg daher das Institut für Kirchenmusik in Berlin zur Akademie für Kirchen- und Schulmusik. Im selben Jahr erließ er die ‚Prüfungsordnung für das künstlerische Lehramt an höheren Schulen in Preußen’[92], die beinhaltete, daß Musiklehrer eine gleichwertige akademische Ausbildung wie die Lehrer anderer Fächer erhalten und somit ‚Musikstudienrat’ werden konnten, was ein grundlegender Schritt für die weiteren Neuerungen war, da für einen qualifizierten Unterricht entsprechend ausgebildete Lehrkräfte noch weitgehend fehlten. Die bisherige ‚Ordnung der Prüfung für Gesanglehrer und -lehrerinnen an den höheren Lehranstalten in Preußen’ von 1910 sah lediglich eine Volksschullehrerausbildung auf dem Lehrerseminar sowie eine zweijährige musikalische und gesangspädagogische Ausbildung vor.[93]
1923 erschien im Auftrag des Landtages Kestenbergs ‚Denkschrift über die gesamte Musikpflege in Schule und Volk’, basierend auf seiner Studie ‚Musikerziehung und Musikpflege’ von 1921.[94] 1923 ernannte er Fritz Jöde zum Professor an der neuen Akademie in Berlin, was diesem weiteren Einfluß auf die Lehrer-Ausbildung verschaffte. Basierend auf Kestenbergs Denkschrift wurde ab 1924 das neue, von der Jugendmusikbewegung beeinflußte Gedankengut schrittweise in Richtlinien und Lehrpläne für die verschiedenen Schulstufen und sogar für den musikalischen Privatunterricht umgesetzt.:
„Regelung des Musikunterrichts an höheren Schulen (1924), [...] Ordnung der staatlichen Prüfung für Organisten, [...] Erlaß über Privatunterricht in Musik (1925), [...] Bestimmungen über Musikunterricht an Mittelschulen (1925), [...] Richtlinien für den Musikunterricht an Volksschulen (1927), [...] Richtlinien für die Musikpflege in den Ausbildungsstätten für Kindergärtnerinnen (1928)“[95]
Dieses Reformprogramm klang umfassend, außerdem waren bzw. wurden viele Führer von Jugendgruppen der Jugendmusikbewegung Lehrer und trugen auch auf diesem Weg entsprechendes Gedankengut in die Schule. Dennoch wurde der Einfluß der Kestenberg-Reform bzw. der Jugendmusikbewegung auf den Musikunterricht oft überschätzt, da man die Reformpläne kurzerhand mit der Realität gleichsetzte. Die praktische Umsetzung der Bestimmungen und Richtlinien begegnete aber immensen Problemen.
Ein inhaltliches Problem der Reform war, daß die Hinwendung zum Kind und dessen Fähigkeiten teils mißverstanden wurde als „Warten auf die erhoffte eigene Entfaltung seiner musikalischen Kräfte [...], [das] Verharren in anspruchslosem Musizieren,“ [96] was den Unterricht zur kindlichen Spielerei machte. Dazu kamen vor allem praktische Hindernisse: Die noch im Sinne der Gesangslehrertradition ausgebildeten Lehrer waren oft weder in der Lage noch willens, die neuen Inhalte anzunehmen und umzusetzen,[97] die musikalische Aus- und Weiterbildung der Volksschullehrer an Pädagogischen Akademien scheiterte oft an der ungenügenden Vorbildung.[98] Außerdem standen nach wie vor meist zuwenig Musikstunden zur Verfügung. Das verschlechterte sich 1931 noch durch den Erlaß der Notverordnungen, durch die die Anzahl der Musikstunden noch unter den bereits ungenügenden Stand von 1924 gesenkt wurde.[99] Die Erweiterung des Gesangs- auf einen umfassenderen Musikunterricht war so kaum möglich, und selbst anfangs engagierte Lehrer gaben unter den gegebenen Umständen oft auf.[100]
Von einer Durchdringung des Schulunterrichts durch die Jugendmusikbewegung kann in der Weimarer Republik also keinesfalls gesprochen werden. Es zeigte sich in der Kestenberg-Reform allerdings die staatliche Anerkennung der Bewegung, sicher auch aufgrund ihrer leichten politischen Verdaulichkeit.
1.2.7 Jugendmusikbewegung und Politik
Die Ideen Jödes und der Jugendmusikbewegung konnten nicht zuletzt deshalb einen derartigen Einfluß auf die Gesetzgebung für die Schulmusik haben, weil sie für alle Parteien, deren Unterstützung Kestenberg zur Durchsetzung seiner Reform ja benötigte, in verschiedener Hinsicht attraktiv waren. Eine Erklärungsmöglichkeit dafür könnte sein, daß „die (vordergründige) Herausnahme der Musikerziehung aus den politischen und gesellschaftlichen Bindungen [...] als ein von allen Parteien geduldeter Freiraum betrachtet [wird], der humanitären Zwecken diene.“[101]
Kritische Stimmen gehen allerdings von praktischeren Beweggründen der Herrschaftssicherung aus:
„Seinen Förderern hatte sich Jöde [...] durch etliche Veröffentlichungen empfohlen, in denen ‚Musikerziehung’ mit dem von der verblichenen Jugendbewegung ererbten ‚Gesellschaftskult’ zu einer Musikideologie verbunden wurde, die den hellhörigen politischen Mandatsträgern in Berlin und andernorts zeigte, wie die Musik in ein Mittel politischer Herrschaft verwandelt werden könne.“[102]
Daß der Begriff der Gemeinschaft innerhalb der Jugendmusikbewegung nicht klar definiert wurde, machte ihn zudem für alle politischen Richtungen nutzbar, da die Parteien der Weimarer Republik in ihren Kulturprogrammen alle ein - wenn auch unterschiedlich ausgerichtetes - Gemeinschaftsideal verfolgten.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß das nach außen getragene Ideal der gleichberechtigten Gemeinschaft, das sich beispielsweise in der Polyphonie zeigen sollte, sich in der inneren Struktur der Jugendmusikbewegung keineswegs wiederfand, die streng hierarchisch aufgebaut und durchorganisiert war:
„In der ‚Jöde’-Bewegung wurden alle Veranstaltungen und jede Öffentlichkeitsarbeit vom ‚Arbeitsamt der Musikantengilden’ durchgeführt, mit jährlichen ‚Führerwochen’ und ‚Reichsführerwochen’ ab 1925. Hierarchisch geregelt war das im ganzen Reich ausgebreitete Netz von zuletzt rund 250 Gilden. Auch die Singwochen [der Finkensteiner Bewegung] hatten einen streng geregelten Tagesplan, der diktiert wurde und verbindlich war.“[103]
Diese durchorganisierten Strukturen trugen zusätzlich dazu bei, daß die Übernahme der Jugendmusikbewegung durch die Nationalsozialisten sehr unproblematisch verlief. Deren ‚Hinwendung zum Kind’ wurde natürlich konträr zu den Bestrebungen der Jugendmusikbewegung in Form von Anpassung und Nivellierung betrieben. Ab 1933 wurden die Verbände der Jugendmusikbewegung - sofern sie sich nicht auflösten - gleichgeschaltet zu nationalsozialistischen Organisationen, 1934 gingen die Singbewegungen um Jöde und auch Hensel in den ‚Reichsbund Volkstum und Heimat’ über, weitere jugendmusikalische Gruppierungen wurden meist in die Hitler-Jugend integriert, Widerstand gab es wenig.[104]
Problematisch war, daß die Jugendmusikbewegung den zentralen Stellenwert von Musik und ihren Einfluß auf den Menschen betonte und ihre entsprechende politische Manipulierbarkeit hätte sehen müssen, sich selbst aber als politisch neutral definierte und nicht erkannte, daß sie sich gerade durch diese indifferente Haltung für politische Zwecke benutzbar machte. Dazu kamen Unklarheiten und unsachliche Polemik besonders in Jödes musikphilosophischen Schriften, die für weitgehende Interpretationen offen waren. Jöde verstand sich selbst und die Jugendmusikbewegung als unpolitisch, sah seine Gemeinschaftsidee als außerhalb der Politik stehend. Aus dieser Haltung heraus bemühte er sich, selbst unter nationalsozialistischer Herrschaft zumindest Teile seiner Arbeit fortzuführen, in der Annahme, damit zu retten, was zu retten sei. Er übersah dabei, daß er in dieser Weise durch seine Arbeit das System unterstützte, was politisch sicher zumindest naiv war:
„Fritz Jödes Schriften enthalten eine Fülle von Widersprüchlichkeiten und ein Konglomerat aller zeitgenössischen Einstellungen, die verschiedene Interpretationen möglich machen. Besetzt von missionarischem Eifer fand er in jeder Ideologie Argumente. [...] Seine idealistisch-irrationale Gedankenwelt kann als Beweis dafür gelten, daß er für sich selbst tatsächlich ein unpolitischer Mensch war, doch übersah er im besten Falle, daß er sich und seine Bewegung politisch verwendbar machte.“[105]
Nicht übersehen werden darf auch, daß nationalistische Tendenzen der Kaiserzeit sich teilweise in der Weimarer Republik gehalten hatten und auch in der Jugendmusikbewegung auftraten, wenn es um den Vorrang der deutschen Kultur ging:
„Die Musikerziehung in der ‚Musikantengilde’ und im ‚Finkensteiner Bund’ war auf deutsch-völkische Bewußtseinswerdung angelegt. Der Schritt vom oft naiv-biederen Germanozentrismus zum nationalsozialistischen Chauvinismus war nicht groß.“[106]
Kolland macht außerdem darauf aufmerksam, daß alle, bis auf die jüdischen und konsequent demokratischen Führer der Jugendmusikbewegung, im Dritten Reich wieder entsprechende Positionen fanden.[107]
Daß man Jöde und der Jugendmusikbewegung besonders in den fünfziger und sechziger Jahren vorwarf, der nationalsozialistischen Herrschaft den Weg geebnet zu haben, ist aufgrund der Folgen, die dies zeitigte, verständlich, aber aus heutiger Sicht nicht immer gerechtfertigt. Die gesamte Zeit bot den Nährboden und die Möglichkeiten zu den politischen Entwicklungen, es fehlte die 'demokratische Tradition', über die wir heute verfügen.[108] Den Protagonisten einer vergangenen Zeit allerdings vorzuwerfen, sie hätten die eigenen Erfahrungen noch nicht gemacht und keine Lehren aus nach ihrer Zeit erfolgten Entwicklungen gezogen, ist zumindest kurzsichtig, geschieht allerdings oft in nahe beieinanderliegenden Generationen.
2 Menschenbild und Musikverständnis Fritz Jödes
Jödes theoretische Abhandlungen waren, wie bereits erwähnt, nicht immer durch logische Stringenz gekennzeichnet. Seine musik- und gesellschaftsphilosophischen Ideen, besonders in den frühen Schriften, blieben größtenteils vage und waren oft übertrieben schwärmerisch, in dieser Hinsicht ein Produkt ihrer Zeit und heute zumeist nicht mehr ganz ernstzunehmen. Auch der teils fast kindlich gefühlvolle, teils pseudo-bedeutsame Schreibstil ist aus heutiger Sicht oft schwer erträglich, scheint aber damals für viele den Nerv der Zeit getroffen zu haben[109] und paßt durchaus - fast unfreiwillig komisch - zur Ablehnung der Vernunfts-Überbetonung der Bewegung. Schneider faßt Jödes Anschauungen zusammen als
„Gemisch aus naturphilosophischen Annahmen (Kraft), musikhistorischen Befangenheiten (Melodie des 16., 17. Jahrhunderts als Ausdruck der Gemeinschaft), musikphilosophischen Vermutungen (Bewegung hinter der real erklingenden melodischen Linie),“[110]
was sein theoretisches Gesamtwerk zwar knapp und treffend charakterisiert, ihm bei genauerer Betrachtung in dieser Kürze allerdings Unrecht tut. Es stimmt, daß Jödes Texte sich nicht zu einem Gesamtsystem vereinigen lassen und immer wieder Unstimmigkeiten auftauchen. Bedenken sollte man dabei aber, daß Jöde als lediglich seminaristisch ausgebildeter sehr engagierter Volksschullehrer begann und bis auf ein Jahr Musikstudium an der Universität Leipzig[111] Autodidakt war, der besonders in seiner Anfangszeit seinen Weg noch suchte, wobei er die Allgemeinheit manchmal vielleicht etwas vorschnell an seinen Zwischenergebnissen teilhaben ließ. Problematisch war daran, daß er diese als mehr oder weniger wissenschaftlich belegte Tatbestände darstellte, was allerdings eine allgemein übliche Methode bei derartigen Entwicklungen ist. Jödes Mitarbeiter Georg Götsch kritisierte ihn 1929 zu Recht:
„Wir haben zu rasch und oberflächlich Worte gesucht für unsere Inhalte. Das hat sich gestraft, und es wurde rasch Literatur, die schon heute keinen mehr lebendig anruft. In diesem Zusammenhange muß erwähnt werden, lieber Fritz, daß Du besonders zu rasch ins Zeug gegangen bist. Deine theoretischen und stark weltanschaulich durchsetzten Schriften haben leider viel häufiger auf mindere als auf vornehme und klare Menschen gewirkt. Ich kenne viele, die dennoch zu uns stehen, aber nicht wegen, sondern trotz Deiner Schriften.“[112]
Jödes musikwissenschaftliche und -pädagogische Hauptwerke dagegen, die ‚Organik’, die ‚Elementarlehre der Musik’ und ‚Das schaffende Kind in der Musik’ bieten auch heute noch überraschend interessante Ansätze, sowohl für die damalige Zeit als auch für den heutigen Musikunterricht, die keineswegs alle bereits umgesetzt, geschweige denn veraltet sind. Der Schreibstil ist deutlich sachlicher und konkreter als in den überschwenglichen Frühwerken. So scheint es, daß Jödes Kritiker sich gern an seinen frühen, unzulänglichen Schriften aufgehalten und auch den späteren Jöde danach beurteilt haben. Im folgenden soll daher zunächst versucht werden, seine Ideen und Vorstellungen trotz theoretischer Schwächen mit- bzw. nachzuverfolgen.
2.1 Der ‚neue Mensch’
Grundlage der Ideen Jödes und weitgehend der Jugendmusikbewegung insgesamt[113] war der ‚neue Mensch’, dessen Schaffung bzw. Wiedererweckung im Mittelpunkt aller Bemühungen stand. Dies war ein allgemein gängiger Begriff der Zeit, der sich in vielen Reformbewegungen fand,[114] allerdings selten klar definiert wurde. Auch bei Jöde ist man darauf angewiesen, die Definition aus seinen Ausführungen zu extrahieren:
„Für Jöde ist der ‚neue Mensch’ jener, der sich all seiner Anlagen und Fähigkeiten bewußt wird, diese ausbildet und anwendet und so zum ganzen, vollkommenen Menschen wird. Für ihn fließt die Vollkommenheit aus einem neuen Körpergefühl sowie dem Bemühen um ein ständiges geistiges Weiterwachsen und in Verbindung des Einzelmenschen zur Gemeinschaft.“[115]
Der Begriff der Ganzheitlichkeit wandte sich vor allem gegen die Überbetonung des Verstandes und des Denkens. Intellektualismus war von Anfang an ein Feindbild der Jugendmusikbewegung. Verstand, Gefühl und Wille des zu erneuernden modernen Menschen waren wieder in Einklang miteinander zu bringen.[116] Diese Idee der persönlichen Einheit bzw. Ganzheit wurde übertragen auf die größeren Zusammenhänge zwischen Mensch und Umwelt und den Menschen untereinander. Hierauf baute der bei Jöde zentrale Begriff der menschlichen Gemeinschaft und der Gemeinschaft mit der Natur auf.
Den Ideen Rousseaus folgend sollten für dieses Ziel die im Menschen vorhandenen natürlichen Kräfte gefördert werden, die in der überkommenen Erziehung und nicht zuletzt der Schule bisher gegängelt und domestiziert wurden. Jöde ging es nicht darum, die Pädagogik um größerer Lernerfolge willen zu verbessern, sondern es ging ihm um die Möglichkeit, durch die Schule möglichst große Teile der Bevölkerung mit seinen Ideen und Methoden zu erreichen und besonders die Entwicklung der noch weitgehend ‚unverdorbenen’ Kinder in die richtige Richtung zu lenken.
2.2 Musik als Lebendiges
Neben der Gemeinschaft bzw. in Kombination mit ihr schien die Musik das gegebene Mittel zur Schaffung des neuen Menschen zu sein.
Jöde scheint seine Musikanschauung damit in die Tradition humanistisch-idealistischer Erziehungsziele zu stellen, die auf der antik-mittelalterlichen Philosophie mit der Idee der ‚harmonia mundi’ fußen, einer Harmonie der ganzen Welt, die sich in jedem ihrer Teile, in jedem Mikrokosmos widerspiegelt. Der Mensch ist demnach durch die Widerspiegelung der Weltharmonie in der Musik von Natur aus musikempfänglich, da dieselbe Harmonie auch in ihm selbst wirkt.[117] Jöde beruft sich aber nicht auf diese Quellen, befaßt sich auch nicht näher mit der Frage, wie man „den umgreifend humanitären Anspruch antik-mittelalterlicher Musikerziehung in die Gegenwart [...] transportieren“ könne,[118] sondern scheint die erneuernden Kräfte der Musik kurzerhand aus dem Nichts heraus für die Gegenwart zu postulieren.[119]
Vieles, was bei Jöde undurchsichtig zu sein scheint, erhellt sich nach Ehrenforth beträchtlich, wenn man es im Lichte der Ideen des um die Jahrhundertwende bedeutenden Philosophen Henri Bergson sieht, dessen Werk ‚Schöpferische Entwicklung’ (L’évolution créatrice) 1912 erstmals in Deutschland erschien und große Beachtung fand. Nach Bergson strömt stetig der schöpferische ‚élan vital’, der Lebensschwung, durch Natur und Mensch, Geist und Materie, und verbindet so Subjekt und Objekt. Jödes Vorstellung der Kraft des Schöpferischen im Menschen und sein Glaube daran, daß Musik zu einer verbindenden Gemeinschaft zwischen Menschen und auch zwischen Mensch und Natur führt, ist vor diesem Hintergrund verständlicher.
Ebenso findet sich die Idee des Lebens als fortschreitende Bewegung wieder, die sich auch in der Musik ausdrückt, denn Musik ist nach Jöde nicht nur ‚Bewegtes’, sondern auch weiter ‚Bewegendes’. Auch dem nur Hörenden soll sich in der Musik die schöpferische Bewegung, die zu ihrer Entstehung geführt hat, wieder mitteilen, indem sie ihn zum Nachschöpfen anregt:
„Als Wunschbild [steht] vor uns, das Kunstwerk so erleben zu sollen, daß es dem Erleben seines Erbauers nahe kommt.“[120]
Jöde selbst wies weder auf Bergsons Ideen hin, die ihm wahrscheinlich nicht ausdrücklich bekannt waren, noch auf andere Philosophen, deren Begriffe oder Ideen er teils zu übernehmen scheint, woraus Ehrenforth schließt, daß er „offensichtlich ohne hinreichende Kenntnis der entscheidenden Vordenker den Zeitströmungen erstaunlich hellhörig und einfühlsam zu folgen wußte.“[121]
2.3 Theoretische Hauptwerke
Bei Jödes wichtigsten Schriften handelt sich in erster Linie um schulpädagogische Werke, da Jöde sich primär als Pädagoge verstand. Man muß aber bedenken, daß der Musikunterricht für ihn nur ein Mittel zum Zweck darstellte, um die Kinder auf den richtigen Entwicklungsweg zu schicken, der schließlich zur gesamtgesellschaftlichen Erneuerung führen sollte.
In der Anfangszeit seines Wirkens verfolgte er teilweise auch von der Jugendbewegung übernommene revolutionäre Gedanken und schien die Institution Schule zeitweilig ganz abzulehnen. Daß er „mit Musik als Fach nichts zu tun“ haben wollte,[122] stellte sich aber bald als das Bestreben heraus, das Fach Musik in seiner damaligen Ausprägung zu ändern und bezog sich darauf, daß Musik nicht ein Schulfach unter anderen sein durfte (erst recht nicht ein weniger wichtiges), sondern das Leben umfassen sollte. Jöde strebte besonders danach, die Kinder zu erreichen, aus dem Grunde, daß diese noch nicht von der ‚Mechanik’ und ‚Stofflichkeit’ der Zivilisation einverleibt worden seien und sich in ihnen der ‚göttliche Funke’ noch rege, das Schöpferische in ihnen daher noch leicht zu wecken und zu fördern sei.[123]
1921 schrieb Jöde über seine Schularbeit in ‚Die Lebensfrage der neuen Schule’:
„wir hofften so mitten unter den menschen zu stehen - und nicht gesondert schularbeit zu leisten - wenn wir auch in der schule zuerst anpackten - da wir doch schulmeister waren [...] lebenserneuerung wollten wir - damit allerdings auch schulerneuerung - aber nicht zuerst das zweite - und dann möglicherweise das erste“[124]
Wie diese Erneuerungen vonstatten gehen sollten, soll nun anhand seiner Hauptwerke nachvollzogen werden.
2.3.1 Organik
1926 erschien ‚Die Kunst Bachs - Dargestellt an seinen Inventionen’ als erster Band der von Jöde geplanten Schriftenreihe zu seiner Theorie der ‚Organik’, die er allerdings nicht weiterführte.
Kernstück des Werks ist die Vorstellung des Lebens und jeden geistigen Schaffens zwischen den Polen des Organischen und des Mechanischen. Die im 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhundert erfolgte extreme Annäherung an den mechanischen Pol muß laut Jöde nun zum Rückschlag zum Organischen führen, ein Vorgang, der sich in Teilen der Bevölkerung bereits in der Ablehnung der industriellen Welt und der Hinwendung zur Natur zeige. Für die Musik bedeutet es, daß die Vorherrschaft der in ihren Mitteln Ton und Klang bis aufs Äußerste ausgereizten Materie nun dem inneren Zusammenhang, der der Musik innewohnenden Energie oder Spannung weichen muß. Die dafür nötige neue Betrachtungsweise soll sich nicht den Resultaten, den festgelegten äußeren Formen der Musik widmen, sondern diese Formung jeweils als Ausdruck der dahinterliegenden Bewegung betrachten. Diese Bewegung ist eine Art ‚Plan der Welt’, der sich in der Musik ausdrückt und aus dem heraus auch die musikalischen Gesetze entstehen. Diese Gesetze darf man daher nicht als Selbstzweck betrachten, sondern man muß sich immer des dahinterliegenden Lebensplanes bewußt sein.
Statt des Anhäufens von Wissen um musikalische Abläufe (was wieder einer Anhäufung von Materie entspräche), sieht Jöde als vordringliche pädagogische Aufgabe der Organik daher,
„das Ohr in der Weise zu üben, daß es in der Erkennung der äußeren Zusammenhänge schließlich selbst immer zusammenhängender hört und in der Erkennung des inneren Bewegungsvorganges schließlich selbst am Musikgeschehen immer tätiger Anteil nimmt.“[125]
Wichtige Anregungen für die ‚Organik’ gaben August Halms Werke und Ernst Kurths ‚Grundlagen des linearen Kontrapunkts, Einführung in Stil und Technik von Bachs melodischer Polyphonie’,[126] die Jöde intensiv studiert hatte.
Anhand von fünf der insgesamt 15 zweistimmigen Inventionen Bachs legt Jöde seine Ideen dar, und zwar in Form von genauen, erst kleinschrittigen, dann die große Form jeweils zusammenfassenden Analysen, die einer musikwissenschaftlichen Sachlichkeit durchaus gerecht werden. Bedenken muß man auch, daß die konventionelle Kompositionsanalytik jener Zeit größtenteils unzulänglich war und sich zwischen extremem Formalismus (nach Jöde ‚Verstofflichung’) und „hermeneutischem Hineininterpretieren außermusikalischer Fantasiegehalte in Musikwerke“ [127] bewegte. Beides lehnte Jöde für sich ab. Von vereinzelten Schwachpunkten abgesehen sind seine Ausführungen sachlich, bleiben aber nicht beim bloßen Feststellen der Form stehen,[128] und seine Deutungen gehen nicht über nachvollziehbare Bewegungsimpulse hinaus.
Zum Schluß geht Jöde auf Max Regers Orgelbearbeitung der Inventionen ein, an denen er die Haltung seiner Zeit zur Musik Bachs und zur Musik im allgemeinen zeigen will. Reger setzte in seiner ‚Schule des Triospiels’ für Orgel eine dritte Stimme zwischen die zwei vorhandenen der Bach-Inventionen. Für Jöde sind die Inventionen in sich aber bereits vollkommen - sonst hätte man vorher bereits einen Mangel verspüren müssen - und Reger dringt für ihn mit der dritten, an die vorhandenen angepaßten Stimme störend ein, er nimmt damit die Bewegungen der Originalstimmen nicht ernst, „Denn ernst nehmen würde hier heißen, sie so sehr als Lebewesen zu achten, daß man es nicht wagt, sie irgendwie zu verstümmeln.“[129]
Jöde schließt daraus, daß Reger als Kind seiner Zeit gegen das Lebendige in der Musik, gegen organische Geschehnisse so abgestumpft sein müsse, daß er die augen- bzw. ohrenfälligen Bewegungsvorgänge innerhalb der Inventionen nicht mehr wahrnehme.[130] Er gesteht ihm durchaus technisches Geschick in der Einfügung der dritten Stimme zu, eine Gewandtheit mit dem Stoff, indem er sich an der äußeren Form der vorhandenen Stimmen orientiert, aber keinerlei Erkennen des Lebens, der Bewegungsenergie, die diese ursprünglich formte.
Am Rande kritisiert Jöde auch Regers ‚Kanons für Pianoforte durch alle Dur- und Molltonarten.’ In diesen 111 Kanons hat Reger unter anderem Zitate aus Werken älterer Meister benutzt, für Jöde offenbar willkürlich, oder noch schlimmer „als ob Reger das für einen Kanon ausgerechnet ungeeignetste Material zum Thema erhoben hat, um sozusagen nun gerade einen Kanon daraus zu bauen und dadurch zu zeigen, daß er auch dieses fertigbringt.“[131]
Er wirft ihm vor, „am inneren Leben [des Themas] völlig vorübergegangen [zu sein] und es ohne jedes Körperempfinden rücksichtslos zum Material erniedrigt“[132] zu haben.
Klar wird hier, daß Jöde in Sachen Musik keinen Spaß versteht. Ein ironischer oder unernst-unterhaltsamer Umgang mit der Musik ist für ihn leichtfertig, frivol und frevelhaft, egal wie kunstfertig er ist, und daß Reger mit seinen Kanons womöglich einen ‚Fastnachtsscherz’ vorhatte, ist eher als Abwertung seiner Arbeit denn als echter Vorwurf gemeint.
Interessant ist, daß Jödes Vermittlungsmethode seiner Ideen seinem ‚organischen’ Anspruch durchaus gerecht wird.[133] Er läßt den Leser seine Gedankengänge zu den einzelnen Inventionen mitverfolgen, stellt Fragen, deren Beantwortung er hinauszögert, um zum Mitdenken anzuregen, und folgt so ganz dem Ideal des ‚fließenden Lebens’ und der organischen Bewegung, anstatt dem Schüler bzw. Leser das Wissen als fertigen Stoff zur Übernahme zu präsentieren.
Die Organik ist für Jöde unter anderem eine ‚Geniekunde’, die zwischen den Werken eines bloßen Talents und eines Genies unterscheiden helfen soll, wobei für ihn „Genialität und Talentiertheit keine Übergangsstufen sind, sondern Gegensätzlichkeiten“. [134] Wichtig ist ihm die Unterscheidung „zwischen einem alltäglichen Schaffen, das jeder mehr oder weniger fertigbringt, und einer sonntäglichen Schöpfung, die ein Wunder ist“, [135] was dem ‚alltäglichen Schaffen’ allerdings keineswegs seine Daseinsberechtigung verwehren soll.
2.3.2 Elementarlehre der Musik
Die ‚Elementarlehre der Musik. Gegeben als Anweisung im Notensingen.’ erschien 1927 als Methodikbuch, in dem Jöde sein Musikverständnis didaktisch umsetzte. Geplant waren ursprünglich sechs Bände, von denen aber nur der erste erschien. Dieser entstand als „erster Niederschlag einer seit vier Jahren an der Jugendmusikschule Charlottenburg der Akademie für Kirchen- und Schulmusik durchgeführten Arbeit“,[136]
war also praktisch erprobt und sollte weiteren Volks- und Jugendmusikschulen als Unterrichtsgrundlage dienen. Im Mittelpunkt steht der lebendige, selbst erfahrende und erforschende Umgang mit Musik. Jöde schreibt im Nachwort:
„1. Jede Übung führe zum Leben. 2. Jedes Gewußte sei zuvor ein Gehörtes und Erfahrenes. 3. Jedes Gehörte und Erfahrene sei Musik.“[137]
Die Bezeichnung Lehrer kommt im ganzen Werk nicht vor. Manchmal wird der damals noch unbelastete Begriff ‚Führer’ benutzt, der ein etwas erfahrener Schüler zu sein scheint, sonst schreibt Jöde in der Wir-Form, als ob die ganze Gruppe sich gemeinsam auf einen Erkundungsweg machte. Sicher wird es in der Praxis eine stärkere Anleitung durch den Lehrer gegeben haben, aber in Schreibweise und Methodik der Elementarlehre zeigt sich bereits eine sehr viel größere Freiheit der Schüler als bisher üblich.[138]
Dazu kam ein neuer ganzheitlicher Anspruch, der sich in dieser Zeit auch in anderen Unterrichtsfächern bemerkbar machte. Der bisherige Musikunterricht behandelte die Elemente Rhythmik, Melodik und Harmonik schematisch getrennt. Gehörbildung und Notenlesen begann mit dem Nachsingen einzelner Töne, dem Unterscheiden von Halb- und Ganztönen, dann folgte das isolierte Erlernen der Intervalle, die schließlich mosaikartig zur Melodie zusammengesetzt wurden.[139]
Auch Jöde behandelt die unterschiedlichen Intervalle, aber von Anfang an innerhalb eines harmonisch-melodischen Zusammenhanges, so daß ihre unterschiedliche Qualität sofort sinnlich erfahrbar wird. Er arbeitet mit der von ihm modifizierten ‚Tonika-Do-Methode’,[140] die, wie er betont, nicht nur zum Vom-Blatt-Singen führen soll, denn
„[Eine] ‚Anweisung im Notensingen’ [...] darf sich [...] nicht damit begnügen, ein äußerlich sicheres Treffen von Tönen und Tonfolgen zu erzielen, sondern muß bestrebt sein, in allem dem Lebendigen in der Musik, der Melodie nachzugehen. Ausgehend von der Anschauung, daß die Melodie kein Tonstoff vor dem Menschen, sondern ein lebendiger Vorgang in ihm sei, sucht sie ihren Weg nicht vom fertig vorliegenden Stoff [...], sondern überall in produktiver Arbeit.“[141]
Er schafft mit seiner Methode zuerst ein Klangbewußtsein für die Dur-Tonleiter, beginnend mit dem Dreiklang, wobei von Anfang an kleinste Improvisationen der Schüler eine Rolle spielen: Jeder ist hin und wieder Vorsänger oder Führer der Gruppe. Jöde betont, daß bereits zum Üben melodische Wendungen gefunden werden sollen, keine willkürlichen Tonsprünge - wird dieses zur Übung einmal eingesetzt, dann mit dem deutlichen Hinweis darauf, daß dies keine Musik sei - , und weist immer wieder auf das Eigenleben der Melodie bzw. der ihr innewohnenden Energie und auf die Wichtigkeit dieser Erfahrung in der Praxis hin:
„Jeder singe also [...] immer darauf los, überlasse sich aus irgendeinem kleinen Ansatz her sich selbst und sorge sich nicht. Was er nicht schaffen zu können vermeint, schafft die Tonbewegung, der er sich anvertraut, in ihm. [...] Durch Nachdenken kommt man nie zum Singen, sondern allein durch das Singen selbst.“[142]
Wenn die Schüler sich innerhalb einer Oktave relativ heimisch fühlen und nach ersten Übungen, die rhythmische und harmonische Aspekte einbeziehen, befaßt sich die Elementarlehre bewußter mit der für Jöde so wichtigen Melodiebewegung, indem die Schüler musikalische Fragen und Antworten erfinden, an denen genau untersucht wird, welche Tonschritte die jeweilige Qualität ausmachen.[143]
Ziele der Elementarlehre sind die Fähigkeit zum Singen nach Noten und zum eigenen Notieren in relativer Tonhöhe, wobei der Grundton der Durtonleiter im Liniensystem einfach durch einen ‚do-Schlüssel’ gekennzeichnet und auf Vorzeichen verzichtet wird. Dazu kommen erste Kenntnisse der Intervalle und der rhythmischen Grundlagen, zentral ist aber in all diesen technischen Fertigkeiten vor allem das elementare Erfahren der Musik.
2.3.3 Das schaffende Kind in der Musik
1928 veröffentlichte Jöde ‚Das schaffende Kind in der Musik - Eine Anweisung für Lehrer und Freunde der Jugend’ in einem Theorie- und einem Praxisteil, in denen er die Ideen seiner Organik noch einmal zusammen mit seinen didaktisch-pädagogischen Vorstellungen darlegte und ausbaute.
Der Praxisteil baut auf Jödes Elementarlehre auf, wiederholt vieles aus ihr, erweitert es und führt nach denselben Methoden noch etwas weiter für den Unterricht in der Oberstufe, bringt aber nichts grundsätzlich Neues. Dazu gibt Jöde, ähnlich seinen ‚Lebensbildern aus der Schule’ Beispiele aus seinen Musikstunden,[144] die zum Teil etwas geschönt sein mögen, insgesamt aber ein glaubwürdiges Bild seines lebendigen Unterrichts vermitteln, so daß man ihm seine etwas blumigen Ausführungen über die Freuden des Lehrerberufes und die leuchtenden Augen der Kinder verzeiht.
Der theoretische Teil (der auch einige Beispiele enthält) führt tiefer ein in Jödes Musikverständnis und die sich daraus ergebenden pädagogischen Notwendigkeiten. Im Mittelpunkt steht die Dringlichkeit des eigenen musikalischen Schaffens des Kindes, die in der Elementarlehre bereits in den selbst improvisierten kleinen Übungen zum Ausdruck kam. Es geht Jöde hier aber nicht einfach um den pädagogischen Gedanken, daß eigene Kreativität den Unterricht befördere, sondern sein Anliegen ist sehr viel tiefergehend. Er bezeichnet die „Musikerhaltung [...] nur [als] eine Wesensseite unserer Lebenserhaltung“ [145] , was er allerdings nicht näher darlegt. Des weiteren postuliert er, das ganze Leben müsse aus dem Schaffen heraus begriffen werden und sich damit der vorherrschenden Mechanisierung widersetzen, entsprechend auch die Musik:
„zuerst steht als Forderung das schaffende Spiel und die schaffende Arbeit des Kindes in der Schulmusik da, nicht als etwas, das auch einmal angeregt werden könnte, sondern das als Verlangen des Lebendigen immer wieder auftaucht und schwere Bedenken erweckt, wenn kein Verlangen danach im Menschen und in einer Zeit bemerkbar ist.“[146]
Jöde verwahrt sich erneut und ausführlich gegen die Gleichsetzung von ‚schaffender Arbeit’ und ‚Schöpfung’ im Sinne eines Kunstwerks. Es geht ihm nicht um einen vermeintlichen ‚Künstler im Kinde’, sondern um eine im Menschen natürliche, wenn auch in unterschiedlichen Graden vorhandene Fähigkeit zu musikalischem Schaffen, die besonders im Kind noch aktiv ist:
„Es singt und spielt überall, wo es nur möglich ist, und Singen und Spielen ist ihm eigentlich keine besondere Tätigkeit neben andern Tätigkeiten, sondern im Grunde das Leben selbst.“[147]
Diesen Umgang des Kindes mit Musik als Lebensnotwendigkeit will Jöde beibehalten bzw. fördern, indem er in seinem Unterricht beginnend „von der Lebenseinheit zu den Stoffen des Lebens“ vorgeht,[148] anstatt wie bisher üblich umgekehrt. Er nennt als drei Entwicklungsphasen des Kindes, denen der Unterricht zu folgen habe:
„1 die unbewußte, triebhafte, ungeteilte Selbstbetätigung, [...] 2 das Erwachen des Bewußtseins in der Selbstbetätigung, der Beginn der Analyse und der Objektivierung, [...] 3 die Technik der Selbstentfaltung, die durchgeführte Versachlichung.“[149]
Das Schaffen soll daher zunächst losgelöst von jedem pädagogischen Zweck sehr spielerisch verfolgt werden, der Lehrer soll das Kind „in Vollmusik eintauchen, daß es sich in ihr tummeln lernt“.[150] Unter Vollmusik ist ein ganzheitlicher Umgang mit Musik zu verstehen, die auch aus nur sehr kurzen Elementen bestehen kann; es geht nicht um ganze Musikstücke oder künstlerische Ansprüche. Immer betont Jöde den Zusammenhang bzw. das Entstehen aus dem Leben und auch aus der Körperlichkeit, wenn er von der natürlichen Sprachmelodie zur Tonmelodie und schließlich zur Schrittmelodie übergeht. Letztere bedeutet die rhythmisierte Melodie, die Jöde körperlich erfahrbar macht, indem die Kinder sie mitschreiten und auch begreifen, daß die Melodie sich bewegt, selbst ‚schreitet’, im Gegensatz zur üblichen Ausdrucksweise, die Melodie ‚habe’ einen Takt, einen Rhythmus, ein Tempo, was der stofflichen Anschauungsweise entspricht.
In dieser Zeit soll der Lehrer sich von seinem Lehrgedanken weitgehend befreien (wiewohl all diese spielerischen Erfahrungen später natürlich nutzbar gemacht werden sollen) und diesen erst später wieder aufnehmen, wenn „das Kind sich [zeitweilig] neben sich selbst stellt, sein eigenes Tun sieht und im Hinsehen Einzelheiten erkennt.“ [151] Es findet dabei aber keine Abspaltung des Stofflichen vom Lebendigen statt:
„Weil [das Kind] [...] dabei den Blick ständig auf das Ganze gerichtet hat, werden ihm die Bewegung eben dieses Ganzen erkennbar sein und folglich selbst als Bewegungsangelegenheiten erscheinen.“[152]
Das Erlernen der Technik geschieht als letztes und immer nur auf der Grundlage des Lebens, der vorher erlebten Musik:
„Und erst ganz zum Schluß zeigt sich dann für uns [...] die Möglichkeit der Erwerbung einer Technik der Selbstbetätigung, der bewußten Formung aus dem Erkennen der Vorgänge und ihrer Innengesetzlichkeit.“[153]
Daß dieses Stadium nicht alle Kinder (und auch Erwachsenen) erreichen können, ist dabei nicht ausschlaggebend. Jöde betont, daß auch Kinder, die es nicht so weit bringen, eigene musikalische Einfälle zu gestalten und durch Singen oder Musizieren mitzuteilen, dennoch innerlich einen Teil des Schaffensprozesses zu erleben vermögen - er unterscheidet dabei die Phasen des Einfalls und des Hinausstellens einer Gestalt in den Raum -, und außerdem durch das Miterleben der Gestaltungen der anderen bereichert werden.[154]
Betont werden soll noch einmal, daß es Jöde nicht um das Herstellen von Kompositionen im Sinne echter ‚Schöpfungen’ ging, geschweige denn darum, eine Kompositionslehre zu schaffen. Ziel seines Musikunterrichts war vor allem, die für ihn unnatürliche und in seiner Zeit extreme Trennung zwischen Schaffen und Nachschaffen und damit auch zwischen Kunst- und Laienmusik zu überwinden, indem er im Musizierenden durch das immer bewußtere Selbst-Schaffen eine Ahnung für die vom Komponisten umgesetzte Bewegung eines Stückes weckte:
„Da ist nicht mehr das Lied ein Tonstoff vor uns, den wir einfach wiedergeben; sondern immer wieder erfahren wir in ihm, was wir zuvor in uns selbst an Bewegung beim Schaffen erfahren haben, so daß uns unser Schaffen nunmehr befähigt, das Lied, mit dem wir uns beschäftigen, ebenfalls als ein Gewordenes zu begreifen und im eigenen Werden den Eingang zu ihm suchen.“[155]
Es ging ihm um das Verständnis und das Erleben von Musik beim eigenen Musizieren und auch beim Hören von Musik, was im Erkennen des Unterschieds zum eigenen ‚Schaffen’ auch das Gefühl und Verständnis für die Größe echter ‚Schöpfung’ bewirken sollte:
„Ja, wir hoffen, gerade daraus wieder die so oft in uns verloren gegangene Fähigkeit zum Abstandnehmen in Ehrfurcht zu gewinnen, welche uns als die dem Kunstwerk gegenüber allein würdige Haltung erscheint.“[156]
Übergeordnetes Ziel ist nichts weniger als die Erneuerung des Schulgedankens insgesamt, eine Abkehr von der Lernschule zugunsten einer Arbeitsschule, die auf der echten, freiwilligen und ernstgenommenen Mitarbeit der Schüler aufbaut. Die Tätigkeit des Lehrers soll nicht mehr darin bestehen, mit stets wacher Kritik „Ungenauigkeiten und Verkehrtheiten“ zu bekämpfen und so das Kind „auf eine Einheitslinie einer Musikbewegung [abzustempeln],“ [157] sondern in erster Linie, durch Mittun und gegenseitiges Vertrauen die Hemmungen des Kindes zu überwinden, um dessen eigene Kräfte frei fließen zu lassen:
„Erste Voraussetzung für dieses Ablösen [des Kindes von seiner Gehemmtheit] aber ist das tätige Bekenntnis des Erziehers zum Kinde, damit dieses sich in ihm geborgen fühlt.“[158]
Es reicht nicht bzw. ist kaum möglich, Jödes Ideen lediglich als neue Methode in das alte System zu übernehmen, denn „[Wer] sich im Schaffen mit den Kindern vom alten Schulgedanken befreit, der wird erst verstanden haben, daß ich mit dieser Schrift keinen neuen methodischen Handgriff lehren will, der schmerzlos in ein altes System eingefügt werden kann, sondern daß ich am Beispiel der Schulmusik helfen möchte, der Bewegung zur Erneuerung des Schulgedankens überhaupt an einem stofflichen Beispiel zu dienen.“[159]
Deutlich treten hier Einflüsse der Kunsterziehungsbewegung und der freien Schulen zutage. Der neue Schulentwurf verlangt dem Lehrer einiges an Flexibilität und eigener Improvisationsfähigkeit ab, da er den Kindern ein großes Mitgestaltungsrecht einräumt bzw. es gerade darauf anlegt. So geschieht auch die Erteilung der Hausaufgaben in Zusammenarbeit mit den Kindern. Deren Ausführung ist sehr frei, und es soll keine Bewertung stattfinden, vielmehr sollen - neben den Erfahrungen, die jedes Kind mit seinen Aufgaben selbst macht - die fruchtbarsten Ergebnisse die ganze Klasse bereichern, indem sie zusammen bearbeitet werden. Letztendlich ist die übergeordnete pädagogische Aufgabe für den Lehrer, durch das eigene Schaffen des Kindes dieses immer besser kennenzulernen und ihm so weiterzuhelfen, seine eigenen Kräfte zu entfalten und somit zum ‚neuen Menschen’ zu werden:
„Das ist das Schönste für den Lehrer, daß er seine Kinder, die sich ihm im freien Schaffen aufschließen, immer mehr von innen heraus sieht, sie immer besser verstehen lernt und eigentlich auf diese Weise den Weg findet, gut zu ihnen zu sein.“[160]
Es klingt in diesem Zusammenhang noch einmal die Idee an, daß Musik nicht ihren Zweck völlig in sich selbst berge, sondern dem Leben diene, was nicht mit einer zweckgebunden, rein funktionellen Musik verwechselt werden darf, vielmehr soll Musik in der Lage sein, die Bewegung des Lebens auszudrücken. Für Jöde bedeutet das:
„Musik ist [...] nicht [...] um des Musikstoffs und seiner Ziele willen da, sondern sie ist, wie ich es so oft gesagt habe, der klingende Ausdruck dafür, daß Menschen beieinander sind.“[161]
Wenn die kreativen Hervorbringungen der Kinder auch unbewertet bleiben, ist Jöde alles andere als unkritisch dem musikalischen Material gegenüber, das daneben für den Unterricht herangezogen wird. „Dichterische und künstlerische Halbheiten, Süßlichkeiten und Eitelkeiten“ [162] sollen dem Kind nicht nahekommen. Von Anfang an soll das kindliche Schaffen begleitet werden von Liedgut, das derselben Quelle, dem Leben entspringt - das tut für Jöde natürlich vor allem das Volkslied-, was zu förderlichen Wechselbeziehungen zwischen beiden Unterrichts-Elementen führen soll:
„Schon beim Schaffen im Ansatz findet die eigene Sprache der Kinder ihre ständige Parallele in der Sprachformung der ersten kleinen Kinderreime, [...] Kinderrufe und Kinderspiele, und überall zeigt sich, wie die ersten Tonbildungen oft wörtlich dieselben sind wie die entsprechenden Tonbildungen bei den Liedern, welche die Kinder singen.“[163]
Daß umgekehrt die Kinderlieder die ersten eigenen Versuche der Kinder beeinflussen könnten, zieht Jöde nicht in Betracht, obwohl er an anderer Stelle anmerkt, daß unter anderem folgende Fragen noch auf ihre Beantwortung warteten, da sie erst im jetzigen, neuartigen Verkehr mit den Kindern zu beantworten seien:
„Wie steht das Kind auf Grund seiner eigenen Arbeiten zum Dur-Raum, zur Pentatonik, zu den Kirchentönen? [...] Was hat das Kind durch sein eigenes freies Schaffen etwa der Intervallenlehre, der Lehre von der Harmonik und der Kadenz zu sagen? In welchem Verhältnis stehen Sprachmelodie und Tonmelodie im Kinde anfänglich zueinander, und nach welchen Gesetzen und in welcher Weise entwickeln sie sich?“[164]
Er macht dabei keinen Unterschied zwischen Kindern verschiedener Kulturen, fast als gäbe es vor der Schule keinen Kontakt zur Musik der eigenen Kultur und als wären Kinder nicht von dieser beeinflußt, sondern kämen in einer Art musikalischen Rohzustandes in die Schule. Allerdings ist davon auszugehen, daß ein entsprechendes Bewußtsein zu seiner Zeit noch nicht geschärft war und dieser Aspekt allgemein vernachlässigt wurde bzw. ein national beschränkter Blick allgemein vorherrschend war.
Dazu kommt Jödes nicht immer wissenschaftliche Vorgehensweise, wenn er z. B. von ihm präferierte Kinderlieder in ihren Anfängen darstellt und offenbar aus eigenen Erfahrungen schließt, diese seien ganz der natürlichen Sprachmelodie nachempfunden oder sogar, daß „kein Kind, das ohne Kenntnis dieser Weise den Text zu singen versucht, andere Tonwerte wählen wird, als sie im Lied vorkommen“ [165] , obwohl er vorher davon spricht, daß die Fragen von Sprach- und Tonmelodie noch auf eine Beantwortung warteten. Derartige Behauptungen stören leider den wissenschaftlichen Anstrich, den Jöde sich zu geben versucht.
Für das im Unterricht verwandte Liedgut ist Jöde nun wichtig,
„daß es musikalisch als der stärkere Teil erscheint, so daß das Kind durch den Vergleich eine Bereicherung erfährt, [aber] [...] es darf außerdem auf keinen Fall so sein, daß das Lied [...] dabei dem Kinde so fern steht, daß dieses selbst durch die Beziehung zu ihm unfrei, gehemmt wird und sein eigenes Schaffen darunter leidet,“[166]
wie es passieren könne bei ‚unechten’, kindertümelnden Volksliedern[167] oder zu hoch gegriffenen Stücken, die die Aufnahmefähigkeit des Kindes noch überschreiten.
In der Oberstufe, wenn einfache choralartige Melodien erfunden werden sollen, hält er es für wichtig, das Schaffen der Kinder anfangs stark am Beispiel älterer Melodik zu orientieren, weshalb die alten Meister studiert werden sollten. Dies sei wiederum auch nötig, um die jüngste Musik verstehen zu können.[168] An dieser Stelle kommt Jöde kurz auf die Unzulänglichkeit der üblichen Schulliederbücher zu sprechen:
„Unsere Liederbücher bergen gerade für die Abschlußzeit der Schule oft noch allzuviel Halbheiten, Minderwertigkeiten in sich, die zwar äußerlich durch angenehm klingende mehrstimmige Sätze zugedeckt, aber [...] um so gefährlicher die Verbindung mit wirklichen melodischen Werten verhindern.“[169]
2.3.4 Zusammenfassung
Jöde bringt in seinen musiktheoretischen und -pädagogischen Hauptwerken viele interessante Anregungen für eine moderne Pädagogik und Didaktik mit einer starken Betonung der Spontaneität und Kreativität der Schüler. Er bemüht sich um einen ganzheitlichen Unterricht, der die Körperlichkeit mit einbezieht und ‚vom Kind’ ausgeht, einerseits dadurch, daß er die Impulse der Kinder in den Unterricht übernimmt, andererseits dadurch, daß er auf den kindlichen Lebensraum und das kindliche Verständnis eingeht.
In den Versuchen philosophischer und musikwissenschaftlicher Verankerungen seiner Ideen zeigt er Schwächen und Unklarheiten, bleibt oft vage und allgemein. Es gelingt ihm nicht bzw. er bemüht sich nicht darum, die großen Ideen, die sich bei näherer Betrachtung oft als Worthülsen erweisen - auf konkrete Kleinziele herunterzubrechen. Befindet er sich aber erst einmal im praktischen Bereich des Unterrichts, tritt die Stärke seiner pädagogischen Ideen und Fähigkeiten klar zutage.
Gegenüber seiner großen Offenheit im Umgang mit den Schülern und deren (wenn auch teils gesteuerten) Hervorbringungen nimmt sich seine Betonung des Volkslieds und der alten Meister und seine Ablehnung bzw. Ignoranz anderer Musik gegenüber unerwartet konservativ aus. Jödes Betonung der Vorherrschaft der Melodie und ihrer Bewegung, die er in der ‚Organik’ darlegt, bringt interessante Aspekte, erlegt sich aber auch Beschränkungen auf und bringt sich so um andere Formen der Musik.
3 Jödes außerschulische Musikvermittlung
Jöde wurde immer wieder - auch von seinen Kritikern - als aktiver und geschickter Organisator bezeichnet, wobei dies hin und wieder mit dem Vorwurf des Taktierens verbunden, von anderen wiederum als politisch-diplomatisches Geschick gelobt wurde. Bei den folgenden Aktivitäten war Jöde nicht in jedem Fall der persönlich Ausführende, was bei einer derart umfassenden Arbeit auch nicht der Fall sein kann. Die Anregungen und Anstöße aber kamen von ihm, teils in Form von bewußter Planung, die von anderen ausgeführt wurde - besonders bei seiner Arbeit innerhalb der Musikantengilde -, teils durch vorbildhafte Arbeiten, die von anderen übernommen oder fortgeführt wurden. Jöde selbst wurde von Zeitzeugen eine - meist begeisternde - unermüdliche Tätigkeit bescheinigt.[170] Es gab auch Stimmen wie die Walther Hensels, die ihm Unstetigkeit, ungenügendes Ausfeilen einzelner Ideen vorwarfen. Daß bei einer Vielzahl von Ideen einige vage oder unausgeführt bleiben, ist gut möglich, andererseits herrschten zwischen Hensel und Jöde als zwei Führern der Jugendmusikbewegung mit unterschiedlichen Arbeitsweisen persönliche Animositäten, die eventuell zu derartigen Vorwürfen führten. Es ist in jedem Fall erstaunlich, wie viele Impulse Jöde gegeben hat.
3.1 Die Musikantengilde
3.1.1 Idee und Organisation
Die Musikantengilde war die Organisationsform des von Jöde geführten Teils der Jugendmusikbewegung. 1918 veröffentlichte Jöde in der ‚Laute’ einen Aufruf des 20jährigen Wandervogels Hermann Reichenbach an alle Musikfreunde, sich zu gemeinsamer musikalischer Arbeit zusammenzufinden:
„Was uns als gegenwärtige Möglichkeit vor Augen steht, sind Kreise von gleichgesinnten Musikfreunden, ausübenden wie hörenden, zum gemeinsamen Spiel, Streichquartett, Klavier oder Laute und andere alte Instrumente. Und vor allem: Chorsingen!“[171]
Interessenten sollten sich an die ‚Laute’ wenden, die erste Treffen in den jeweiligen Städten organisierte. Der Aufruf war äußerst erfolgreich, und in ganz Deutschland entstanden Musiziergruppen,[172] die sich 1919 unter Jöde als Obmann als die ‚Neudeutsche Musikergilde’ (später Musikantengilde) konstituierten. 1921 wurde in Stuttgart ein ‚Arbeitsamt der Laute’ eingerichtet, das den schriftlichen Verkehr zwischen den Musikgruppen und der Zeitschrift betreuen und vor allem bei der Vermittlung von Musikern für Veranstaltungen helfen sollte.
Betont wurde immer wieder die Ernsthaftigkeit und Demut, die das Musizieren prägen sollten, der Dienst an der Musik. Reichenbach sprach schon im Aufruf davon, „mit dem Ernste und mit der Würde und mit der Freudigkeit, die ihr gebührt, Musik zu treiben,“ [173] Jöde wies darauf hin, daß man sich der Gilde nur anschließen dürfe, „um zu dienen, nicht um für sich Vorteile zu erjagen,“ [174] was offenbar verschiedene Solisten durch Vermittlung durch das Arbeitsamt und Komponisten zwecks Verbreitung ihrer Werke über die Musikantengilde versuchten. Die musikalischen Qualifikationen in den einzelnen Musikantengilden waren sehr unterschiedlich, vom einfachen Singkreis bis zum anspruchsvollen Laienmusizieren (beispielsweise einer Gruppe Musiklehrer) gab es viele Abstufungen.[175]
Bis 1926 weitete sich die Gildenarbeit derart aus - etwa 250 Gruppen entstanden, vor allem Singkreise -, daß das Arbeitsamt der Laute vergrößert und als ‚Arbeitsamt der Musikantengilden’ nach Berlin verlegt wurde. Zusätzlich war es nun zuständig für die Organisation von Führer- und Schulungswochen, Jugend- und Schulmusiktagungen, es übernahm die Vermittlung von Mitarbeitern für Vorträge und Singwochen und fungierte als Presseamt.
Außerdem gab die Musikergilde 1921 bis 1923 ein Jahrbuch heraus, das „die Absicht der ersten zusammenfassenden Darstellung einer aus der Jugendbewegung hervorgegangenen Musik [hat]. Darüber hinaus will es durch sein Dasein mitwirken zur Entfaltung immer größeren Ernstes und immer gründlicherer Arbeit in der musizierenden Jugend. [...] Nur an die wendet es sich, die es ernst nehmen mit ihrer Musik.“[176]
Besonders die Führungsriege der Musikantengilde bildete eine intensive Arbeitsgemeinschaft, deren Mitglieder ständig in Gedankenaustausch und Diskussion miteinander standen, so daß von ihr auch Impulse und Aktivitäten ausgingen, die nicht direkt der Organisation Musikantengilde zuzurechnen waren. Aus ihrem Kreis stammten beispielsweise auch Leiter und Mitarbeiter von Musikschulen, die nicht von der Gilde gegründet wurden, und viele folgten Jöde bei seiner Arbeit für den Rundfunk.
3.1.2 Musikwochen
1924 fand die erste Jugendmusikwoche auf der Burg Lobeda in Thüringen statt, in der die Mitglieder der verschiedenen Gilden praktisch zusammenarbeiteten. Musikwochen gehörten von da an zu den regelmäßigen Veranstaltungen der Musikantengilde.
1926 fand die erste Hochschulwoche in Brieselang bei Berlin unter dem Titel ‚Grenzen und Möglichkeiten der Musikpflege’ statt, in der die Musikantengilde den Kontakt zur Fachmusik suchte und zu der vor allem die Führer, d. h. Leiter von Sing- und Musizierkreisen sowie übergeordnete Vertreter der Kreise, aber auch Lehrer und Interessierte, geladen waren. Es war die erste ‚Reichsführerwoche’, der neben anderen 1927 und 28 zwei große in Lichtenthal folgten, da durch das Wachstum der Gilde die ‚Führerschulung’ zu einer wichtigen Aufgabe wurde. Das Programm war in erster Linie der alten Musik gewidmet - Es gab Vorträge über die Polyphonie des 16. Jahrhunderts, die Kirchentonarten, Heinrich Schütz, das Volkslied sowie die jugendmusikalischen Vorstellungen über Musik -, aber es wurde bereits der Versuch gemacht, sich neuerer Musik zu öffnen.[177] Dazu kamen praktische Unterweisungen in Stimmbildung und Chorleitung, um die Arbeit der einzelnen Musikantengilden zu verbessern, deren Leiter in vielen Fällen das nötige Handwerk nicht beherrschten.[178]
Neben den Reichsführerwochen gab es auch verschiedene regionale Musikwochen. Das gemeinsame Singen und Musizieren stand natürlich jeweils im Mittelpunkt, dazu kamen musiktheoretische Unterweisungen. Wichtig war der Musikantengilde auch das gemeinschaftliche Zusammenleben während der Arbeit.
3.1.3 Zusammenarbeit mit Hindemith
Ein interessante Phase stellt der zeitweilig enge Kontakt des Komponisten und Musikers Paul Hindemith zu Jöde und der Musikantengilde dar, die ein helleres Licht wirft auf das Verhältnis der Jugendmusikbewegung zur modernen Kunstmusik.
Teile der Jugendmusikbewegung bemühten sich ab der Mitte der zwanziger Jahre verstärkt, ihre immer noch stark rückwärtsgewandte Musikpflege zu erneuern, da sie diese nicht als Flucht aus der Gegenwart, sondern als Entwicklungsschritt zu Neuem definieren wollten:
„Die Jugend will [...] nicht in einer entlegenen Welt, der Gegenwart abgewandt, selbstzufrieden leben, historisch-literarische Genießerei betreiben. [...] Jene [alte Musik] ist ihr kein erreichtes Ziel [...], sondern Fingerzeig auf eine von uns zu lösende Aufgabe.“[179]
Das wirkliche Ziel, die zu lösende Aufgabe sollte sein, Kunst- und Volksmusik wieder miteinander zu verbinden, wobei das ‚wieder’ darauf hinwies, daß man eine solche Verbindung in der Vergangenheit voraussetzte. Hier wirkte noch das romantisierte und idealisierte Bild der ‚alten heilen Welt’, das vom Wandervogel übernommen worden war.
Man wollte sich nun auch neuerer Musik öffnen bzw. suchte eine den eigenen Idealen entsprechende neue Musik, da sowohl der bürgerliche Betrieb der auf Unterhaltung ausgerichteten Musik als auch die in ihren Augen (bzw. Ohren) überintellektualisierte Avantgarde weitgehend abgelehnt wurde. Zu dieser gehörte allerdings auch Hindemith, was bald zu Differenzen führte. Für Hindemith hingegen eröffnete sich die gewünschte Möglichkeit, Einfluß auf die moderne Laienmusik zu nehmen.[180]
Die jugendmusikalischen Ideen über die Wichtigkeit des eigenen Musizierens trafen sich in vieler Hinsicht mit den Bestrebungen Hindemiths, der 1922 im Prospekt für ein Konzert schrieb:
„Wir sind überzeugt, daß das Konzert in seiner heutigen Form eine Einrichtung ist, die bekämpft werden muß und wollen versuchen, die fast verloren gegangene Gemeinschaft zwischen Ausführenden und Hörern wieder herzustellen.“[181]
Besagtes Konzert sollte unbekannte alte und neue Musik in kleiner Besetzung anbieten, wobei die Zuhörer das Programm mitgestalten konnten. Der Eintritt war frei, daher nicht an Einkommen und Schicht gebunden. Die Namen der Ausführenden wurden nicht erwähnt, was der Idee des Zurücktretens hinter die Musik, dem Dienst an ihr entsprach. Ebenso sollte es keine Kritiken in den Zeitungen geben, was im üblichen Konzertbetrieb ein ausschlaggebendes Moment war. Das Erlebnis der Musik war hier wichtig, nicht eine nachträgliche Bewertung. Des weiteren beschäftigte sich Hindemith damit, Musik für Laien und Kinder zu schreiben, die auch hohen künstlerischen Kriterien genügen sollte.
Aufgrund dieser Übereinstimmungen mit der Jugendmusikbewegung nahm Hindemith im Oktober 1926 an der Hochschulwoche der Musikantengilde in Brieselang teil, um sich ein genaueres Bild von deren Arbeit zu machen. Dies führte dazu, daß er auf die Bitte Hilmar Höckners, eines engagierten Musiklehrers und führenden Repräsentanten der Jugendmusikbewegung, begann, Kompositionen für die Musikantengilde zu schreiben.[182]
Jöde war sehr interessiert an der Zusammenarbeit mit einem modernen Komponisten, der, wie es schien, mit seinen eigenen Vorstellungen von Musik weitgehend übereinstimmte, denn er sah ‚Inzucht’-Gefahren sowohl für die Jugendmusikbewegung als auch für die Avantgarde, wenn diese sich nicht aus ihrer jeweiligen Isolation befreien würden.[183] Hindemith war zudem der anerkannte Führer der musikalischen Avantgarde. Daß er die Jugendmusikbewegung ernst nahm, konnte ihr Ansehen in Fachkreisen, die sie bisher noch belächelt hatten, heben.
So wurde auf Hindemiths und Jödes Initiative hin beschlossen, im darauffolgenden Jahr das avantgardistische ‚Donaueschinger Musikfest’,[184] das Hindemith mit organisierte, mit der Reichsführerwoche der Musikantengilde zu kombinieren.[185] Ein Brief Hindemiths an Jöde, in dem er sich bereits Gedanken über Vorträge und den konkreten Ablauf der geplanten Veranstaltung machte, dokumentiert seine Begeisterung über das Erlebte und seine Hoffnungen für die Zusammenarbeit. Allerdings irritierte ihn „die ständige Begeisterung, in der die Gemeinschaft sich befindet“, [186] da Begeisterung für ihn etwas besonderes sein sollte. Er glaubte aber,
„daß sich eine Menge solcher leicht komischen Auswüchse verlieren wird, wenn die Leute sehen, daß sie - wie wir alle - doch nur Teil eines größeren Geschehens sind.“[187]
Die zweite Reichsführerwoche der Musikantengilde fand daher 1928 in Lichtenfeld bei Baden-Baden statt unter der Leitfrage nach dem ‚Verhältnis der Jugendmusik zu der schaffenden Musik und dem Musikleben unserer Zeit’. Gleichzeitig fand in Baden-Baden als Nachfolgerin der Donaueschinger Musikfeste die ‚Deutsche Kammermusik’ statt, so daß ein Austausch zwischen den Veranstaltungen bzw. deren Teilnehmern stattfinden konnte.[188]
Das Programm der Führerwoche beinhaltete Gruppenbesuche der ‚Kammermusik’, und die Musikantengilde gestaltete das gemeinsame Abschlußfest musikalisch.[189] In der praktischen Arbeit stand diesmal die Erarbeitung verschiedener Stücke moderner Komponisten im Vordergrund. So gab es Chorstücke von Armin Knab, Ludwig Weber und Walter Rein, die der Jugendmusikbewegung nahe standen. Und Jöde selbst studierte mit einer Gruppe 4 ‚Lieder für Singkreise’ von Hindemith ein. In den Musizierkreisen wurden Stücke von Johann Kaspar Fischer, Ernst Lothar von Knorr und wiederum Hindemith erarbeitet.[190]
Innerhalb der Jugendmusikbewegung gab es aber auch Kritik an der Teilnahme am Kammermusikfest. Einerseits da es sich dabei wieder um Konzerte, Vorführungen handelte, während man sich auf ein musikalisches Zusammenleben konzentrierte, Musik nach wie vor primär als Gemeinschaftserlebnis, als „klingend gewordene Ordnung eines Menschenkreises“ [191] sehen wollte. Jödes Mitarbeiter Georg Götsch schrieb dazu, daß „die Frage der ‚neueren Musik’ [...] viel weniger im Stoffe, in der Komposition [liegt], als vielmehr in der Darstellungsform, in der Art, wie und an welcher Stelle und mit welchem Ernste sie sich ins allgemeine Leben einbaut.“[192]
Sehr viel wichtiger als der Besuch der Konzerte war ihm deshalb die praktische musikalische Arbeit mit Hindemith, die „viel mehr fröhliche Fühlung“ [193] erlaubte. Viele Mitglieder der Musikantengilde lehnten die moderne Kunstmusik allerdings insgesamt weitgehend ab und sahen die eigene Aufgabe eher im Schaffen einer neuen Volksmusik, deren konkrete Kriterien allerdings nie geklärt wurden. Was auf dem Kammermusikfest zu hören war, war ihnen „eine höchstdifferenzierte Kunstübung,“ bei der es sich trotz der Abkehr von romantischen Mitteln um „überfeinerte, rasch welkende Blüten am Baume der Musik“ [194] handelte, wie Konrad Ameln es im Sinne der konservativeren Mitglieder der Musikantengilde formulierte. Hindemiths Werke für Laien, die eine vereinfachte Form dieser Musik darstellte, waren für die meisten „weder [...] selbst volkstümlich, noch führen sie zu einer volkstümlichen Musikübung hin; die Schulwerke haben vielmehr die Aufgabe, von Stufe zu Stufe bis zu jenen überfeinerten höchstdifferenzierten Kunstwerken hinzuführen.[195]
Zwar bemühte sich Hindemith, die technischen Anforderungen seiner Musik an den Spieler oder Sänger zu reduzieren, andererseits war seine oft freie Tonalität für viele ungewohnt, die Stimmführung etwa seiner ‚Lieder für Singkreise’ sehr instrumental, nicht immer leicht singbar. Hindemith ging es primär immer um die künstlerische Weiterentwicklung der Musik nach seinen Vorstellungen, die er auch Laien nahebringen wollte. Die Vereinfachung war ein Mittel dazu, aber keineswegs das Ziel. Daher wird [...] deutlich, daß eine Begegnung der Jugendmusik mit Hindemith und dem Baden-Badener Kreise für eine neue Volksmusik kaum fruchtbar werden kann; der Kunstmusik (im engeren Sinne) frisches Blut zuzuführen darf aber nur eine untergeordnete Aufgabe der Jugendmusik sein.“[196]
Trotz der Gegenstimmen wurden auch 1928 Kammermusik und Jugendmusikwoche wieder zusammengelegt. Neben anderen kleinen Stücken wurde Hindemiths Kantate ‚Frau Musica’ nach Texten von Luther unter Mitwirkung des Publikums aufgeführt, das den Anfangs- und Endchor mitsang. Hier schien die Idee der Gemeinschaft zwischen Musizierenden und Publikum weitgehend realisiert, dennoch zeigte sich immer deutlicher, daß die angestrebte Vereinigung von Volks- und Kunstmusik allgemein noch nicht erreicht bzw. vielleicht auch gar nicht zu erreichen war:
„Dies zeigte sich bei einigen Kompositionen, die im Kreis der Musikantengilde oder von ihr nächststehenden Musikern geschrieben waren. Werke, deren Sinnerfülltheit nicht zu bezweifeln ist, deren schöpferische Substanz und stilistische Eindeutigkeit jedoch für den anspruchsvollen Kenner nicht überzeugend erscheinen. [...] zum Problem wird [hier]: der Konflikt zwischen ästhetischer, schöpferischer Wertigkeit und lebensverbundener, bekenntnisklarer Gebrauchsmäßigkeit.“[197]
Die Unterschiede in den Anschauungsweisen führte schließlich zur Aufgabe der gemeinsamen Aktivitäten: Obwohl das Kammermusikfest 1929 als eines der Hauptthemen ‚Musik für Liebhaber’ behandelte, hatte man der Musikantengilde kein Mitspracherecht an der Planung eingeräumt. Das wiederum brachte Jöde zum Abbruch der Zusammenarbeit, da dieses Thema für die Jugendmusikbewegung zentral war. Hätten die Musikwochen der Musikantengilde wieder parallel stattgefunden, hätte man diese auch für mitverantwortlich für das Kammermusikfest gehalten,[198] und dort waren weder Kompositionen aus der Jugendmusikbewegung berücksichtigt noch deren Ablehnung der üblichen Konzertkultur, die der Gemeinschaftsidee widersprach.[199] Wahrscheinlich kam dazu noch die persönliche Kränkung, für eine Mitarbeit in den Kreisen der Künstler als nicht kompetent betrachtet zu werden.
Die Zusammenarbeit hatte in Bezug auf das Modernisieren der Jugendmusikbewegung auch für Hindemith nicht soviel bewirkt, wie er es sich ursprünglich erhofft hatte, denn 1930 warf er der Laienmusik immer noch „übertriebenen Historizismus“ vor und fügte hinzu:
„Wer sich in die Historie zurückzieht, ist feige. Seine Kraft geht der heutigen Musik verloren, die darum längere Zeit benötigen wird, sich auf eine höhere Stufe zu entwickeln. Nicht alle alte Musik ist gut. Früher hat es auch Schund gegeben. Er sollte heute ebensowenig gespielt werden, wie neuzeitlicher Unfug.“[200]
Er kritisierte auch ihren praktischen Umgang mit der Musik, da man unabhängig von allen hehren Theorien „bei vielen Vereinigungen musikalischer Laien [...] die Beobachtung machen [kann], daß die Musik innerhalb ihrer Gemeinschaft gar nicht so wichtig ist, als sie selbst glauben. Von der übelsten Vereinsmeierei über die geläufigen Formen gesellschaftlicher Unterhaltung bis zum verschrobensten Sektenwesen finden sich alle Arten gemeinsamen Handelns.“[201]
Hindemith mußte erkennen, daß besonders an der Basis der Jugendmusikbewegung die musikalisch fortschrittlichen Bestrebungen keineswegs ausschlaggebend waren. Viele Mitglieder von Sing- und Spielkreisen waren mit ihrer rückwärtsgewandten Musikpflege und ihren Gemeinschaftserlebnissen durch Musik wahrscheinlich völlig zufrieden, und auch das oft bestrittene Moment der Weltflucht liegt nahe, wenn man erst das desillusionierende Erlebnis des Krieges und später die schlechte wirtschaftliche Lage der Zeit bedenkt.
Dennoch befaßte sich Hindemith weiter intensiv mit Laienmusik,[202] durch kostenlosen Unterricht an Musikschulen und auch durch spezielle Kompositionen, wie etwa den ‚Plöner Musiktag’ für Chor und Orchester, geschrieben für ein Musikfest an der Staatlichen Bildungsanstalt in Plön 1932. Für die Jugendmusikbewegung blieb diese Musik zwiespältig:
„Es fehlt dem Werk wie allen Werken Hindemiths und dem größten Teil der modernen Musik überhaupt etwas von der wirklichen Bindung an Volk und Heimat.“[203]
Dieser Kritik fehlte allerdings wie üblich eine Aussage darüber, wie eine solche Bindung musikalisch aussehen müßte. Offenbar fehlten hierfür die Kriterien, und es liegt der Verdacht nahe, daß eine wirkliche Offenheit für neue Musik in den konservativen Kreisen gar nicht bestand, obwohl man dies behauptete, um nicht der Rückwärtsgewandtheit bezichtigt zu werden, man sah sich ja nach wie vor als erneuernde Kraft. Nach außen hin wurde die Suche nach einer neuen volksgemäßen Musik betrieben, dann aber wurden alle sich bietenden Möglichkeiten abgelehnt.[204]
3.1.4 Die ‚Schwarze Hand von Oberhof’
Die unterschiedlichen Einstellung zur neuen Kunstmusik war nur ein Problem der immer heterogener werdenden Musikantengilde, die Ende der zwanziger Jahre grundlegende Identitätsprobleme bekam. Ihre unterschiedlichen Aktivitäten hatten sich teilweise verselbständigt und waren nicht mehr ohne Widersprüche in einer Organisation zu vereinigen:
„es gab die Spezialisierung auf alte Aufführungspraxis und die Renaissance alter Instrumente, es gab Musikpädagogik, es gab die Verbindung zur Neuen Musik, Konfessionelle Gruppen entstanden, die ‚Musiksoziologen’ bildeten sich heraus.“[205]
Aus diesem Grund trafen sich im Januar 1929 die führenden Männer der Gilde in Oberhof zu einer Geheimtagung, die nach dem Ort die ‚Schwarze Hand von Oberhof’ genannt wurde.[206] In dieser Krisensitzung sollte über die Wandlungen der Bewegung und ihrer Anschauungen beraten werden sowie darüber, ob prinzipiell noch ein gemeinsames Fundament für die weitere Arbeit vorhanden war. Die von Jöde gewünschten Stellungnahmen der Teilnehmer zeigten die Unvereinbarkeit der verschiedenen Vorstellungen, wenn das auch nicht alle wahrhaben wollten.[207]
Georg Götsch stellte fest, wie festgefahren und erstarrt die Bewegung bereits war, „wie verhärtet jetzt schon viele Schlagwörter, Lebens- und Musizierformen sind. [...] Wir hatten viel Ursache, uns zu wundern, wie formelhaft abgegriffen und also alt und wirkungslos vieles im Gebrauch geworden war, was wir vor wenigen Jahren hell und frisch erst entdeckt hatten.“[208]
Dazu kam die Kritik, daß die Bewegung - ähnlich wie bei Sekten und anderen religionsartigen Zusammenschlüssen - viele Orientierungslose angezogen hatte, denen es primär um das Gefühl der Gemeinschaft und der Sicherheit ging:
„Am stärksten belastet uns [...] die Tatsache, daß die Musikantengilden weiterhin Sammelstellen von Lebensängstlichen, von steckengebliebenen Jugendbewegten, von dünnsäftigen und unsicheren Puritanern sind, und daß ihre ‚Führer’ manchmal harmlos schwatzen, oft kaum Verstandenes nachbeten und nicht ungefährliche Verwirrung damit anrichten.“[209]
Derartige Anhänger waren nicht geeignet, selbst aktiv gestaltend und verändernd mitzuwirken. In den meisten Fällen waren sie verunsichernden Veränderungen ja eher abhold. Götsch sprach sich für einen mindestens zeitweiligen Rückzug der Musikantengilde als Organisation aus, da eine „sich selbst verabsolutierende Musikbewegung keine Zukunft hat.“ [210] . Die selbständigen Mitglieder müßten für sich persönlich Wege der Weiterarbeit finden. Jöde, den er stark kritisierte, legte er eine Arbeitspause, womöglich einen längeren Auslandsaushalt nahe, vor allem müßte die „ ‚wilde Produktion’ an Büchern, Aufsätzen und Schriften unterbleiben.“ [211]
Neben milder kritisierenden Stimmen standen viele, die sich beruhigten mit der allgemein spürbaren Bindung unter den Teilnehmern, dem gemeinsamen Ziel, das es nach wie vor zu erreichen gelte, meist wieder in Schlagworten wie ‚Musik und Volk’, ‚Musik und Leben’ abgehandelt. Fast alle Stellungnahmen wurden äußerst vage und unsachlich formuliert, zu praktischen Ergebnissen kam es kaum.
Ein - allerdings nur kurzlebiger - Versuch der Musikantengilde zur Erneuerung war die Zeitschrift ‚Musik und Gesellschaft’.[212] Insgesamt blieb die Organisation aber stehen bzw. in ihren verschiedenen Richtungen stecken und änderte nicht viel an ihren Aktivitäten und Anschauungen. Insgesamt fand in der Jugendmusikbewegung ein weitgehender Rückzug auf die eigenen als heil empfundenen Kreise statt, noch verstärkt durch die schwierigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse, bis es 1933 zu ihrem von außen bewirkten Ende kam.
3.2 Jugend- und Volksmusikschulen
Ein bedeutender und bis heute wirkungsvoller Schritt Jödes war die Einrichtung von Musikschulen, auf denen auch die heutigen Musikschulen aufbauen. Die Einrichtung von Musikschulen zählt zur außerschulischen Musikvermittlung, da es sich hierbei nicht um den üblichen staatlichen Schulbegriff handelt, sondern um freiwillig besuchte Kurse während der Freizeit. Zudem sind die Musikschulen schon wegen des geringen zeitlichen Umfangs von einigen Stunden pro Woche einer regulären Schule nicht zu vergleichen.
Neben dem Einfluß, der über die Kestenbergschen Reformen auf den regulären Musikunterricht ausgeübt werden sollte (was, wie bereits erwähnt, nicht sofort zur Zufriedenheit gelang), lag Jöde daran, mit den Musikschulen allen Teilen der Bevölkerung eine elementare Musikübung zu ermöglichen, denen dies bisher verschlossen geblieben war.
Kestenberg entwarf 1921 das Konzept einer Volksmusikschule,[213] die prinzipiell von den Gemeinden getragen werden und sich - aufgrund der finanziellen Lage des deutschen Staates - durch Beiträge der Schüler selbst erhalten sollte, allerdings ohne einen Gewinn. Ihm schwebten drei verschiedene, voneinander getrennte Typen der Volksmusikschule vor: eine Singschule, eine Instrumentalschule sowie eine rhythmisch-gymnastische Schule. Jöde dagegen ging es um eine umfassendere Musikschule, die die genannten Elemente im Sinne seiner ganzheitlichen Musikauffassung vereinigte, anstatt erneut eine Art der Spezialisierung hervorzurufen. Es sollte zwar auch Instrumentalunterricht geben, aber nicht, um zum Virtuosentum, sondern um zusammen mit anderen Bestrebungen zu einer Erneuerung und Erweiterung der Hausmusik zu führen.
3.2.1 Jugendmusikschule Berlin Charlottenburg
1923 erhielt Jöde die Möglichkeit, quasi als Modell-Versuch die erste Jugendmusikschule nach seinem Konzept zu entwickeln. In Berlin Charlottenburg gründete er die richtungsweisende ‚Jugendmusikschule Charlottenburg der Akademie für Kirchen- und Schulmusik’. An die Akademie war er im April als ordentlicher Professor berufen worden,[214] und die angegliederte Jugendmusikschule sollte „ein Musterbeispiel einer Musikschule für die Schuljugend [sein] [...], das wegweisend für die Einrichtung weiterer ähnlicher Schulen [...] werden könnte.“[215]
Das Statut der Schule nannte als Zweck:
„die Wiedererweckung einer edlen Volksmusik durch gründliche, über den Rahmen des heutigen Schulunterrichts hinausgehende Musikunterweisung und gemeinsame Pflege des durch sie erworbenen Kulturgutes. Sie soll ferner den [...] Studierenden der Akademie Gelegenheit geben, sich unter der ständigen Leitung eines erfahrenen Musikerziehers und Methodikers unterrichtlich zu betätigen.“[216]
Die Jugendmusikschule Charlottenburg war für Jöde eine ‚Versuchsschule’ für seine Lehrverfahren, die er nach vier Jahren der praktischen Erprobung 1927 in seiner ‚Elementarlehre’ veröffentlichte.[217] Außerdem war sie die ‚Übungsschule’ für Jödes Musikstudenten an der Akademie, die durch ihre Unterrichtstätigkeit dort praktische Erfahrungen sammelten, und wodurch es möglich war, kein Schulgeld zu fordern.[218] Dadurch konnten sie auch musikbegabte Kinder aus schlechteren wirtschaftlichen Verhältnissen besuchen, deren Förderung eines der Hauptanliegen Jödes war.[219] Schüler waren musikalisch besonders begabte Kinder zwischen neun und etwa zwölf Jahren aus den Gemeindeschulen Charlottenburgs, die sich einer Aufnahmeprüfung unterziehen mußten. Die Eltern wurden von den Schulgemeinden angeschrieben, wobei noch einmal deutlich gemacht wurde, daß es nicht um ein Hinführen zum Berufsmusikertum ging, sondern daß die Kinder innerhalb von drei Jahren „eine gründliche musikalische Ausbildung erhalten sollen, die sie befähigt, ihr Können in den Dienst ihrer Freunde in Schule und Haus zu stellen.“[220]
Von 123 Kindern, die zur Aufnahmeprüfung erschienen, wurden 45 ausgewählt.[221] Der Unterricht fand in zwei Altersklassen sowie einer Instrumentalklasse für besonders begabte Kinder statt,[222] betrug jeweils zwei Wochenstunden und umfaßte für alle Schüler Stimmerziehung, Einzel- und Chorgesang sowie allgemeine musikalische Erziehung. Es wurde mit Übungen zur Gehörbildung begonnen, die vom Notenlesen und Blattsingen bis zum Notendiktat führten. Parallel wurden Stimmpflege und rhythmische Schulung durch körperlich-musikalische Betätigung betrieben. Auch die Instrumentalklassen nahmen an diesem allgemeinen Unterricht teil, da der isolierte Instrumentalunterricht nach altem Muster für Jöde unfruchtbar war und Musikunterweisung und Musikausübung stets in Beziehung zueinander stehen sollten.[223]
Trotz schlechter bzw. kaum vorhandener Grundlagen durch den Schulmusikunterricht ging die Arbeit der Jugendmusikschule offenbar gut voran. Im folgenden Jahr wurden zusätzlich rund 20 Kinder von sechs bis acht Jahren aufgenommen, da Jöde ja besonders daran lag, den Unterricht bereits bei kleinen Kindern zu beginnen. Nach dem Ablauf der drei Ausbildungsjahre konnten die Schüler im Singkreis des Jugendmusikschule ihre Arbeit fortführen, einige nahmen zusätzlich an einem weiterführenden Theorieunterricht teil. Aus praktischen wie auch erzieherischen Gründen begannen ältere und erfahrene Schüler jüngere Nachzügler zusätzlich zu unterrichten, was sowohl für die Kinder als auch für die Studenten offenbar eine neue Erfahrung war, zum eigenständigen Arbeiten beitrug und das Gemeinschaftsgefühl in erwünschter Weise festigte.
3.2.2 Volksmusikschule Hamburg
Im Mai 1923 entstand die ‚Hamburger Volksmusikschule’, maßgeblich von Jöde geplant, der zu dem Zeitpunkt allerdings bereits in Berlin war, und gegründet vom ‚Musikausschuß der Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens’. Ihr lag weitestgehend dasselbe Konzept zugrunde wie der Jugendmusikschule, nur daß sie sich an Erwachsene statt an Kinder richtete, und zwar ausdrücklich an „Erwachsene jedes Alters, beiderlei Geschlechts und jedes Berufes.“ [224] In Hamburg mußte Schulgeld bezahlt werden,[225] da die Musikschule nicht an ein entsprechendes Institut angebunden war, sondern als Privatschule Lehrer engagieren mußte. Diese stammten zum großen Teil aus der Jugendmusikbewegung, aber auch aus Konservatorien, oder sie waren Berufsmusiker. Mitglieder der Hamburger Philharmonie etwa gaben Unterricht für Blasinstrumente.[226]
In zwei ehemaligen Lehrerseminaren wurden anfangs etwa 400 Schüler unterrichtet, von denen allerdings nur ein halbes Prozent der Arbeiterjugend entstammte.[227] Die unteren Bevölkerungsschichten zu erreichen stellte sich erneut als schwierig heraus. Zudem nahm die Schülerzahl ab, da das Bezahlen des Beitrags während der Inflationszeit mit sich erhöhenden Arbeitslosenzahlen vielen Schülern nicht mehr möglich war.[228] Ab 1926 gab es einen regelmäßigen staatlichen Zuschuß, der die Anschaffung einiger Klaviere und einigen bedürftigen Schülern Freistellen ermöglichte.[229]
3.2.3 Weitere Entwicklung
Die Arbeit der Musikschulen wurde insgesamt sehr gut angenommen. Bis 1928 entstanden 10 Volks- und Jugendmusikschulen, die jeweils etwa 200 bis 400 Schüler hatten.[230] Dazu kamen Volkshochschulheime, die denselben Grundsätzen folgten. Das Ziel, „Die angestrebte Ausfüllung des Vakuums zwischen Volksmusik und hoher Kunst wurde nicht immer erreicht, [aber] die Jugend- und Volksmusikschulen [...] schufen ein solides Fundament musikalischer Ausbildung.“[231]
Fundament ist in dem Sinne zu verstehen, daß es in allen Bevölkerungsschichten Menschen gab, die die Chance nutzten, sich die entsprechenden musikalischen Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen und die Möglichkeit dazu prinzipiell allen offenstand, wenn auch das flächendeckende Erfassen besonders der untersten Schichten nicht gelang, denn ganz so gemischt wie beabsichtigt fiel die Klientel der Schulen nicht aus. In dieser Hinsicht blieb ein Problem, daß die meisten Musikschulen Privatschulen waren und über Schülerbeiträge zumindest mitfinanziert werden mußten. Die soziale Herkunft der Schüler konzentrierte sich in erster Linie auf das untere Kleinbürgertum.[232] Die Volksmusikschule Kassel ist allerdings ein gutes Beispiel für die recht erfolgreiche Erprobung neuer Methoden zur Kontaktaufnahme mit dem Proletariat und den Arbeitslosen.[233] Reichenbach konstatierte 1927 immerhin befriedigt, daß „die Statistiken der Volksmusikschulen beweisen, daß nur ein geringer Prozentsatz ihrer Schülerschaft [...] jemals vorher sich an einem Konservatorium oder entsprechendem Privatunterricht beteiligt hat. Es ist tatsächlich gelungen, eine große Menschenmenge musikalisch zu erfassen, die - obgleich [...] musikalisch besonders rege - in ihrem Musikbedarf bisher an Konzert und Konservatorium unberührt vorbeigegangen ist.“[234]
3.2.4 Fortbildung der Lehrkräfte
Auch für die Volks- und Jugendmusikschulen war Jöde die Ausbildung der Lehrkräfte sehr wichtig, da es ihm nicht nur um das Verbreiten musikalischer Kenntnisse und Fähigkeiten ging, sondern dabei immer auch die neue jugendmusikalische Haltung zur Musik und seine neuen Methoden im Zentrum standen. Jöde wollte den Musikerzieher anstelle des Musiklehrers alten Formats. Statt der „Leistung des Schülers als Selbstzweck“ ging es um „die Erziehung, d. h. die Bildung der Individualität des Schülers [...] durch die Konfrontierung mit musikalischen Fachgegenständen.“ [235] Ab 1925 richtete er Ausbildungskurse zum Volksmusikschullehrer an der Akademie für Kirchen- und Schulmusik ein. Es handelte sich dabei um die Fortbildung von Musiklehrern, Musikern und Musikwissenschaftlern, die über die fachliche musikalische Ausbildung bereits verfügten und die mit den pädagogisch-methodischen Inhalten der Jugendmusikbewegung vertraut gemacht werden sollten, um einen Unterricht nach deren Prinzipien zu garantieren.[236]
Als weitere wichtige Lehrer-Fortbildungsstätte wurde 1929 das ‚Musikheim Frankfurt/Oder’ unter der Leitung von Georg Götsch gegründet. Dieses war angebunden an die Akademie für Kirchen- und Schulmusik Berlin und sollte durch die Form der Heimvolkshochschule eine noch intensivere Zusammenarbeit im Sinne einer wirklichen Lebensgemeinschaft ermöglichen, da die Teilnehmer hier einige Wochen oder Monate zusammenlebten.[237]
Neben diesen zentralen Fortbildungsstätten gab es auch immer wieder einzelne Lehrgänge an Volkshochschulen oder im Rahmen der Musikwochen und weiterer Aktivitäten der Musikantengilde.
3.3 Wiederbelebung alter Instrumente
Jöde war sehr daran gelegen, für die Erneuerung der Hausmusik neben der Vokalmusik auch das Instrumentalspiel in der Bevölkerung zu fördern. Hierfür kamen natürlich nur die ‚organischen’ Instrumente in Frage;[238] dazu kam das Problem der richtigen Literatur. Jöde wirkte in dieser Hinsicht vor allem durch die praktische Arbeit in den Musikantengilden und durch viele Veröffentlichungen in ihren Organen.
Gegen Ende der zwanziger Jahre begann man sich stärker mit alten Instrumenten besonders der Barockzeit zu befassen und sie nachzubauen. Der Instrumentenbauer Hellwig forderte hierfür eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit von Komponisten, Instrumentenbauern und Musizierenden zwecks gegenseitiger Befruchtung, was 1929 in der ‚Instrumentenversuchsstätte’ des Musikheims Frankfurt/Oder unter Gofferje verwirklicht wurde. Gofferje baute hier einfache Instrumente nach alten Vorbildern, wobei möglichst wenig Mechanik eingesetzt werden sollte.[239]
Für die Gambe etwa, von Möller bereits 1918 wiederentdeckt, tauchte immer mehr alte Literatur auf, die dem Instrument zu größerer Verbreitung verhalf. Auch die Fidel wurde wiederentdeckt, die mit ihrem weniger vollen Ton als dem der Geige dem neuen Klangideal entgegenkam.
Als Generalbaßinstrument, das für die Musik des Barock notwendig war, entwickelte man ein einmanualiges Cembalo, das einen leiseren, und dadurch zu den anderen Instrumenten passenderen Klang als das ohnehin verpönte Klavier besaß und in der Herstellung günstiger als das übliche zweimanualige war.
Profitieren konnte die Jugendmusikbewegung auch von der parallel laufenden Orgelbewegung. Auch diese wollte weg vom möglichst vollen, bombastischen Orchesterklang der romantischen Orgel, zurück zur stilreinen Disposition des Barock mit nur orgeleigenen Registern und baute Orgeln nach diesem Klangmuster, die auch die Jugendmusikbewegung als ihrem Ideal entsprechend ansah.[240]
Genauer betrachtet werden sollen im folgenden Blockflöte und Gitarre bzw. Laute, die damals neu entdeckt wurden und bis heute zu den verbreitetsten Laieninstrumenten gehören.
3.3.1 Blockflöte
Der Instrumentenbauer Peter Harlan hörte 1925 in England eine rekonstruierte Renaissance-Blockflöte und baute sie daraufhin in Deutschland nach, wobei er die vereinfachte und heute noch verbreitete ‚deutsche Griffweise’ entwickelte. Um 1929 hatte er ein befriedigendes Ergebnis erzielt, und die Jugendmusikbewegung erkor die Blockflöte bald darauf zum idealen Volksinstrument, das in der Musikschule für Atemschulung und Gehörbildung Verwendung fand sowie in Sing- und Spielkreisen beliebt war, und bald auch in den regulären Schulunterricht einzog.[241]
Die Flöte war leicht erlernbar und transportabel, ein lineares Instrument mit schlichtem, zurückhaltendem Klang, das kaum Möglichkeiten zu individuell-persönlichem Ausdruck bot, und aufgrund der Anblastechnik war sie auch als ‚singendes’ Instrument einzuordnen. Die Stimmen des Blockflötenensembles entsprachen den Vokalregistern, was eine zusätzliche Verbindung zum Gesang schuf. Zudem war sie - ein nicht zu unterschätzendes Moment in Anbetracht der schlechten wirtschaftlichen Lage - sehr günstig in der Anschaffung.
All diese Eigenschaften machten sie perfekt als Symbolinstrument für die Jugendmusikbewegung und als Waffe gegen die ‚Harmonikabewegung’, die 1927 durch eine große Werbekampagne der ‚Hohner AG’ gestartet wurde und die der Jugendmusikbewegung ein Dorn im Auge war. Die in der Bevölkerung äußerst beliebte Mundharmonika[242] galt dem Kreis um Jöde als mechanisches Instrument, da sie ein Industrieprodukt war, durch die Werbung deutlich als Ware ausgewiesen, außerdem ein Akkordinstrument, was dem melodischen Ideal der Jugendmusikbewegung widersprach.[243] Daher förderten die Vertreter der Jugendmusikbewegung die Verbreitung der Blockflöte, was um 1930 zu einem regelrechten ‚Blockflötenboom’ führte und den Status der Blockflöte als ideales Instrument für Gemeinschaftsmusik festigte:
„Der Blockflötenspieler kann sein Instrument nur zum Kern bringen, wenn er bereit ist, unter Zurückstellung seiner persönlichen Ausdruckswünsche dem Ton zu dienen. Indem er diesem Ton und Klang nachstrebt, verzichtet er auf Ausdruck seiner Empfindungen und überwindet sein Persönlichstes. Indem er dem Ton dient, dient er einem Objektiven. Und gerade durch diesen Willen zum Dienst am Objektiven schafft er auch die Grundlagen zu einer Gemeinschaft.“[244]
3.3.2 Laute und Gitarre - ein Streitfall
Eine herausgehobene Stellung nahmen damals auch die Instrumente Laute und Gitarre ein, um die es einen heftigen, sachlich allerdings fragwürdigen Streit gab. Da dieses Beispiel ein erhellendes Licht auf die ideologischen Probleme der Musikauffassung der Jugendmusikbewegung wirft, möchte ich es näher ausführen. Die Unterstützung des Lautenspiels ging nicht allein von Jöde aus, er war aber hier sehr aktiv und stark meinungsbildend für seinen Umkreis.
Parallel zur Jugendmusikbewegung entwickelte sich aus dem Gitarrenspiel der Wandervögel heraus eine künstlerisch ausgerichtete Gitarrenbewegung. Diese hatte wie die Jugendmusikbewegung die Pflege des Volksliedes in der Hausmusik zum Ziel, aber auch und vor allem die künstlerische Aufwertung der Gitarre und ihre Etablierung als Konzert- und Soloinstrument, was vor allem durch Wiederentdeckung und Verbreitung von Gitarrenmusik aus dem 19. Jahrhundert betrieben wurde. Entsprechende Zeitschriften waren ‚Der Gitarrefreund’ (München, gegründet 1900) und ‚Die Gitarre’ (Berlin, gegründet 1919). Aus heutiger Sicht könnte diese Bewegung durchaus der Jugendmusikbewegung zugerechnet werden, die an unterschiedlichen, einander oft kritisierenden Strömungen ja reich war. Damals aber empfanden sich die Bewegungen als gegensätzlichen Zielen nacheifernd und befehdeten sich heftig, wodurch viel Energie vertan wurde, die wahrscheinlich besser hätte eingesetzt werden können. Die Jugendmusikbewegung, in erster Linie Jöde und die Musikantengilde, übte scharfe Kritik sowohl an der Literatur der Gitarrenbewegung als auch an der Gitarre als Instrument, die quasi unter die mechanischen Instrumente eingeordnet wurde, wohingegen die Jugendmusikbewegung die Laute
„zu ihrem Symbolinstrument erkoren [hatte] welches sie mit all den idealistischen Vorstellungen, die sie von Musik, Geschichte und Gesellschaft besaßen, behafteten“[245].
Nicht umsonst hieß das Organ der Jugendmusikbewegung zu Beginn ‚Die Laute’, die für dieses und bald auch andere bevorzugte Instrumente bessere Literatur bereitstellen sollte. Im ersten Heft versuchte Richard Möller die Bedeutung der Laute für das moderne Musikleben wie folgt zu untermauern:
„In der eigentlichen Blütezeit der Laute, also im 15. und 16. Jahrhundert, spielte sich nun das ganze Leben ja auch entschieden mehr in häuslichem Kreise ab; man war nicht so aushäusig, nicht so vom Strudel öffentlicher Veranstaltungen mitgerissen wie heute. Daher war auch die Musik damals mehr diesen ganzen Verhältnissen angepaßt; d. h. man trieb mehr Haus- und Kammermusik. Hierin liegt nun auch wieder eine Anregung für uns, mehr Fühlung mit der Musik der damaligen Zeit zu suchen. Wir bemühen uns doch gerade heute besonders, durch Siedlungen u. a. das Haus- und Familienleben wieder zu vertiefen. Nichts kann dazu nun aber mehr beitragen als gerade die Musik, und zwar nur die Haus- und Kammermusik.“[246]
Dies hatte also mit der vermeintlichen Geschichte der Laute zu tun, nicht mit ihren musikalischen Qualitäten. Dabei scheint Möller nicht klar gewesen zu sein, daß eine mengenmäßig relevante Hausmusik erst im 19. Jahrhundert entstand, als dieselbe sich im Bürgertum auszubreiten begann, nicht zuletzt mit Hilfe der Gitarre. Die sogenannte Hausmusik der Renaissance- und Barockzeit hingegen beschränkte sich auf die Aristokratie und einen eher kleinen elitär-bürgerlichen Zirkel,[247] ist als Vorbild für die große musizierende Menschen-Gemeinschaft daher ungeeignet. Das wird in Bezug auf das idealisierte ‚polyphone Zeitalter’ des 15. und 16. Jahrhunderts aber verschwiegen.
Es ist dies nicht der einzige Irrtum, dem die Jugendmusikbewegung in Bezug auf die Laute unterlag, denn vollends fragwürdig wird ihre Gitarren-Ablehnung, wenn man die damaligen Instrumente näher betrachtet. Bis in die Anfangszeit der Jugendmusikbewegung um 1920 unterschied man Gitarre und Laute begrifflich meist gar nicht, nannte beides Laute oder Zupfgeige, und in der Tat waren die Instrumente einander sehr ähnlich. Bei der damals üblichen Laute handelte es sich keineswegs um die Renaissance-Laute, auf deren Geschichte man sich berief,[248] sondern eigentlich um eine Gitarre, deren bauchige Form lediglich der alten Laute nachempfunden war, mit sechs Saiten in Gitarren-Stimmung. Während die Gitarristen dies für einen ausreichenden Grund hielten, auch diese ‚moderne Laute’ als Gitarre zu bezeichnen, befanden die Lautenisten den Unterschied zwischen den Instrumenten als groß genug, um auf der Verbindung der modernen mit der Renaissance-Laute und damit auf der Höherwertigkeit ihres Instruments zu pochen. Die Begründungen ließen allerdings zu wünschen übrig:
„Möller gab als wesentliche Gründe für die Argumentation der Lautenisten an, daß die Stimmung und Saitenzahl der Lauteninstrumente (wie auch vieler anderer Instrumente der Alten Musik) ständig variierte. Er schloß daraus: ‚Aus diesen Tatsachen wird wohl jeder erkennen, daß die Stimmung und Saitenzahl nie grundlegend, bestimmend für ein Instrument sein kann und darf. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Form; auch diese hat große Wandlungen durchgemacht. [...] das Wesentliche bei der Einteilung und Unterscheidung der Instrumente [ist] der Klang - oder vielleicht besser gesagt - die Klangfarbe und die Spielmöglichkeiten.’“[249]
Dürftige Argumente, die der Laute die historische Legitimation eher entzogen bzw. diese recht beliebig erschienen ließen und ihr nur die Unterscheidung durch die klangliche Qualität ließen, denn die Spielmöglichkeiten waren auf der Gitarre dieselben.
Möller beschrieb den Klang der Laute als voller und runder im Gegensatz zum helleren der Gitarre, wodurch man darauf schließen könnte, die Gitarre habe einen kühleren, unemotionaleren Klang, was der Jugendmusikbewegung ja wünschenswert erschien. Dies war offenbar aber nicht seine Schlußfolgerung. Jöde wiederum empfand den Lautenklang als stiller und in sich gekehrter, wodurch er sich dem ‚Klangrausch’ und der ‚Klanggaukelei’ entzöge, die er den als mechanisch eingeordneten Instrumenten unterstellte.[250]
Zur Kritik am Instrument Gitarre kam die Ablehnung der von der Gitarrenbewegung bevorzugten Literatur, die in erster Linie aus dem ‚goldenen Zeitalter der Gitarre’, dem 19. Jahrhundert stammte. Hier griff einerseits wieder das Ideal der Polyphonie, das diese Musik nicht erfüllte, und als weitere Argumente wurden auch hier die historischen Ursprünge herangezogen, wonach im 19. Jahrhundert das abgelehnte bürgerliche Konzertwesen und der Virtuosenkult ihre Hochzeit hatten.[251] Übersehen wurde, daß gerade zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Gitarre auch ein beliebtes Haus- und Kammermusikinstrument war, was sich an der Menge der Ensemblenoten zeigt, die zu der Zeit verfügbar waren und die die Menge der solistischen Noten deutlich überstieg.[252]
Am Beispiel von Laute und Gitarre zeigt sich eine bedauerliche, ideologisch begründete, historisch und pseudo-musikalisch verbrämte Eingeschränktheit und Engstirnigkeit der Jugendmusikbewegung bzw. einiger ihrer Teile, Jöde eingeschlossen, die ihr insgesamt sicher geschadet hat und späterer Kritik günstige Angriffspunkte lieferte. Einige Kritikpunkte der Jugendmusikbewegung an der Gitarrenbewegung hinsichtlich deren unkritischer Wiederbelebung von Gitarrenliteratur des 19. Jahrhunderts mochten durchaus berechtigt sein, verloren aber durch den unsachlichen Rundumschlag gegen die Bewegung und ihr Instrument an Glaubwürdigkeit. Verwunderlich erscheint heute auch die Aggressivität, mit der Jöde und Mitstreiter ihre vermeintlichen Widersacher angriffen, wenn Jöde etwa von „der hier in der sogenannten ‚Gitarristik’ herrschenden heillosen Verwirrung“ [253] sprach, der man die Stirn bieten müsse.
Leider bekämpften sich hier nahe beieinanderliegende Strömungen, wie es so oft in derartigen Bewegungen oder politischen Gruppierungen geschieht, anstatt im Blick auf gemeinsame Ziele zusammenzuarbeiten. Nichtsdestotrotz gab es eine gegenseitige Beeinflussung der Jugendmusikbewegung und der Gitarrenbewegung, auch wenn dies den meisten nicht bewußt war.[254] Schmitz ist der Ansicht, daß es bewußten gemeinsamen Bemühungen beider Bewegungen hätte gelingen können, sowohl Laute als auch Gitarre als anerkannte Instrumente in der Musikwelt zu etablieren, hätte man sich nicht in erster Linie mit Grabenkämpfen beschäftigt.[255] Diese Chance wurde leider vertan.
3.4 Offenes Singen
Ab 1926 begann Jöde, ‚offene Singstunden’ abzuhalten, an denen jeder teilnehmen konnte. Hier ging es anfangs nicht um musikalische Weiterbildung oder hohe Ansprüche an die gesangliche Ausführung, sondern es wurden in einfachster Art vor allem Volkslieder gemeinsam gesungen. Die Anregung dazu ergab sich nach einem Elternabend der Volks- und Jugendmusikschule Charlottenburg in Berlin, auf dem Jöde mit Eltern und Kindern einige Volkslieder gesungen hatte. Hinterher trat eine Frau an ihn heran, um ihm ihre Freude über das gemeinsame Singen sowie den bedauerlichen Mangel an entsprechenden Gelegenheiten mitzuteilen. Jöde beeindruckte dies offenbar stark.[256] Er erkannte in den Bestrebungen zur stetigen künstlerischen Verbesserung des Laienmusizierens die Gefahr, große Teile der Bevölkerung wiederum aus der Musizierpraxis auszuschließen, weil sie den Anforderungen nicht genügten oder nicht regelmäßig die nötige Zeit erübrigen konnten.
Von 1926 bis 1934 hielt Jöde daher monatlich eine ‚offene Singstunde’ an der Jugendmusikschule in Charlottenburg ab,[257] in der gemeinsam Volkslieder oder einfache neue Lieder aus der Jugendmusikbewegung gesungen wurden. Zu neuen Liedern gab es erst kleine Einführungen, dann studierte Jöde sie meist ein- oder zweistimmig mit den Teilnehmern ein, durch Nachsingen und mit Hilfe seiner Handzeichen.[258] Ein ‚Ansingechor’ oder kleiner Spielkreis unterstützte dabei die Sänger.
Diese einfache Art des Singens aus einem inneren Bedürfnis heraus schien Jöde für das Leben fast wertvoller zu sein als die stärker künstlerisch orientierte Arbeit innerhalb der Chöre:
„Ist es [das Singen in Chören] nicht eher eine Unterhaltung gewesen, der sich hingeben konnte, wer über stimmliche Mittel und über Zeit verfügte [...]? Und gewiß ist es eine Unterhaltung, der man sich hingeben kann, auf die man aber auch verzichten kann. In den offenen Singstunden aber, in denen ich vielfach gerade Kreise erfaßte, die sonst nicht zum Singen kommen, denen aber das Herz voll war zu singen, habe ich gemerkt, was Singen überhaupt für den Menschen bedeuten kann, wie es ihn schön macht und ihm etwas gibt, was seiner ganzen Lebenshaltung zugute kommt.“[259]
Die Singstunden erfreuten sich schnell großer Beliebtheit - Zeitzeugen sprechen begeistert von Jödes mitreißender Anleitung[260] -, und das Konzept wurde bald von vielen anderen, vor allem Lehrern, aber auch sonst interessierten, übernommen. Jöde verbreitete es durch seine Lehrerfortbildungskurse über ganz Deutschland,[261] und auch in der Schweiz, in Dänemark, Schweden und Österreich, später auch im Banat und in Ungarn, gab es ähnliche Veranstaltungen.[262]
Die Singstunden fanden meist in Schulsälen oder ähnlichen Räumen statt, wurden aber bei passender Gelegenheit auch gern nach draußen in die Natur verlegt, z. B. in Verbindung mit Feierlichkeiten wie der Sonnenwendfeier, in der sich gleichzeitig die Verbindung zur Natur und zu den Jahreszeiten und damit zum Leben ausdrückte. Inhaltliche Grundlage der Stunden blieben Volkslieder, manchmal Tanzliedchen zur Betonung des körperlichen Aspekts und volkstümliche Lieder der Jugendmusikbewegung. Daneben bemühte man sich immer stärker darum, moderne Lieder und auch Instrumentalmusik einzubauen. Zu besonderen Anlässen entstanden ‚Liedkantaten’ mit Chor und Orchester bzw. Musizierkreis, bei denen die Zuhörer einige der Lieder mitsangen. 1928 bei der Reichsführerwoche in Baden-Lichtenthal, die zusammen mit Hindemith gestaltet wurde, wurde innerhalb einer offenen Singstunde dessen Kantate ‚Frau Musica’ in dieser Art aufgeführt. Auch die neue Musik sollte aktiv erlebt werden, wobei Besucher der Musikwoche natürlich von vornherein an neuen Entwicklungen der Musik interessiert waren. Aber man fand auch in den allgemein zugänglichen Singstunden Wege, neue Musik spielerisch einzubauen. So wurde bei einer Singstunde in der Schule Charlottenburg gemeinsam das Volkslied ‚Alleweil ein wenig lustig’ gesungen, worauf Variationen über dasselbe Lied für Streichquartett von Ernst Lothar von Knorr folgten. Danach sang man es erneut. Diese Art der Heranführung an ein modernes Musikwerk schien erfolgreich zu sein und den Teilnehmern Freude zu bereiten, die Spaß hatten am spontanen Wiedererkennen ihres Liedes in den Variationen und den Humor der Komposition empfanden, ohne sich belehrt zu fühlen.[263] Ähnlich verfuhr man auch mit alter Musik, indem der Chor alte Sätze zu den von allen Teilnehmern gesungenen Liedern hinzufügte, z. B. bei Weihnachtsfeierlichkeiten den Praetorius-Satz zu ‚Es ist ein Ros entsprungen.’[264]
In der Regel waren die Singstunden frei zugänglich - umsonst oder mit einem geringen Eintrittsgeld verbunden, wofür meist Liedblätter ausgegeben wurden -, es gab aber auch Stunden für geschlossene Organisationen wie Arbeiterverbände oder Jugendgruppen, und in Kirchen fanden hin und wieder ‚offene Choralsingstunden’ statt.[265] Es stellte sich allerdings heraus, daß die untersten Schichten wenig in die Singstunden kamen und nicht ohne weiteres erreichbar waren, selbst wenn man den Veranstaltungsort in entsprechende Stadtviertel legte. Gerade dies lag aber besonders im Interesse der Jugendmusikbewegung, die ja eine Volksgemeinschaft auf Grundlage der Musik anstrebte.
Exemplarisch für entsprechende Bemühungen seien hier Aktivitäten der Kasseler Volksmusikschule ‚Lied und Volk’ genannt, die sich besonders um das großstädtische Proletariat und die Arbeitslosen bemühte, indem sie ihre Singstunden in die Arbeit entsprechender staatlicher Stellen einbaute.[266] So wurden etwa Singstunden in einem Mädchentagesheim abgehalten, in dem 60 bis 70 arbeitslose Mädchen beschäftigt waren, oder in einer Männergruppe des freiwilligen Arbeitsdienstes. Hier ging es allerdings kaum um das Heranführen an höherwertige Musik, vielmehr mußte man „nach Wunsch und Lust singen [...] lassen, um erst Freude am Singen zu erwecken und die inneren Widerstände zu beseitigen.“ [267]
Neben den kleineren Singstunden, zu denen allerdings auch schon bis zu 100 Menschen kamen, fanden von Zeit zu Zeit große volksfestartige Singtreffen mit bis zu mehreren tausend Teilnehmern statt, wie das jährliche Singtreffen der Berliner Jugend auf der Freilichtbühne im Volkspark Jungfernheide oder das vierteljährliche Singtreffen auf dem Ludwigstein bei Kassel. Zu diesen Treffen erschien ein sehr gemischtes Publikum, wobei Anhänger der Jugendbewegung und Jugendmusikbewegung überwogen, denen diese Feste unter anderem zur Selbstvergewisserung gedient haben dürften. Hier stand das Gemeinschaftserlebnis ganz im Vordergrund; die Lieder waren meist sehr einfacher Art.
1931 beschrieb Jöde beide Richtungen der jugendmusikalischen Arbeit - die mehr künstlerisch ausgerichtete und die volksverbundene in Form der Singstunden - als einander ganzheitlich ergänzende Teile der Bewegung.[268] Es handelte sich für ihn nicht um einander bekämpfende Anschauungsweisen oder um einen ‚Rückfall’ in die vereinfachte Gemeinschaftsmusik. Die Laienmusik sollte durchaus weiterentwickelt werden, aber jedem Menschen sollte die Möglichkeit zum Musizieren innerhalb seiner Möglichkeiten gegeben werden. Dabei blieb auch für die künstlerische Weiterentwicklung der Musik der Gemeinschaftsgedanke grundlegend:
„die Bewegung [hätte] langsam zu einer mehr fachlichen und die Gesamtheit des deutschen Volkes nicht mehr berührenden Angelegenheit werden können, wenn nicht ihr sozialer Grundzug als die eigentlich ausschlaggebende Prägung [Hervorhebung d. Verf.] aller ihrer Inhalte ihr letzten Endes den Charakter einer das Volk im ganzen erfassenden Bewegung gegeben hätte. [...] So ist möglicherweise das Erfreulichste dieses neu erwachten Volksgesanges, daß er in der einfachsten und problem- und kampflosesten Weise Menschen der verschiedensten Lebensalter, Konfessionen, Berufe, Bildungsgrade und wirtschaftlichen sowie politischen Haltungen zu Begegnungen führt.“[269]
Jöde sah daher die Aufgabe der Jugendmusikbewegung als zumindest teilweise erreicht an. Er war überzeugt davon, „daß die Verbindung [der Jugendmusikbewegung] mit allen denen, die nicht im besonderen Sinne musikalisch interessiert sind - d. h. mit der Gesamtheit unseres Volkes -, nach und nach zu einer immer festeren und heute auf keine Weise mehr zu lösenden geworden ist.“[270]
Daß die Ideen der Jugendmusikbewegung wirklich tief ins Bewußtsein der breiten Bevölkerung eingedrungen waren, ist fraglich, nicht zuletzt weil entsprechende Entwicklungen sich gewöhnlich nicht innerhalb einer Generation vollziehen. Die offenen Singstunden waren zwar sehr beliebt und gut besucht, aber es ist anzunehmen, daß die Teilnehmer etwa in Bezug auf die Liedauswahl keineswegs so kritisch gewesen wären wie die jugendmusikalischen Veranstalter es waren. Der theoretische Unterbau war für den Erfolg wahrscheinlich weniger ausschlaggebend, und wie weit die neuere Musik wirklich in den Alltag der Menschen eindrang, ist sehr ungewiß. Ein Verdienst Jödes und der Jugendmusikbewegung war es aber sicher, unter anderem durch die offenen Singstunden das Singen wieder stärker in den Alltag vieler Menschen zu bringen.
3.5 Neue Musik-Literatur
Jöde bemühte sich schon sehr früh darum, seine Ideen durch das Schreiben von Artikeln und Aufsätzen zu verbreiten. Sein wahrscheinlich erster veröffentlichter Artikel ‚Anderes vom Gesangunterricht auf der Unterstufe’ erschien bereits 1906 - Jöde war damals ein erst 19jähriger seminaristisch ausgebildeter Volksschullehrer - , und diesem folgten bis zum Ende seines Lebens unzählige weitere. Von Jödes ‚Verkündigungsfreudigkeit’ war bereits anfangs die Rede, und viele seiner Schriften sind heute nicht mehr von Interesse. Sehr wohl von Interesse ist aber nach wie vor sein Beitrag zu neuer Musikliteratur, was das Wiederentdecken alter Musik und auch das Fördern und Verbreiten neuer Komponisten anging.
Wichtig war dabei der Zwissler-, später Kallmeyer-Verlag in Wolfenbüttel, dessen Teilhaber Georg Kallmeyer ursprünglich der Jugendbewegung nahestand und die Bücher des Wandervogels sowie dessen Bundesblatt herausgab.[271] 1916 wurde er Alleininhaber des Verlags, der 1925 in Kallmeyer umbenannt wurde. Ab 1917 gab er ‚Die Laute’ heraus, die 1918 von Jöde übernommen wurde. Georg Kallmeyer gehörte später zur Führungsriege der Musikantengilde und gab deren Liedersammlungen, Heftreihen und auch die meisten Zeitschriften heraus.[272]
Mit seiner immensen Herausgebertätigkeit wollte Jöde dazu beitragen, gute Instrumental- und noch stärker Vokalliteratur für die neue Laien- und Hausmusik bereitzustellen. Vieles davon gehört heute zum Standard-Programm für Chormusik.[273] Daneben veröffentlichte er auch Methoden- und Liederbücher für die Schule,[274] wobei er immer betonte, daß alle demselben Zweck dienten, nämlich der Erneuerung des gesamten Musiklebens. Die Schulmusik sollte dabei lediglich Mittel zum Zweck sein, denn „Es ist klar, daß unsere Musikarbeit erst dann zur rechten Entfaltung kommen kann, wenn ihr von der Schulmusik her ein Boden bereitet worden ist.“[275]
Im folgenden soll erst die Entwicklung der Musik-, in erster Linie der Chorliteratur in der Jugendmusikbewegung kurz beleuchtet werden. Danach gehe ich näher auf einige der Werke ein.
3.5.1 Die Wiederentdeckung alter Musik
Nicht zu unterschätzen ist der Einfluß Jödes und der Jugendmusikbewegung auf die Wiederbelebung alter Musik und ihre Herausgabe in neuen Editionen.[276] Das Interesse am alten Lied, das mit Breuers ‚Zupfgeigenhansl’ geweckt wurde, erstreckte sich bald auch auf den Chorgesang. Vorher war der vierstimmig akkordisch-homophon angelegte Chorsatz, im Vereinswesen besonders für Männerchor, vorherrschend. Oft war dieser wie bereits beschrieben chromatisch überladen, was als unklar und zu gefühlvoll empfunden wurde. Die Literatur stammte in erster Linie aus dem 19. Jahrhundert und die wenigen älteren Stücke waren in gleicher romantischer Manier gesetzt.[277] In der Ablehnung dieser Literatur waren sich die Vertreter der Jugendbewegung einig. So schrieb Hensel 1923:
„Unausstehliche chromatische Gänge (die im echten Volkslied unmöglich sind), weichliche Septimen- und Nonenakkorde, womöglich alteriert (Gefühl!), fast durchweg eine Stimmführung mit wesenlosen Begleitstimmen [...] Wenn sich hier und da ein [...] Lied aus dem 16. Jahrhundert in einen ‚Liederkranz’ verirrte, so mußte es sich eine süßliche, neuzeitliche Harmonisierung gefallen lassen.“[278]
Viele Choristen begannen, sich voller Entdeckerfreude mit der Musik des 15. bis 17. Jahrhunderts zu beschäftigen. Im Gegensatz zu den rein musikwissenschaftlichen Denkmäler-Ausgaben des 19. Jahrhunderts - auf die man als Grundlagen allerdings zurückgreifen konnte -, waren jetzt singbare Ausgaben für die Chorpraxis gefordert. Dieser Aufgabe nahmen sich vor allem Studenten der Musikwissenschaft an, die zur Jugendmusikbewegung gehörten. Die Forschung und das theoretische Durchdringen der Musik gingen dabei in den Chören oft Hand in Hand mit der praktischen Erprobung und befruchteten sich gegenseitig, so daß man hier wirklich von einer ganzheitlichen Zusammenarbeit und der Umsetzung der von Jöde geforderten Mitverantwortung der Laien für Musik sprechen kann.[279] Auch auf den Musikwochen der Musikantengilde wurde wiederholt über das Thema der Notation alter Lieder referiert und praktisch gearbeitet.
Es traten Probleme mit der Übertragung in moderne Notation auf, beispielsweise da sich die Akzentmelodik nicht in das starre Korsett des üblichen Taktschemas pressen ließ, ohne etwas von ihrer Lebendigkeit einzubüßen. Gerade die möglichst authentische Wiedergabe der Lieder war den Bearbeitenden aber besonders wichtig, ‚Werktreue’ wurde zum Ideal im Gegensatz zum herkömmlichen Umgang mit alter Musik, bei dem man sich oft bemüht hatte, diese den modernen Klangvorstellungen anzupassen.[280]
In einer Ausgabe des 23. Psalms von Schütz hieß es:
„Jede Bearbeitung, die in der Richtung auf eine Verminderung des Gehalts um äußerer Behinderung willen hinzielt, ist grundsätzlich abzulehnen.“[281]
So setzte sich der heute noch übliche Mensurstrich zwischen den Zeilen durch, dessen größere Freiheit teilweise auch für neue Kompositionen benutzt wurde (und noch wird).
Jöde lehnte außerdem die in älteren Liederbüchern sehr großzügig verteilten Vortragszeichen ab. Das Verständnis für ein Lied sollte ohne äußere Hilfsmittel oder Vorschriften aus ihm selbst heraus beim Singen oder Musizieren entstehen. Er forderte daher, „daß z. B. ein auftretendes Crescendo oder Decrescendo sich ausschließlich aus der Architektonik des ganzen Baus zu ergeben hat, niemals aber subjektive Hinzufügung aus einer dichterischen Erwägung sein darf.“[282]
Dies bedeutete für die Sänger eine größere Gestaltungsfreiheit, aber auch die Notwendigkeit aktiverer Mitarbeit und einer größeren Aufmerksamkeit für die Musik, wobei die Idee, daß sich aus ihr heraus eine einzig richtige Art des Vortrags ergibt, d. h. daß es für ein Musikstück quasi eine objektiv richtige Interpretationsweise gibt, sicher zu eingeschränkt ist.
Intensivere Arbeit erforderten auch Chorsätze, in denen lediglich die erste Strophe eines Liedes direkt im Notenbild stand, alle weiteren aber so weit entfernt, daß man genötigt war, entweder Stimme oder Text auswendig zu lernen.[283]
Die alte Praxis der offenen Musizierformen wurde begeistert wiederaufgenommen, da sie den eigenen Vorstellungen einerseits des Vorranges der Musik und andererseits der Praktikabilität des Zusammenspiels in verschiedenen Besetzungen entsprach. Zusätzlich ging man auch zu offenen Satzanlagen über, in denen Begleitungsvorschläge angedeutet waren, die aber viel Raum für Improvisation und eigene Ausgestaltung ließen bzw. diese verlangten.
3.5.2 Neue Kompositionen
Die Beschäftigung mit alter Chorliteratur führte in der Musikantengilde bald auch zu Versuchen, nach alten Vorbildern neue Liedsätze zu schreiben.[284] Mit der Zeit kristallisierten sich dabei neue Kriterien heraus. Durch die neue Vorherrschaft der Melodie und der Linearität aller Stimmen trat in der Jugendmusikbewegung das nur vertikal harmonisierende Element in den Hintergrund. Das Ideal war auch in den neuen Liedern die polyphone Stimmführung. Die Begleitstimmen übernahmen nach Möglichkeit selbständig verarbeitend den melodisch-thematischen Gehalt der Melodie.[285]
Für Jöde begann der mehrstimmige Gesang, sowohl geschichtlich als auch für die Chorarbeit geltend, mit der volksmäßig improvisierten Mehrstimmigkeit, häufig mit begleitenden Terzen oder Sexten,[286] bei der die Begleitstimmen durchaus als selbständige Stimmen empfunden werden können, da sie ja auch als linear logische Stimme in der Improvisation entwickelt und nicht im Satz nach Vorgaben von Harmonien quasi berechnet werden. Von hier aus ging er über zur kunstmäßigen Zweistimmigkeit. Er schrieb zweistimmige Sätze zu Liedern des 16. und 17. Jahrhunderts, die er erst in der Laute und 1922 in seinem ‚Altdeutschen Liederbuch in polyphonem Satz zu zwei Stimmen’ herausgab, wobei die Vokalstimmen auch durch Instrumentalstimmen ersetzt werden konnten.
Zwei- oder Dreistimmigkeit war vorher lediglich eine Notlösung gewesen, etwa für Schule oder Kirche, wenn nicht genügend gute Sänger zur Hand waren. Es bedeutete in der Regel, daß man eine oder zwei harmonisch vorgesehene Stimmen aus einem vierstimmigen Satz wegließ, was natürlich unvollständig und ‚dünn’ klang. In der folgenden Entwicklung emanzipierte sich der eigenständige zwei- und dreistimmige Satz, da er den einzelnen Stimmen größere melodische Entfaltungsmöglichkeiten bot. Die Lieder sollten „in ihrem zweistimmigen Satz über die bekannte Bedientenrolle der Begleitung hinaus zu einer freien Zwiesprache selbständiger und sinnvoller Stimmen führen.“[287]
Die vorher als Mangel angesehene Durchsichtigkeit und Klarheit der Sätze wurde jetzt positiv gewertet, da man dadurch den Lauf der einzelnen Stimmen verfolgen konnte, die zwar selbständig, dabei aber eng melodisch verknüpft sein sollten. Viele von Jödes zweistimmigen Sätzen sind in Durchimitationen angelegt, manche folgen einer fast kanonischen Stimmführung. Die Selbständigkeit der Stimmen führte bei dem Lied ‚Aus meines Herzens Grunde’ soweit, daß Jöde die zweite Stimme in einer anderen Taktart schrieb. Er setzte einen 6/4- gegen einen 4/4-Takt.[288] Dieses Element der Satztechnik findet sich von Zeit zu Zeit bei ihm wieder, auch in der Bearbeitung von Volks- und Kinderliedern. Die anfänglichen Sätze Jödes und anderer Komponisten seines Kreises enthielten oft noch Dissonanzen und Parallelführungen, die „auf eine [...] Unbekümmertheit den Regeln einer strengen Stimmführung gegenüber hindeuten.“ [289] Die Selbständigkeit der Stimmen und ihre innere lineare Stimmigkeit wurde höher gewertet, und es fehlten oft auch noch die nötigen musikalischen Kenntnisse.
Im Laufe der Zeit entwickelte sich aber eine kompetente neue Komponistengeneration innerhalb der Musikantengilde. Jödes eigene Kompositionen gehörten dabei nicht zu den herausragenden Arbeiten, der Einfluß seiner Ideen war aber nicht unbeträchtlich. Herausragende Namen der zwanziger Jahre waren beispielsweise Walter Rein, Armin Knab, Paul Kikstat u.a., deren Lieder und Sätze man in der heutigen Chorliteratur noch findet. Allerdings empfand man sich im Sinne der Gemeinschaftsideologie eher als zusammengehörige Gruppe, in deren Rahmen die Werke geschaffen wurden.
Im Verlauf der Entwicklung trat die funktionsharmonisch orientierte Satzweise immer stärker zurück. Man löste sich aus der Funktionsharmonik, erst indem man sich den Kirchentonarten zuwandte, später durch eine immer freiere, linear entwickelte Melodik.[290] Der Eigenwert des einzelnen Intervalls wurde betont im Gegensatz zu seiner Eingebundenheit innerhalb einer Tonart. Im Zusammenklang erhielten Quarte und Quinte Vorrang vor der harmonisch eindeutigeren Terz und Sext, was zu einer stärkeren harmonischen Ungebundenheit führte. Man strebte einer eigengesetzlichen Melodik zu, in der sich die einzelnen Stimmen einzig aus dem melodischen Gehalt der ersten Stimme bzw. der Liedweise entwickelten, oft in kanonisch-imitatorischer Stimmführung.
Zu einer weitestgehend freien Melodik ohne harmonische Tonraumbindung kam es schließlich Mitte der zwanziger Jahre bei Hindemiths Sätzen für die Jugendmusikbewegung.[291] Hindemith ging nur äußerst selten von einer bestehenden Liedmelodie aus, sondern entwickelte alle Stimmen parallel, so daß eine Hauptstimme nicht mehr nachzuvollziehen war und Lied und Satz zu einer vollkommenen Einheit verschmolzen. Auch polyrhythmische Strukturen setzte er verstärkt ein. Obwohl Hindemith selbst nach einiger Zeit wieder Abstand von der Jugendmusikbewegung nahm, regte er weitere Komponisten zur Zusammenarbeit mit ihr an, und auch außerhalb ihrer Reihen gab es ähnliche Bestrebungen. Höhepunkt und Abschluß dieser Entwicklung kann man in den Kompositionen Hugo Distlers ab den dreißiger Jahre sehen,[292] der nicht zur Musikantengilde gehörte, ihr in musikalischer Hinsicht aber nahestand. Er beherrschte das „Spielen mit melodisch und rhythmisch freischwingenden Melodielinien“ [293] perfekt und schuf Liedsätze großer Klarheit und Lebendigkeit , wobei er meist stark vom Text ausgehend die Stimmen gestaltete.
Wenn die Jugendmusikbewegung auch die umstürzenden Neuerungen der Kunstmusik jener Zeit wie etwa Schönbergs atonale Kompositionen u.a. nicht mitvollzog, so gab es doch - zumindest in ihrem aufgeschlosseneren Teil - eine interessante künstlerische Weiterentwicklung.
3.5.3 Liederbücher und Heftreihen
Jöde gab insgesamt etwa sechzig Liedsammlungen und zehn Liederbücher mit eigenen Kompositionen heraus.[294] Er bemühte sich dabei um große ‚Lebensverbundenheit.’ Musik sollte (wieder) im Alltag der Menschen fest verankert werden, weshalb er Lieder in thematische Gruppen nach Tages-, Jahres und Lebenskreises ordnete, aus denen man zu bestimmten Anlässen und Festlichkeiten auswählen konnte.[295] Lebensverbunden waren auch die Kinder-Spiellieder und Ringelreihen, die er mit den dazugehörigen Spielanleitungen versah wie in seinem ersten Liederheft ‚Ringel, Rangel, Rosen. Spiel- und Ansingelieder für Haus, Kindergarten und Schule’, das 1913 erschien. Hier ging er bereits auf den kindlichen Umgang mit Musik und ihr Bewegungsbedürfnis ein, was - besonders in der damaligen Schule - nicht üblich war.
Zentral blieb das Volkslied, und Jöde sammelte unter anderem viele regionale Dialektlieder, um sie zu erhalten oder wieder in Umlauf zu bringen. Daneben gab es aber immer wieder zeitgenössische Musik, meist aus den Reihen der Jugendmusikbewegung oder ihr nahestehender Komponisten. Auf einige wichtige Bücher und Sammlungen soll im Folgenden etwas näher eingegangen werden.
Hausmusik
1918 bereits mit dem Aufruf zur Bildung der Gilden, kündigte Jöde die Heftreihe ‚Hausmusik’ an, die für die Zwecke der Laiengruppen besonders geeignete Musik bereitstellen sollte, wobei Jöde einmal mehr den Qualitätsaspekt betonte:
„Was in diese Reihe aufgenommen wird, soll der schärfsten Kritik gegenüber standhalten können und zu seinem Teile dazu beitragen, das Niveau der gesamten Jugendmusik zu heben.“[296]
Ab 1919 kamen insgesamt 22 Hefte heraus, die sehr gemischt alte und neue Musik brachten, die für den laienmusikalischen Gebrauch ausgesucht oder entsprechend bearbeitet war. Darunter waren Instrumentalsätze von Mozart, von Jöde für Geige und Gitarre bearbeitet, diverse Lieder zur Laute, Musik für kleine Streicherensemble und Ähnliches. Innerhalb dieser Reihe kamen auch die ‚Alten Madrigale’ heraus, die später als Extra-Heft noch einmal gesammelt erschienen.
Der Musikant
Äußerst erfolgreich war Jödes Schulliederbuch ‚Der Musikant. Lieder für die Schule’, das zuerst in Einzelheften von 1922 bis 1924, danach auch als Gesamtausgabe erschien. Es erreichte eine ähnliche Auflage wie der ‚Zupfgeigenhansl’, wurde sogar vom Kultusminister des Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung empfohlen und setzte sich weitgehend für den Schulunterricht durch.[297] Binnen kurzer Zeit war es über das gesamte deutsche Sprachgebiet verteilt.
Jöde legte darin sein Unterrichtskonzept bzw. sein Konzept des Herangehens an Musik, das ja nicht nur für die Schule galt, anhand von Musikliteratur dar. Die Reihenfolge der Stücke entsprach seinem Weg „vom einstimmigen Liede [...] über den melodisch-linearen zweistimmigen Satz bis zu größer angelegten polyphonen Satzgebilden.“ [298] Sechs Hefte, je zwei für Unter-, Mittel- und Oberstufe, führten vom Kinderlied mit Spielanleitungen über teils polyphon gesetzte Volks- und Kunstlieder verschiedener Schwierigkeitsgrade zu Liedern alter Meister wie Praetorius, Schütz, Händel, Mozart, Beethoven sowie neuer Komponisten und endeten bei Gesängen Bachs, womit für Jöde der Gipfel der Musik erreicht war. Auch instrumentale Begleitsätze waren enthalten, um die Pflege des bisher vernachlässigten Instrumentalspiels einzubeziehen.
Ekkehart Pfannenstiel, Mitarbeiter Jödes in der Musikantengilde, brachte 1929 ergänzend die ‚Lehrweise des Musikanten. Eine kleine Musiklehre für die Schule’ heraus, die den Gebrauch des Buches im Unterricht unterstützen sollte.
Der Kanon
Eine sehr interessante und heute noch ergiebige Sammlung ist auch ‚Der Kanon’, deren erstes Heft Jöde 1925 herausgab. Heft zwei und drei folgten 1926. Bereits 1913 hatte er eine kleine Kanon-Sammlung ‚Für Schule und Haus’ geplant und zusammengestellt, konnte diese aus verschiedenen Gründen aber nicht veröffentlichen. Im Laufe der Jahre trug er eine größere Sammlung zusammen, aus der er schließlich über 400 Kanons auswählte und in der Art „eine[r] kleine[n] Musikgeschichte unseres Volkes, dargestellt an seinen Kanons“ [299] herausgab. Damit wollte Jöde geschichtlich bedeutsame, vor allem aber auch lebendige und erlebbare Musik in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden anbieten.
Das Kanonsingen nahm in der Vokalmusikpraxis der Jugendmusikbewegung einen wichtigen Platz ein, da es eine Vereinigung der jugendmusikalisch präferierten Formen der Einstimmigkeit und der Polyphonie bzw. eine sehr strikte Form der Polyphonie darstellte. Ein Kanon war außerdem für einen Chor oder eine Gesangsgruppe relativ schnell umzusetzen, da - von komplizierteren Formen abgesehen - nur eine Stimme einstudiert werden mußte. Daher bot er sich an als Einstieg in alte und auch neue Musik.
Jöde schuf zudem viele neue Textunterlegungen, übertrug fremdsprachige Texte ins Deutsche, um die Lieder leichter zugänglich und sangbarer zu machen.[300] In einer späteren Ausgabe schrieb er über die Kanon-Sammlung:
„sie durfte [...] mithelfen, bei dem Verlangen nach einer neuen Polyphonie in der Musik einem neuen Kanonsingen den Weg zu bereiten, ja, sie durfte in vielen den Sinn für die polyphone Mehrstimmigkeit überhaupt erst wecken. Es ist ihr vergönnt gewesen, zu ihrem Teile mit beizutragen am Wandel unserer Musikpflege.“[301]
Der erste Teil ‚Von der Gotik bis zum Hochbarock’ beginnt mit dem ältesten schriftlich überlieferten Kanon aus dem 13. Jahrhundert[302] Es folgen weltliche Kanons des 13. und 14. Jahrhunderts, z. B. von Oswald von Wolkenstein; den größten Teil machen geistliche Kanons von Meistern des 16. und 17. Jahrhunderts aus, zumeist größeren Chorwerken oder theoretischen Abhandlungen entnommen. Der zweite Band ‚Vom Spätbarock bis zur Klassik’ zeigt die Abkehr des Kanons von der großen öffentlichen, meist geistlichen Form hin zum oft scherzhaften Lied im vertrauten Kreis mit vielen Beispielen von Haydn, Mozart und Beethoven. Der letzte Teil ‚Von der Romantik bis zur Gegenwart.’ bringt auch Beispiele des verpönten 19. Jahrhunderts, meist einfache Stufenkanons, allerdings mit dem Hinweis, daß diese am ehesten für den Schulunterricht der Mittel- und Unterstufe geeignet seien, da sie lediglich „den Kindern so manche kleine Kanonweise [bringen], an der sie sich erfreuen und durch die sie in die Kunst des Kanonsingens hineinwachsen mögen.“[303]
Die neueren Kanon-Kompositionen, mit denen die Sammlung schließt und die zum großen Teil von Mitgliedern der Jugendmusikbewegung stammen, sind für Jöde bereits in dem Entwicklungsstand, „aufs neue Brücken zu schlagen zu der Kanonkunst unserer älteren Meister, und wie sie bereits in ihren weltlichen, vor allem aber in ihren geistlichen Kanons auf dem Wege zum Adel einer melodischen Linie.“[304]
Die umfassende Sammlung sollte helfen, den Kanon wieder in die lebendige Gesangskultur zu bringen und ihn von dem Ruf zu befreien, „ein Sondergebiet artistischer Konstruktionsfreudigkeit außerhalb des eigentlich künstlerischen Bereiches der Musik“ [305] zu sein, den er durch seine Behandlung im 19. Jahrhundert erlangt hatte, als er außerhalb der Kunstmusik „nur noch in kleinstem Format in der Schule gepflegt wurde.“ [306] Zum Teil ist dies sicher gelungen. Der Kanon wurde wieder zu einer beliebten und vielgesungenen Form. Die neuen, oft polyphonen und an den Kirchentonarten orientierten Kanons der Jugendmusikbewegung setzten sich auf Dauer allerdings nur recht spärlich durch, wenn überhaupt, dann eher in der Chorliteratur, da sie für absolute Laien in der Regel zu anspruchsvoll waren. Die Klassiker, die auch heute noch in der breiten Bevölkerung bekannt sind, sind interessanterweise größtenteils die verschmähten aus der Romantik.[307] Dennoch hat Jöde auch auf dem Gebiet des Kanons viel dazu beigetragen, daß alte Musik wieder allgemein zugänglich war und gesungen wurde.
Das Neue Werk
Im Zusammenhang mit der Arbeit mit Hindemith gab Jöde 1927 mit diesem und Hans Mersmann zusammen ‚Das Neue Werk’ heraus, in dem Hindemiths Lieder und Spielmusiken enthalten waren, die er für die Jugendmusikbewegung geschrieben hatte und die größtenteils auf den Hochschulmusikwochen der Musikantengilde musiziert worden waren. Dazu kam neu eine systematisch aufgebaute ‚Schule für instrumentales Zusammenspiel’ von Hindemith sowie von Ludwig Weber ‚Hymnen zu gemeinschaftlichem Singen und Spielen.’ Mit dieser Sammlung sollten die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit allgemein zugänglich gemacht werden.
Die Singstunde
Aus den offenen Singstunden erwuchs die Heftreihe ‚Die Singstunde’, die ab 1928 monatlich erschien. Die insgesamt 36 jeweils vierseitigen Blätter waren einerseits zur Benutzung während der Singstunden gedacht, konnten dann aber mit nach Hause genommen und nach Möglichkeit weiter benutzt werden. Es handelte sich daher um relativ einfache, einstimmige Lieder, vor allem Volkslieder und solche aus der Jugendmusikbewegung, oft mit Satzanlagen und einer Bezifferung bzw. Akkorden versehen.[308] Auch diese waren thematisch geordnet, es gab beispielsweise ‚Das Morgenlied’, ‚Jagdlieder’, ‚Das gesellige Lied’, ‚Adventslieder’ und viele mehr.
Der Spielmann
Ergänzend zum ‚Musikanten’ erschien 1930 ‚Der Spielmann’ mit Instrumentalmusik für Schule und Haus. Auch hier ging es von einfachen Instrumentalformen bis zu anspruchsvolleren Werken der Gegenwart. Vier Hefte boten ‚Kleinste Musik für den Alltag’, ‚Grundformen der Spielmusik’, ‚Musik der Vergangenheit in historischer Folge’ und ‚Angewandte Musikformen der Gegenwart.’ Wichtig waren auch hier offene Besetzungsformen, die die Stücke oder Satzanlagen vielfältig nutzbar machten.
3.5.4 Zeitschriften
Zeitschriften waren wichtiger und auch konstituierender Bestandteil der Jugendmusikbewegung. Über Reichenbachs Aufruf in der ‚Laute’ entstand erst die Organisation der Musikantengilde, was dazu führte, daß der Leserkreis immer etwas ‚Gemeindeartiges’ hatte,[309] auch wenn die Jugendmusikbewegung eigentlich alle Menschen ansprechen wollte.
Die Laute
‚Die Laute. Monatsschrift zur Pflege des deutschen Liedes und guter Hausmusik’ wurde 1917 gegründet von Richard Möller, einem Mitglied der Jugendbewegung, der mit dieser Zeitschrift für ein stärkeres Verständnis der historischen Zusammenhänge des Lautenspiels sorgen und auch andere alte Instrumente wieder für die Hausmusik nutzbar machen wollte. Ab 1918 (nach Möllers Tod) wurde die ‚Laute’ von Fritz Jöde weitergeführt, der sie mit Notenbeilagen versah, um bessere Musikliteratur nach den Kriterien der Jugendmusikbewegung allgemein zugänglich zu machen und auch deren musik- und gesellschaftsphilosophischen Ideen einem größeren Publikum genauer zu entwickeln. In diesem Jahr erfolgte auch der die Musikantengilde konstituierende Aufruf Reichenbachs, deren Organ die Laute damit wurde.
Die Musikantengilde
1922 wurde die ‚Laute’ entsprechend umbenannt in ‚Die Musikantengilde. Blätter der Erneuerung aus dem Geist der Jugend.’ Dazu kamen die Beiblätter ‚Musik in der Schule’ und ‚Musik im Anfang’, was den umfassenden Aspekt der Bewegung betonte, die ja längst weit über die alte Lautenmusik hinausging. Das Konzept blieb, die musiktheoretischen, und -philosophischen Gedanken der Jugendmusikbewegung zu verbreiten und gleichzeitig Musiziermaterial bereitzustellen, da der Fokus immer auf dem praktischen Tun lag. Daneben wurde über Aktivitäten der Musikantengilde berichtet.
‚Musik im Anfang’ wurde 1927 zum eigenständigen Blatt ‚Der Kreis’, der das ‚wahre Volkslied’ behandelte sowie alte Werke und zeitgenössische Musik. Dazu kamen musikpädagogische und -wissenschaftliche Beiträge.
Musik und Gesellschaft
1930 wurde die ‚Musikantengilde’ als Organ der Organisation von der Zeitschrift ‚Musik und Gesellschaft. Arbeitsblätter für soziale Musikpflege und Musikpolitik’ abgelöst, herausgegeben von Jöde und Hans Boettcher, dem Leiter der Volksmusikschule Berlin-Neukölln, der auch der Schriftleiter war. Obwohl von ihr nur ein einziger Jahrgang erschien, lohnt sich hier ein genauerer Blick, da die Probleme um diese Zeitschrift Licht auf den Versuch der Jugendmusikbewegung werfen, sich aus ihrer ideologischen Isolierung zu befreien. Im neuen Namen zeigte sich der Versuch einer Ausweitung des selbstgesteckten Arbeitsgebietes von der Musikantengilde als abgegrenzter Organisation auf die ganze Gesellschaft.
Für Jöde lag die allgemeingültige Bedeutung der Jugendmusik darin, „Gestalt gewordene Frage nach dem Sinn unseres Musiklebens“ [310] zu sein. Diese Einstellung ließ ein vereinsmäßig abgeschlossenes Arbeiten, ein ‚Schmoren im eigenen Saft’ prinzipiell nicht zu, und er war - zumindest theoretisch - daran interessiert, mit seinen Ideen größere Kreise zu erreichen bzw. sich mit diesen auseinanderzusetzen. In der Praxis führte dies aber bald zu Problemen.
Jöde schrieb im ersten Heft einen einleitenden Artikel, der in jödescher Manier vage die Daseinsberechtigung der neuen Zeitschrift oder eigentlich nur „den Anlaß zur Aufrichtung der Frage nach Musik und Gesellschaft“ darlegen sollte. Dieser lag demnach einerseits darin, daß Jugendmusik als Begriff überhaupt nötig sei, denn „Wenn in einer Zeit alles in Ordnung ist, dann gibt es Musik in der Schule, wie überhaupt Musik in der Jugend. Stimmt aber nicht alles mehr, so hantiert die betreffende Zeit mit Begriffen wie Schulmusik und Jugendmusik.“[311]
Die Jugend müsse daher „von sich abweisen und nach Musik und Gesellschaft fragen.“ [312] Des weiteren führte er über die Schlagworte ‚Volk’, ‚Urkräfte’ usf. pauschal zu der Aussage, daß die Jugendmusikbewegung „ im Singen eins der grundlegenden Aufbauprinzipien für die innere und äußere Gestaltung des Staatswesens sähe,“ [313] was für ihn wiederum die Beziehung zwischen Musik und Gesellschaft bewies. Die ganze Beweisführung Jödes war äußerst dürftig, und über Aufgabe und Aufbau der Zeitschrift war damit noch nichts gesagt.
In der Tat scheint Jöde sich nur halbherzig auf diese Aufgabe eingelassen zu haben. Weitere Artikel für ‚Musik und Gesellschaft’ schrieb er nicht, und seine und Boettchers Anschauungen liefen offenbar größtenteils konträr zueinander. ‚Musik und Gesellschaft’ war vor allem auch eine Reaktion auf die Führertagung in Oberhof, der Versuch, eine neue Perspektive mit neuen Mitarbeitern zu erarbeiten,[314] für Jöde allerdings eher eine Notlösung, ein Ausweichen statt eines bewußten Schrittes nach vorn.
Inhaltlich war ‚Musik und Gesellschaft’ besonders durch die Bemühungen Boettchers, der dem Titel entsprechend wirklich über die jugendmusikalischen Kreise hinauswollte, sehr viel weiter gefaßt als bisherigen Organe der Gilde. In der enthaltenen ‚Umschau’ der Zeitschrift wurde regelmäßig über das öffentliche Musikleben berichtet. Auch Kritiken, die in der Jugendmusikbewegung lange verpönt waren, gab es, in Form sachlicher Aufführungskritiken.[315] Für die fortschrittliche und niveauvolle Zeitschrift konnte Boettcher als Autoren unter anderen Strawinsky, Hindemith, Brecht und Besseler gewinnen.[316]
Boettcher bemühte sich, ‚Musiksoziologie’ als Forschungsgebiet der Musikwissenschaft zu etablieren und betonte die Abhängigkeit der Musik vom Vorgang des Musizierens in sachlicher Weise:
„Aller Absolutheit von Musik [...] steht hier die schlichte Tatsächlichkeit gegenüber, daß in der Wirklichkeit Musik immer nur Musizieren ist (sowohl tätiges wie aufnehmendes Musizieren). [...] Wenn aber die Wirklichkeit von Musik an den Vorgang des Musizierens gebunden ist, so ist sie damit immer zugleich an die nur als ‚jetzt’ gegebene Existenz des (der) jeweils Musizierenden gebunden.“[317]
Entsprechende eher vage Ideen der Jugendmusikbewegung wollte er damit auf ein wissenschaftliches Fundament stellen, denn der Begriff des Soziologischen war in der Musikantengilde bisher oft inflationär und eher im Sinne von ‚gemeinschaftsbezogen’ verwendet worden, während Boettcher den Begriff nun konsequent „als Bezeichnung für die Auseinandersetzung mit den sozialen und ökonomischen Grundlagen von Musik“ benutzte.[318]
All diese Sachlichkeit stellte sich aber als nicht den Bedürfnissen der Bewegung entsprechend heraus. Die meisten wollten auch keineswegs aus ihrer heimeligen Gemeinschaft heraus. Nüchterne Wissenschaft vertrug sich schlecht mit der Heilserwartung, die viele nach wie vor an die Musik richteten. Ekkehart Pfannenstiel kritisierte in einem Brief an Jöde ‚Musik und Gesellschaft’ als negativ und unproduktiv. Die Zeitschrift habe
„keine aufbauende Haltung. [...] Überall Problematik der heutigen Lage. [...] Nirgends ein Weg heraus. [...] Muge [Musik und Gesellschaft] [...] nimmt die Gegebenheiten [...] stofflich. Ich vermisse einen irgendwie gerichteten Glauben an Verwandlung der Dinge, einen Glauben, der die Jugendmusikbewegung jahrelang getragen hat.“[319]
Den Vorwurf der Stofflichkeit machte Pfannenstiel auch der Musiksoziologie, die mit einem von ihm abgelehnten Ehrgeiz nach wissenschaftlicher Anerkennung betrieben werde. Deren rein deskriptive Fragen waren für ihn nicht lebensfördernd:
„Muge fragt nicht: wie kann der heutige Mensch mit dieser und jener Umwelt sich selbst im Musizieren wiederfinden, sondern: wie ist er? was tut er? wie ist seine Umwelt? wie deren Musik? wieweit hat er überhaupt Verhältnis zur Musik? wieweit eine Möglichkeit (stofflich!) zur Musik, zum Musizieren? Ich verweise nochmals auf das oben Gesagte, daß hier an keine Verwandlung der Stoffe geglaubt wird.“[320]
‚Musik und Gesellschaft’ war für ihn daher ‚nur’ eine Fachzeitschrift unter vielen, angeglichen an übliche Formate. Die Ablehnung des ‚Fachlichen’ als ‚Stoffliches’ wird hier noch einmal sehr deutlich.
Richtig lag Pfannenstiel mit seiner Vermutung, daß die Zeitschrift sich nicht würde halten können. Das Problem war, daß ‚Musik und Gesellschaft’ einerseits die Nachfolgerin der ‚Musikantengilde’ sein sollte, also als Organ der Jugendmusikbewegung fungierte, andererseits - und daran war besonders Boettcher ja sehr gelegen - darüber hinauswollte. Die Abnehmer waren aber noch dieselben, und diese waren an einer Änderung des Konzeptes größtenteils nicht interessiert, was viele Leserzuschriften zeigten. Die Jugendmusikbewegung hatte sich in dieser Hinsicht offenbar festgefahren und war in ihren Vorstellungen unflexibel. Eine Öffnung nach außen war so nicht möglich. Nach lediglich acht Ausgaben wurde die Zeitschrift daher im Februar 1931 wieder eingestellt.
An ihre Stelle sollte wieder eine Zeitschrift wie die ‚Musikantengilde’ mit mehr Anregungen zu praktischer Arbeit und Notenbeilagen treten. Bereits vorhanden war in dieser Hinsicht ‚Der Kreis’, dessen Name klar auch die Konzentration der Jugendmusikbewegung auf ihren nach innen gerichteten Kreis widerspiegelte.[321] Dazu kam von 1932 bis 33 die Notenzeitschrift ‚Pro Musica. Organ für neue Musik’, herausgegeben von Jöde, Ernst-Lothar von Knorr und Herman Reichenbach. Der Versuch der Erweiterung der Bewegung bzw. der Öffnung des geschlossenen Kreises zum gesellschaftlichen Musikleben war gescheitert.
3.6 Neue Medien
Ab 1928 ging Jöde auf seinem Weg, die aktive Teilhabe an Musik möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, einen entscheidenden Schritt, der viele seiner Mitstreiter skeptisch machte: Er bemühte sich um einen größeren Wirkungskreis mit Hilfe von Rundfunk und Schallplatte.[322]
3.6.1 Rundfunk
Der Rundfunk war seit seinem Beginn 1923 in verschiedener Hinsicht umstritten. Zum einen gab es Probleme mit der politischen Nutzung bzw. Beeinflussung seitens des Staates. Der Rundfunk wurde als staatliche Institution etabliert, was der Regierung eine starke Einflußnahme ermöglichte und politische, besonders stärker linksgerichtete Inhalte weitgehend ausschloß.[323]
Der Rundfunk diente zunächst vor allem der gesellschaftlichen Entpolitisierung durch die Betonung der Unterhaltung.[324] Abwechslung und Entspannung, Ablenkung von der unsicheren politischen Situation sollte dieser ‚Vergnügungsrundfunk’ bieten. Neben dem Verlesen vorgegebener Nachrichten machte den Hauptteil der Sendezeit Musik aus: Funk-Kapellen und Tanzorchester spielten den Hörern auf, aber es gab auch anspruchsvollere Übertragungen klassischer Konzerte. Die sich selbst als unpolitisch sehende Jugendmusikbewegung mit ihren kulturellen Bestrebungen paßte in dieses Programm gut hinein, so daß Jöde mit seinen Ideen schnell Aufnahme und Unterstützung fand, vor allem bei der Norddeutschen Rundfunk AG Hamburg (NORAG), die von Anfang an auf rundfunkspezifische Gebrauchsmusik ausgerichtet war und auch entsprechende Aufträge vergab.[325]
Neben der Frage der Mitbestimmung bzw. Einflußnahme gab es aber auch grundsätzliche Kritik am neuen Medium, das die
„lebendige Gegenwart der sichtbaren und hörbaren Welt [zerschlägt], sie [Rundfunk und Film] zerspalten die lebendige Haltung des sehenden und hörenden, schauenden und lauschenden Menschen. Darin [...] liegt ihre innerste Gefahr.“[326]
Das Radio trug dieser Anschauung zufolge zur weiteren Entfremdung und Vereinzelung des Menschen bei. Die Vereinzelung wurde anfangs noch dadurch verstärkt, daß die günstigeren Detektorenempfänger (im Gegensatz zu den teureren Röhrenempfängern) nur mit Kopfhörern funktionierten, so daß selbst Hörer, die sich im selben Raum befanden, akustisch voneinander isoliert waren.[327] In der Jugendmusikbewegung war die völlige Ablehnung des Rundfunks eine stark vertretene Haltung, zumindest was die Darbietung von Musik anging. Das Radiokonzert stellte aus dieser Sicht die höchste Form des abgelehnten bürgerlichen Konzertbetriebs dar, da die Trennung von Musizierenden und Publikum nun auch räumlich eine vollständige war. Die Zuhörerschaft war völlig anonym und konnte nichts als konsumieren, jegliche Möglichkeit auf aktive Teilnahme schien ausgeschlossen. Auch befürchtete man, daß mit der bequemen Handhabbarkeit der Musik sowohl die Notwendigkeit selbst zu musizieren als auch die gewünschte Ehrfurcht vor der Musik verlorenginge. Auch Jöde folgte bis kurz vor seinen eigenen Rundfunk-Aktivitäten dieser Anschauung.[328] Musik sollte nicht etwas für den täglichen bzw. alltäglichen Konsum werden, denn
„Wenn der Zugang zu dem Reich der Wahrheit und der Kunst rein äußerlich allzu bequem gemacht wird, so hat sich das noch immer gerächt darin, daß die Menschen sich nicht mehr von dem Erhabenen haben erheben lassen, sondern es vielmehr in die Niederungen ihres eigenen Lebens heruntergezogen haben.“[329]
Viele Musiker und Komponisten der zwanziger Jahre waren im Gegensatz dazu geradezu technikversessen: Der Rundfunk war für sie „ein technisches Spielzeug, das den Erfindergeist anspornte und die Gedanken in Erregung versetzte.“ [330] Auch anerkannte Komponisten wie Hindemith und Weill schrieben für das neue Medium. Berücksichtigt werden mußten dabei technische Probleme, besonders in der Anfangszeit, als die noch sehr schlechte Übertragungsqualität bestimmte, besonders größere Besetzungen mehr oder weniger ausschloß. Dazu kam das Wegfallen optischer Eindrücke, was besonders bei Bühnenstücken kompensiert werden mußte. Außerdem
„konnte sich [die Rundfunkmusik] nicht an ein spezifisches Publikum in öffentlichen Räumen richten, sondern mußte eine ungewöhnlich breite Hörerschaft in privater Umgebung und in isolierender Räumlichkeit erreichen.“[331]
Zwischen den extremen Haltungen gab es wiederum Stimmen, die den Rundfunk pragmatisch als technische Errungenschaft ansahen, die sich in jedem Fall durchsetzen würde. Daher kam es ihnen darauf an, das neue Medium nach Möglichkeit zu beeinflussen und für die eigenen Ziele zu benutzen.[332] Die zunehmende Massenwirkung des Rundfunks sollte der Aufklärung und Bildung dienen, denn die Zahl der deutschen Rundfunkteilnehmer wuchs pro Jahr um etwa 500.000 (von ‚Schwarzhörern’ ganz abgesehen). 1928 gab es bereits mehr als 2 1/2 Millionen Haushalte mit Radioempfängern.[333]
Daher wuchsen auch die Bestrebungen für Bildungsprogramme: Es wurden Diskussionssendungen und speziell für den Rundfunk konzipierte Literaturbearbeitungen und Musikstücke geschrieben,[334] auf der Seite der Rezipienten entstanden Hörergemeinschaften, teils aus technischen und finanziellen Gründen,[335] größtenteils aber aus Bildungsgründen, angeregt von schulischen und kirchlichen Organisationen oder Gewerkschaften. Sendungen wurden gemeinsam vorbereitet, angehört und hinterher diskutiert, teilweise gab es sogar Rückmeldungen an die Sender, was somit über reinen Konsum weit hinausging.
Rundfunk-Singstunden
Jöde wollte nun mit seinen jugendmusikalischen Ideen an diesen Entwicklungen teilhaben. Er war beeindruckt
„von Möglichkeiten der Erfassung von Gebieten, zu denen sonst nicht die geringste Anregung - es sei denn durch das schweigende Buch - gelangt.“[336]
Er suchte nach Wegen, die seiner Ansicht nach schädlichen Wirkungen des Rundfunks auszuschalten und die Breitenwirkung in seinem Sinne zu nutzen.
Im Februar 1928 gab er daher seine erste Rundfunksingstunde in der NORAG, und aufgrund der guten Resonanz wurden ab Juni desselben Jahres regelmäßig Singstunden ausgestrahlt. Jeweils vierzehntägig gab es ‚Volksliedsingstunden’ für Erwachsene und ‚Singstunden für Kinderstube und Kindergarten’. Jöde führte jeweils kurz in die Lieder ein und sang sie dann abschnittsweise mit einem kleinen Sing- und Spielkreis vor, wobei er die Zuhörer immer wieder zum Mitsingen animierte. Bei den Kindersingstunden gab er außerdem Spielanleitungen zu den Liedern, die auch von den Kindern im Senderaum ausgeführt wurden. Viele Zuschriften überzeugten Jöde davon, auf dem richtigen Weg zu sein:
„Es zeigt sich, daß ich mit den Singstunden überall im Lande Kreise erfasse, die gar nichts Programmatisches mit dem Liedersingen verbinden, sondern die einfach singen wollen. [...] Gerade sie bezeigen in ihren Briefen eine große Dankbarkeit und äußern wiederholt den Wunsch, diese Stunden viel öfter zu halten.“[337]
Kompositionen für den Rundfunk
Um den Rundfunk noch weitergehend für die Ziele der Jugendmusikbewegung nutzbar zu machen, regte Jöde 1929 den Intendanten der NORAG Hans Bodenstedt zur Gründung des ‚Kreises der Zwölf’ bzw. der ‚zwölf Musiker’ an: Zwölf junge, der Jugendmusikbewegung nahestehende Komponisten bildeten eine Arbeitsgemeinschaft, die im Auftrag des Rundfunks neue Gebrauchsmusik schrieb.[338] Vorbild war der ‚Kreis der zwölf Dichter’, dessen Ziel eine rundfunkorientierte hochwertige Literatur war, und mit dem auch Zusammenarbeit stattfand. So entstanden ab 1930 Kammermusiken für Märchensingstunden, Rahmenmusik für Laienhörspiele und neue Lieder für die Singstunden.[339] Zu einzelnen Komponisten des Kreises fanden Radiokonzerte mit Erläuterungen statt. Zugrundeliegendes Ziel war erneut die Schaffung einer zeitgemäßen, echten Volksmusik bzw. die Zusammenführung von Fach- und Volksmusik.
Rundfunk-Hausmusik
Angeregt durch den Erfolg der Singstunden begann Herbert Just Anfang der dreißiger Jahre, auch Instrumentalmusik zum Mitmachen per Radio zu senden, in der Sendung ‚Musizieren mit unsichtbaren Partnern.’ Die Noten zu den relativ einfachen Stücken, die gespielt werden sollten, wurden vor der Sendung von verschiedenen Funkzeitschriften abgedruckt und eigneten sich für Flöte, Geige, Klarinette, Klavier und andere Instrumente. Mitglieder der jugendmusikalischen Führungsriege musizierten den Hörern erst etwas vor, bei der Wiederholung entfiel dann meist eine Stimme, die zu Hause dazu gespielt werden konnte.[340]
Daß diese Versuche überhaupt nicht zum jugendmusikalischen Gemeinschaftsideal paßten, schien ihre Erfinder nicht zu stören, obwohl sie auch scharfe Kritik aus den eigenen Reihen ernteten. Sowohl Jöde als auch Just waren der Meinung, der Zuhörer und Mitsänger bzw. Mitmusizierer erlebe während der Sendungen tatsächlich eine Art Gemeinschaft mit den Musikern am Mikrophon, wenn auch einer etwas minderwertigeren als bei einer echten Begegnung. Just schrieb hierzu:
„Der Sinn der Sendungen ist vielmehr der, den Hörer zu eigener musikalischer Betätigung [...] während der Sendung anzuregen, ihn selbst das Beglückende gemeinsamen musikalischen Tuns ein wenig spüren zu lassen und dadurch die Freude am eigenen Spiel zu wecken oder ihr neuen Auftrieb zu geben.“[341]
3.6.2 Schallplatte
Nur kurz erwähnt werden sollen hier die Schallplatten, die Jöde herausgab, da sie in erster Linie für den Schulunterricht (und natürlich auch für den Musikschulunterricht) als Hilfsmittel für den Musiklehrer gedacht waren, aber auch einen weiteren Hinweis auf seine pragmatische Nutzung neuer Medien geben.
Ab 1929 erschienen in der Carl Lindström AG die vier Plattenreihen ‚Singspiele für Kinder’, ‚Deutsche Volkstänze’, ‚Kleine Liedkantaten’ und ‚Kleine Elementarlehre der Musik’ nach seinem Lehrbuch, jeweils zusammen mit einer Erläuterungsschrift.[342] Jöde hielt auch den Einsatz von Konzert-Einspielungen im Unterricht für sinnvoll, da es sonst für viele Schüler kaum eine Möglichkeit für echte Hörerfahrungen großer Werke gab. Dies war aber für sein Lehrkonzept wichtig, da das Einführen in Musikwerke immer mit klingender, erlebter Musik verbunden sein sollte.
3.6.3 Rundfunk und Gemeinschaftsbegriff
Kolland hält Jödes Nutzung des Rundfunks bzw. der neuen Medien für inkonsequent und ihn unglaubwürdig machend, da er seine anfängliche Ablehnung des Rundfunks im Zuge seiner eigenen Versuche so plötzlich und nach außen hin unreflektiert aufgab und das ihrer Meinung nach Unmögliche versuchte:
„mit dem Rundfunk selbst will er die Passivität des Hörers bekämpfen, die er vom Rundfunk gefördert sieht; mit dem Rundfunk will er die Rundfunkhörer gegen den Rundfunk erziehen.“[343]
Andererseits kann man es positiv werten, daß er keine Scheuklappen trug und neue Techniken nicht einfach ignorierte. Genausowenig huldigte er der ebenfalls verbreiteten Technikgläubigkeit. Stattdessen versuchte er auf pragmatische Weise, die neuen Medien in seinem Sinne mitzugestalten und zu nutzen. Kolland zitiert Jöde:
„Der irrtümliche Gebrauch des Radios ist ein neuer Schritt zur geistigen Volksverarmung, zur Entwöhnung vom eigenen Tun und Erfinden, zur Vereinzelung der Menschen beim bloß subjektiven Hörvorgang, zur verheerenden Verwechslung von trägem Genuß mit tätiger und alle Seelenkräfte geschmeidig haltender Kultur.“[344]
Mit diesem Gebrauch meinte er jedoch den herkömmlichen Konsum, und offenbar bemühte er sich danach um einen richtigen Gebrauch des Radios, was ihm seinen Vorgaben entsprechend auch gelungen zu sein scheint. Er (und nach seinem Vorbild Just) benutzte seine Sendungen erfolgreich als Bildungsinstrumente, als Vehikel zur Verbreitung von Volks- und Kunstmusik und zur Animation zum eigenen Singen und Musizieren.
Zwiespältig bleibt allerdings die Übertragung der Gemeinschaftsidee auf das neue, räumlich trennende Medium. Für die Singstunden wäre es noch denkbar, daß diese zum Teil gemeinsam gehört wurden und das Gelernte danach weitergetragen wurde. Für das ‚Musizieren mit unsichtbaren Partnern’ ist dies aber äußerst unwahrscheinlich, da es ja gerade darum ging, Laienmusikern zu helfen, die keine Möglichkeiten hatten, mit anderen zusammenzuspielen. Daß Sendungen dieser Art als Ersatz für reale Gemeinschaftserlebnisse dienen und zu noch stärkerer Vereinzelung führen könnten, wurde nicht berücksichtigt,[345] obwohl Just betonte, die Sendungen sollten keineswegs Ersatz, sondern „nur Helfer und Anreger der Hausmusik sein, niemals diese selbst.“ [346] Wie dies vonstatten gehen sollte, blieb allerdings unklar. Hier wichen Jöde und Just von den jugendmusikalischen Idealen ab, vielleicht, ohne sich darüber klar zu sein, zumindest aber ohne es zu thematisieren.
4 Fazit
Untersucht man Jödes außerschulische Musikvermittlung daraufhin, wieweit er seine Ideale und Ziele in ihr umsetzen konnte, sieht man sich mit dem Problem konfrontiert, daß diese Ziele sehr unterschiedliche Qualitäten in Bezug auf Präzision und Sachlichkeit haben: Es ist schwer nachzuprüfen, ob der ‚neue Mensch’ geschaffen wurde oder es wieder eine ‚Einheit von Musik und Volk’, von ‚Musik und Leben’, eine ‚wahre Volksmusik’ gibt. Eher kann man feststellen, ob mehr Singkreise entstehen oder Menschen, die bisher keinen Zugang zu einer musikalischen Ausbildung hatten, eine solche nun an einer Musikschule erhalten.
Hilfreich ist hier die Unterteilung von Jugendbewegungen in zwei verschiedene Schichten, wie Horst Rumpf sie vornimmt. Er unterscheidet den ‚humanistisch-kritischen Impuls’,
„der nahe bei der Erfahrung konkreter gesellschaftlicher und biographischer Verhältnisse bestimmte erstarrte Disziplinierungen und Routinen in Schule und Jugendleben beim Namen nennt, kritisiert und andere Lebens- und Lernformen probiert“,[347]
und den ‚messianisch-mythisierenden Impuls’, der ausgeht von
„dem Glauben, die Aktivitäten und Lebensformen dieser Jugendbewegung seien Bestandteil eines mythischen Endkampfes zwischen Licht und Finsternis, [...] Geist und Ungeist - sie seien Symptom einer Wiedergeburt, einer Auferstehung von welthistorischem Ausmaß.“[348]
Dieser Impuls hat kurzgefaßt die Funktion, die durch das ‚Unbehagen in der Kultur’[349] entstandenen Lebensängste durch Grandiosität und scheinbares Heldentum zu überdecken, weshalb in entsprechenden Bewegungen oft ein ‚Kampf’ z. B. gegen die Unkultur oder für die Wahrheit geführt wird.[350] Er wirkt - im Gegensatz zum humanistisch-kritischen Impuls - entdifferenzierend und antirational.
Vor diesem Hintergrund sind auch die Unterschiede und Unvereinbarkeiten verschiedener Ziele innerhalb der Jugendmusikbewegung besser verständlich. Beide Impulse waren in ihr von Anfang an vorhanden. Aufgrund der schwierigen Verhältnisse in Deutschland nahm der messianisch-mythisierende Impuls zu, der den humanistisch-kritischen als zu intellektuell und zu ausdifferenziert ablehnten mußte, da er dem Bedürfnis nach dem ‚ganzheitlich-großartigen Gefühl’ nicht entsprach, das man sich wünschte, sondern sich nüchtern und gründlich mit den Gegebenheiten auseinandersetze, um sie schrittweise zu ändern.
Auch bei Jöde zeigten sich beide Impulse. Seine umfassenden ‚Großziele’ waren messianisch-mythisierender Art und für die praktische Arbeit nicht handhabbar. In seiner Arbeit folgte er dagegen dem humanistisch-kritischen Weg. Das Problem dabei war, daß das Ziehen einer Verbindung zwischen beiden kaum möglich war, was zu der Diskrepanz zwischen seinen musikphilosophischen Schriften, die diesen Namen meist kaum verdienen, und seiner Arbeit führte.
Entkleidet man Jödes Ideen und Bestrebungen des messianisch-mythischen Impulses, ergeben sich aus seiner Arbeit Möglichkeiten auch für die heutige Zeit. Setzt man als sein humanistisch-kritisch ausgerichtetes Hauptziel, daß Laien- und Hausmusik wieder stärkeren Eingang in das Leben vieler Menschen finden sollte, so war er durch die Arbeit der Musikantengilde, Singstunden, Musikschulen und Verbreitung entsprechender Literatur sicher erfolgreich, wenn natürlich auch vieles hinter seinen Wünschen zurückblieb. Die konkrete Mitgliederzahl der Bewegung war zwar nicht sehr groß, doch konnte über Anhänger und Sympathisanten ein weitergehender Einfluß auf das Musikleben ausgeübt werden.[351] Eine Kultur der Hausmusik, wie die Jugendmusikbewegung sie vor dem 19. Jahrhundert als gegeben ansah, wurde allerdings nicht erreicht.
Jöde führte viele Menschen an die Musik heran und entwickelte neue Strukturen für das Laienmusizieren. Die Auswirkungen sind bis heute zu spüren, beispielsweise in den Musikschulen, wie bereits am Anfang erwähnt. Auch daß bei Konzerten oft mit dem Publikum zusammen gesungen wird, geht auf die Jugendmusikbewegung zurück. Der Einfluß der Chorbewegung ist heute noch hörbar in Klang und Literaturauswahl vieler Chöre. Auf den pädagogisch-didaktischen Bereich des Musikunterrichts hat Jöde großen Einfluß gehabt, und eventuell ist das bei ihm vorhandene Potential hier noch nicht ausgeschöpft. Der Musikunterricht hat zudem innerhalb der Schule immer noch einen geringeren Stellenwert als andere Fächer und fällt öfter aus, obwohl Forschungsergebnisse auf seine Wichtigkeit hinweisen.[352]
Die Betonung der Körperlichkeit im Umgang mit Musik ist heute beispielsweise auch in der Musiktherapie zu finden. Auch wenn hier keine direkte Beeinflussung stattgefunden hat, zeigt sich, wie viele von Jödes Ideen sich durchgesetzt haben, was sicher auch mit seinem Gespür für die Fragen der Zeit zu tun hat.
Interessant ist auch seine Arbeit für den bzw. mit dem Rundfunk, den er pragmatisch für seine Bildungszwecke zu nutzen versuchte. Ähnliche Debatten und Bestrebungen wie damals um den Rundfunk gibt es heute um das Internet, das einerseits Gefahren der Vereinzelung, andererseits große Bildungsmöglichkeiten bietet.
Viele von Jödes Anregungen haben sich weiterentwickelt und natürlich auch verändert. Heute ist der psychologische Wert des Singens und Musizierens allgemein weitgehend anerkannt, ohne daß dabei an die Erzeugnisse allzu scharfe qualitative Maßstäbe angelegt werden müssen. Eigenes Musizieren gilt grundsätzlich als ‚gesund’, besonders im pädagogischen Bereich. Hodek kritisiert zu Recht an Jöde, daß dieser zwar das Bedürfnis der Jugend bzw. des Menschen auf einen eigenen musikalischen Ausdruck ernstnahm, die entstehenden Formen dann aber bewertete und beschränkte auf das, was nach seinen Maßstäben gut war:
„Die Singbewegung um Jöde [...] nimmt den Anspruch auf Authentizität von ästhetischen und musikalischen Ausdrucksformen zunächst einmal ernst. Sein Problem aber ist, daß er das ästhetische Ziel, orientiert an der Funktionsweise des Singens und am gemeinsamen Singklang vor allem der sog. alten Musik pädagogisiert. Dadurch muß bei nachfolgenden Jugendkulturen [...] der Eindruck entstehen, daß Jöde sie letztlich doch nur pädagogisch, aber ästhetisch und musikalisch in ihrer Authentizität nicht ernst nehmen könnte.“[353]
Auf der anderen Seite wird der Wert des gemeinsamen Musizierens nicht mehr pseudoreligiös überhöht und als etwas in jedem Fall ethisch Wertvolles eingestuft. Singen schafft Gemeinschaftsgefühl[354] in christlichen Vereinen, auf friedlichen Demonstrationen und in Gruppen von Neonazis. Das ‚wo man singt, da laß dich ruhig nieder’ wird ebenfalls nicht mehr unhinterfragt vorausgesetzt, wie es in der Jugendmusikbewegung oft naiv geschah.
Jödes zum Teil sehr konservative und manchen Musikstilen gegenüber ablehnende Haltung ist in der Tat bedauerlich, verständlich vielleicht aus der Zeit, in der nach Symbolen für eine Gemeinschaft gesucht wurde. Eine große Bereicherung des Musiklebens war und ist dagegen die Wiederentdeckung und Nutzbarmachung alter und die Förderung neuer Musikliteratur sowie die Impulse, die er auch für die neue Laienmusik gegeben hat, selbst wenn er dieser nicht zu der erwünschten[355] Verbreitung verhelfen konnte.
Anhang: Zeittafel (Auswahl)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis
Abel-Struth, Sigrid (1985): Grundriß der Musikpädagogik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- (Hg.) (1987): Jugendbewegungen und Musikpädagogik. Sitzungsbericht 1985 der Wissenschaftlichen Sozietät Musikpädagogik. Musikpädagogik Forschung und Lehre, Beiheft 2. Mainz: Schott.
Ameln, Konrad (1927): Zweite Reichsführerwoche der Musikantengilde und Deutsche Kammermusik Baden-Baden im Juli 1927. In: Singgemeinde, H. 2/1927, abgedruckt in Archiv 1980, S, 402 - 404.
Antholz, Heinz (1987): Die Jugendmusikbewegung - ‚Schulbeispiel’ für pädagogische Musik? Fachgeschichtliche und -systematische Skizzen. In: Abel-Struth 1987, S. 9 - 23.
- (1996): Jugendmusikbewegung. In: Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil 4. Kassel u. a.: Bärenreiter, S. 1569 - 1587.
Archiv der deutschen Jugendmusikbewegung e. V. Hamburg (Hg.) (1980): Die deutsche Jugendmusikbewegung in Dokumenten ihrer Zeit von den Anfängen bis 1933. Wolfenbüttel / Zürich: Möseler.
Batel, Günther (1989): Leo Kestenberg. Pianist, Klavierpädagoge, Kulturorganisator, Reformer des Musikerziehungswesens. Wolfenbüttel / Zürich: Möseler.
Baum, Richard (1929/30): Der Rundfunk als Lebensmacht. In: Singgemeinde, H. 4/29/30, abgedruckt in Archiv 1980, S. 509-510.
Beck-Kapphan, Cornelia (1998): Geschlechtsspezifische Musikerziehung in Wandervogel und Jugendmusikbewegung. Frankfurt / Main: Lang.
Bethge, Philip (2003): Die Musik-Formel. Der Spiegel, H. 31/2003, S. 130 - 140 .
Blankenburg, Walter (1932): Aus der Arbeit der Schule ‚Lied und Volk’ in Kassel. In: Lied und Volk, H. 8/32, abgedruckt in Archiv 1980, S. 739 - 743.
- (1933): Der Plöner Musiktag. In: Collegium Musicum, H. 1/33, abgedruckt in Archiv 1980, S. 431 - 433.
Böhle, Ingrid (1982): Musikinstrumente im Zeichen der reformpädagogischen Bewegungen. Dissertation. Universität Dortmund.
Boettcher, Hans (1928): Berufsmusikerorganisation und Jugendmusikbewegung. In: Musikantengilde, H. 4/28, abgedruckt in Archiv 1980, S. 750 - 751.
- (1930): Musik und Gesellschaft als Arbeitsprogramm In: Jöde / Boettcher 1930/31, S. 14 - 21.
Breuer, Hans (Hg.) (1913, 1. Aufl. 1909): Der Zupfgeigenhansl. Leipzig: Hofmeister.
- (1918): Wandervogel und Volkslied. In: Jöde 1918 c, S. 95 - 101.
Briner, Andres (1978): Ich und Wir - Zur Entwicklung des jungen Paul Hindemith. In: Rexroth 1978, S. 27 - 34.
Broschart, Jürgen / Tentrup, Isabelle (2003): Der Klang der Sinne. Der Einfluß der Klänge auf Gehirn, Gefühl und Gedanken. In: GEO, H. 11/03, S. 54 - 88.
Doflein, Erich (1928): Jugendmusik und moderne Musik. Maschinen-Manuskript aus Privatbesitz, abgedruckt in Archiv 1980, S. 406.
Eckart-Bäcker, Ursula (1987): Wilhelm Kamlah und seine Arbeit mit dem ‚Heinrich-Schütz-Kreis’ (1926 - 36). Ein Beitrag zur Geschichte der musikalischen Jugendbewegung. In: Abel-Struth 1987, S. 65 - 91.
Ehrenforth, Karl Heinrich (1987): Musik will leben und gelebt werden - Anmerkungen zur Musikanschauung Fritz Jödes. In: Reinfandt 1987, S. 12 - 21.
Ehrhorn, Manfred (1987): Das chorische Singen in der Jugendmusikbewegung. Erneuerungsbestrebungen nach 1900. In: Reinfandt 1987, S. 37 - 55.
Eppinger, Heino (1924): Für und wider den Rundfunk. In: Singgemeinde, H. 4/24/25, abgedruckt in Archiv 1980, S. 499 - 505.
Erpf, Hermann (1927): Anmerkungen zur Bearbeitung und Wiedergabe alter Musik. In: Musikantengilde, H. 3/27, abgedruckt in Archiv 1980, S. 341 - 343.
Funck, Eicke (1987): Alte Musik und Jugendmusikbewegung. In Reinfandt 1987, S. 63 - 91.
Funk-Hennings, Erika (1987 a): Über die instrumentale Praxis der Jugendmusikbewegung - Voraussetzungen und Auswirkungen. In: Reinfandt 1987, S. 221 - 234.
- (1987 b): Zum Verhältnis von instrumentaler Praxis in der Jugendbewegung und der Schulmusikerziehung. In: Abel-Struth 1987, S. 24 - 53.
Fuhrmann, Roderich (1987): Grundlagen der Musikpädagogik der deutschen Landerziehungsheimbewegung. In: Abel-Struth 1987, S. 54 - 64.
Götsch, Georg (1928): Kurzer Bericht über die Reichsführerwoche in Lichtenthal. In: Der Kreis, H. 1/28, abgedruckt in Archiv 1980, S. 169 - 174.
- (1928/29): Das Musikheim in Frankfurt / Oder im Zusammenhang mit der Staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik Charlottenburg. In: Singgemeinde, H. 5/28/29, abgedruckt in Archiv 1980, S. 891 - 894.
- (1929): Stellungnahme zur Führerkonferenz in Oberhof / Thür 1929, abgedruckt in Archiv 1980, S. 965 - 966.
Grabienski, Olaf (1998): Zeit der Experimente. Vorläufer des Radio-Features in der Weimarer Republik. Hausarbeit an der Universität Hamburg. (http://www.olafski.de/arbeiten/feature.pdf, Datum des Zugriffs: 5. 11. 2004, 20:33).
Halm, August (1918 a): Gegensätze. In: Jöde 1918 c, S. 55 - 57.
- (1918 b): Musik und Leben. In: Jöde 1918 c, S. 23 - 30.
Hammel, Heide (1990): Die Schulmusik in der Weimarer Republik. Politische und Gesellschaftliche Aspekte der Reformdiskussion in den 20er Jahren. Stuttgart: Metzler.
Hecht, Ralf (1995): Die modernen Medien der Weimarer Republik. Hausarbeit an der Philipps-Universität Marburg. (www.ralf-hecht.de/downloads/weimar.pdf, Datum des Zugriffs: 5. 11. 04, 21:03).
Hindemith, Paul (1922): Gemeinschaft für Musik. Prospekt, abgedruckt in Schubert 1994, S. 8.
- (1926): Brief an Fritz Jöde. abgedruckt in Archiv 1980, S. 394 - 395.
- (1927): Wie soll der ideale Chorsatz der Gegenwart oder besser der nächsten Zukunft beschaffen sein? Vortragsmanuskript, abgedruckt in Schubert 1994, S. 25 - 28.
- (1930): Forderungen an den Laien. In: Musik und Gesellschaft H. 1/1930, abgedruckt in Schubert 1994, S. 42 - 44.
Höckner, Hilmar (1956): Paul Hindemith und die Jugendmusikbewegung. In: Aus dem Leben großer Musiker. Frankfurt/Main: Hirschgraben, abgedruckt in Archiv 1980, S. 396 - 399.
Hodek, Johannes (1996): Singbewegung - Studentenbewegung oder: Mit Fritz Jöde auf dem Berliner Kulturpfad. In: Krützfeldt-Junker 1996 a, S. 237 - 250.
Holtmeyer, Gert (1996): Fritz Jödes musikpädagogische Intentionen und die Kestenberg-Reform. Übereinstimmungen und Abgrenzungen. In: Krützfeldt-Junker 1996 a, S. 97 - 106.
Huber, Karl (1995): Die Wiederbelebung des künstlerischen Gitarrenspiels um 1900. Augsburg: Lisardo.
Jöde, Fritz (Hg.): (1917): Robert Kothe und das deutsche Volkslied. Magdeburg: Heinrichshofen.
- (1918 a): Aufruf. In: Die Laute. Monatsschrift zur Pflege des deutschen Liedes und guter Hausmusik. Wolfenbüttel: Zwißler, H. 7/1918, abgedruckt in Archiv 1980, S. 76 - 77.
- (1918 b): Durch Arbeit (Ein Geleitwort). in: ders. 1918 c, S. 5 - 6.
- (1918 c): Musikalische Jugendkultur. Anregungen aus der Jugendbewegung. Hamburg: Freideutscher Jugendverlag Adolf Saal.
- (1919): Musik und Erziehung, Lebensbilder aus der Schule. Wolfenbüttel: Kallmeyer.
- (1920): Vorwort zum ersten Jahrbuch der Musikergilde. Hartenstein / Rudolfstadt: -Greifenverlag, abgedruckt in Archiv 1980, S. 85.
- (1921 a): Die Lebensfrage der neuen Schule. Lauenburg / Elbe: Saal.
- (1921 b): Die Musikergilde. Undatiertes Einzelblatt, vermutlich 1921, abgedruckt in Archiv 1980, S. 81 - 82.
- (1922 a): Die Grundlagen musikalischer Betätigung in Schule und Leben. In: Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht Berlin (Hg.), Musik und Schule. Leipzig: Quelle & Meyer, S. 30 - 46.
- (1922 b): Der Musikant. Lieder für die Schule (Selbstanzeige). In: Die Laute 6/22, abgedruckt in Archiv 1980, S. 87.
- (1922/23): Die Volksmusikschule. In: Musikantengilde, H. 4/22/23, abgedruckt in Archiv 1980, S. 708 - 710.
- (1926): Die Kunst Bachs. Dargestellt an seinen Inventionen. Organik Bd. 1. Wolfenbüttel: Kallmeyer.
- (1927 a): Bericht über den I. Kursus zur Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen an Volksmusikschulen. In: ders. 1927 e, S. 93 - 108.
- (1927 b): Elementarlehre der Musik. Gegeben als Anweisung im Notensingen. 1. Teil. Wolfenbüttel: Kallmeyer.
- (1927 c): Erster zusammenfassender Bericht über die Jugendmusikschule der Akademie für Kirchen- und Schulmusik für die Zeit von Mai 1923 - März 1926. In: ders. 1927 e, S. 51 - 66.
- (1927 d): Jugendmusik bis Lichtental 1927. In: Musikantengilde, H. 6/27, abgedruckt in Archiv 1980, S. 387 - 388.
- (1927 e): Musikdienst am Volk. Ein Querschnitt in Dokumenten. Werkschriften der Musikantengilde Bd. 3. Wolfenbüttel / Berlin: Kallmeyer.
- (1928 a): Ertrag der ersten Rundfunktagung des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht. In: Musikantengilde, H. 5/28, abgedruckt in Archiv 1980, S. 505 - 506.
- (1928 b): Musik in der Volksschule. Eine Einleitung. Berlin: Comenius.
- (1928 c, 1. Aufl. 1924): Musikschulen für Jugend und Volk. Wolfenbüttel: Kallmeyer, Auszüge abgedruckt in Archiv 1980, S. 711 - 716.
- (1929 a): Unser Recht auf das Lied. In: Drachentöter 1929, abgedruckt in Archiv 1980, S. 479.
- (1929 b): Volks- und Jugendmusikpflege durch den Rundfunk. In: Musikantengilde, H. 1/29, abgedruckt in Archiv 1980, S. 507 - 508.
- (1930 a): Kind und Musik. Eine Einführung. Berlin: Comenius.
- (1930 b): Musik und Gesellschaft. Eine Einleitung. In: Musik und Gesellschaft, H. 1/1930, S. 1 - 3.
- (1931): Die Singstunde. Eine Einführung zu unserer gleichnamigen Notenbeilage. In: Zeitschrift für Schulmusik, H. 10/31, abgedruckt in Archiv 1980, S. 478 - 479.
- (1948, 1. Aufl. 1921): Alte Madrigale und andere A-cappella-Gesänge für gemischten Chor aus dem 16. und dem Anfange des 17. Jahrhunderts. Wolfenbüttel: Möseler.
- (1959, 1. Aufl. 1925/26 in drei Heften): Der Kanon. Ein Singbuch für alle. Gesamtband: Von der Gotik bis zur Gegenwart. Wolfenbüttel: Möseler.
- (1962, 1. Aufl. 1928 in zwei Bänden): Das schaffende Kind in der Musik. Eine Anweisung für Lehrer und Freunde der Jugend. 1. Teil: Zur Theorie des Schaffens. 2. Teil: Aus der Praxis des Schaffens. Wolfenbüttel / Berlin: Möseler (ehem. Kallmeyer).
- / Boettcher, Hans (Hg.) (1930/31): Musik und Gesellschaft. Arbeitsblätter für soziale Musikpflege und Musikpolitik. Wolfenbüttel: Kallmeyer und Mainz / Leipzig: Schott’s Söhne, Reprint von Kolland, Dorothea (Hg.) (1978), Westberlin: deb.
Jöde, Ulf (1969): Die Entwicklung des Liedsatzes in der deutschen Jugendmusikbewegung. Wolfenbüttel / Zürich: Möseler.
- (1987): Liedsatzbeiträge in der deutschen Jugendmusikbewegung und späteren Veröffentlichungen im Rahmen dieser Tradition. In: Reinfandt 1987a, S. 56 - 62.
Just, Herbert (1929): Zur offenen Singstunde der V. M. S. In: Musikantengilde, H. 4/29, abgedruckt in Archiv 1980, S. 491.
- (1932): Hausmusik und Rundfunk. In: Die Sendung, H. 47/32, abgedruckt in Archiv 1980, S. 511 - 513.
- (1933): Musizieren mit unsichtbaren Partnern. In: Collegium Musicum, H. 2/33, abgedruckt in Archiv 1980, S. 513 - 514.
Kaiser, Hermann J. (1987): Der Erziehungsbegriff in der Jugendmusikbewegung. Ortsbestimmungen. In: Reinfandt 1987a, S. 134 - 159.
Kallmeyer, Georg (1930): Aus der Geschichte des Verlages. In: Drachentöter, Jahrbuch 1930, abgedruckt in Archiv 1980, S. 188 - 190.
- (1931): Brief des Verlegers Georg Kallmeyer. Als Beilage im Februar-Heft von Musik und Gesellschaft. In: Jöde / Boettcher 1930/31, S. XXVI - XXVII.
Kolland, Dorothea (1979): Die Jugendmusikbewegung. Gemeinschaftsmusik - Theorie und Praxis. Stuttgart: Metzler.
Kommer, Sven (1997): Musik in der Jugendbewegung. In: Baacke (Hg.), Handbuch Jugend und Musik, Opladen: Leske und Budrich, S. 195 - 216.
Krützfeldt-Junker, Hildegard (Hg.) (1996 a, 1. Aufl. 1988): Fritz Jöde - ein Beitrag zur Geschichte der Musikpädagogik des 20. Jahrhunderts. Bericht über das Fritz-Jöde-Symposion, veranstaltet von der Gesellschaft für Musikpädagogik GMP vom 5. - 7. Februar 1988 in der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg. Altenmedingen: Hildegard Junker.
- (1996 b): Musikalische Werkbetrachtung bei Fritz Jöde. In: dies. (Hg) (1996a), S. 210 - 233.
- (1988): Fritz Jöde: Von der Novemberrevolution zur Musikpädagogik. In: Lorent / Ullrich 1988, S. 338 - 341.
Kühn, Hellmut (1978): Hindemiths Beitrag zur Radiomusik / Vorstellungen über Radiomusik in den zwanziger Jahren. In: Rexroth 1978, S. 47 - 55.
Leitner, Klaus Peter (1994): Fritz Jöde und Walther Hensel. Zwei Wege der Jugendmusikbewegung. Eine Untersuchung zur Ausbreitung der Singbewegung in Württemberg unter Berücksichtigung der Singtreffen von Hans Grischkat. In: Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg (Hg): Musik in Baden-Württemberg. Jahrbuch. Stuttgart: Metzler, S. 41 - 71.
Lemmermann, Heinz (1996): Fritz Jödes Schulzeit. Zum Stand der Musikpädagogik um die Jahrhundertwende. In: Krützfeldt-Junker 1996a, S. 10 - 38.
Lorent, Hans-Peter de (1988): Schulalltag in der Weimarer Republik. Aus Konferenzprotokollen, Festschriften, Chroniken und Berichten Hamburger Schulen von 1918 - 1933. In: ders./ Ullrich 1988, S. 222 - 237.
- / Ullrich, Volker (Hg) (1988): Der Traum von der freien Schule. Schule und Schulpolitik in der Weimarer Republik. Hamburg: Ergebnisse.
Martin, Wolfgang (1982): Studien zur Musikpädagogik der Weimarer Republik. Mainz / London / New York / Tokyo: Schott.
Mersmann, Hans (1931): Die moderne Musik seit der Romantik. Potsdam: Athenaion.
Möseler-Verlag: Verlagsgeschichte seit 1821. http://www.moeseler-verlag.de/php/index.php?xId=F9c8z0T3s8U3A6p7k1z6I0B8m3&aktion=start (Datum des Zugriffs: 23. 11. 04, 14:19).
Molkow, Wolfgang (1978): Paul Hindemith - Hanns Eisler. Zweckbestimmung und gesellschaftliche Funktion. In: Rexroth 1978, S. 35 - 46.
Möller, Richard (1918): Laute und Lautenmusik. In: Jöde 1918c, S. 164 - 168.
Musikschule Neukölln / Fricke, Heike / Sparrer, Walter-Wolfgang (Hg.) (2002): Musikschule Paul Hindemith - 75 Jahre Musikschule Neukölln. Saarbrücken: Pfau. Homepage der Musikschule Paul Hindemith Neukölln. Bezirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung Bildung, Schule und Kultur, http://www.musikschule-paul-hindemith.de/seiten/fest.pdf (Datum des Zugriffs: 28. 9. 04, 11:30).
Pfannenstiel, Ekkehard (1930): Brief an Fritz Jöde, 2. 8. 1930. In: Jöde / Boettcher 1930/31, S. XXVII - XXIX.
Probst-Effah, Gisela (2000): Musikalische Jugendkulturen. Homepage Universität zu Köln, Institut für Musikalische Volkskunde. http://www.uni-koeln.de/ew-fak/Mus_volk/scripten/probst/jugend.pdf (Datum des Zugriffs: 7. 9. 04, 12:10).
Reichenbach, Herman (1925): Unsere Stellung zu Bach. In: Musikantengilde, H. 7/1925, S. 330 - 334.
- (1927): Laienerziehung durch Volksmusikschulen. In: Musikantengilde, H. 6/7/1927, abgedruckt in Archiv 1980, S. 721 - 722.
- (1931): Singtreffen der Berliner Jugend. In: Musik und Gesellschaft 1930/31, abgedruckt in Archiv 1980, S. 495 - 497.
- (1959, Erstaufl. 1925/26): Einleitung. In: Jöde 1959, o. S..
Reinfandt, Karl-Heinz (Hg.) (1987 a): Die Jugendmusikbewegung. Impulse und Wirkungen. Wolfenbüttel: Möseler.
- (1987 b): Fritz Jödes Wirken während der Zeit des Dritten Reiches. In: Krützfeldt-Junker 1996, S. 115 - 130.
- (1987 c): ‚Tätige Teilnahme an der Musik’ als erzieherischer Auftrag. Zum Praxis-Bezug und zur Verwirklichung von Jödes Reformkonzept im Musikunterricht. In: Abel-Struth 1978, S. 111 - 133.
- (1996): Jöde, Fritz. In: . In: Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil 9. Kassel u. a.: Bärenreiter, S. 1074 - 1076.
Reusch, Fritz (1926): Erste Hochschulwoche der Musikantengilde. In: Musikantengilde 6/26, abgedruckt in Archiv 1980, S. 167 - 169.
- (1927): Zweite Reichsführerwoche der Musikantengilde vom 11. - 17. Juli 1927 in Lichtental bei Baden-Baden. In: Musikantengilde, H. 4/27, abgedruckt in Archiv 1980, S. 400.
Rexroth, Dieter (Hg.) (1978): Erprobungen und Erfahrungen. Zu Paul Hindemiths Schaffen in den zwanziger Jahren. Mainz: Schott.
Rittinghaus, F. W. (1912): Volkslied und Neutöner. In: Wandervogel. Monatsschrift für deutsches Jugendwandern. H 8/12, abgedruckt in Archiv 1980, S. 27 - 30.
Rohwer, Jens (1987): Fritz Jödes Musikauffassung und spezifische Musikalität am Beispiel seiner Analysen einiger Inventionen J. S. Bachs. In: Reinfandt 1987, S. 22 - 36.
Rumpf, Horst (1987): Zwischen Zivilisationskritik und Regression. Über neuere Jugendbewegungen und ihre Ausstrahlung in die Erziehung. In: Abel-Struth 1987, S. 101 - 110.
Salmen, Walter (1982): Haus- und Kammermusik. Privates Musizieren im gesellschaftlichen Wandel zwischen 1600 und 1900. Musikgeschichte in Bildern Bd. IV Hg. von Besseler, Heinrich / Bachmann, Werner (Hg.), Leipzig: Deutscher Verlag für Musik.
Sambeth, Heinrich M. (1957): Die singende Hand und die offene Singstunde. In: Stapelberg 1957, S. 89 - 94.
Schaal, Richard (1958): Jugendmusik. In: Blume, Friedrich (Hg.), Musik in Geschichte und Gegenwart. Band 7. Kassel u. a.: Bärenreiter, S. 286 - 306.
Schaal-Gotthardt, Susanne (2002): ‚Das musikalische Blickfeld erweitern.’ Paul Hindemiths laienmusikalisches Wirken. In: Musikschule Neukölln 2002, S. 119 - 137.
Schmitz, Peter (1995): “Der hier in der sogenannten ‚Gitarristik’ herrschenden heillosen Verwirrung galt es von vornherein die Stirn zu bieten.“ Die Kritik der Jugendbewegung an der Gitarrenbewegung. In: Gitarre & Laute H. 1/1995, S. 57 - 66 .
Schneider, Reinhard (1996): Jödes musikphilosophische Anschauungen. In: Krützfeldt-Junker 1996, S. 185 - 196.
Schubert, Giselher (Hg.) (1997): Hans Boettcher. Auszug aus: Hans Boettchers Briefe an Paul Hindemith. In: Hindemith-Jahrbuch 26, S. 196 - 214, abgedruckt in Musikschule Neukölln 2002, S. 138 - 140.
- (1994): Paul Hindemith. Aufsätze, Vorträge, Reden. Zürich / Mainz: Atlantis.
Schumann, Heinrich (1928): Die Volksmusikschule in Hamburg. In: Jöde, Fritz (1928): Musikschulen für Jugend und Volk. Wolfenbüttel: Kallmeyer, abgedruckt in Archiv 1980, S. 731 - 734.
- (1931): Die ‚offenen Singstunden’ in unserer Musikarbeit. Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis. In: Der Kreis 6/31, abgedruckt in Archiv 1980, S. 481 - 485.
- (1996): Begegnungen und gemeinsames Wirken mit Fritz Jöde in den Jahren 1922 bis 1969. In: Krützfeldt-Junker 1996a, S. 149 - 184.
Simons, Henry (1928): Deutsche Jugendmusik in Lichtental 9. - 15. Juli 1928. In: Musikantengilde, H. 8/28, abgedruckt in Archiv 1980, S. 174 - 176.
Smits von Waesberghe, Joseph (1969): Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter. Musikgeschichte in Bildern Bd. IV. Hg. von Besseler, Heinrich / Bachmann, Werner, Leipzig: Deutscher Verlag für Musik.
Stapelberg, Reinhold (Hg.) (1957): Fritz Jöde. Leben und Werk. Trossingen: Hohner, Wolfenbüttel: Möseler.
- (1985): Jöde, Fritz. . In: Blume, Friedrich (Hg.), Musik in Geschichte und Gegenwart. Band 7. Kassel u. a.: Bärenreiter, S. 80 - 82.
Stephan, Rudolf (1978): Die Musik der Zwanzigerjahre. In: Rexroth 1975, S. 9 - 14.
Stoffels, Ludwig (1997): Rundfunk als Erneuerer und Förderer. In: Leonhard, Joachim-Felix (Hg) (1997), Programmgeschichte des Hörfunks in der Weimarer Republik. Band 2. München: dtv, S. 847 - 947.
Struwe, Friedrich (1930): Proletarier-Singabende. In: Singgemeinde, H. 6/39, abgedruckt in Archiv 1980, S. 493.
Stumme, Wolfgang (1987): Die Musikschule im 20. Jahrhundert. Bericht eines Zeitzeugen. In: Reinfandt 1987, S. 245 - 270.
Thiel, Jörn (1957): Wirksamkeit durch Rundfunk und Schallplatte. In: Stapelberg 1957, S. 131 - 135.
Träder, Willi (1979): Musikpädagogik des 20. Jahrhunderts im Überblick. In: Wucher, Diethard / Berg, Hans-Walter / Träder, Willi (Hg.): Handbuch des Musikschulunterrichts. Regensburg: Bosse, S. 103 - 109.
Trautner, Günter (1968): Die Musikerziehung bei Fritz Jöde. Wolfenbüttel / Zürich: Möseler.
- (1996): Jödes Schulpraxis. Erziehung zum ‚neuen Menschen’. In: Krützfeldt-Junker 1996 a, S. 73 - 89.
Twittenhoff, Wilhelm (1929): Volksmusikschulen. In: Zeitschrift für Musik, H. 8/1929, abgedruckt in Archiv 1980, S. 717 - 720.
Weber, Ludwig (1925): Neue Gemeinschaftsmusik. Wiedergeburt der Kunstmusik aus dem Geiste des Volksliedes. In: Melos, H. 12/25, abgedruckt in Archiv 1980, S. 389 - 392.
Weniger, Erich (1980): Die Jugendbewegung und ihre kulturelle Auswirkung. In: Archiv 1980, S. , S. 1 - 8.
Zepf, Josef (1957): Die Mundharmonika in der Jugend. In: Stapelberg 1957, S. 172 - 175.
Zuckmayer, Eduard (1929): Warum werden wir in diesem Sommer nicht zum ‚Deutschen Kammermusikfeste’ nach Baden-Baden gehen? In: Musikantengilde, H. 4/29, abgedruckt in Archiv 1980, S. 407 - 412.
Erklärung
Hiermit erkläre ich, daß ich die vorliegende Magisterarbeit selbständig angefertigt habe. Es wurden nur die in der Arbeit ausdrücklich benannten Quellen und Hilfsmittel benutzt. Wörtlich oder sinngemäß übernommenes Gedankengut habe ich als solches kenntlich gemacht.
Ort, Datum Unterschrift
[...]
[1] Broschart / Tentrup 2003, S. 68ff.
[2] Den entsprechenden Diskurs genauer zu schildern, würde hier zu weit führen.
[3] Siehe Abschnitt 1.2.7.
[4] Ehrenfort 1987, S. 12.
[5] Ebd.
[6] Lemmermann 1996, S. 10.
[7] Jöde 1918 b, S. 5f.
[8] Rumpf 1987, S. 107f.
[9] Lemmermann 1987, S. 13. Lemmermann nennt als einen der prominenten Protagonisten dieser Einstellung Langbehn, der in seinem 1890 veröffentlichten, vielgelesenen Buch ‚Rembrandt als Erzieher’ die Deutschen als das musikalischste aller Völker bezeichnet, das „auch im politischen Weltkonzert die erste Geige zu spielen“ berufen sei (Langbehn, J. (1890): Rembrandt als Erzieher. Leipzig, S. 239, zit. n. Lemmermann 1987, S. 13).
[10] Lemmermann 1996, S. 11ff.
[11] Lemmermann 1987, S. 16.
[12] 1911 war unter 1000 Studenten höchstens ein Arbeitersohn. Dieses Verhältnis blieb bis weit ins 20. Jahrhundert in etwa erhalten (Lemmermann 1987, S. 13).
[13] Lemmermann weist auch auf den ‚Vorteil’ des Liedes für Propagandazwecke hin: „Das Lied mit seiner relativ leichten Rezeptions- und Realisationsmöglichkeit - Kürze, Überschaubarkeit, geringer Schwierigkeitsgrad - kann durch Singen und Auswendiglernen in jeden Menschen ‚eingeschleust’ werden; es bleibt im Menschen ‚deponiert’ und wird bei Bedarf von außen (oder innen) abgerufen. Da Singen zumeist auch lustbetonter Ausdruck sinnlichen Wohlbehagens ist, besteht bei der Liedrezeption stets die Gefahr der unkritischen Übernahme von Inhalten. Welchen Einfluß und welche Wirkungsintensität dabei Texte haben, ist nicht recht abzuschätzen“ (a. a. O., S. 17). Diese Kritik ist natürlich auch für den Gebrauch von Liedern bei der Jugendbewegung und der Jugendmusikbewegung zutreffend.
[14] A. a. O., S. 11.
[15] Trautner 1968, S. 11.
[16] Fuhrmann 1987, S. 54.
[17] Landerziehungsheime waren ländliche nichtstaatliche Internatsschulen, die Unterricht und Erziehung im Sinne sozialen Lernens integrieren wollten. Das erste Landerziehungsheim in Deutschland entstand 1898 nach englischen Vorbild unter H. Lietz (Probst-Effah 2000, S. 3).
[18] Die Bewegungen werden daher auch unter dem Begriff der ‚musischen Bewegung’ subsumiert.
[19] Näheres zum Begriff des ‚neuen Menschen’ in Abschnitt 2.1.
[20] Bis 1926 erreichte das Buch 26 Auflagen in deutscher Sprache (Abel-Struth 1985, S. 370).
[21] Trautner 1968, S. 93.
[22] Siehe Abschnitt 1.2.6.
[23] Um 1890 gründete der Berliner Student Hermann Hoffmann Wandergruppen, die sich ab 1901 unter Karl Fischer ‚Wandervogel’ nannten und später als ‚Altwandervogel’ bezeichnet wurden. Weitere Bünde gingen hieraus hervor und entstanden auch an anderen Orten. 1907 formierte sich unter Hans Breuer der ‚Wandervogel, deutscher Bund für Jugendwanderungen’.
[24] Reinfandt 1987, S. 9.
[25] Es gab viele, teils aggressiv argumentierende Feinde des ‚Mädchenwanderns’, und der Altwandervogel schloß Mädchengruppen sogar aus. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, auf die geschlechtsspezifische Thematik innerhalb der Jugendbewegung und Jugendmusikbewegung näher einzugehen, man sollte sich aber darüber klar sein, daß es sich besonders beim Wandervogel vorrangig um eine männliche Bewegung handelte. In ihrem Frauenbild folgten alle Jugendbünde prinzipiell dem bürgerlichen Ideal der zur Mutter bestimmten und in all ihrem Tun und in ihrer Erziehung entsprechend vorzubereitenden Frau (vgl. Beck-Kapphan 1998).
[26] Das ‚Ideal’ war: „Haare nach hinten gekämmt [kein Hut, Anm. d. A.] , offenes Hemd mit Schillerkragen, schwarze Jacke, kurze schwarze Hosen, keine Schuhe“ (Leitner 1994, S. 43).
[27] Weniger 1980, S. 3.
[28] Vgl. Trautner 1968, S. 9 und Leitner 1980, S. 3.
[29] Beim Tanzen ging es allerdings nur um Volkstanz, da der Gesellschaftstanz als denaturiert, dem Bürgertum zugehörend und damit den Ideen der Bewegung zuwiderlaufend galt.
[30] Rittinghaus 1912, S. 27.
[31] Wandervogel e. V. Steglitz (Hg.) (1905): Des Wandervogels Liederbuch. Berlin: Zickfeldt.
[32] Fast 90% des Zupfgeigenhansels bestand aus alten Volksliedern. Quellen hierfür waren in erster Linie Franz Magnus Böhmes ‚Deutscher Liederhort’ und ‚Deutsche Volkslieder mit ihren Originalweisen’ von Kretzschmer und Zuccalmaglio. Bis 1933 erschienen mehr als eine Million Exemplare des ‚Zupf’ (Probst-Effah 2000, S. 3).
[33] Breuer 1913, Vorwort zur 1. Auflage 1908, o. S..
[34] Breuer 1918, S. 99.
[35] Viele hielten Robert Kothe beispielsweise für einen neuen Volkslieddichter, was Jöde 1917 in seiner Schrift ‚Robert Kothe und das deutsche Volkslied’ zu untermauern versuchte. Dessen Lieder setzten sich allerdings auf Dauer nicht durch.
[36] Siehe Abschnitt 3.3.2.
[37] Funk-Hennings 1987 b, S. 25.
[38] Dies geschah durch Heinrich Scherrer, der allerdings auch bei alten Liedern mit kirchentonartlicher Melodik meist einfachste Hauptstufenharmonik verwendete, was den Stücken natürlich nicht gerecht wurde (Schmitz 1995, S. 58).
[39] Vgl. Möller 1918, S. 164.
[40] Vgl. Breuer 1918, S. 95f und Jöde 1918 c, S. 162.
[41] Z. B. im ‚Wandervogel-Lautenbuch’, das Kurella und Gofferje 1913 herausgaben und im ‚Jenaer Liederblatt’ Baußnerns von 1917.
[42] Jöde 1918 c, S. 163.
[43] A. a. O., S. 161.
[44] Jöde 1918 b, S. 161, vgl. auch Funk-Hennings 1987 b, S. 28.
[45] Unterscheidung von Mehnert (1981): Ein Deutscher in der Welt, Stuttgart, S. 87, nach Antholz 1987, S. 14.
[46] Vgl. a. a. O., S. 11.
[47] Ebd.
[48] Hensel lehnte jede Form staatlicher Unterstützung sowie die Mitarbeit an der staatlichen Erziehungsreform durch Kestenberg ab mit der Begründung: „Nie und nimmer kann Musik gezwungen werden, zur Verherrlichung einer Zweck-Idee - und das ist z. B. der Staat - herangezogen zu werden.“ ab (Hensel, Walther (1924): Über die gesamte Musikpflege in Schule und Volk, S. 18, zit. n. Hammel 1990, S. 69). Jöde dagegen war bei dieser Reform ausschlaggebend beteiligt (siehe Abschnitt 1.2.6).
[49] Siehe Abschnitt 3.1.4.
[50] Vgl. Reinfandt 1996, S. 1570 und Hodek 1996, S. 237.
[51] Jöde war selbst ab etwa 1908 in der Jugendbewegung aktiv (Schumann 1996, S. 150).
[52] Jöde 1922 a, S. 32.
[53] Böhle 1982, S. 28f.
[54] Besseler unterscheidet in diesem Zusammenhang Darbietungs- und Umgangsmusik (Schwab 1971, S. 6).
[55] Reichenbach 1925, S. 330.
[56] Mersmann 1931, S. 38.
[57] Weitere Feindbilder auf Nebenschauplätzen des Musikkampfes waren der verbreitete Klaviersatz, der denselben harmonischen Prinzipien folgte, sowie das Klavier selbst aufgrund seiner Klangqualitäten und auch der Verwendung im bürgerlichen Salon, sowie andere Salon- und Unterhaltungsmusik, die als nicht volksgemäß galt.
[58] Salmen 1982, S. 5.
[59] Jöde 1948, S. 96.
[60] Näheres zur Entwicklung des Chorsatzes siehe Abschnitt 3.5.
[61] Jöde 1969, S. 102.
[62] Siehe Abschnitt 3.5.1.
[63] Der Heinrich-Schütz-Kreis wurde 1926 von dem Philosophiestudenten Wilhelm Kamlah gegründet, dessen Ziel es war, auf Singfahrten Werke von Schütz einem größeren Publikum zu Gehör zu bringen und dessen Musik so bekannter und anerkannter zu machen. Derartige Chöre oder Singkreise setzten sich bald kaum mehr aus Laien zusammen, sondern zum größten Teil aus Musikstudenten und anderen musikalisch höher qualifizierten Mitgliedern der Singbewegung (Eckart-Bäcker 1987, S. 66f).
[64] Reichenbach 1925, S. 333.
[65] Es gab allerdings auch andere Auslegungen polyphoner Musik. Der Komponist Hanns Eisler, der unter anderem Kampflieder für die Arbeiterbewegung schrieb, benutzte in seinem Chorstück ‚Kurfürstendamm’ aus op. 13 einen polyphonen Chor, um die Entfremdung und das Aneinander-Vorbeireden des modernen Menschen darzustellen und schrieb 1927: „ Polyphonie erklärt man am besten so. Vier Leute schreien miteinander, um den Hörer davon zu überzeugen, daß sie absolut nichts zu sagen haben.“ (Zeitgemäße Betrachtungen zweier Musiker, zit. n. Molkow 1978, S. 38). Diesen unterhaltsamen Streit weiter zu verfolgen, würde hier zu weit führen, klar ist aber, daß es nicht nur originär musikalische Argumente waren, die die Jugendmusikbewegung zur Polyphonie führten. Auch der stete Ruf nach einem ‚Führer’ für die Jugendmusikbewegung paßt nicht zu diesem Konzept, ließe er doch eher auf eine Vorliebe für Homophonie schließen, in der sich alle harmonisch einer richtungsweisenden Stimme anschließen und somit einer Idee dienen.
[66] Reichenbach 1925, S. 334.
[67] Vgl. Probst-Effah 2000, S. 4.
[68] Lemmermann 1987, S. 21.
[69] Halm 1918 b, S. 24.
[70] Halm 1918 a, S. 57.
[71] Siehe Abschnitt 3.1.
[72] Vgl. Hodek 1996, S. 237ff.
[73] Vgl. Böhle 1982, Vorbemerkung.
[74] Ehrhorn 1987, S. 37ff.
[75] Vgl. Schmitz 1995, S. 57.
[76] Ehrhorn 1987, S. 51.
[77] Näheres zur neuen Gesangsliteratur siehe Abschnitt 3.5.
[78] Ehrhorn 1987, S. 41.
[79] Jöde, Fritz (1918/19): Die Laute, H. 2, S. 14, zit. n. Ehrhorn 1987, S. 42.
[80] Funk-Hennings 1987 b, S. 31.
[81] Jöde 1969, S. 112.
[82] Funk-Hennings unterteilt die Jugendmusikbewegung in eine vokale Phase von 1922 - 1928, worauf sich eine instrumentale anschließe (Funk-Hennings 1987 b, S. 34f). Dies bedeutet nicht, daß vor 1928 nur wenig Instrumentalspiel stattfand, ab dieser Zeit verstärkte sich jedoch die Theoriebildung auf diesem Gebiet. Allerdings muß bedacht werden, daß viele Strömungen parallel liefen und der Gesang durchgehend eine zentrale Rolle innehatte, sich diese Entwicklungen daher nicht als aufeinanderfolgende, deutlich getrennte Phasen betrachten lassen.
[83] Siehe Abschnitt 3.3.2.
[84] Gneist, in: Die Singgemeinde JG. VII, H.6, S. 194, zit. n. Kolland 1979, S. 80. Kolland macht darauf aufmerksam, daß offenbar nur die Instrumente mit deutschen Namen poetisch klangen, also zumindest unterschwellig auch nationalistische Beweggründe zur Auswahl führten (ebd.).
[85] Funk-Hennings 1987 b, S. 38.
[86] Just (1930/31): Die Barockinstrumente in der Gegenwart. In: Musik und Gesellschaft 1930/31, S. 34, zit. n. Funk-Hennings 1987 b, S. 39.
[87] Die Arbeitsweise auf ihren Instrumentalwochen war entsprechend: Stücke wurden erst gesanglich einstudiert und dann auf die Instrumente übertragen.
[88] Funk-Hennings 1987, S. 42. Zumindest für Gitarre und Mandoline ist der Vorwurf der Mechanik schwer nachvollziehbar im Vergleich auch mit der als organisch angesehenen Laute (siehe Abschnitt 3.3.2). Hier spielten offensichtlich wieder ideologische Gründe eine Rolle, wahrscheinlich auch die Ablehnung der üblichen Literatur für die Instrumente.
[89] Abel-Struth 1985, S. 540ff.
[90] Siehe Abschnitt. 2.3.3.
[91] Batel 1989, S. 61.
[92] Die Prüfungsordnung wurde später weitgehend von den anderen deutschen Kultusministerien übernommen (a. a. O., S. 63).
[93] Martin 1982, S. 121. Die Prüfungsordnung von 1910 blieb allerdings übergangsweise noch bis 1927 gültig.
[94] Kestenberg mußte die Studie allerdings um seine Sozialisierungsabsichten in Bezug auf das Musikleben kürzen, da dies der konservativen Parteipolitik nicht entsprach (Batel 1989, S. 59). Außerdem wurde die kriegswichtige Geltung des Volksliedesbetont, eine Idee, die nach Batel nicht von Kestenberg stammen könne (a. a. O., S. 62). Zumindest kompromißwillig scheint er in dieser Hinsicht aber gewesen zu sein.
[95] Abel-Struth 1985, S. 540f.
[96] Abel-Struth 1985, S. 541. Diese Haltung entsprach allerdings nicht Jödes Vorstellungen, die seine Arbeit und seine Schriften durchziehen und im ‚Schaffenden Kind’ zentral behandelt werden (siehe Abschnitt 2.3.3).
[97] Funk-Hennings 1985, S. 48f.
[98] Abel-Struth 1985, S. 541.
[99] Funk-Hennings 1985, S. 51.
[100] Unter nationalsozialistischer Herrschaft wurden die Richtlinien Kestenbergs äußerlich weitergeführt, allerdings politisch entsprechend geändert, so daß die musische Grundlage dem Zweck der politischen Beeinflussung wich. Musikunterricht und auch außerschulische Musikpflege waren noch fester in staatlicher Hand als im Kaiserreich. Nach 1945 fand eine Restauration der Kestenberg-Reform statt, die diese erst voll wirksam werden ließ.
[101] Hammel 1990, S. 68.
[102] Härting, Michael (1971): Fritz Jödes ‚Weg in die Musik’. Zu den Anfängen der Singbewegung. In: Stephan, Rudolph (Hg), Musik und Politik, zit. nach Hammel ebd..
[103] Hammel 1990, S. 74.
[104] Probst-Effah 2000, S. 5.
[105] Hammel 1990, S. 74.
[106] Reinfandt 1996, S. 1583.
[107] Kolland 1979, S. 218.
[108] Vgl. Schneider 1996, S. 196.
[109] Es scheint dies wirklich ein Problem der Zeit bzw. der Generationen zu sein: In den zwanziger und dreißiger Jahren wurde Jöde als wortgewandt und mitreißend empfunden (vgl. Lemmermann 1996, S. 10). Jödes Anhänger und enger Mitarbeiter Heinrich Schumann zitierte noch 1988 begeistert unsäglich aufgeblasene und nichtssagende Texte Jödes über die Güte (Schumann 1996, S. 152f). Hier trifft Hodeks nicht immer differenzierte Kritik zu, die der Jugendmusikbewegung „eine langweilige Betulichkeit, die sich in unbeschreiblicher Verquastheit und Verquollenheit der Sprache äußerte“ nachsagt (Hodek 1996, S. 239). Auch Hildegard Krützfeldt-Junker, die in den fünfziger Jahren bei Jöde studierte, schreibt, daß den Studenten seine Sprache meist zu überschwenglich und gefühlvoll war (Krützfeldt-Junker 1996 b, S. 229).
[110] Schneider 1996, S. 190.
[111] 1920/21 bei Hermann Abert (Stapelberg 1957, S. 10).
[112] Götsch 1929, S. 965.
[113] Bei einer so großen Bewegung, die sich aus vielen unterschiedlichen Strömungen zusammensetzt, kann man natürlich nur mit Einschränkungen von einer einheitlichen Grundidee oder -ideologie sprechen. Von vielen Anhängern wurden die theoretischen Grundlagen sicher auch nicht mitvollzogen.
[114] Der sich wandelnde Begriff des ‚neuen Menschen’ hat eine lange Tradition in Philosophie und Religion, die hier näher zu beleuchten den Rahmen sprengen würde. In Zeiten des Umbruchs wurde er oft heraufbeschworen (vgl. Trautner 1996, S. 73f).
[115] Trautner 1996, S. 74.
[116] Kaiser 1987, S. 136.
[117] Smits von Waesberghe 1969, S. 37f.
[118] Ehrenforth 1987, S. 12.
[119] A. a. O., S. 13.
[120] Jöde 1962, S. 11.
[121] Ehrenforth 1987, S. 17.
[122] Jöde 1919, S. 196.
[123] Ehrenforth 1987, S. 18.
[124] Jöde 1921 b, S. 8f.
[125] Jöde 1926, S. 11.
[126] Kurth, Ernst (1917): Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Bachs melodische Polyphonie. Bern: Krompholz. Kurth beschreibt „Bachs Linearität als Muster einer kontrapunktischen Satztechnik [...], deren Wichtigstes die in der Melodik ihren Niederschlag findende Bewegungsenergie (kinetische Energie) ist“. (Stephan 1978, S. 11).
[127] Rohwer 1987, S. 24.
[128] In seiner Analyse der Invention Nr. 14 in B-Dur weist Jöde noch einmal ausdrücklich darauf hin: „[Wir] haben [...] eine klare Umkehrung, eine Spiegelung vor uns. Der musikalischen Mechanik mag das genügen, uns kann mit diesem Wissen um Stoffe nicht gedient sein. [...] Ein Durchspielen der drei Takte zeigt sofort, daß die beiden ersten Takte völlig in sich selbst ruhen, in ihren beiden Hälften sozusagen ausgependelt, gegeneinander abgewogen sind, während der dritte, der die Aufwärtstendenz seiner ersten Hälfte gleich noch einmal bringt, über sich hinausweist.“ (Jöde 1926, S. 19).
[129] A. a. O., S. 206.
[130] A. a. O., S. 207.
[131] Jöde 1926, S. 214.
[132] A. a. O., S. 215.
[133] Vgl. Rohwer 1987, S. 26.
[134] Jöde 1926, S. 12.
[135] Ebd.
[136] Jöde 1927 b, S. 138.
[137] Ebd.
[138] Indizien hierfür sind bereits, daß nicht der Lehrer einen Grundton vorgibt, sondern alle zusammen einen solchen finden; ebenso verfährt Jöde beim Finden eines gemeinsamen Schrittempos (a. a. O., S. 9 u. 16ff). Diese Vorgehensweise betont sowohl die Eigenaktivität der Schüler als auch das Erfahren die Verbindung von Musik mit Leben auch im Sinne der eigenen Körperlichkeit.
[139] Vgl. Trautner 1968, S. 126ff.
[140] In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte John Curwen in Birmingham die ‚Tonic-Sol-Fa-Method’ als Lehrmethode für den Gesangsunterricht. In Deutschland wurde die Methode durch Agnes Hundoegger weiterentwickelt und fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts als ‚Tonika-Do-Methode’ weite Verbreitung. Es handelt sich um eine Methode der relativen Solmisation, d.h. den Tonstufen der in der Tonhöhe nicht absolut festgelegten (vorerst Dur-)Tonleiter werden Namen gegeben, in der Regel die auf Guido von Arezzo zurückgehenden Silben ut/do re mi fa so la ti/si. Diesen werden außerdem bestimmte Handzeichen zugeordnet, die bereits auf die Qualität der Töne bzw. ihre Beziehung zueinander hinweisen (so wird z. B. die siebte Stufe ti durch einen nach oben weisenden Zeigefinger als zum Grundton strebender Leitton deutlich gemacht).
[141] Jöde 1927 b, S. 138.
[142] A. a. O., S. 15.
[143] Jöde 1927 b, S. 93ff.
[144] In der 1962 erschienenen Neuauflage des ‚Schaffenden Kindes’ sind als dritter zusätzlich Teil einige der ‚Lebensbilder’ enthalten, die Jöde offenbar immer noch als mit seinen Ideen übereinstimmend ansah.
[145] Jöde 1962, S. 25.
[146] Ebd.
[147] A. a. O., S. 21.
[148] A. a. O., S. 43.
[149] Ebd.
[150] Jöde 1962, S. 45.
[151] Ebd.
[152] Ebd.
[153] A. a. O., S. 45.
[154] A. a. O., S. 28ff.
[155] Jöde 1962, S. 114.
[156] A. a. O., S. 11f.
[157] A. a. O., S. 105.
[158] Jöde 1962, S. 26.
[159] A. a. O., S. 100.
[160] A. a. O., S. 107.
[161] Jöde 1962, S. 107.
[162] A. a. O., S. 108.
[163] Ebd.
[164] A. a. O., S. 106.
[165] Jöde 1962, S. 110.
[166] A. a. O., S. 109.
[167] Auf entsprechende musikalische Kriterien geht er allerdings nicht ein (ebd.).
[168] Nicht deutlich wird, ob Jöde damit auch die von der Jugendmusikbewegung weitgehend abgelehnte Avantgarde meint. Die folgende erneute Hervorhebung des melodisch orientierten Liedgutes macht das unwahrscheinlich, und Jöde scheint es zu vermeiden, auf diesen Punkt näher einzugehen. Im praktischen Teil des ‚Schaffenden Kindes’ spielt neuere Musik zudem keine Rolle.
[169] Jöde 1962, S. 116.
[170] Vgl. Kestenberg (1961): Bewegte Zeiten. Musisch-musikantische Lebenserinnerungen. Wolfenbüttel, S. 57f, nach Stumme 1987, S. 252.
[171] Jöde 1918 a, S. 76.
[172] Der spätere Führer der Finkensteiner Bewegung Walther Hensel, damals noch unter seinem eigentlichen Namen Julius Janiczek, bildete eine Gruppe in Prag (Musikgruppen der Laute, In: Die Laute 1919, abgedruckt in Archiv 1980, S. 79).
[173] Jöde 1918 a, S. 76.
[174] Jöde 1921 b, S. 82.
[175] Jöde selbst beispielsweise gründete 1921 mit Lehrerkollegen eine Musikantengilde in Hamburg, die vor allem geistliche Konzerte gab (Schumann 1996, S. 154).
[176] Jöde 1920, S. 85.
[177] Willibald Gurlitt sprach z. B. über ‚Jugendbewegung und neue Musik’, und Hindemith, der als Teilnehmer anwesend war, spielte abends seine Sonate op 25, I für Bratsche.
[178] Reusch 1926, S. 167ff.
[179] Weber 1925, S. 390.
[180] Vgl. Schaal-Gotthardt 2002, S. 121. Weitere Gelegenheiten, die Hindemith in dieser Hinsicht ergriff, waren die Professur an der Staatlichen Akademischen Hochschule für Musik in Berlin, die Kestenberg ihm 1926 anbot, und seine unentgeltliche Arbeit an der Musikschule Neukölln.
[181] Hindemith 1922, S. 8.
[182] Höckner bat Hindemith, etwas für das kleine Schulorchester seines Landerziehungsheimes zu schreiben. Dieser war von der Idee so angetan, daß er auf der Stelle - noch abends im Gasthof - begann, seine ‚Spielmusik op. 43, I, für Streichorchester, Flöten und Oboen’ zu schreiben und diese auf der gemeinsamen Rückfahrt im Zug beendete. Hindemith und Frau besuchten die Schule später zur Aufführung der Spielmusik (Höckner 1956, S. 397f).
[183] Jöde 1927 d, S. 388.
[184] Die Donaueschinger Kammermusikfeste wurden 1921 ins Leben gerufen, um jungen experimentellen Komponisten ein Forum zu geben.
[185] Schaal-Gotthardt 2002, S. 122.
[186] Hindemith 1926, S. 395.
[187] Ebd.
[188] Reusch 1927, S. 400.
[189] Schaal-Gotthardt 2002, S. 122.
[190] Götsch 1928, S. 169ff.
[191] A. a. O., S., S. 172f.
[192] Ebd.
[193] Ebd.
[194] Ameln 1927, S. 403.
[195] Ameln 1927, S. 403.
[196] Ebd.
[197] Doflein 1929, S. 406.
[198] Schaal-Gotthardt 2002, S. 124f.
[199] Zuckmayer 1929, S. 411f.
[200] Hindemith 1930, S. 43f.
[201] A. a. O., S. 43.
[202] Vgl. Briner 1978, S. 32f.
[203] Blankenburg 1933, S. 433.
[204] Die populäre Musik wie Schlager, Jazz gehörte ja ebenfalls zu den Feindbildern und kam nicht in Betracht.
[205] Kolland 1979, S. 212.
[206] Teilnehmer waren: Jöde, Fritz Reusch, Friedrich Blume, Hermann Erpf, Georg Götsch, Hilmar Höckner, Hans Hoffmann, Georg Kallmeyer, Ernst Lothar von Knorr, Ernst Mehlich, Felix Messerschmidt, Ekkehard Pfannenstiel, Herman Reichenbach, Walter Rein, Ludwig Weber, Waldemar Woehl, Eduard Zuckmayer (Kolland 1979, S. 247).
[207] Stellungnahmen abgedruckt in Archiv 1980, S. 963 - 980.
[208] Götsch 1929, S. 965.
[209] Ebd.
[210] A. a. O., S. 966.
[211] Ebd..
[212] Siehe Abschnitt 3.5.4.
[213] Er griff hierbei auf Reformen Kretzschmars (siehe Kap. 1.1.3) und Ideen des Kulturredakteurs Karl Storcks zurück, der 1913 erstmals einen Entwurf für eine Volksmusikschule veröffentlichte und auch die Bezeichnung prägte (Storck (1913): Volksmusikschulen. In: Der Türmer, H. 9/1913, nach Stumme 1987, S. 248).
[214] Siehe Abschnitt 1.2.6.
[215] Jöde 1927 c, S. 53.
[216] A. a. O., S. 55.
[217] Siehe Abschnitt 2.3.2.
[218] Jöde 1927 c, S. 53ff
[219] Daß eine äußerlich erkennbare ‚Begabung’ bereits mit früherer Förderung im Elternhaus und diese wiederum mit den wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun haben könnte, wurde allerdings noch nicht berücksichtigt.
[220] Jöde 1927 c, S. 57.
[221] 70% davon waren Mädchen. Dieser Schnitt blieb während der nächsten Jahre in etwa bestehen.
[222] Gelehrt wurden Geige, Cello, Laute, Flöte und Klavier.
[223] Jöde 1928 c, S. 713f
[224] Jöde 1922/23, S. 709.
[225] Der genaue Betrag ist mir nicht bekannt, üblich war an Volksmusikschulen aber eine Summe von etwa 10 Mark monatlich (Kolland 1979, S. 129).
[226] Schumann 1928, S. 732.
[227] Schumann 1996, S. 155.
[228] Schumann 1928, S. 732.
[229] a. a. O., S. 734
[230] Stumme 1987, S. 254
[231] Ebd.
[232] Kolland 1979, S. 120.
[233] Siehe Abschnitt 3.4.
[234] Reichenbach 1927, S. 721.
[235] Boettcher 1928, S. 750.
[236] Jöde 1927, S. 95.
[237] Götsch 1928/29, S. 891f.
[238] Siehe Abschnitt 1.2.5.
[239] Z.B. Dudelsack, Schalmeien, Zinken, Radleier, Bauernharfe, Zither, Scheitholz, Hackbrett, Trumscheit, Portativ (Götsch (1956): Musische Bildung Bd. 3, Wolfenbüttel, S. 80, zit. n. Funk-Hennings 1987 b, S. 42).
[240] Funk-Hennings 1987 b, S. 39.
[241] Böhle 1982, S. 20.
[242] Zwischen 1927 und 1930 gab es in Deutschland mehr als 5000 Mundharmonikaorchester (Funk-Hennings 1987b, S. 40).
[243] Daß man sie auch als Melodieinstrument spielen konnte, wurde dabei übersehen. In den 50er Jahren unterstützte Jöde allerdings selbst das Harmonikaspiel, da er offenbar das Potential einer solchen Volksbewegung erkannte und eigene Vorurteile abbaute (vgl. Zepf 1957, S. 172ff).
[244] Gericke (1932): Mit Blockflötenspiel allein ist es nicht getan. In: Der Blockflötenspiegel, 2. Jg. S. 183, zit. n. Funk-Hennings 1987 b, S. 41.
[245] Schmitz 1995, S. 57.
[246] Möller, Richard (1917/18): Laute und Lautenmusik. In: Die Laute, H. 1, S. 5 - 7, zit. nach Schmitz 1995, S. 62.
[247] Ebd.
[248] Die Laute der Renaissance hatte einen Knickhals und war doppelchörig, die Stimmung der Saiten bzw. Saitenpaare seit Mitte des 16. Jahrhunderts auf A d f a d’ f’ festgelegt, teils mit zusätzlichen Bordunsaiten.
[249] Schmitz 1995, S. 64, darin Möller (1917): Laute oder Gitarre, in: Die Laute, 1. Jg. 1917, S. 4.
[250] Funk-Hennings 1987 b, S. 34.
[251] Laut Jöde wird durch das Virtuosentum die Musik in den Dienst des Instruments gestellt, statt das Instrument in den Dienst der Musik, wie er es forderte. (Funk-Hennings 1987 a, S. 222).
[252] Schmitz 1995, S. 66.
[253] Jöde, Fritz (1918/19): Ein Jahr Arbeit. In: Die Laute, 2. Jg., S. 61, zit. n. Schmitz 1995, S. 61.
[254] Beispielsweise an der großen Anzahl von aus der Jugendmusikbewegung stammenden Kompositionen zu sehen, die in den Beilagen des ‚Gitarrefreunds’ publiziert wurden (Huber 1995, S. 192f).
[255] Schmitz 1995, S. 64.
[256] Vgl. Jöde 1929 a, S. 481 und Sambeth 1957, S. 92.
[257] Sambeth 1957, S. 90ff.
[258] Wobei diese eher den Zweck einer Verbildlichung der Melodiebewegung gehabt haben dürften (vgl. Sambeth 1957, S. 90 und Schumann 1931, S. 483), da die Teilnehmer nicht geschult waren, nach Handzeichen zu singen.
[259] Jöde 1929 a, S. 479.
[260] Schumann 1931.
[261] Er gab über verschiedene Lehrerverbände Fortbildungskurse in folgenden Städten: Berlin, Stendal, Königsberg, Plön, Stuttgart, Münster und Essen (Sambeth 1957, S. 94).
[262] Sambeth beschreibt die ganze Entwicklung der offenen Singstunden als zentral von Jöde ausgehend. Diese Sichtweise dürfte etwas idealisierend sein, aber sicher gab Jöde hier starke Anstöße (vgl. Sambeth ebd.).
[263] Just 1929, S. 491.
[264] Schumann 1931, S. 484.
[265] A. a. O., S. 482.
[266] Blankenburg 1932, S. 740ff.
[267] A. a. O., S. 741.
[268] Jöde 1931, S. 478.
[269] A. a. O., S. 478f.
[270] Jöde 1931, S. 478.
[271] Kallmeyer 1930, S. 188.
[272] 1945 wurde Karl-Heinz Moeseler Verlagsleiter. Der Moeseler-Verlag arbeitete mit Vertretern der nächsten Generation der Jugendmusikbewegung zusammen, wie Gottfried Wolters, Felicitas Kuckuck u.a..
[273] Z. B. zu finden in der von Gottfried Wolters herausgegebenen Reihe ‚ars musica’ des Möseler-Verlages (Nachfolger von Kallmeyer).
[274] Auf die Methodenbücher soll hier nicht näher eingegangen werden, da die wichtigen Grundideen Jödes sich in der ‚Elementarlehre’ und im ‚Schaffenden Kind’ finden, die in Abschnitt 2.3 bereits abgehandelt wurden.
[275] Jöde 1922 b, S. 87.
[276] Ehrhorn 1987, 49f.
[277] Beliebte und weitverbreitete Gesangsbücher entsprechender Art waren beispielsweise die 1907 und 1915 auf Veranlassung Wilhelms II erschienenen sogenannten ‚Kaiserliederbücher’: das ‚Volksliederbuch für Männerchor’ und das ‚Volksliederbuch für gemischten Chor’ oder der ‚Sängerhain’ von Ludwig Erk und Wilhelm Greef. Beliebte Komponisten waren in diesen Sammlungen Silcher, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann u.a..
[278] Hensel, Walther (1923): Lied und Volk, Böhmerland, S. 27f, zit. n. Jöde 1969, S. 108.
[279] Ehrhorn 1987, S. 46.
[280] Erpf 1927, S. 341.
[281] Jöde / Friedrichs, Wolfenbüttel 1924, zit. nach Antholz 1987, S. 17.
[282] Jöde (1921): Alte Madrigale. Nachwort zur 1. Auflage. Auch die jungen Komponisten der Jugendbewegung folgten zumeist dieser Einstellung (Hensel allerdings nicht).
[283] Diese pädagogische ‚Druck-Methode’ in doppeltem Sinne findet sich auch heute noch in vielen Chorbüchern, z. B. in der ‚ars musica’-Reihe (siehe Fußnote 273). Auch Vortragszeichen sind hier sehr sparsam bzw. bei alter Musik gar nicht gesetzt.
[284] Diese Entwicklung fand innerhalb der Jugendbewegung nur im Flügel der Musikantengilde statt. Im Gegensatz dazu blieb die Finkensteiner Singbewegung unter Hensel bei ihrer Konzentration auf das alte Lied (Jöde 1969, S. 177).
[285] A. a. O., S. 8ff.
[286] Jöde 1969, S. 80.
[287] Ebd..
[288] A. a. O., S. 84.
[289] A. a. O., S. 85.
[290] Jöde 1969, 165ff.
[291] A. a. O., S. 173ff.
[292] A. a. O., S. 260f.
[293] Jöde 1969., S. 260.
[294] Trautner 1968, S. 198.
[295] A. a. O., S. 199f.
[296] Jöde 1918 a, S. 77.
[297] Böhle 1982, S. 13.
[298] Jöde 1969, S. 82.
[299] Jöde 1959, S. 246.
[300] Daß Jöde den Mozart-Kanon ‚Leck mich im Arsch’ in ‚Kommt her und singt!’ umwandelte, war allerdings wahrscheinlich eher nötig, um ihn zu der Zeit überhaupt druckbar zu machen.
[301] Jöde 1959, S. 245.
[302] Es handelt sich dabei um den altenglischen Kanon ‚Sumer is icumen in’, den Jöde ins Deutsche übertrug.
[303] Jöde 1959, S. 247.
[304] Ebd.
[305] Reichenbach 1959, o. S..
[306] Jöde 1959, S. 247. In seiner ‚Organik’ bemängelt Jöde bereits den Umgang Regers und anderer mit der Form des Kanons (siehe Abschnitt 2.3.1).
[307] Aus dieser Zeit stammen beispielsweise: Meister Jakob, Ich armes welsches Teufli, CAFFEE, Es tönen die Lieder u.a..
[308] Jöde 1987, S. 57f.
[309] Vgl. Pfannenstiel 1930, S. XXVIII.
[310] Jöde 1930 b, S. 1.
[311] Ebd.
[312] A. a. O., S. 2.
[313] A. a. O., S. 3.
[314] Vgl. Kolland 1979, S. 212 (siehe auch Abschnitt 3.1.4).
[315] Schubert 1997, S. 139.
[316] Boettcher und Hindemith standen durch die Arbeit des letzteren an der Musikschule Neukölln in engem Kontakt miteinander (a. a. O., S. 138f).
[317] Boettcher 1930, S. 21.
[318] Kolland 1979, S. 213.
[319] Pfannenstiel 1930, S. XXVII.
[320] Pfannenstiel 1930, S. XXVIII.
[321] Pfannenstiel fand diesen der Aufgabe allerdings nicht gewachsen, da er zu volkstümlich und elementar sei (a. a. O., S. XXIX).
[322] Schumann 1996, S. 163ff.
[323] Das Reich hatte die ausschließliche Funkhoheit, das Reichspostministerium war zuständig für die Einrichtung von Sendestationen und die Vergabe von Sendelizenzen; faktisch wurden diese Aufgaben von der Militärbürokratie ausgeübt. Dazu kamen staatliche Kontrollmechanismen (Hecht 1995, S. 32f).
[324] Erst unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurde der Staatsfunk zum aggressiven Propagandamittel. In der Weimarer Republik führten Neutralitätsgebot und Überparteilichkeit bei den Rundfunkanstalten zu einer vorsichtigen Vermeidung politischer Themen und damit zu einer sehr blassen Berichterstattung (Grabienski 1998, S. 5 u. 33).
[325] Stoffels 1997, S. 892f.
[326] Eppinger 1924/25, S. 503.
[327] Grabienski 1998, S. 6.
[328] „Die Krönung dieses materialistischen Irrtums ist der Wahn, das Radio könne in den Dienst einer musikalischen Volkskultur treten, während doch Musik überhaupt nicht übertragen werden kann, sondern gemacht sein will.“ (Jöde, Fritz (1927). In: Badeblatt. Amtliche Fremdenliste der Stadt Baden-Baden, zit. n. Kolland 1979, S. 76).
[329] Eppinger 1924/25, S. 503.
[330] Kühn 1978, S. 48.
[331] Stoffels 1997, S. 847. Dieses Massenpublikum zu erreichen, wurde von vielen allerdings weniger als Beschränkung denn als positive Herausforderung betrachtet. Besonders Hindemith hatte mit seinem Engagement in der Laienmusik bereits vorher versucht, möglichst große Kreise anzusprechen, was ihm allerdings auch den Vorwurf von Substanzverlust seiner Musik zugunsten einer reinen ‚Spielfreudigkeit’ eintrug (Molkow 1987, S. 36).
[332] Baum 1929/30, S. 510.
[333] Das entsprach in etwa 17% der deutschen Haushalte (Baum 1929/39, S. 509 u. Grabienski 1998, S. 28).
[334] Hindemith beispielsweise war fasziniert von dem neuen Medium und schrieb Stücke für den Rundfunk, die die eingeschränkten Wiedergabemöglichkeiten berücksichtigten. Zeitweilig arbeitete er mit Brecht zusammen an Rundfunkstücken (Kühn 1978, S. 49ff).
[335] Die Kosten für die Anschaffung eines Gerätes und die Rundfunkgebühren konnten in der Zeit der Inflation von vielen Menschen nicht aufgebracht werden. Dazu kam, daß besonders auf dem Land die technischen Möglichkeiten meist eingeschränkt waren (Grabienski 1998, S. 6).
[336] Jöde 1928 a, S. 504.
[337] Jöde 1929 b, S. 507.
[338] Die von Jöde vorgeschlagenen Komponisten waren: Günther Bialas, Hermann Erdlen, Hermann Erpf, Heinrich Kaminski, Armin Knab, Ernst-Lothar v. Knorr, Christian Lahusen, Gerhard Maasz, Wilhelm Maler, Siegfried Scheffler, Kurt Thomas und Ludwig Weber (Thiel 1957, S. 133).
[339] Thiel 1957, S. 133.
[340] Just 1933, S. 514.
[341] Ebd.
[342] Schumann 1996, S. 166.
[343] Kolland 1979, S. 77.
[344] In: Badeblatt. Amtliche Fremdenliste der Stadt Baden-Baden, zit. n. Kolland 1979, S. 76.
[345] Allerdings liegen solche Gedanken heute aufgrund der Erfahrungen mit Medien wie dem Internet sehr viel näher, als es damals der Fall sein konnte.
[346] Just 1933, S. 514.
[347] Rumpf 1987, S. 101.
[348] Ebd.
[349] Wie im Abschnitt 1.1.1 beschrieben.
[350] Rumpf 1987, S. 105ff.
[351] Antholz 1996, S. 1570. Davon abgesehen ist bereits eine Bestimmung der Mitgliederzahl fast unmöglich, da es sich nicht um eine in sich geschlossene Verband nach Art eines Vereins handelte und die Meinungen darüber, welche Gruppierungen zur Jugendmusikbewegung gehörten, sehr differieren.
[352] Broschart / Tentrup 2003, S. 65ff.
[353] Hodek 1996, S. 245.
[354] Jüngere Forschungen weisen darauf hin, daß Musik eventuell entstanden ist, um Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, da die frühzeitlichen Jäger- und Sammlergruppen extrem auf soziale Beziehungen angewiesen waren (Bethge 2003, S. 139).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die deutsche Jugendmusikbewegung im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, insbesondere auf Fritz Jöde, seine pädagogischen Ansätze und sein Wirken sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schulsystems. Ziel ist es, die Bedeutung und die Einflüsse dieser Bewegung auf das heutige musikalische Leben und Musikverständnis zu analysieren.
Welches Ziel verfolgte die Jugendmusikbewegung?
Die Jugendmusikbewegung strebte die Neubelebung der Laienmusik bzw. die Schaffung einer neuen Volksmusik an. Sie setzte sich für die musikalische Früherziehung, die Popularisierung der Blockflöte und Gitarre als Instrumente für jedermann ein und vertrat die Vorstellung, dass Musizieren für alle zugänglich sein sollte.
Welche Kritik wurde an der Jugendmusikbewegung geübt?
Ab den 1950er Jahren wurde die Jugendmusikbewegung, insbesondere durch Theodor W. Adorno, heftig kritisiert. Es gab Vorwürfe, sie habe der nationalsozialistischen Bewegung durch ihre völkisch-nationale Gemeinschaftsideologie Vorschub geleistet und sich widerstandslos politisch vereinnahmen lassen.
Welche Schwerpunkte setzt Fritz Jöde in seiner Musikvermittlung?
Jöde legt Wert auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, die er ernst nimmt und in seine pädagogischen Ansätze einbezieht. Er strebt eine gesamtgesellschaftliche Veränderung durch Musik an, wobei der Musikunterricht in der Schule lediglich ein Mittel zum Zweck ist. Sein Menschenbild bildet die Grundlage all seiner Bestrebungen.
Was sind Jödes theoretische Schwächen?
Jödes theoretische Abhandlungen werden oft als unklar und polemisch kritisiert. Viele seiner Ausführungen richten sich an das Gefühl der Leser und gleiten ab "in die Vagheit bloßer Rhetorik und modischer Schlagworte." Dies erschwert es, seine Werke in wissenschaftlicher Hinsicht ernst zu nehmen.
Welche außerschulischen Aktivitäten zur Musikvermittlung verfolgte Jöde?
Jöde gründete unter anderem die Musikantengilde, Jugend- und Volksmusikschulen und belebte alte Instrumente wie die Blockflöte wieder. Er förderte das offene Singen und schuf neue Musik-Literatur, wobei er auch neue Medien wie Rundfunk und Schallplatte nutzte.
Was war die Musikantengilde?
Die Musikantengilde war eine von Fritz Jöde initiierte Organisation, die Laien-Musiziergruppen zusammenführte. Ziel war es, die Musikkultur zu erneuern und gemeinschaftliches Musizieren zu fördern.
Was sind die Kernaussagen von Jödes Hauptwerken?
Seine wichtigsten Schriften umfassen "Organik," "Elementarlehre der Musik," und "Das schaffende Kind in der Musik." Diese Werke betonen den lebendigen Umgang mit Musik, die Bedeutung des eigenen musikalischen Schaffens und die Förderung der Kreativität der Schüler.
Was ist die Kestenberg-Reform?
Die Kestenberg-Reform war eine Initiative von Leo Kestenberg, die den Musikunterricht in den 1920er Jahren reformieren sollte. Sie beinhaltete eine qualifizierte Lehrerausbildung und einen umfassenden Musikunterricht, der sich an den Bedürfnissen des Kindes orientierte. Fritz Jöde war an dieser Reform maßgeblich beteiligt.
Wie war das Verhältnis der Jugendmusikbewegung zur Politik?
Die Jugendmusikbewegung wurde zu ihrer Zeit politisch vereinnahmt und ab 1933 gleichgeschaltet. Viele Anhänger der Bewegung gingen politische Kompromisse ein, um unter der Herrschaft der Nationalsozialisten weiterarbeiten zu können.
- Citation du texte
- Rika Schütte (Auteur), 2004, Das Menschenbild Fritz Jödes und seine Bestrebungen zur außerschulischen Musikvermittlung im Zusammenhang mit der Jugendmusikbewegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110088