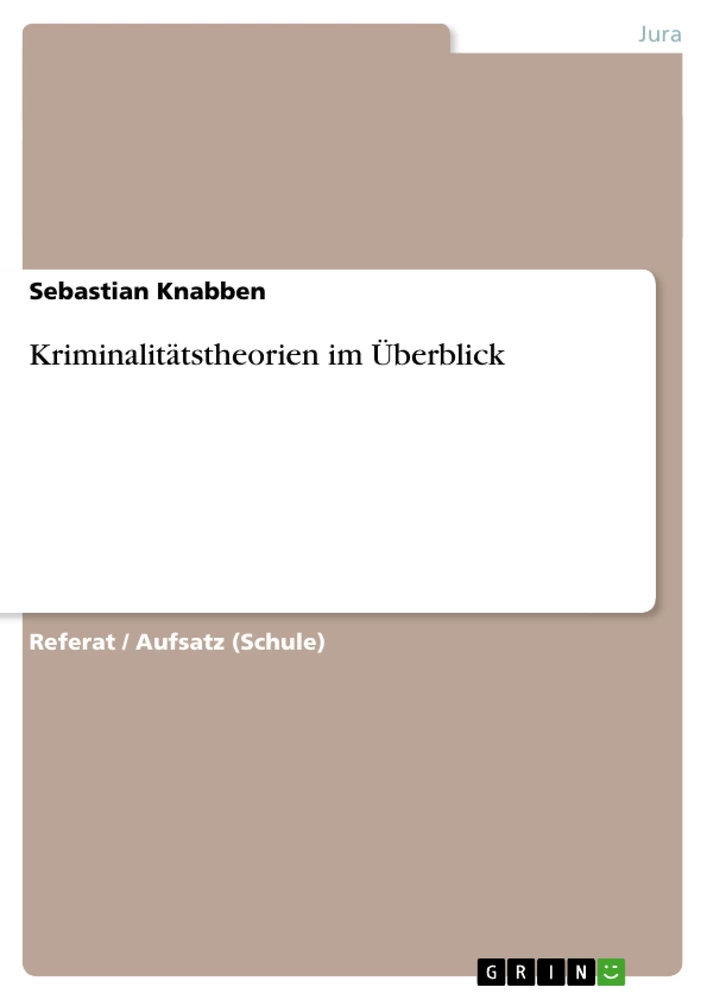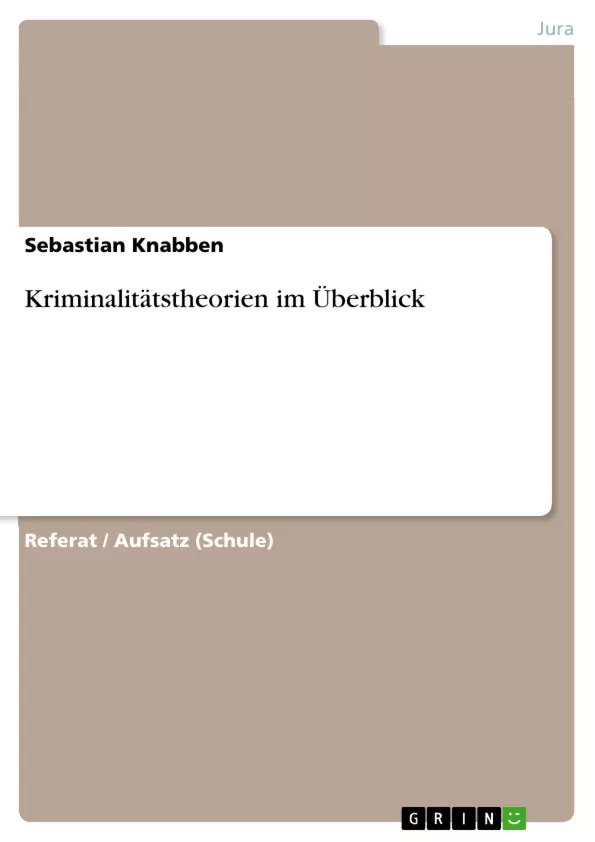Kurze tabellarische Übersicht; sehr gut zum Wiederholen geeignet; gibt Einsteigern einen sehr guten ersten Überblick, ohne gleich 50 Seiten Lehrbuch lesen zu müssen
Inhaltsverzeichnis
- A) Persönlichkeitsbezogene Kriminalitätstheorien
- 1) „Der geborene Verbrecher“ (biologische Theorie)
- 2) Zwillingsforschung (biologische Theorie)
- 3) Adoptionsforschung (biologische Theorie)
- 4) Ethologisches Triebmodell (biologische Theorie)
- 5) Tiefenpsychologisches Modell (psychologische Theorie)
- 6) Psychologische Lerntheorien
- B) Gesellschaftsbezogene Kriminalitätstheorien
- 1) Theorie der differentiellen Assoziation (sozialpsychologische Theorie)
- 2) Theorie der differentiellen Identifikation (sozialpsychologische Theorie)
- 3) Theorie der Neutralisationstechnik (sozialpsychologische Theorie)
- 4) Kontrolltheorie (sozialpsychologische Theorie)
- 5) Labeling-Approach (sozialpsychologische Theorie)
- 6) Theorie von der sekundären Abweichung (sozialpsychologische Theorie)
- 7) Anomietheorie im weiteren Sinne (soziologische Theorie)
- 8) Anomietheorie im engeren Sinne (soziologische Theorie)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat gibt einen tabellarischen Überblick über die wichtigsten Kriminalitätstheorien. Es werden sowohl persönlichkeitsbezogene als auch gesellschaftsbezogene Theorien vorgestellt und deren jeweilige Inhalte und Kritikpunkte beleuchtet. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der unterschiedlichen Erklärungsansätze für Kriminalität.
- Persönlichkeitsbezogene Kriminalitätstheorien (biologische und psychologische Ansätze)
- Gesellschaftsbezogene Kriminalitätstheorien (sozialpsychologische und soziologische Ansätze)
- Kritikpunkte und Schwächen der einzelnen Theorien
- Vergleichende Betrachtung der verschiedenen Theorien
- Empirische Fundierung und Überprüfbarkeit der Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
A) Persönlichkeitsbezogene Kriminalitätstheorien: Dieses Kapitel untersucht Theorien, die Kriminalität auf individuelle Persönlichkeitsmerkmale zurückführen. Es beginnt mit biologischen Ansätzen wie Lombrosos Konzept des „geborenen Verbrechers“, Zwillings- und Adoptionsstudien, sowie dem ethologischen Triebmodell von Lorenz. Diese Ansätze werden kritisch hinterfragt, da sie oft an empirischen Belegen mangeln und Umwelteinflüsse vernachlässigen. Im Anschluss werden psychologische Theorien betrachtet, darunter das tiefenpsychologische Modell Freuds und verschiedene Lerntheorien, die die Rolle von Konditionierung, Frustration und sozialem Lernen hervorheben. Die Kritikpunkte an diesen Theorien umfassen die Schwierigkeit, menschliches Verhalten rein auf biologische oder psychologische Faktoren zu reduzieren und die Komplexität sozialer Einflüsse zu berücksichtigen.
B) Gesellschaftsbezogene Kriminalitätstheorien: Dieser Abschnitt befasst sich mit soziologischen und sozialpsychologischen Theorien, die Kriminalität als Produkt gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse verstehen. Die Theorie der differentiellen Assoziation von Sutherland und Cressey betont den Einfluss von kriminellen Peergruppen auf das Erlernen kriminellen Verhaltens. Die Theorie der differentiellen Identifikation von Glaser erweitert diesen Ansatz, indem sie die Bedeutung der Identifikation mit kriminellen Vorbildern hervorhebt. Weitere Theorien, wie die der Neutralisationstechniken, die Kontrolltheorie und der Labeling-Approach, analysieren, wie Individuen kriminelles Verhalten rechtfertigen, welche Faktoren normkonformes Verhalten fördern und wie gesellschaftliche Reaktionen auf Kriminalität diese weiter beeinflussen. Die Anomietheorien von Durkheim und Merton schließlich erklären Kriminalität als Folge von Spannungen zwischen gesellschaftlichen Zielen und den zur Verfügung stehenden Mitteln, um diese zu erreichen. Die Kapitel beleuchten die jeweiligen Stärken und Schwächen dieser Ansätze und diskutieren ihre empirische Überprüfbarkeit.
Schlüsselwörter
Kriminalitätstheorien, Persönlichkeitsmerkmale, Gesellschaftsstrukturen, biologische Theorien, psychologische Theorien, sozialpsychologische Theorien, soziologische Theorien, Lombroso, Freud, Sutherland, Merton, Lerntheorien, Anomie, Labeling, Kontrolltheorie, differentielle Assoziation, differentielle Identifikation, Neutralisationstechniken, Empirie, Kritik.
Häufig gestellte Fragen zum Referat: Kriminalitätstheorien
Was sind die behandelten Themen im Referat?
Das Referat bietet einen Überblick über wichtige Kriminalitätstheorien. Es werden sowohl persönlichkeitsbezogene (biologische und psychologische Ansätze) als auch gesellschaftsbezogene Theorien (sozialpsychologische und soziologische Ansätze) vorgestellt. Die Inhalte, Kritikpunkte, empirische Fundierung und ein Vergleich der verschiedenen Theorien sind zentrale Bestandteile.
Welche persönlichkeitsbezogenen Kriminalitätstheorien werden behandelt?
Im Bereich der persönlichkeitsbezogenen Theorien werden biologische Ansätze wie Lombrosos "geborener Verbrecher", Zwillings- und Adoptionsforschung, das ethologische Triebmodell sowie psychologische Theorien wie das tiefenpsychologische Modell Freuds und verschiedene Lerntheorien behandelt.
Welche gesellschaftsbezogenen Kriminalitätstheorien werden behandelt?
Die gesellschaftsbezogenen Theorien umfassen die Theorie der differentiellen Assoziation und Identifikation, die Theorie der Neutralisationstechniken, die Kontrolltheorie, den Labeling-Approach, die Theorie der sekundären Abweichung und die Anomietheorien von Durkheim und Merton.
Welche Kritikpunkte werden an den Theorien geäußert?
Das Referat beleuchtet die Kritikpunkte der einzelnen Theorien. Biologische Ansätze werden für ihre Vernachlässigung von Umwelteinflüssen kritisiert. Psychologische Theorien werden für die Reduktion auf individuelle Faktoren und die Vernachlässigung sozialer Einflüsse kritisiert. Soziologische und sozialpsychologische Theorien werden ebenfalls kritisch betrachtet, wobei die jeweiligen Stärken und Schwächen sowie die empirische Überprüfbarkeit diskutiert werden.
Wie sind die Kapitel des Referats strukturiert?
Das Referat ist in zwei Hauptteile gegliedert: A) Persönlichkeitsbezogene Kriminalitätstheorien und B) Gesellschaftsbezogene Kriminalitätstheorien. Jeder Teil enthält eine detaillierte Beschreibung der relevanten Theorien, inklusive ihrer jeweiligen Kritikpunkte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Referat?
Schlüsselwörter sind: Kriminalitätstheorien, Persönlichkeitsmerkmale, Gesellschaftsstrukturen, biologische Theorien, psychologische Theorien, sozialpsychologische Theorien, soziologische Theorien, Lombroso, Freud, Sutherland, Merton, Lerntheorien, Anomie, Labeling, Kontrolltheorie, differentielle Assoziation, differentielle Identifikation, Neutralisationstechniken, Empirie, Kritik.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, das Referat enthält eine Zusammenfassung der Kapitel A und B, die die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse jedes Abschnitts prägnant darstellt.
Welches ist die Zielsetzung des Referats?
Die Zielsetzung ist es, einen tabellarischen Überblick über die wichtigsten Kriminalitätstheorien zu geben und deren jeweilige Inhalte und Kritikpunkte zu beleuchten. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der unterschiedlichen Erklärungsansätze für Kriminalität.
- Citar trabajo
- Ass. Jur. Sebastian Knabben (Autor), 2003, Kriminalitätstheorien im Überblick, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110116