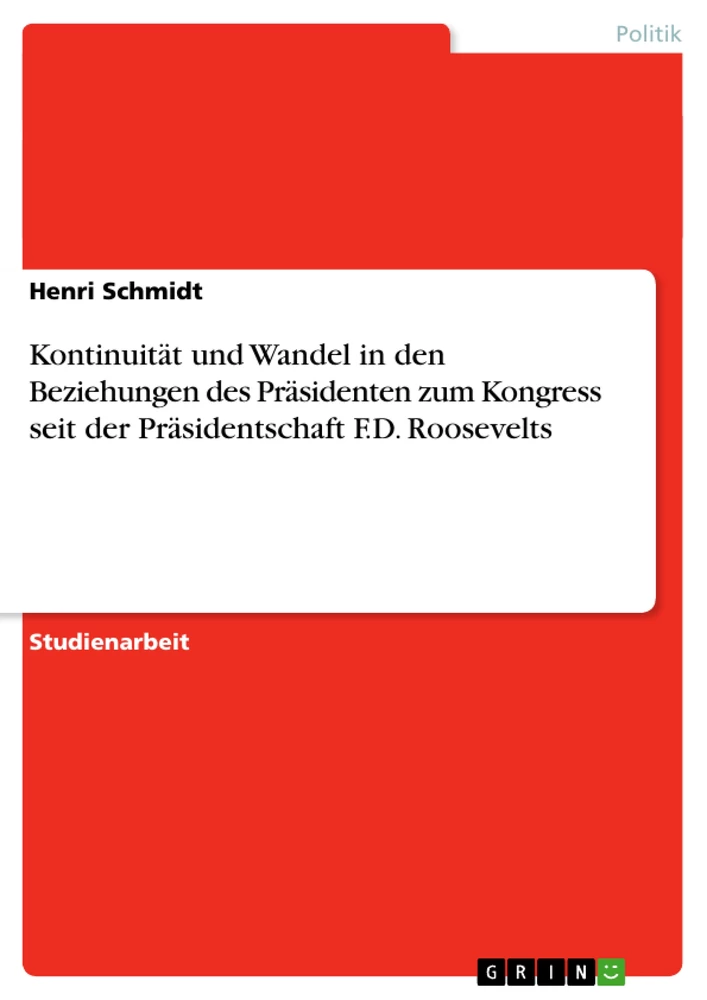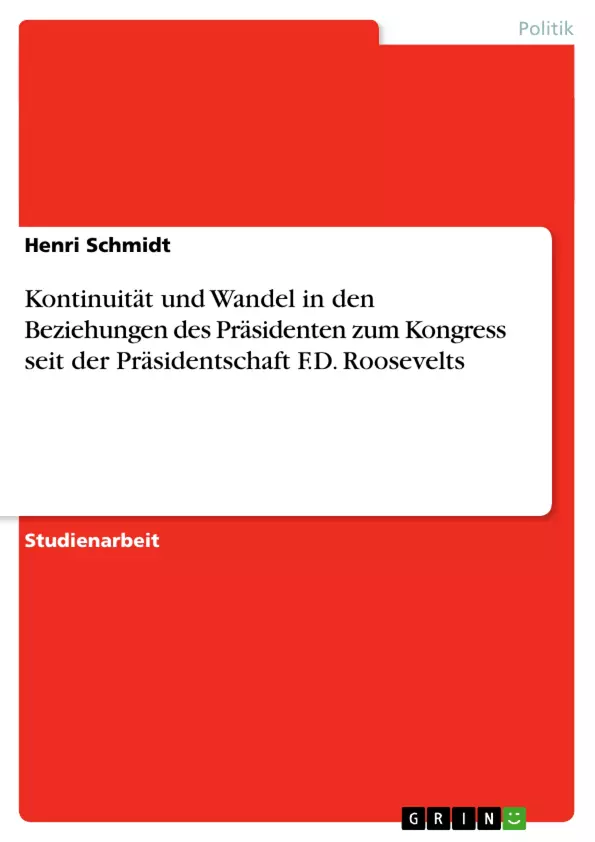Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlegende Betrachtungen und das Verhältnis von Kongress und Präsident
2.1 Organisation und Verfahrensweisen von Kongress und Präsident
2.1.1 Allgemeine Aufgabenverteilung
2.1.2 Das Gesetzgebungsverfahren
2.2 Das Prinzip der separation of powers und der checks and balances
2.3 Teilzusammenfassung
3. Veränderungen in den Beziehungen zwischen Kongress und Präsident
3.1 Der New Deal - Der Präsident wird zum Gesetzesinitiator
3.2 Der Präsident zum Impulsgeber und Chefdiplomaten in der Außenpolitik
3.2.1 Die Entwicklung der USA zur Weltmacht
3.2.2 Die Tonking Gulf Resolution
3.2.3 Exekutivabkommen zur Entmachtung des Kongresses
3.3 Teilzusammenfassung
3.4 Die Gegenreaktion des Kongresses
3.4.1 Ursachen
3.4.2 Kongressinterne Veränderungen
3.4.3 Der War Powers Act
3.4.4 Der Budget and Impoundment Control Act
3.5 Teilzusammenfassung
3.6 Die Rolle der Medien - going public
4. Zusammenfassung und Ausblick
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika behandelt die Organe „Kongress“ und „Präsident“ in zwei von einander getrennten Abschnitten. Scheinbar weißt sie den Organen auf diesem Weg auch eindeutige Kompetenzbereiche zu. Die politische Realität zeigt jedoch das Gegenteil, nämlich die enge Verbindung beider Organe und die Überschneidung bestimmter Tätigkeitsfelder. Unvermeidlich sind es Spannungen, die dieses Verhältnis prägen. Diese Spannungen drücken sich in einem fortwährenden Kampf um Kompetenzen in den zahlreichen Politikfeldern aus, der in der Vergangenheit häufig zur Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen Kongress und Präsident geführt hat. Die Analyse und Beurteilung der bedeutendsten Veränderungen im Verhältnis beider Organe seit der Präsidentschaft Roosevelts ist die Aufgabe dieser Arbeit.
Unter der Überschrift „Kontinuität und Wandel in den Beziehungen des Präsiden- ten zum Kongress seit der Präsidentschaft F.D. Roosevelts“ wird insbesondere auf die Frage eingegangen werden, ob das Verhältnis zwischen beiden Organen ins- gesamt eher von Kontinuität oder von Wandel geprägt wurde. Zusätzlich stellen sich die Fragen, in welchen Politikfeldern der Wandel gegebenenfalls am deut- lichsten war und wo genau möglicherweise Kontinuitätselemente zu finden sind. Hierzu werden die wichtigsten Einschnitte in das Verhältnis von Exekutive und Legislative näher beleuchtet, um daraus Rückschlüsse auf das Verhältnis von Kongress und Präsident ziehen zu können. Besonders interessant wird dabei sein, ob sich die Veränderungen aufgrund neuer politischer Herausforderungen oder schlicht aus der Stärke oder Schwäche des Präsidenten ergeben haben. Außer- dem erlauben die Fragestellungen eine Aussage darüber, ob vorhandene Verän- derungen nur temporär oder auf Dauer ausgelegt waren und somit zu Kontinui- tätselementen im Verhältnis von Kongress und Präsident werden.
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen vor allem die innenpolitischen Veränderungen zwischen Exekutive und Legislative. Trotzdem sind die außenpolitischen Verände- rungen keineswegs außer Acht zu lassen, da die Interdependenzen beider Politik- felder, gerade in den USA, unverkennbar sind. Außerdem sind es vor allem diese Veränderungen, die das Verhältnis besonders nachhaltig prägen können. Wie schon die jüngere amerikanische Geschichte zeigt, kann es einem außenpolitisch starken Präsidenten gelingen, seine innenpolitischen Defizite zu überspielen. Demzufolge ist eine Vernachlässigung der Außenpolitik unmöglich.
Zunächst werden im zweiten Kapitel einige grundlegende Betrachtungen über das Verhältnis von Kongress und Präsident unternommen. Dazu gehören unter ande- rem die Darstellung der allgemein durch die Verfassung vorgegebenen Aufgaben- verteilung sowie die kurze Beschreibung des Gesetzgebungsverfahrens als eines der wichtigsten Tätigkeitsfelder von Legislative und Exekutive. Nachdem kurz das Prinzip der separation of powers .rläutert wurde, werden im Kapitel drei, dem Schwerpunkt der Arbeit, einige wichtige Veränderungen zwischen Kongress und Präsident dargestellt. Hierzu gehören beispielsweise der New Deal . die Tonking Gulf Resolution . der War Powers Act .nd der Budget and Impoundment Control . Act . Im Kapitel 4 werden dann eine kurze Synopse der wichtigsten Erkenntnisse sowie die Beantwortung der zentralen Fragestellung erfolgen.
Diese Gliederung macht es möglich eine sowohl chronologische aber auch inhaltlich zusammenhängende Bearbeitung des Themas vorzunehmen. Hierzu werden zunächst Grundlagen für das Verständnis der Arbeit gelegt. Danach werden Aspekte des Machtausbaus des Präsidenten gekennzeichnet, um dann wiederum die Gegenreaktion des Kongresses näher zu beschreiben. Obwohl Legislative und Exekutive hier, der Analyse wegen, häufig voneinander getrennt betrachtet werden, sollten sie doch zumindest immer gemeinsam bedacht werden.
Der Forschungen zu diesem Thema sind bereits sehr umfangreich, wobei stetige Wandlungen, bis in die Gegenwart hinein, immer wieder neue Untersuchungen notwendig machen. Die Literaturlage ist demzufolge ebenfalls sehr gut, sowohl im deutschsprachigen als auch im englischsprachigen Bereich. Ausgewählt habe ich vor allem die einschlägigste Literatur, die immer wieder im Zusammenhang mit der Untersuchung des amerikanischen Regierungssystems genutzt wird.
2. Grundlegende Betrachtungen und das Verhältnis von Kongress und Präsident
In diesem Abschnitt sollen einige Grundlagen für das weitere Verständnis der Gesamtarbeit gelegt werden. Hierzu werden vor allem die durch die Verfassung zugewiesenen Aufgaben sowie das allgemeine Verhältnis zwischen Präsident und Kongress dargestellt.
2.1 Organisation und Verfahrensweisen von Kongress und Präsident
Bildung, Zuständigkeiten und Organisation des Kongresses als Staatsorgan sind im ersten Artikel der Bundesverfassung, welcher etwas mehr als die Hälfte des gesamten Verfassungstextes ausmacht, geregelt. Alle durch die Verfassung der USA verliehene gesetzgebende Gewalt liegt beim Kongress, welcher aus zwei Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus besteht.1Der Kongress setzt sich heute aus insgesamt 535 Mitgliedern zusammen, von denen 100 dem Senat und 435 dem Repräsentantenhaus angehören. Die Senatoren werden von den Wählern ihres Staates gewählt. Jeder Unionsstaat entsendet zwei Senatoren, die alle sechs Jahre2neu gewählt werden. Dahingehend werden die Repräsentanten in ungefähr gleich großen Wahlkreisen gewählt und befinden sich nahezu im stän- digen Wahlkampf, da ihr Mandat auf zwei Jahre beschränkt ist.3Während die Rep- räsentanten also den Willen der wahlberechtigten Bürger zum Ausdruck bringen sollen, soll der Senat, als einzelstaatliche Interessenrepräsentation, im bundespo- litischen Willensbildungsprozess mitwirken.
Aufgrund der Größe des Repräsentantenhauses sind striktere Regelungen der Verfahrensweisen notwendig. Dagegen sind die Prozeduren im Senat wesentlich informeller, begründet durch die oft jahrzehntelange Zusammenarbeit der Senatoren. Der Kongress ist ein Ausschussparlament in dessen politischen Entscheidungsprozess Fraktionen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Der Einfluss von Interessengruppen, so genannten informal caucuses .Interessengruppierungen) sowie die enge Wahlkreisbindung sind dagegen entscheidende Faktoren in der täglichen Arbeit der Kongressmitglieder. Der Kongress verfügt über eine Vielzahl von Mitarbeiterstäben und Hilfsdiensten, um der zunehmenden Zahl und Komplexität der Aufgaben gerecht werden zu können. Darüber hinaus steht dem Kongress zu, sich selbst zu organisieren und zu verwalten.4
Der Präsident vereinigt die Ämter des Staatsoberhauptes und des Regierungs- chefs in einer Person, bei ihm liegt die vollziehende Gewalt. Das Wahlverfahren für den Präsidenten ist sehr komplex. Er wird zumindest formal nicht von den ame- rikanischen Bürgern sondern von einem Wahlmännerkollegium gewählt. Dieses besteht aus insgesamt 538 Delegierten aus den 50 Bundesstaaten. Praktisch handelt es sich jedoch um eine direkte Volkswahl, da die Wahlmänner schon seit langem gesetzlich dazu verpflichtet sind, den Kandidaten zu wählen, auf den auch die Mehrheit der Wählerstimmen entfallen wäre. Eine Ausnahme bestünde im Fal- le des Vorhandenseins von populären Drittkandidaten und einer dadurch verpass- ten absoluten Mehrheit. Hier wäre dann die Wahl des Präsidenten im Repräsen- tantenhaus notwendig. Die Präsidentschaftswahlen finden alle vier Jahre statt, wobei seit 1952 der Präsident nur noch ein Mal wiedergewählt werden darf.5
Schon im Verfassungskonvent von Philadelphia bestanden zahlreiche Diskussio- nen über die Beschaffung des Präsidentenamtes. Neben grundlegenden Fragen über Wahlmodus und Dauer der Amtszeit interessierte vor allem die Machtfülle des Amtes. Ziel sollte es sein, eine Balance zwischen Exekutive und Legislative zu schaffen.6Auf diesen Aspekt wird vor allem im Abschnitt 2.2 noch weiter einge- gangen werden.
2.1.1 Allgemeine Aufgabenverteilung
Die Verfassung beschreibt die Zuständigkeiten von Kongress und Präsident in recht allgemeinen Worten. Die Kompetenzgrenzen sind daher ungenau und vor allem fließend.
Der Kongress ist kein Parlament, dem es möglich ist, der Regierung das Misstrauen auszusprechen. Die Gesetzgebung ist daher die höchste politische Sanktionsgewalt. Zwar ist der Präsident auf dem Wege der Amtsanklage ( impeachment . aus seinem Amt enthebbar. Jedoch ist dies allein aufgrund nachgewiesener krimineller Handlungen durchführbar.7
Die Hauptaufgabe des Kongresses liegt im Bereich der Gesetzgebung. Die Bun- desverfassung enthält allerdings eine längere Aufzählung der Befugnisse des Kongresses. Besonders erwähnenswert sind dabei die Rechte der Festsetzung und Einziehung von Zöllen, Münzprägung, Außenhandelsregulierung, Bildung von Bundesgerichten, Aufstellung und Unterhaltung von Armee und Flotte sowie das Recht zur ausschließlichen und uneingeschränkten Gesetzgebung in zahlreichen Feldern. Neben der generellen Gesetzgebungskompetenz erhielt der Kongress zusätzlich die Möglichkeit, genauestens zu bestimmen, wozu und wie viele Gelder aus der Staatskasse entnommen werden dürfen ( power of the purse .. Im Zusam- menhang mit der allgemeinen Gesetzgebungskompetenz begründet dies die weit reichende Sanktionsgewalt des Kongresses gegenüber der Exekutive. Nicht ge- setzgeberische Kompetenzen befinden sich zudem im Bereich der Mitwirkung bei Verfassungsänderungen sowie der Wahl von Präsident und Vizepräsident. Ganz besonders wichtig ist diesbezüglich auch noch die Möglichkeit der Mitwirkung des Senats bei der Ernennung von Regierungsmitgliedern und Bundesrichtern. Zu den bestehenden Kompetenzen kam 1946 im Rahmen des Legislative Reorganisation . Acts .och das Untersuchungsrecht hinzu.8
Auch dem Präsidenten obliegen verschiedene Aufgaben. Er steht immer wieder im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses, er stiftet eine nationale Identität und wird zudem häufig zu einer Art imperialen Figur stilisiert. Er ist nach der Verfassung und der Verfassungswirklichkeit mit Kompetenzen ausgestattet wie kein anderer Regierungschef in einer Demokratie.9Prinzipiell kann der Präsident alle Politikfel- der abdecken, die nicht ausschließlich der Legislative zugeordnet sind.10Zunächst einmal ist der Präsident der Führer seiner Partei. Zwar ist er nicht formell dessen Vorsitzender, dies würde seiner Überparteilichkeit widersprechen, jedoch gilt er als Machtzentrum und Aushängeschild, wobei das Verhältnis ständigem Wandel un- terworfen und in starker Abhängigkeit zur Person des Präsidenten steht. Des Wei- teren ist der Präsident als Chef der Exekutive damit beauftragt, die Gesetze des Bundes zu vollziehen. Hierzu bedient sich der Präsident eines umfangreichen Verwaltungsapparates in dem er selbst als Manager gefordert ist. Die Möglichkeit zu delegieren wird dabei von den einzelnen Präsidenten sehr unterschiedlich wahrgenommen. Außerdem ist der Präsident Chefdiplomat in der Außenpolitik und darüber hinaus Oberkommandierender der Streitkräfte.
Allerdings sind auch im Bereich der Kriegsgewalt Kompetenzteilungen zwischen Kongress und Präsident vorhanden, auf die später noch einzugehen sein wird.11
2.1.2 Das Gesetzgebungsverfahren
Prinzipiell muss hier zunächst vorweg genommen werden, dass, anders als von der Verfassung vorgesehen, heute einer Vielzahl der Gesetzesvorlagen aus der Exekutive kommen. Diese werden dann von Kongressabgeordneten eingebracht, die dem Präsidenten nahe stehen.12
Nachdem die Gesetzesvorlage formell eingebracht worden ist, geht sie zumeist an einen oder mehrere Ausschüsse, von dort an einen Unterausschuss und wieder zurück. Viele der Gesetzesvorhaben scheitern bereits hier. Eine weitere Hürde stellt das Rules Committee .es Repräsentantenhauses dar. Es bestimmt die Be- dingungen unter denen ein Gesetz im Plenum behandelt wird. Dadurch kann es den Fortgang der Gesetzgebung deutlich beeinflussen. Im Senat ist kein entspre- chender Ausschuss vorhanden. Nach der Verabschiedung im Plenum des einen Hauses geht die Vorlage weiter zur Behandelung in die zweite Kammer des Kon- gresses. Hier wiederholt sich der Beratungsprozess noch einmal in ähnlicher Wei- se. Im Falle von abweichenden Vorlagen durch die beiden Kammern wird das mit dem deutschen Vermittlungsausschuss vergleichbare „ conference committee . eingeschaltet, in welchem dann ein Konsens angestrebt wird, der dann wiederum von beiden Häusern bestätigt werden muss.13
Jedes vom Kongress verabschiedete Gesetz benötigt im Anschluss die förmliche Zustimmung des Präsidenten. Diese Zustimmung kann der Präsident durch seine Unterschrift unter das Gesetz erteilen. Bei einem Veto des Präsidenten, d.h. ei- nem schriftlichen Widerspruch gegen das Gesetz, kann der Beschluss nicht in Kraft treten. Das Veto des Präsidenten kann durch eine Zweidrittelmehrheit in bei- den Häusern des Kongresses außer Kraft Gesetz werden, jedoch ist die Findung einer solchen Mehrheit meist unmöglich. Dem Präsidenten bleibt eine 10 Tages- Frist für ein mögliches Veto. Vertagt sich der Kongress in dieser Zeit, greift das Veto auch ohne die schriftliche Ablehnung durch den Präsidenten ( pocket veto ..14
Präsident Roosevelt setzte die Möglichkeit des Vetos zudem erstmals auch in der Finanzgesetzgebung ein.
An dieser Stelle soll noch kurz auf den Unterschied von divided .nd unified . go- vernment .ingegangen werden. Während das divided government .ine Phase gegensätzlicher parteipolitischer Kontrolle von Kongress und Präsidentenamt be- schreibt, steht das unified government .ür eine gleiche parteipolitische Kontrolle beider Institutionen. Nach dem zweiten Weltkrieg war fast ausnahmslos das divi- . ded government .as übliche Machtverteilungsmuster, wobei sich in der Regel ein demokratisch kontrollierter Kongress und ein republikanischer Präsident gegenü- berstanden. Clinton sah sich 1994 einem republikanisch kontrollierten Kongress gegenüber und war damit erst der zweite demokratische Nachkriegspräsident, der sich dem divided government .u stellen hatte. Diese parteipolitischen Machtvertei- lungsmuster haben, so die Ansicht vieler Autoren, zumindest einen Einfluss auf den Verhandlungsstil in der legislativen Arena.15Im Allgemeinen sind Phasen des unified government .her durch Kooperation, Phasen des divided government .her durch Diskussion gekennzeichnet. Somit ist zumindest ein Einfluss auf den Hand- lungsspielraum des Präsidenten denkbar, der sich seit den 1980er Jahren durch die gestiegene Parteipolitisierung des Kongresses noch deutlich verstärkt.16Eine genauere Ausführung ist in dieser Arbeit leider nicht möglich, jedoch sollte zumin- dest kurz der Einfluss der Konstellationen auf den legislativen Entscheidungspro- zess skizziert werden.
2.2 Das Prinzip der separation of powers .nd der checks and balances .
Bei der Beschreibung des amerikanischen Regierungssystems ist häufig die Rede von einer völligen Gewaltenteilung ( separation of powers .. Grundlage hierfür ist der Vergleich zwischen dem präsidentiellen Regierungssystem der USA mit dem in Europa vorherrschenden parlamentarischen Regierungssystem. Als Unter- schiede können zum Beispiel die getrennten Wahlen von Kongress und Präsident, das fehlende Recht zur Abberufung der Regierung durch den Kongress, die n- kompatibilität von Legislative und Exekutive oder auch das fehlende Gesetzesiniti- ativrecht des Präsidenten genannt werden. Diese Unterschiede deuten tatsächlich auf eine strenge Trennung der Gewalten hin. Zumindest gelten restriktivere Be- stimmungen als im parlamentarischen System.17
Jedoch sind durchaus auch Elemente in der Verfassung zu finden, die von dieser strikten Trennung absehen. Als Beispiel hierfür ist das Amt des Vizepräsidenten zu nennen. Er hat als Präsident des Senates und damit als Teil der Legislative bei Stimmengleichheit der Senatoren die entscheidende Stimme. Dieses Amt wird also umso wichtiger, je knapper die jeweiligen Senatsmehrheiten sind. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass der Vizepräsident im Falle, dass dem Präsidenten etwas zustößt, dieses Amt übernimmt.18
Schon bei der Verfassungskonstituierung war allerdings bekannt, dass gar keine absolute Gewaltenteilung gewollt war. So verteidigte James Madison .n den Fede . ralist Papers .iese Idee damit, dass eine Gewaltenteilung überhaupt nur funktionieren könne, wenn Gewaltenvermischung bis zu einem bestimmten Grade vorhanden sei. Gerade deshalb sprechen die Amerikaner auch heute nur selten isoliert vom Prinzip der separation of powers . sondern betonen daneben auch immer das Prinzip der checks and balances .19
In der Praxis stehen die gewaltenteilenden Elemente also völlig gleichwertig neben den gewaltenvermischenden Elementen.
2.3 Teilzusammenfassung
Die Beziehungen zwischen Kongress und Präsident sind durch die Verfassung keinesfalls eindeutig ausgeführt worden. Aufgaben und Kompetenzen überschneiden sich sowohl im Bereich der Innenpolitik als auch im Bereich der Außenpolitik. Die Beziehungen zwischen Kongress und Präsident finden häufig eine Prägung durch den jeweiligen Präsidenten. Das Gesetzgebungsverfahren ist kompliziert, Gesetzesinitiativen kommen immer häufiger, zumindest informell, aus der Exekutive. Eine vollständige Gewaltenteilung besteht nicht. Oft wird von einer allmächtigen, imperialen Herrschaft des Präsidenten gesprochen.
Auf der anderen Seite existiert die Gegenthese, nämlich die der Herrschaft des Kongresses.20Wo die Kompetenzen tatsächlich liegen, bedarf im Folgenden einer näheren Untersuchung.
3. Veränderungen in den Beziehungen zwischen Kongress und Präsident
Im folgenden Kapitel sollen die Kompetenzverschiebungen zwischen Kongress und Präsident untersucht werden.
3.1 Der New Deal . Der Präsident wird zum Gesetzesinitiator
Wie bereits im Punkt 2.1.2 geschildert, tritt der Präsident mehr und mehr als Ge- setzesinitiator in Erscheinung, obwohl dies von der Verfassung keinesfalls so vor- gesehen war. Er bedient sich dabei an informellen Kontakten zu nahe stehenden Kongressabgeordneten, die formal die Gesetzesvorhaben der Exekutive in das Plenum einbringen.
In der Geschichte war dieser Weg lange vollkommen ungenutzt. Erst Franklin D. . Roosevelt .elang es 1933 in seiner ersten Präsidentschaft aktiv als Teilnehmer und Vorantreiber im Kongress aufzutreten. Grund dafür war die Weltwirtschaftskri- se, die ihren Ursprung in den USA fand und immer weiter voranschritt. Die Idee der freien Marktwirtschaft schien gescheitert. Das Vertrauen in den Marktprozess war verloren. Firmenzusammenbrüche und Arbeitslosigkeit kennzeichneten das tägliche Leben, so dass politische Eingriffe notwendig wurden, um die Situation zu retten. Die amerikanische Öffentlichkeit blickte vor allem auf den Präsidenten, der neue Auswege suchen sollte. Wirtschafts- und sozialpolitische Reformen verspra- chen diesbezüglich eine Besserung der bestehenden Verhältnisse. Unter dem Regierungsmotte des New Deal .chaffte es Roosevelt .n den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit eine Serie von Gesetzgebungsinitiativen in den Kongress einzu- bringen, die es ohne Mühe schafften, den Kongress zu passieren.21
Roosevelt .egegnete der Herausforderung also mit einer bis heute in Friedenszei- ten beispiellosen Interventionspolitik. Helms .pricht gar von einem „Feuerwerk präsidentiellen Aktivismus“.22Er prägte seine Amtszeit damit bis an die Grenzen seiner Möglichkeiten. Sein Leitmotiv war die Tatsache, dass die Nation eine Interessengemeinschaft ist, in der alle voneinander abhängig sind. Roosevelt .erkörperte nicht nur den Führer und Sprecher sondern auch den Erzieher der Nation. Diesbezüglich war sein politikfeldübergreifender Ansatz besonders wichtig. So hing seines Erachtens der innere Wohlstand der USA unmittelbar auch mit dem Schicksal Europas und Asiens zusammen. Das Einzige, was die Nation seines Erachtens zu fürchten hatte, war die Furcht selbst.23
Zur Umsetzung seiner Vorstellungen bediente er sich vor allem seines rhetori- schen Talents, welches er auch in Rundfunk und Presse souverän einzusetzen wusste. Sein erster gesetzgeberischer Eingriff betraf das Geld- und Kreditwesen mit den Zielen der Reform des chaotischen Bankwesens, der Überwachung und Kontrolle des Handels mit Wertpapieren und die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für eine Inflationspolitik des Staates. Zu den tiefsten Eingriffen gehör- ten die Hilfsmaßnahmen für die Landwirtschaft. In diesem Wirtschaftsbereich wur- de der Versuch unternommen, Preise und Mengen zu regulieren. Als sofortige Maßnahme wurden beispielsweise 6 Millionen Ferkel geschlachtet. In diesem Zu- ge wurde zusätzlich eine staatliche Aufkaufstelle zur Unterstützung der Preisni- veaus geschaffen.24
Die Überproduktion gab auch Anlass zum Eingriff in den industriellen Sektor. Hier sollten Regeln für einen fairen Wettbewerb geschaffen werden. Die Arbeiterschaft erhielt zudem erstmals ein Recht zu freier überbetrieblicher Organisation und zu kollektiven Tarifverhandlungen. Außerdem wurden noch Mindestlöhne und Höchstarbeitszeiten versprochen. Der sozialen Sicherheit der Arbeiter dienten wei- terhin auch umfangreiche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Gesetze zur Ar- beitslosenversicherung und Altersversorgung, auch wenn diese mehr oder minder als unzulänglich gewertet werden können. Jedoch war ein erster Grundstein auf dem Weg vom liberalen „Nachtwächterstaat“ zum amerikanischen Sozialstaat ge- legt. Der liberale Wirtschaftsgedanke konnte in den USA allerdings schnell wieder die Oberhand gewinnen.25
Obwohl viele von Roosevelts .eformen erfolgreich waren, wurde ihm nur wenige Jahre später, in seiner zweiten Amtszeit, sein Second New Deal .einahe ausnahmslos verweigert. Allerdings hat sich die Erwartungshaltung der amerikanischen Öffentlichkeit seither dahingehend verändert, dass sie die Aktion des Präsidenten als Gesetzesinitiator und seine Interventionen in sozialen Notlagen erwarten. Inzwischen ist es Normalität, dass jeder Präsident seinen Wahlkampf mit Unterstützung von großen Gesetzesvorhaben führt.26
Der insgesamt veränderten Rolle des Präsidenten wurde schon 1939 Rechnung getragen, indem ihm das Executive Office of the President .ur Seite gestellt wur- de, welches ihm fortan in seinem erweiterten Aufgabenspektrum unterstützen soll- te. Vor allem sollte es ihm die Rolle als Gesprächs- und Verhandlungspartner des Kongresses erleichtern. Ganz besondere Erwähnung verdient diesbezüglich noch das Office of Congressional Relations .essen Organisation vollständig am Kon- gress orientiert ist und als Lobbying- Organisation des Präsidenten im Kongress wirkt. Hierzu nutzt es Kontakte zu besonders einflussreichen Mitgliedern des Kon- gresses, um legislative Anliegen und die Agenda des Präsidenten zu unterstützen. Angewandte Mittel sind dabei vor allem die Überredung, Unterstützungsverspre- chungen, Blockierungsandrohungen, Bundesmittelzuweisung und -verweigerung. Im Falle von ganz besonders wichtigen Entscheidungen greift auch der Präsident selbst, über persönliche Gespräche zu bestimmten Kongressmitgliedern, in den Prozess ein.27
Dennoch ist einschränkend und resümierend zu sagen, dass, anders als in den meisten europäischen Ländern, die Gesetzesinitiative nicht weitgehend vom Par- lament an die Exekutive abgegeben wurde. Gesetze haben vielerlei Ursprünge und besonders die Ausschüsse des Kongresses bleiben dabei eine wichtige Triebkraft. Der Bedeutungsgewinn des Präsidenten im legislativen Prozess ist e- doch unverkennbar. Kurt Shell .ennt hier ergänzend den Begriff der „exekutiven Gesetzgebung“28mit dem er Formen von delegierter Gesetzgebung an den Präsi- denten ( rules, orders . bezeichnet, die aus der zunehmenden Komplexität und Notwendigkeit von Flexibilität in der Anwendung von Gesetzen resultiert.
Schlussendlich stellt sich nun noch die Frage nach der Bewertung des New Deals .
Diese Frage ist bis heute sehr umstritten. Unbestritten ist dagegen, dass Roose- velt die Massen mit seiner Botschaft einer verantwortlichen Regierung erreichte. Darüber hinaus gab er der amerikanischen Bevölkerung neue Hoffnung und sorg- te für den sozialpolitischen Eintritt ins 20. Jahrhundert. Mit seiner Politik, vor allem durch seine zahlreichen Gesetzesinitiativen gab er dem Präsidentenamt ein neues Gewicht. Die Anfänge der imperial presidency .ehen damit eindeutig auf ihn zu- rück. Auf der anderen Seite darf aber nicht vergessen werden, dass Not und Ar- beitslosigkeit zwar gelindert, aber längst nicht beseitigt werden konnten. Die sozi- alpolitischen Ansätze waren nicht tief greifend genug und nicht organisierte Bevöl- kerungsgruppen, wie Schwarze und andere Minderheiten, blieben außen hervor. Die eigentliche Beendigung der Wirtschaftskrise konnte erst durch den Wirt- schaftsaufschwung der Nachkriegsproduktion erreicht werden.29
3.2 Der Präsident zum Impulsgeber und Chefdiplomaten in der Außenpolitik
In diesem Abschnitt wird auf Veränderungen im außenpolitischen Bereich eingegangen. Hierzu werden zunächst verfassungsrechtliche Aspekte beschrieben werden um dann auf die einzelnen Veränderungen einzugehen. Zentraler Untersuchungsgegenstand sind die so genannten War Powers .außen- und sicherheitspolitische Machtbefugnisse).
Das Ringen um außenpolitische Kompetenzen und die Gestaltung der internationalen Beziehungen zwischen Kongress und Präsident ist so alt wie die beiden Institutionen selbst.30Dies wiederum bestätigt die bereits oben angesprochene These, dass die Kompetenzverteilungen insgesamt oft nur vage formuliert sind.
3.2.1 Die Entwicklung der USA zur Weltmacht
Ganz besonderen Einfluss auf dieses Politikfeld nahm die Entwicklung der USA zur Weltmacht. Präsident Wilsons .ersuch, die USA zu einem dauerhaften Akteur in der Weltpolitik zu machen, scheiterte noch an der verweigerten Ratifizierung des Versailler Vertrages durch den Senat. Die Intervention in den zweiten Welt- krieg änderte das isolationistische Weltbild jedoch deutlich. Der Überfall der Japa- ner auf Pearl Harbor .rug mit Sicherheit deutlich zur Aufgabe des Isolationismus bei. Schließlich war die USA niemals zuvor einer so unmittelbaren Bedrohung ausgesetzt. Neue, komplexe Herausforderungen in diesem Sinne erleichterten den Machtausbau der Exekutive.31Der Präsident profitierte in seinem öffentlichen Ansehen weitaus mehr als der Kongress vom Aufstieg der Vereinigten Staaten zur globalen Supermacht. Das Auftreten des Präsidenten als Chef Diplomat in den Kriegskonferenzen (hauptsächlich Jalta) unterstreicht dies zusätzlich.32
Dem Präsidenten wuchsen Kompetenzen weit über die Verfassung hinaus, als „notwendige Aspekte nationaler Souveränität“33, zu. Die Außenpolitik gewann so an Bedeutung, die Mitarbeiterzahlen stiegen und das Konfliktpotential zwischen Kongress und Präsident nahm, bedingt durch zahlreiche Krisen34in der Folge des zweiten Weltkrieges, zu.
Im Bereich der War Powers .teht dem Kongress verfassungsrechtlich gesehen das Kriegserklärungsrecht zu. Der Kongress hat somit allein die Möglichkeit, formell Krieg zu erklären. Darüber hinaus obliegen dem Kongress noch weitere Befugnisse, zum Beispiel im Bereich der Ratifizierung von Verträgen oder der Zuweisung von Geldern. Dem Präsidenten ist dagegen die Kommandogewalt über die Streitkräfte in die Hand gelegt worden. Er ist Oberkommandierender der Streitkräfte, kann militärische Aktionen führen und auch exekutive Abkommen schließen. Der Präsident verfügt weiterhin über das Recht, Überraschungsangriffe abzuwehren, hierzu muss er den Kongress nicht konsultieren.35
Während die veränderte weltpolitische Rolle der USA den Präsidenten nun in ei- nem ganz anderen Licht erscheinen ließ, wirkte die Legislative schwach. Der Prä- sident riss die außenpolitische Macht, so auch das Kriegserklärungsrecht, nach und nach an sich. Der Kongress sei zu groß für schnelle Entscheidungen. Die Ver- fassung gab keinerlei Auskunft über die wirkliche Macht der Exekutive. Die ersten Nachkriegspräsidenten konnten auch deutlich von dieser schwachen Legislative profitieren.
Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete die Präsidentschaft Johnsons . Symbol der präsidentiellen Dominanz wurde die Tonking Golf Resolution .om August 1964.36
3.2.2 Die Tonking Gulf Resolution
Die Tonking Gulf Resolution . die mit nur zwei Gegenstimmen im Kongress ange- nommen wurde, kann als freiwillige Abgabe von sicherheitspolitischen Kompeten- zen seitens des Kongresses gesehen werden. Der Resolution waren, laut Exekuti- ve, Angriffe auf amerikanische Patrouillenbote am 02. und 04. August 1964 durch Nordvietnam vorausgegangen. Die Legislative konnte sich diesbezüglich kein voll- ständiges Lagebild machen, da ihr der Zugang zu wichtigen Informationen fehlte.37
Johnson .ekam mit der Resolution eine Blankovollmacht für die Kriegsführung in Indochina ausgestellt. Czempiel .ezeichnet die Resolution, verfassungspraktisch gesehen, als den Höhepunkt der „imperialen Präsidentschaft“, da der Kongress durch diese Resolution sein Recht zur Kriegserklärung freiwillig an die Exekutive abtrat.38
Insbesondere zwei Stellen in der Tonking Gulf Resolution .eigen, dass der Kon- gress die Verantwortung über den Militäreinsatz in Vietnam voll in die Hände des Präsidenten legte. Erstens: „[…] daß der Kongreß die Entschlossenheit des Präsi- denten, als Oberbefehlshaber, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um jeden bewaffneten Angriff auf die Streitkräfte der Vereinigten Staaten zurückzu- schlagen und weitere Angriffe zu verhindern, gutheißt und unterstützt.“39Somit war der Präsident befugt alle Maßnahmen anzuwenden, die er für wichtig und rich- tig im Kampf gegen den kommunistischen Einfluss in Vietnam erachtete, ohne dabei die Einmischung des Kongresses fürchten zu müssen. Zudem lieferte der Kongress dem Präsidenten die Legitimationsbasis, indem er das Recht des Präsi- denten als Oberbefehlshaber betonte. Weiterhin wurde durch die Formulierung:
„Diese Entschließung läuft aus, wenn der Präsident feststellt, […]“40, auch dass Ende der Maßnahmen in den Verantwortungsbereich der Exekutive übertragen.
Allerdings hielt sich der Kongress zumindest die theoretische Möglichkeit offen, mit Hilfe einer concurrent resolution .ie Tonking Gulf Resolution .u widerrufen, um selbst die Entscheidung über den weiteren Verlauf des Vietnamkrieges zurückzu- erlangen.41
Nixon, Johnsons Nachfolger im Präsidentenamt, legte kaum Wert auf legislativen Rückhalt. So führte er den Vietnamkrieg aufgrund seiner Vollmachten als Oberkommandierender der Streitkräfte weiter. Die inzwischen in Missgunst geratene Tonking Gulf Resolution .ab er als Begründung auf.42
3.2.3 Exekutivabkommen zur Entmachtung des Kongresses
Exekutivabkommen ( executive agreements . sind außenpolitische Abkommen, die dem Präsidenten die Möglichkeit geben, sich von der Zweidrittelmehrheit im Senat in völkerrechtlichen Entscheidungen zu lösen. Im Gegensatz zu völkerrechtlichen Verträgen sind Exekutivabkommen von der Zustimmung dieser Mehrheit unab- hängig. Zwar kann der Kongress damit nicht vollkommen umgangen werden, denn eine Gültigkeit ist meist erst dann gegeben, wenn der Kongress keinen Einspruch erhebt. Jedoch befreit sich der Präsident von der notwendigen Zweidrittelmehrheit im Senat. Da die executive agreements .ine ähnliche völkerrechtliche Wirksamkeit haben, ersetzten sie nach und nach die völkerrechtlichen Verträge und bestimmen somit die amerikanische Außenpolitik.43
Als Beispiel ist die Anerkennung der Sowjetunion durch Roosevelt .933 zu nen- nen. Erst seit den frühen 50er Jahren flammte ein Widerstand des Kongresses auf, der sich bis in die 70er Jahre fortsetzte. Eine wirklich weit reichende Entwick- lung auf gesetzgeberischem Wege konnte jedoch, hauptsächlich aufgrund des Konkurrenzverhältnisses zwischen den beiden Kongresskammern, nicht gefunden werden. Zwar gab es einige Ansätze, die Vormachtstellung des Präsidenten bei Exekutivabkommen blieb jedoch erhalten. Die Partizipationsmöglichkeiten der Kongressmitglieder blieben minimal.44
3.3 Teilzusammenfassung
Durch die Entwicklung der USA zur Weltmacht, dem damit verbundenen Wandel der Staatsfunktionen, der Internationalisierung der Politik und durch das veränder- te außenpolitische Rollenverständnis gewann die Exekutive in den USA, wie auch in vielen anderen Ländern, deutlich an Macht. Zwar war dieser Prozess nicht line- ar, jedoch ist eine Machtvergrößerung des Präsidenten über die Zeit unverkenn- bar. Dies geht nicht zwingend mit einem Funktionsverlust des Kongresses einher, denn auch er ist insgesamt stärker geworden und gehört damit zu den stärksten Parlamenten der Welt.
3.4 Die Gegenreaktion des Kongresses
Nachdem nun einige wesentliche Veränderungen zugunsten des Präsidenten dargestellt worden sind, wird nun auf die Gegenreaktionen des Kongresses und ihre Ursachen eingegangen werden.
3.4.1 Ursachen
Grundlegend für die Frage nach Ursachen ist die Feststellung, dass im präsiden- tiellen Regierungssystem eine Inkompatibilität zwischen Exekutive und Legislative besteht. Das heißt die Kongressmehrheit kennt nicht mal in dem Falle eine „eige- ne“ Regierung, wenn der Präsident aus der eigenen Partei kommt. Bei Auseinan- dersetzungen zwischen Präsident und Kongress ist nur dann mit Sanktionen der Wählerschaft zu rechnen, wenn ein erfolgreicher und als beliebt eingeschätzter Präsident allzu sehr in seinen Vorhaben eingeschränkt wird. Zu Beginn der 70er Jahre fand sich daher ein geeigneter Zeitpunkt, um gegen die präsidentielle Ü- bermacht anzukämpfen und Reformen auf den Weg zu bringen.45
Präsident Richard Nixon .1969 -1974) brachte die Präsidentschaft in die schwers- te Krise ihrer Geschichte. Zunächst sah er sich der Wirtschaftskrise gegenüber, die das Ende des Nachkriegsbooms der Weltwirtschaft markierte. Zur Lösung der Krise wandte er bezeichnenderweise kurzfristige finanzpolitische Manipulationen an. Dazu gehörten auch die rechtlich fragwürdigen Maßnahmen, vom Kongress beschlossene Ausgaben zu verweigern ( impoundments .. Darüber hinaus waren es allerdings besonders der Rücktritt von Nixons Vizepräsidenten Agnew .egen eines Bestechungsskandals, die Watergate- Aff . ä . re .nd das in diesem Zusam- menhang häufig durch Nixon betonte executive privilege .Vorrecht der Exekutive), die das Ansehen des Präsidenten erheblich beschädigen sollten.46Nixon habe damit einen „schlafenden Kongreß geweckt und ihn wild gemacht“.47Der Vietnam- krieg sorgte darüber hinaus für ausreichenden Zündstoff in der Außenpolitik.
3.4.2 Kongressinterne Veränderungen
Der oben beschriebene Wandel der Staatsaufgaben, als Resultat der Internationalisierung der Politik, zeichnete sich natürlich nicht nur in den USA sondern auch in den meisten europäischen Ländern ab. Dieser Wandel machte sich jedoch in unterschiedlichem Maße bemerkbar. Dem Machtzuwachs der Exekutive ist nur durch den Aufbau einer Gegenbürokratie beim Parlament entgegenzuwirken. Dies stellt sich in parlamentarischen Regierungssystemen allerdings als ungleich schwerer dar, da kein klassisches Gegenüber von Parlament und Regierung besteht. Dem Ausbau einer Gegenbürokratie wird hier vor allem entgegengewirkt, um ein Erstarken der Opposition zu verhindern. Der Kongress dagegen hatte keinerlei Begründungsprobleme für den Aufbau einer solchen.48
Der Umfang der Mitarbeiterstäbe im Kongress ist so in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Allein von 1960 bis 1980 wuchs die Zahl der im Kongress beschäftigten Personen von 6.300 auf über 15.000. Jedes gewählte Kongressmitglied verfügt inzwischen über ein geräumiges Büro und einen großen Mitarbeiterstab, der mit Stand 2001 im Durchschnitt 17 Personen für Repräsentanten und 40 für Senatoren umfasste. Erst diese umfangreiche Bürokratie ermöglicht dem Kongress die Bewältigung seiner umfassenden Arbeit.49
3.4.3 Der War Powers Act .
Der 1973, nach Nixons .eto, beschlossene War Powers Act .st ein Versuch des Kongresses, Teile seiner im außenpolitischen Bereich verlorenen Macht wieder zurück zu gewinnen. Im Wesentlichen ist er als eine Reaktion auf den nicht erklärten Krieg in Vietnam zu sehen.50
Historisch gesehen wurden die USA immer weiter in den Vietnam-Krieg hineinge- zogen, für den, anders als im Falle des Korea-Krieges, keine UN- Resolution vor- lag und die Begründung recht scheinheilig war. Hinzu kamen innenpolitische Prob- leme, insbesondere der Watergate- Skandal . die das Ansehen des Präsidenten nachhaltig schädigten. Zwischen 1969 und 1971 wurde der Einsatz amerikani- scher Bodentruppen in Laos, Thailand und Kambodscha untersagt. Zusätzlich wurde von der oben genannten Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Tonking Gulf Resolution .u widerrufen. Daran konnte auch der erweiterte Handlungsspielraum des Präsidenten als Resultat des Ost-West-Konfliktes nichts ändern.51
Inhaltlich sollte das Gesetz die Mitsprache des Kongresses beim Einsatz amerika- nischer Streitkräfte grundsätzlich regeln. Der in diesem Gesetz verankerte Kom- promiss umfasst unter anderem die Pflicht des Präsidenten, den Kongress über Truppenentsendungen ins Ausland zu benachrichtigen und die Truppen nach spä- testens 60 Tagen wieder zurückzurufen, sollte der Kongress inzwischen keine Er- mächtigung ausgesprochen haben. Des Weiteren bekam der Präsident die Pflicht auferlegt, sich in allen möglichen Fällen vor einer Truppenentsendung mit dem Kongress auseinanderzusetzen, wobei das Wort „möglich“ nicht weiter definiert wurde. Ansonsten ist zumindest dem Speaker .es Repräsentantenhauses binnen 48 Stunden ein schriftlicher Bericht über die Vorgänge vorzulegen.52
Allerdings ist dieses Gesetz bis heute umstritten. Im Mittelpunkt der Diskussion steht vor allem seine tatsächliche Wirkung. So kann laut Herbert Dittgen .er „Ver- such des Kongresses, durch die War- Powers- Resolution .n der Entscheidung über den Einsatz von Streitkräften beteiligt zu werden, […] als gescheitert betrach- tet werden.“53Andere indessen sehen das Gesetz bis heute als Erfolg an. Die Ur- sache ist bereits in der Entstehung zu suchen, denn der War- Powers- Act .st Resultat eines Kompromisses zwischen Senat und Repräsentantenhaus. Keine der beiden Kammern konnte ihre Vorstellungen vollständig umsetzen. Trotz vieler Differenzen kam es zwar zu einem Gesetz, dem viele der Abgeordneten und Senatoren aber wahrscheinlich nur zustimmten, um dem Präsidenten noch im Nachhinein für seine innenpolitischen Fehler zu rügen.54
In der Folgezeit lehnten alle Präsidenten die War- Powers- Resolution .ls verfassungswidrig ab, versuchten jedoch, eine direkte Konfrontation mit dem Kongress weitestgehend zu vermeiden.55
3.4.4 Der Budget and Impoundment Control Act
Auch der Budget and Impoundment Control Act .on 1974 war, ähnlich dem War . Powers Act . ein Resultat der Unzufriedenheit des Kongresses mit seiner eigenen Arbeit. Ziel des Gesetzes war die Schaffung einer stärkeren Stellung gegenüber der Exekutive in der Haushaltsgesetzgebung.56
Zunächst wird kurz der schwierige Prozess der Haushaltsbewilligung skizziert wer- den. Das Recht zur Geldbewilligung ( power of the purse . liegt laut Verfassung beim Kongress. Der Präsident kann dagegen nur Vorschläge unterbreiten, die letzte Entscheidung bleibt der Legislative vorbehalten. Erst seit 1921 gibt es ein- heitliche Haushaltsvorschläge, das Office of Management and Budget .rstellt für den Präsidenten einen jährlichen Vorschlag, den er dann dem Kongress am An- fang des Jahres unterbreiten kann. Im Kongress selbst sind zwei Phasen zur Haushaltsbewilligung notwendig, die Autorisierungs-( authorisation . und die Zu- weisungsphase ( appropriation .. Die Autorisierung erfolgt zunächst in dem sachlich zuständigen Ausschuss auf der Basis des Präsidentenvorschlages. Darin wird ei- ne bestimmte Geldsumme bewilligt. Der Haushaltsentwurf des Präsidenten kann sowohl aufgestockt als auch reduziert werden. Die tatsächliche Summe der Bewil- ligung wird jedoch erst im Zuweisungsausschuss bestimmt. In der Folge wird im Plenum des Repräsentantenhauses über die Vorlage entschieden, bevor die Vor- lage in den Zuweisungsausschuss des Senates übergeht. Hier wird die Vorlage dann in möglicherweise nochmals veränderte Form verabschiedet, was die Einsetzung eines Vermittlungsausschusses nötig macht.57
Insgesamt handelt es sich demzufolge um einen sehr fragmentierten Prozess, welcher allerdings, durch die Verteilung der Kompetenzen, gleichzeitig eine detail- lierte Kontrolle über die Inhalte der bewilligten Programme zulässt. Der Budget . and Impoundment Control Act .ar ein Versuch der Zentralisierung des Haushalts- prozesses. In Folge dieses Gesetzes wurden zwei zusätzliche Ausschüsse, ein Haushaltsausschuss für jede Kammer, implementiert sowie das Congressional . Budget Office .eschaffen. Dieses sollte bei der Haushaltserstellung unterstützen. Außerdem wurden genaue Zeitpläne für die Erarbeitung des Haushalts festge- setzt. Da das Gesetz jedoch Ausweichmöglichkeiten zulässt, wurde das ange- strebte Ziel der Disziplinierung und Rationalisierung des Haushaltsverfahrens wei- testgehend verpasst. Als weiteres Instrument ist das Verbot präsidentieller im- . poundments .hne Zustimmung des Kongresses, durch welche der Präsident sich weigern konnte, zugewiesene Geldmittel auszugeben, enthalten.58
Trotzdem gewann das Parlament durch das Gesetz wieder eine Vormachtstellung im Budgetwesen. Dem Präsidenten wurde die Möglichkeit genommen, die Haus- haltspolitik zu lenken. Ihm blieb nur noch die Teilhabe. In dieser, durch das Gesetz vorgesehenen Nebenrolle, verharrt die Exekutive bis heute. Das Ergebnis ist letz- ten Endes als zwiespältig zu betrachten. Einerseits hat der Kongress in der Folge- zeit den Bundeshaushalt tatsächlich weitaus stärker geprägt und die Oberhand über den Präsidenten gewonnen, andererseits traten an anderen Stellen neue Probleme auf. So trafen fortan zwei konkurrierende Gesetzesentwürfe (einer aus dem Kongress und einer von der Exekutive) aufeinander, die den Gesamtvorgang noch weiter verkomplizierten. Die haushaltspolitischen Prioritäten von Exekutive und Legislative waren und sind nur schwer miteinander vereinbar. Anstatt also Verbesserungen zu schaffen, wurde das Zusammenwirken von Kongress und Präsident noch weiter erschwert. Der präsidentielle Haushaltsentwurf ist mit der Zeit zu einer „Pflichtübung“ geworden. Eine andere Partizipationsmöglichkeit des Präsidenten besteht im schon erwähnten Vetorecht.
Jedoch wird dieses in diesem Zusammenhang selten eingesetzt, um nicht der ei- genen Politik die Grundlage zu entziehen und um eine Aushöhlung dieser zu vermeiden.59
3.5 Teilzusammenfassung
Der Kongress versuchte mit Hilfe einiger Reformen, verlorene Macht vom Präsi- denten zurück zu gewinnen. Etwas oberflächlich betrachtet, könnte die Vermutung entstehen, der Kongress habe es geschafft die imperial presidency . also die machtvolle Amtsführung des Präsidenten, zu überwinden. Diese Vermutung wäre jedoch eine eindeutige Überschätzung der Reformen. Das Verhältnis von Kon- gress und Präsident bestimmt sich nicht nur aus Reformen innerhalb eines Regie- rungszweiges, sondern es ist von vielen Faktoren, zum Beispiel von der persönli- chen Stärke des Präsidenten oder von den Mehrheiten im Kongress60, abhängig.
3.6 Die Rolle der Medien - going public
Die Medien sind ein zentraler Bestandteil der amerikanischen Alltagskultur. Noch mehr als in europäischen Ländern können sie als eine Art vierte Gewalt angese- hen werden. Das politische Geschehen in den USA wurde schon früh von Analy- sen und Kommentierung seitens der Massenmedien begleitet. In den USA lässt sich eine lange und kontinuierliche journalistische Tradition mit zwei Hauptaktions- feldern wieder finden. Hierzu zählen die Öffentlichkeitsarbeit der politisch Verant- wortlichen sowie die Wahlkämpfe. „Wer in den USA politisch erfolgreich werden oder es bleiben wollte, musste sich schon immer mit den Medien arrangieren kön- nen.“61Dementsprechend lässt sich ein zähes Ringen der Politik um die Unter- stützung der Medien vorfinden. Der Kampf um die Öffentlichkeit ist dabei zu einem festen Bestandteil des politischen Systems herangewachsen.62
Zunächst bietet der Blick auf das amerikanische Mediensystem ein Bild verwirren- der Vielfalt. Dies liegt vor allem daran, dass es nur sehr wenige nationale Zeitungen und Fernsehnetze gibt. So gibt es beispielsweise nur wenige für das gesamte Land bedeutsame Tageszeitungen.63
Bei der Betrachtung der Medien darf nicht nur die Wirkung auf den Rezipienten sondern muss auch die Rückwirkung der Medien auf die politischen Eliten bedacht werden. So spielt in den USA vor allem das agenda setting .ine wichtige Rolle. Die politisch relevanten Themen können auf diesem Weg nicht nur von den Politi- kern selbst, sondern durchaus auch in einem größeren Maße von den Medien mitbestimmt werden. Inzwischen wird nicht mehr bezweifelt, dass die Medien ei- nen großen Einfluss auf die amerikanischen Entscheidungsträger ausüben. Der Präsident kann sich die Medien diesbezüglich zu Nutzen machen, indem er, in der Öffentlichkeit beliebte, Gesetzesinitiativen in den Medien verbreitet, um so wieder- um eine Rückwirkung der Medien auf den Kongress zu erreichen, der sich seiner- seits dann häufig durch den öffentlichen Druck in seinen Entscheidungen beein- flussen lässt.64
Besonders für den Präsidenten ist die Nutzung der Medien also von besonderer Relevanz. Ihm steht, anders als in parlamentarischen Regierungssystemen, keine durch die Fraktionsdisziplin gewährleistete Unterstützung durch seine Parteikolle- gen zur Verfügung. Demzufolge wird sich der Präsident immer dann an die Me- dien wenden müssen ( going public ., wenn er mit dem Widerstand des Kongresses rechnen muss. Es handelt sich dabei um einen Versuch, das Abstimmungsverhal- ten im Kongress gezielt über den Umweg der Mobilisierung der öffentlichen Mei- nung zu beeinflussen.65Vor der Öffentlichkeit hat er dann die Möglichkeit, seine Fähigkeiten auszuspielen, sich als Vertreter des gesamten Volkes zu repräsentie- ren und die Wähler, aber auch den Kongress, für seine Vorhaben zu sensibilisie- ren. Denn der eigentliche Adressat dieser Mobilisierungskampagnen ist gar nicht der Wähler sondern vielmehr die Mitglieder des Kongresses.
Dieses Vorgehen soll den Kongress durch die Erzeugung einer hohen öffentlichen Unterstützung für die Vorhaben des Präsidenten unter Druck setzen und ihn ver- handlungsbereiter machen.66Dies gelingt dem Präsidenten mehr und mehr, so dass sich der Kongress häufig auf die Belange der Exekutive einstellen muss. Franklin D. Roosevelt .ar der erste Präsident, der dies, natürlich auch bedingt durch die Fortentwicklung der Medien, in die Tat umzusetzen verstand. Er galt als Meister der öffentlichen Überzeugungsarbeit, wandte sich häufig in Radiosendun- gen (Kamingespräche) an eine sonst nicht in diesem Umfang erreichbare breite Hörerschaft. Ein weiterer Great Communicator .ar Präsident Reagan . der es als ehemaliger Schauspieler verstand, seine Politik in die Sprache der Medien zu ü- bertragen.67
Zu diesem Zwecke verfügt das Weiße Haus heute über einen riesigen Öffentlich- keitsapparat, der die einzelnen Auftritte des Präsidenten nach professionellen Ge- sichtspunkten exakt zu inszenieren versucht. Der Kongress hat dem nichts Ver- gleichbares entgegenzustellen. So wurde die Strategie des going public .chnell zur wichtigsten Beeinflussungsstrategie des Präsidenten gegenüber dem Kon- gress und schafft es teilweise sogar, die Grenzen zwischen Wahlkampf und Re- gieren zu verwischen.68Besonders in den Wahlkämpfen wird die Public Relations- Maschine für die Reformpakete der einzelnen Präsidenten in Gang gesetzt. Hier werden viele millionen Dollar in die Öffentlichkeitsarbeit investiert. Zu wesentlicher Bedeutung gelangten in den letzten Jahren zudem die so genannten negative . campaignings . Sie dienen dazu, den Gegner in der Öffentlichkeit aufgrund seiner Schwächen anzugreifen.69
Seit 1994 gewannen auch die Mobilisierungskampagnen des Präsidenten zusätzlich an Bedeutung. Der Präsident nutzte sie als Waffe gegen den aggressiven, republikanisch beherrschten Kongress.
Hierzu setzte er ganz neue, unkonventionelle Methoden, wie das Internet oder Talkshowbesuche ein, um Unterstützung für seine Agenda zu bekommen.70
4. Zusammenfassung und Ausblick
Die Arbeit hat gezeigt, dass zahlreiche Veränderungen im innen- aber auch im außenpolitischen Bereich das Verhältnis von Kongress und Präsident seit der Amtszeit Roosevelts geprägt haben. Als Gründe für den Machtzuwachs des Prä- sidenten stellten sich dabei vor allem der Wandel der Staatsfunktionen, die zu- nehmende Internationalisierung der Politik, das veränderte außenpolitische Rol- lenverständnis sowie die Etablierung der USA als Weltmacht heraus. Eine Gegen- reaktion des Kongresses war vor allem am Anfang und in der Mitte der 70er Jahre festzustellen. Diese begründete sich sowohl durch außenpolitische als auch durch innenpolitische Probleme, die vor allem das Ansehen des Präsidenten schädigten und so eine gute Gelegenheit für den Kongress boten, verlorene Macht wieder zurück zu gewinnen. Deutlich geworden ist allerdings auch, dass die, durch den Kongress initiierten Reformen, nur wenig Erfolg hatten. Jedoch resultiert daraus insgesamt kein allgemeiner Bedeutungsverlust des Kongresses. Auch er erlangte neue Kompetenzen und bleibt eines der stärksten Parlamente der Welt.
Damit ist auch schon die Beantwortung der eingangs gestellten Frage, ob das Verhältnis zwischen beiden Organen insgesamt eher von Kontinuität oder von Wandel geprägt wurde, offensichtlich. Eindeutig ist es ein ständiger, fortwährender Wandel, der das Verhältnis zwischen Exekutive und Legislative bestimmt. Kraftquelle des Wandels sind sowohl die bereits oben erwähnten Gründe aber auch immer die persönlichen Stärken und Schwächen jedes Präsidenten. Allerdings waren auch durchaus Kontinuitätselemente zu finden.
Der deutlichste Wandel vollzog sich dabei meiner Meinung nach im Zuge des New Deals . Hier wurde ein aktives Eingreifen des Präsidenten in Politik und Wirtschaft verlangt, um die kaum noch erträglichen Verhältnisse der Weltwirtschaftskrise zu überstehen. Präsident Roosevelt .at dies in Form einer Vielzahl von Gesetzesinitiativen, die auf informellen Wegen in den Gesetzgebungsprozess eingebracht wurden. Der Präsident wurde zum Gesetzesinitiator.
Dieser Gedanke setzte sich in der Bevölkerung fest und hat noch heute Bestand.
Seitdem ist die Initiative des Präsidenten in politischen Notlagen gefordert. Auch haben sich die zusätzlich geschaffenen Behörden vollständig etabliert. Damit zeichnet sich hier nicht nur ein deutlicher Wandel, sondern auch ein deutliches Kontinuitätselement ab.
Im Bereich der Außenpolitik spielte vor allem die Entwicklung der USA zur Welt- macht eine wesentliche Rolle. Der Präsident zog mehr und mehr Kompetenzen an sich und versuchte den Kongress so weit es ging, im außenpolitischen Entschei- dungsgefüge zu umgehen und sich selbst zum Chefdiplomaten zu erklären. Sinn- bild dieser Vorgänge ist die Tonking Gulf Resolution . Als Gegenreaktion des Kon- gresses ist der War Powers Act .u nennen. Jedoch konnte der Kongress auch damit seine verloren gegangene Macht nicht vollständig zurück erobern. Auch die Außenpolitik war demnach durch zahlreiche Kompetenzverschiebungen gekenn- zeichnet, wobei auch hier eine Kontinuität, nämlich in Form des außenpolitisch erstarkten Präsidenten zu finden ist.
Der Budget and Impoundment Control Act .iente dem Machtzuwachs des Kongresses im Bereich der Haushaltsgesetzgebung. Vor allem sollte der Haushaltsprozess zentralisiert werden und präsidentielle impoundments .ollten verhindert werden. Der Erfolg dieser Maßnahme ist fraglich, jedoch verfügt der Kongress seitdem wieder über eine Vorrangstellung im Budgetwesen. Da auch dies bis heute, abgesehen von kleinsten Veränderungen, so geblieben ist, kann auch in diesem Bereich von Kontinuität gesprochen werden.
Auch die Rolle der Medien sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden. Der Präsident nutzt sie sehr stark, um seine Nähe zur Bevölkerung zu signalisieren und um Werbung für seine Anliegen zu machen. So kann er es vor allem in schwierigen Zeiten schaffen, den Kongress über die Rückwirkung der Medien unter Druck zu setzen. Dieser Vorgang ist allerdings deutlich von der Person des Präsidenten abhängig, auch wenn im Trend der letzten Jahrzehnte die Nutzung der going pub . lic . Strategie klar nach oben tendiert.
Nach dieser Synopse der wichtigsten Feststellungen, die hauptsächlich die Wand- lungsvorgänge skizzierten, soll noch einmal kurz auf die wichtigsten Kontinuitäts- elemente eingegangen werden. So ist der Präsident auch heute noch, um nur die wichtigsten Kontinuitätselemente zu verdeutlichen, als Gesetzesinitiator gefordert und gilt noch immer als Chef Diplomat, also aktiver Gestalter, der Außenpolitik.
Die Machtbalance zwischen Kongress und Präsident konnte dabei in der Regel gewahrt bleiben. Alles in Allem sind es also Kontinuität und Wandel, die das Verhältnis zwischen Präsident und Kongress bestimmen.
Zwar konnten im Rahmen der Arbeit nur die bedeutsamsten Ereignisse abgefasst werden, jedoch bieten diese bereits einen sehr guten Überblick über die fortlau- fenden Kompetenzstreitigkeiten der beiden Staatsorgane. Auch in der Zukunft werden diese Streitigkeiten vermutlich fortgesetzt werden, die Persönlichkeit des Präsidenten wird diesbezüglich auch weiter ein wichtiges Kriterium bleiben.
5. Literaturverzeichnis
1. Berg, M.: Liberaler Konsens und gesellschaftliche Polarisierung: Die innere Entwicklung, 1945 - 1975. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 153 - 175.
2. Bierling, S. G.: Partner oder Kontrahenten? Präsident und Kongress im au- ßenpolitischen Entscheidungsprozess der USA (1874-1988), Frankfurt, Ber- lin, Bern 1992.
3. Czempiel, E.-O., Schweitzer, C.-C.: Weltpolitik der USA nach 1945. Einfüh- rung und Dokumente, Bonn 1989.
4. Dittgen, Herbert: Amerikanischer Kongreß und Außenpolitik. Demokratische Außenpolitik nach dem Ende des Kalten Krieges. In: Politische Vierteljah- resschrift, 34. Jahrgang, Heft 1, S. 72 - 90.
5. Hartmann, J.: Westliche Regierungssysteme. Parlamentarismus, präsiden- tielles und semi-präsidentielles Regierungssystem, Opladen 2000.
6. Helms, L.: Präsident und Kongress in der legislativen Arena. Wandlungs- tendenzen amerikanischer Gewaltenteilung am Ende des 20. Jahrhunderts. In: ZParl, Bd. 30 (1999), S. 841 - 863.
7. Hübner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktuali- sierte Auflage, München 2003.
8. Jäger, W.: § 7 Der Präsident. In: Jäger, W., Welz, W. (Hrsg.): Regierungs- system der USA, S. 136 - 169.
9. Klages, W.: Staat auf Sparkurs. Die erfolgreiche Sanierung des US- Haushalts (1981-1997), Frankfurt/ Main, New York 1998.
10. Kleinsteuber, H. J.: Medien und öffentliche Meinung. In: Lösche, P., Loef- felholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 390 - 409.
11. Junker, D.: Weltwirtschaftskrise, New Deal, Zweiter Weltkrieg, 1929 - 1945. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Ge- schichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 129 - 152.
12. Lösche, P.: Herrschaft des Kongresses oder Herrschaft des Präsidenten? Überlegungen zu Fiktion und Wirklichkeit einer populären Dichotomie. In: Hartmann, J., Thaysen, U. (Hrsg.): Pluralismus und Parlamentarismus in Theorie und Praxis. Winfried Steffani zum 65. Geburtstag, Opladen 1995, S. 215 - 230.
13. Nolte, Detlef: Ein latenter Verfassungskonflikt: Die War Powers Resolution von Nixon bis Reagan. In: Politische Vierteljahresschrift, 30. Jahrgang, Heft 1, S. 50 - 74.
14. Prätorius, R.: Die USA, Politischer Prozess und soziale Probleme, Opladen 1997.
15. Shell, K. L.: Kongress und Präsident. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 202 - 260.
16. Steffani, W.: § 6 Der Kongress. In: Jäger, W., Welz, W. (Hrsg.): Regierungssystem der USA, S. 110 - 135.
17. Wolf, D. O. A.: „Präsidenten-Krieg“ in Vietnam? o.O. 1973.
[...]
1Vgl. US- Verfassung, Artikel 1, 1. Abschnitt.
2Alle zwei Jahre steht ein Drittel der Senatoren zur Wahl.
3Vgl. Hartmann, J.: Westliche Regierungssysteme. Parlamentarismus, präsidentielles und semipräsidentielles Regierungssystem, Opladen 2000, S. 115ff.
4Vgl. Shell, K. L.: Kongress und Präsident. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 202ff.
5Vgl. Hartmann, J.: Westliche Regierungssysteme. Parlamentarismus, präsidentielles und semipräsidentielles Regierungssystem, Opladen 2000, S. 126ff.
6Vgl. Hübner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktualisierte Auflage, München 2003, S. 128.
7 Vgl. Steffani, W.: § 6 Der Kongress. In: Jäger, W., Welz, W. (Hrsg.): Regierungssystem der USA, S. 115ff. 5
8Vgl. Ebd.
9Vgl. Lösche, P.: Herrschaft des Kongresses oder Herrschaft des Präsidenten? Überlegungen zu Fiktion und Wirklichkeit einer populären Dichotomie. In: Hartmann, J., Thaysen, U. (Hrsg.): Pluralismus und Parlamentarismus in Theorie und Praxis. Winfried Steffani zum 65. Geburtstag, Opladen 1995, S. 215f.
10 Vgl. Prätorius, R.: Die USA, Politischer Prozess und soziale Probleme, Opladen 1997, S. 28. 6
11Vgl. Jäger, W.: § 7 Der Präsident. In: Jäger, W., Welz, W. (Hrsg.): Regierungssystem der USA, S. 137ff.
12Vgl. Hübner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktualisierte Auflage, München 2003, S. 116.
13Vgl. Ebd, S. 116f.
14Vgl. Shell, K. L.: Kongress und Präsident. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 230 und Hartmann, J.: Westliche Regierungssysteme. Parlamentarismus, präsidentielles und semi-präsidentielles Regierungssystem, Opladen 2000, S. 126ff.
15Vgl. Helms, L.: Präsident und Kongress in der legislativen Arena. Wandlungstendenzen amerikanischer Gewaltenteilung am Ende des 20. Jahrhunderts. In: ZParl, Bd. 30 (1999), S. 856ff.
16Ebd.
17Vgl. Hübner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktualisierte Auflage, München 2003, S. 107ff.
18Vgl. Hartmann, J.: Westliche Regierungssysteme. Parlamentarismus, präsidentielles und semi- präsidentielles Regierungssystem, Opladen 2000, S. 130f und Hübner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktualisierte Auflage, München 2003, S. 109.
19Dieses Prinzip ist vor allem durch gegenseitige Kontrolle und Einflussnahme gekennzeichnet. Vgl. Hüb- ner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktualisierte Auflage, München 2003, S. 109f.
20Vgl. Lösche, P.: Herrschaft des Kongresses oder Herrschaft des Präsidenten? Überlegungen zu Fiktion und Wirklichkeit einer populären Dichotomie. In: Hartmann, J., Thaysen, U.(Hrsg.): Pluralismus und Parlamentarismus in Theorie und Praxis. Winfried Steffani zum 65. Geburtstag, Opladen 1995, S. 216.
21Vgl. Hartmann, J.: Westliche Regierungssysteme. Parlamentarismus, präsidentielles und semipräsidentielles Regierungssystem, Opladen 2000, S. 112f.
22Helms, L.: Präsident und Kongress in der legislativen Arena. Wandlungstendenzen amerikanischer Gewaltenteilung am Ende des 20. Jahrhunderts. In: ZParl, Bd. 30 (1999), S. 845.
23Vgl. Junker, D.: Weltwirtschaftskrise, New Deal, Zweiter Weltkrieg, 1929 - 1945. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 129f.
24Vgl. Ebd. , S. 133ff.
25Vgl. Ebd. , S. 134ff.
26Vgl. Hartmann, J.: Westliche Regierungssysteme. Parlamentarismus, präsidentielles und semipräsidentielles Regierungssystem, Opladen 2000, S. 112f.
27Vgl. Ebd., S. 112f. und Shell, K. L.: Kongress und Präsident. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 228ff.
28Shell, K. L.: Kongress und Präsident. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 231.
29Vgl. Junker, D.: Weltwirtschaftskrise, New Deal, Zweiter Weltkrieg, 1929 - 1945. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 137f.
30Vgl. Bierling, S. G.: Partner oder Kontrahenten? Präsident und Kongress im außenpolitischen Entscheidungsprozess der USA (1874-1988), Frankfurt, Berlin, Bern 1992, S.15.
31Vgl. Ebd., S. 27ff.
32Vgl. Helms, L.: Präsident und Kongress in der legislativen Arena. Wandlungstendenzen amerikanischer Gewaltenteilung am Ende des 20. Jahrhunderts. In: ZParl, Bd. 30 (1999), S. 843.
33Shell, K. L.: Kongress und Präsident. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 232.
34Zum Beispiel: Korea, Vietnam.
35 Vgl. Wolf, D. O. A.: „Präsidenten-Krieg“ in Vietnam? o.O. 1973, S. 30ff. 14
36Vgl. Bierling, S. G.: Partner oder Kontrahenten? Präsident und Kongress im außenpolitischen Entscheidungsprozess der USA (1874-1988), Frankfurt, Berlin, Bern 1992, S. 31f.
37Vgl. Wolf, D. O. A.: „Präsidenten-Krieg“ in Vietnam? o.O. 1973, S. 197.
38Vgl. Czempiel, E.-O., Schweitzer, C.-C.: Weltpolitik der USA nach 1945. Einführung und Dokumente, Bonn 1989, S. 259.
39Ebd., S. 298.
40Ebd.
41Vgl. Wolf, D. O. A.: „Präsidenten-Krieg“ in Vietnam? o.O. 1973, S. 216.
42Vgl. Bierling, S. G.: Partner oder Kontrahenten? Präsident und Kongress im außenpolitischen Entscheidungsprozess der USA (1874-1988), Frankfurt, Berlin, Bern 1992, S. 31f.
43Vgl. Hübner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktualisierte Auflage, München 2003, S. 145.
44Vgl. Bierling, S. G.: Partner oder Kontrahenten? Präsident und Kongress im außenpolitischen Entscheidungsprozess der USA (1874-1988), Frankfurt, Berlin, Bern 1992, S. 116ff.
45Vgl. Hübner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktualisierte Auflage, München 2003, S. 142.
46Vgl. Berg, M.: Liberaler Konsens und gesellschaftliche Polarisierung: Die innere Entwicklung, 1945 - 1975. In: Lösche, P., von Loeffelholz, H. D. (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 171ff.
47Zitiert nach: Hübner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktualisierte Auflage, München 2003, S. 143.
48Vgl. Ebd., S. 140f.
49Vgl. Shell, K. L.: Kongress und Präsident. In: Lösche, P., von Loeffelholz, H. D. (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 208f.
50Vgl. Hübner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktualisierte Auflage, München 2003, S. 143.
51Vgl. Nolte, Detlef: Ein latenter Verfassungskonflikt: Die War Powers Resolution von Nixon bis Reagan. In: Politische Vierteljahresschrift, 30. Jahrgang, Heft 1, S. 52.
52Vgl. Czempiel, E.-O., Schweitzer, C.-C.: Weltpolitik der USA nach 1945. Einführung und Dokumente, Bonn 1989, S. 355.
53Dittgen, Herbert: Amerikanischer Kongreß und Außenpolitik. Demokratische Außenpolitik nach dem Ende des Kalten Krieges. In: Politische Vierteljahresschrift, 34. Jahrgang, Heft 1, S. 89.
54Vgl. Bierling, S. G.: Partner oder Kontrahenten? Präsident und Kongress im außenpolitischen Entscheidungsprozess der USA (1874-1988), Frankfurt, Berlin, Bern 1992, S. 75ff.
55Vgl. Ebd., S. 78.
56Vgl. Hübner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktualisierte Auflage, München 2003, S. 144.
57Vgl. Shell, K. L.: Kongress und Präsident. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 216ff.
58 Vgl. Steffani, W.: § 6 Der Kongress. In: Jäger, W., Welz, W.(Hrsg.): Regierungssystem der USA, S. 122f. 21
59Vgl. Klages, W.: Staat auf Sparkurs. Die erfolgreiche Sanierung des US-Haushalts (1981-1997), Frankfurt/ Main, New York 1998, S. 90ff.
60Siehe 2.1.2.
61Kleinsteuber, H. J.: Medien und öffentliche Meinung. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 402.
62Vgl. Ebd., S. 390ff.
63Vgl. Hübner, E.: Das Politische System der USA. Eine Einführung, 5., aktualisierte Auflage, München 2003, S. 95ff.
64Vgl. Ebd., S. 100ff.
65Vgl. Helms, L.: Präsident und Kongress in der legislativen Arena. Wandlungstendenzen amerikanischer Gewaltenteilung am Ende des 20. Jahrhunderts. In: ZParl, Bd. 30 (1999), S. 845.
66Vgl. Ebd., S. 849.
67Vgl. Kleinsteuber, H. J.: Medien und öffentliche Meinung. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 402ff.
68Vgl. Helms, L.: Präsident und Kongress in der legislativen Arena. Wandlungstendenzen amerikanischer Gewaltenteilung am Ende des 20. Jahrhunderts. In: ZParl, Bd. 30 (1999), S. 849ff.
69Vgl. Kleinsteuber, H. J.: Medien und öffentliche Meinung. In: Lösche, P., Loeffelholz, H. D. von (Hrsg.): Länderbericht USA. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 4., aktualisierte und neu bearbeitete Auflage, Bonn 2004, S. 402ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Schwerpunkt dieser Arbeit über das Verhältnis von Kongress und Präsident in den USA?
Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse und Beurteilung der bedeutendsten Veränderungen im Verhältnis zwischen Kongress und Präsident seit der Präsidentschaft Franklin D. Roosevelts. Die Arbeit untersucht, ob das Verhältnis eher von Kontinuität oder Wandel geprägt ist, und identifiziert Bereiche, in denen Wandel oder Kontinuität besonders deutlich sind.
Welche zentralen Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob das Verhältnis zwischen Kongress und Präsident eher von Kontinuität oder Wandel geprägt ist. Sie untersucht, in welchen Politikfeldern der Wandel am deutlichsten war und wo Kontinuitätselemente zu finden sind. Außerdem wird analysiert, ob Veränderungen durch neue politische Herausforderungen oder durch die Stärke/Schwäche des Präsidenten bedingt waren und ob Veränderungen temporär oder dauerhaft sind.
Welche Rolle spielen außenpolitische Veränderungen in der Analyse?
Obwohl der Schwerpunkt auf innenpolitischen Veränderungen liegt, werden außenpolitische Veränderungen nicht vernachlässigt. Die Interdependenzen beider Politikfelder werden berücksichtigt, da außenpolitische Stärke die innenpolitische Situation eines Präsidenten beeinflussen kann.
Welche grundlegenden Aspekte des Verhältnisses von Kongress und Präsident werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt die durch die Verfassung vorgegebene Aufgabenverteilung, das Gesetzgebungsverfahren, das Prinzip der separation of powers und der checks and balances.
Welche wichtigen Veränderungen im Verhältnis von Kongress und Präsident werden dargestellt?
Die Arbeit behandelt den New Deal als Beginn der präsidialen Gesetzesinitiative, die Tonking Gulf Resolution, den War Powers Act und den Budget and Impoundment Control Act.
Was war der New Deal und wie hat er das Verhältnis von Kongress und Präsident beeinflusst?
Der New Deal unter Präsident Franklin D. Roosevelt markierte einen Wendepunkt, in dem der Präsident aktiv als Gesetzesinitiator auftrat. Angesichts der Weltwirtschaftskrise brachte Roosevelt eine Reihe von Gesetzesinitiativen ein, die das Verhältnis von Kongress und Präsident veränderten, indem sie die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit an die Rolle des Präsidenten als Gesetzesinitiator erhöhten.
Was war die Tonking Gulf Resolution und welche Auswirkungen hatte sie?
Die Tonking Gulf Resolution von 1964 gab Präsident Johnson eine Blankovollmacht für die Kriegsführung in Indochina. Sie wird als freiwillige Abgabe von sicherheitspolitischen Kompetenzen seitens des Kongresses betrachtet und markierte den Höhepunkt der "imperialen Präsidentschaft".
Was ist der War Powers Act und warum wurde er verabschiedet?
Der War Powers Act von 1973 ist ein Versuch des Kongresses, Teile seiner im außenpolitischen Bereich verlorenen Macht zurückzugewinnen. Er wurde als Reaktion auf den nicht erklärten Krieg in Vietnam verabschiedet und soll die Mitsprache des Kongresses beim Einsatz amerikanischer Streitkräfte regeln.
Was ist der Budget and Impoundment Control Act von 1974?
Der Budget and Impoundment Control Act von 1974 war eine Reaktion des Kongresses auf die Unzufriedenheit mit seiner eigenen Rolle in der Haushaltsgesetzgebung. Ziel war es, die Stellung des Kongresses gegenüber der Exekutive in der Haushaltsgesetzgebung zu stärken und präsidentielle impoundments ohne Zustimmung des Kongresses zu verhindern.
Welche Rolle spielen die Medien im Verhältnis von Kongress und Präsident?
Die Medien spielen eine zentrale Rolle in der amerikanischen Alltagskultur und können als eine Art vierte Gewalt angesehen werden. Der Präsident nutzt die Medien, um seine Nähe zur Bevölkerung zu signalisieren und um Werbung für seine Anliegen zu machen (going public). Dies kann den Kongress unter Druck setzen.
Was bedeutet "going public" im Kontext des Präsidenten und des Kongresses?
"Going public" ist eine Strategie, bei der sich der Präsident direkt an die Öffentlichkeit wendet, um Unterstützung für seine politischen Vorhaben zu gewinnen und Druck auf den Kongress auszuüben. Dies beinhaltet die Nutzung von Medienauftritten, Reden und anderen öffentlichen Kommunikationsmitteln, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und den Kongress zu veranlassen, die Agenda des Präsidenten zu unterstützen.
Was sind die wichtigsten Kontinuitätselemente im Verhältnis von Kongress und Präsident?
Trotz des Wandels ist der Präsident weiterhin als Gesetzesinitiator gefordert und gilt als Chefdiplomat, also aktiver Gestalter, der Außenpolitik. Die Machtbalance zwischen Kongress und Präsident konnte in der Regel gewahrt bleiben.
- Citar trabajo
- Henri Schmidt (Autor), 2005, Kontinuität und Wandel in den Beziehungen des Präsidenten zum Kongress seit der Präsidentschaft F.D. Roosevelts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110171