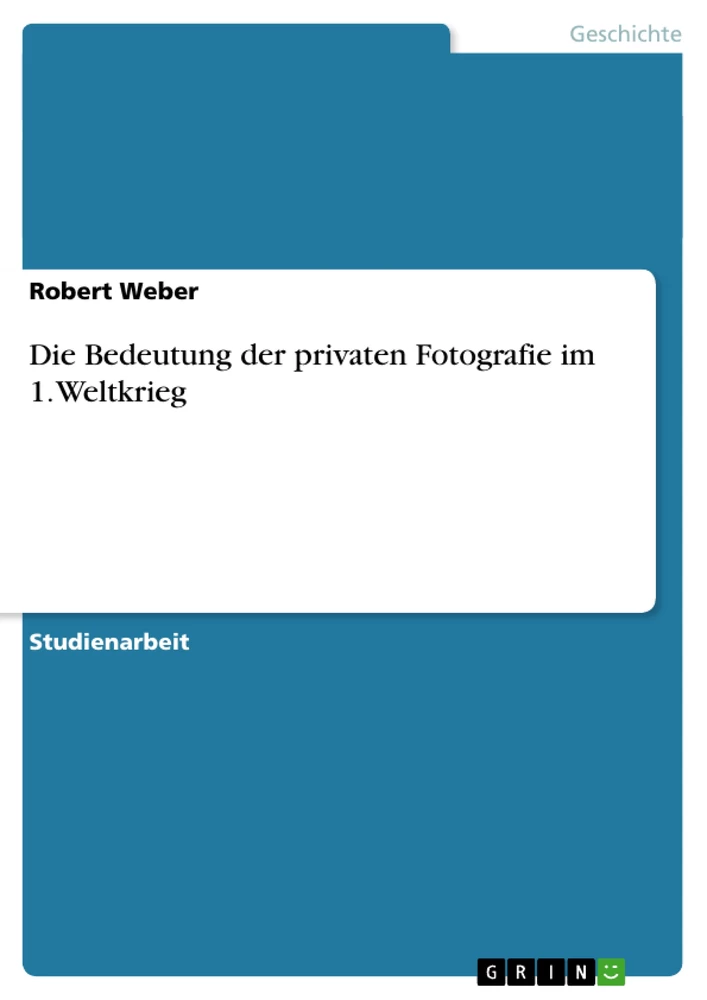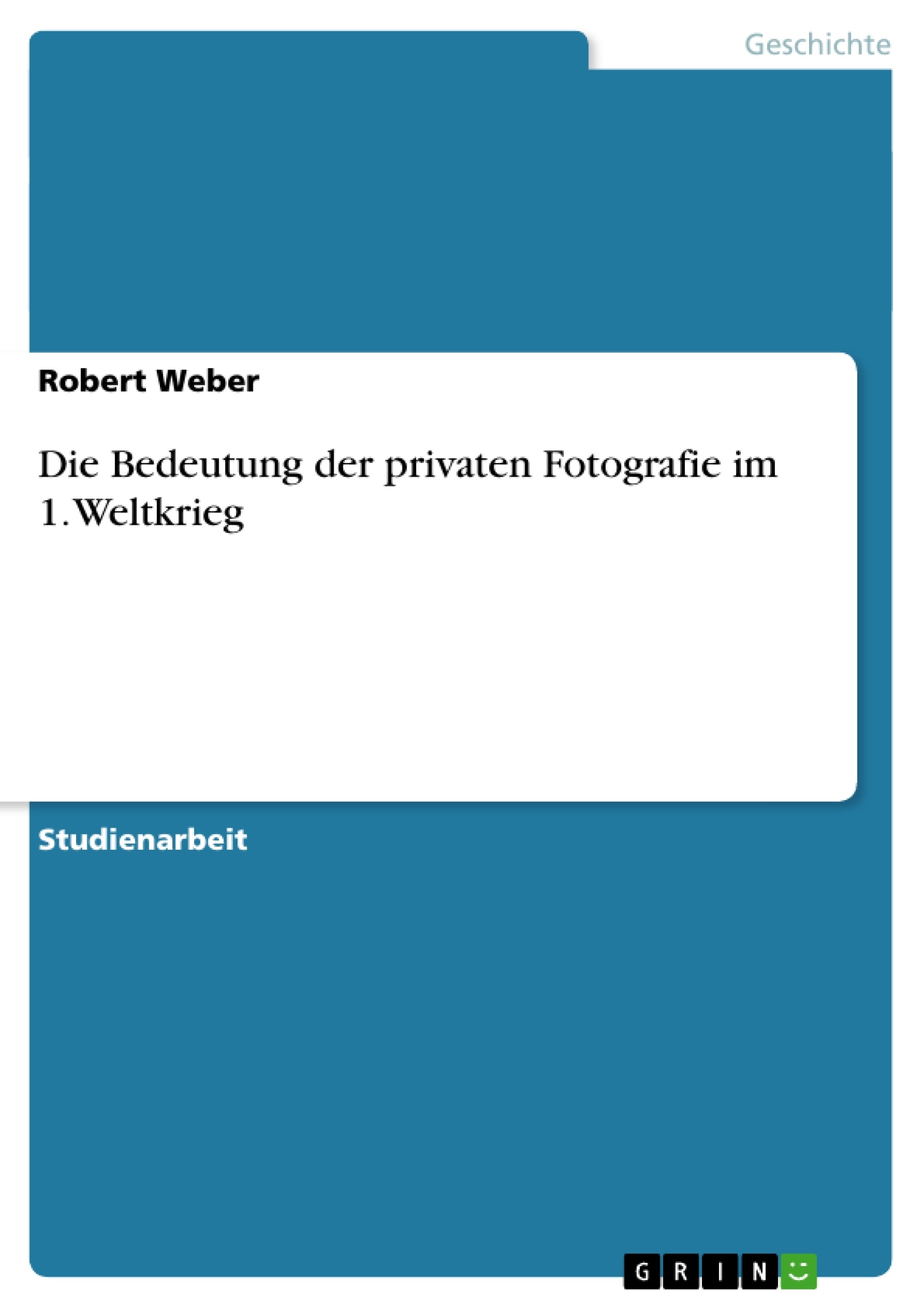Referatsstruktur:
1. Die Entwicklung der Fotografie
2. Die Bedeutung der Fotografie für die Geschichtswissenschaften und ihre historische Einordnung und Verwendung.
3. Analyse verschiedener Fotobände zum 1. Weltkrieg.
4. Schlussbetrachtung
5. Literatur
Einleitung: Neben Tagebüchern, Chroniken, Interviews, Briefen und der Feldpost ist es die Fotografie, die durch den 1. Weltkrieg als historische Quelle zum erstenmal für die Geschichtswissenschaft zugänglich wird. Vor dem 1. Weltkrieg spielten fotografische Abbildung keine bedeutende Rolle in der historischen Forschung. Doch durch die Durchdringung der Bevölkerung mit Fotokameras tauchten am Anfang des 20. Jahrhunderts immer mehr fotografische Andenken und Erinnerungen auf.
Anmerkung: Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt dabei vor allem auf der privaten Fotografie.
1. Die Entwicklung der Fotografie
- 1826 Das erste Foto wird geschossen.
- 1848 Im amerikanisch – mexikanischen Krieg entstehen die ersten Kriegsfotos.
- 1855 Wird das erste Wildtierfoto gemacht.
- 1888 Mit der Entstehung des ersten Familienfotos wird die Fotografie Alltagssache. Kodak wirbt mit dem Slogan „You press the button – we do the rest“[1] für die erste Boxkamera.
- 1900: Wird die erste der bekannten Brownie Kameras auf den Markt gebracht. Sie macht das Fotografieren noch einfacher und handlicher. Die Kosten betrugen damals für die Kamera 1 Dollar und für die Filmrolle 15 Cent. Ein Preis, bei dem sich große Schichten der Bevölkerung eine Kamera leisten konnten
2. Die Bedeutung der Fotografie für die Geschichtswissenschaften und ihre historische Einordnung und Verwendung.
Mit der Entwicklung der Fotografie und der Verbreitung der Fotokameras in vielen gesellschaftlichen Schichten, auf Grund des geringen Preises, veränderte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert die Quellenlage in der Geschichtswissenschaft. „Ab den 1880er Jahren begann sich ein breites Publikum für die Fotografie zu interessieren“[2] und damit tauchten immer mehr Fotografien auf. Oberflächig betrachtet überflüssige Familienfotos und die ersten Kriegsfotos aus dem Krimkrieg, der als „erster Medienkrieg“[3] in die Geschichte einging. Zuvor konzentrierte sich die Geschichtsforschung zumeist auf schriftlich überlieferte Quellen, die Kriegsverläufe dokumentierten und historische Einordnungen ermöglichten. Doch waren bzw. sind schriftliche Quellen nur schwer objektiv einzuordnen, da eine Verfälschung bzw. Zensur nie ausgeschlossen werden durfte. Die Fotografie hingehen wurde als neue Entdeckung gefeiert, da sie vorgab objektiv durch das Objektiv, kommentarlos, wertneutral zu berichten. Im 1. Weltkrieg finden wir fotografische Quellen, die von privaten „Knipsern“ gemacht wurden und staatlich gelenkte Fotografien bzw. Pressefotografien, die den Anfang der Fotografie markierten. Entscheidend für die Einordnung eines Fotos ist meistens der Untertitel, der auf den Autor und die Szene verweist und sie erläutert bzw. kommentiert. Die heute vorliegenden Bildbände zum 1. Weltkrieg entstanden zumeist in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit des Erinnerns unterlagen die fotografischen Werke politischem Druck aus den beiden großen politischen Lagern. Sowohl das „konservativ- nationale Lager“[4] als auch das linke bzw. sozialdemokratische Lager benutzten die privaten, wie auch staatlichen Fotografien für ihre politischen Zwecke. So wurden Untertitel gewählt, die als „zweite Zensur“[5] gewertet werden dürfen. Vgl. Abbildung 1. Man spricht von der zweiten Zensur, weil bereits im Krieg staatliche Fotografen bzw. Pressefotografen zielgerichtet gesteuert wurden. Die Kriegsfotos von Soldaten wurden zumeist erst nach dem Krieg veröffentlicht. Kriegsfotos sind jedoch nicht nur Erinnerung sondern auch Mittel zur Rekonstruktion von Truppenbewegungen und Frontverläufen während des Weltkrieges. Die Fotos stellen somit eine Art „Reisetagebuch“[6] der Regimenter dar und helfen der heutigen Geschichtsforschung den Kriegsverlauf zu analysieren.
Durch die Zensur verlor die Fotografie als objektive Quelle ihren Vorteil gegenüber anderen historischen Quellen. Durch die technische Weiterentwicklung wurde es später sogar möglich, Fotos zu manipulieren, Personen wegzuschneiden und andere hinzuzufügen. Trotzdem ist die Kriegsfotografie wichtig, weil sie Taten und Tätern ein Gesicht gibt und Verbrechen des Krieges eindrucksvoll dokumentiert.
3. Analyse verschiedener Fotobände zum 1. Weltkrieg.
Um eine möglichst hohen Grad von Objektivität zu erzielen bietet es sich an, Fotobände von verschiedenen Regimentern zu analysieren. Ihr Sinn und Zweck lag daran, den ehemaligen Kameraden eine fotografische Erinnerung zu hinterlassen und nicht politisch zu argumentieren. Der Verlauf dieser von ausschließlich privaten Fotografen geführten Regimentsfotobänden ist chronologisch geordnet und zeichnet bildlich den Kriegsweg nach. Es werden nicht nur Kriegsgeschehen fotografiert, sondern die Fotobände ähneln auf einigen Seiten eines Reisetagebuches. Es werden Kirchen, Städte, Erntenarbeiten, Handwerker und Stadtfeste abgebildet. Nach dem Motto „schaut mal, was wir alles gesehen haben“, wirken die ersten Seiten der Fotobände heiter und beschwingt. Doch die Bände und die Fotografien unterliegen einem Wandel.
Im Verlaufe des Krieges werden immer wieder Fotos angefertigt, die in den Fotobänden einen Vorher- Nachher Vergleich ermöglichen. Die Fotos geben dem Betrachter zu verstehen, dass diese Zerstörung nicht gewollt wurde. Dieses lässt sich daraus interpretieren, dass die zerstörten Gebäude auf den ersten Seiten wunderbar und eindrucksvoll in Szene gesetzt wurden und später nur noch nüchtern beschrieben werden. Die Fotos drücken somit eine Art Ernüchterung, Bedauern, vielleicht sogar eine Art Kriegsschuld mit aus.
Neben Fotografien von Gebäuden, Orten, Festen etc. sind vor allem die Gruppenbilder fester Bestandteil jedes Regimentsfotobandes.
Gruppenfotos symbolisieren Zusammenhalt, Stärke und ein wenig Ersatzfamilie. Sie dienen darüber hinaus als Erinnerung an Freunde, die „wir im Krieg waren“, bzw. als Beleg für die Familie nach dem Motto: „Schau mal, wen ich alles kennen gelernt habe“. Die Fotobände erwecken oft den Eindruck einer Hommage an die getöteten Kameraden. Die privaten Fotos sind nicht ausgelegt, um Meinungen zu schüren bzw. klar Position zu beziehen sondern sie dienen alleine der persönlichen Erinnerung an schöne und schreckliche Tage.
Die privaten Fotoarbeiten sind nicht geprägt durch Auftritte des Kaisers oder hohen Militärs sondern das Alltagsleben des Krieges wird sehr authentisch dargestellt.
4. Schlussbetrachtung.
Fotos als Quelle der Geschichtswissenschaften sind sehr wichtig, bedürfen jedoch genauer und intensiver Überprüfung. Fotos formen ein durch das Objektiv, objektive erscheinendes Bild in unserem Kopf. Die Phantasie, die der Mensch beim Lesen von Quellen nicht ausschalten kann, wird durch die Fotografie teilweise aufgehoben. Fotos zeigen Wahrheiten, doch es ist wichtig, wie man diese „Wahrheiten“ interpretiert bzw. welche Kommentare dazu abgegeben werden. Wichtig ist dabei noch zu nennen, dass uns die Fotografie auch nicht alles zeigt, sondern nur das, was der Fotograf für wichtig hielt. Damit unterliegt die Fotografie ebenso einer Schwäche, wie schriftliche Quellen. Trotzdem ermöglichen uns Fotos, Bilder im Kopf zu speichern und sie Berichten und Texten zuzuordnen. Die Kombination von schriftlichen Quellen und Fotos ermöglicht damit die Herstellung von objektiven Forschungspositionen. Beide Quellentypen dürfen nicht getrennt voneinander betrachtet werden, sondern im Zusammenspiel.
5. Literatur.
- Die 26. Reserve Division im Weltkrieg. Herausgeben vom ehemaligen Stab der 26. Reserve Division. Stuttgart 1920.
- Duden, Barbara: Der Kodak und der Stellungskrieg. Versuch einer Situierung von Weltkriegsfotografien. In: BIOS 7 (1994), S. 64 – 82.
- Friedrich, Ernst: Krieg dem Kriege. Berlin 1926.
- Holzer, Anton: Mit der Kamera bewaffnet. Krieg und Fotografie. Marburg 2003.
- Hüppauf, Bernd: Kriegsfotografie. In: Wolfgang Michalka (Hrsg.): Der Erste Weltkrieg. Wirkung Wahrnehmung, Analyse. München 1994, S. 876 – 909.
- Kodak Firmengeschichte, www.kodak.de.
- Müller – Loebnitz, Wilhelm: Die Badener im Weltkrieg 1914/1918.
- Von Dewitz, Bodo: Zur Geschichte der Kriegsphotographie. In: Rainer Rother (Hrsg.): Die letzten Tage der Menschheit. Bilder des Ersten Weltkrieges. Berlin 1994, S. 163 – 176.
[...]
[1] Kodak Firmengeschichte, www.kodak.de.
[2] Holzer, Anton: Mit der Kamera bewaffnet. Krieg und Fotografie. Marburg 2003, S. 60.
[3] Ebd. S. 9
[4] Ebd. 61
[5] Ebd. S. 61
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine Referatsstruktur zum Thema "Die Bedeutung der Fotografie für die Geschichtswissenschaften und ihre historische Einordnung und Verwendung, speziell im Bezug auf den 1. Weltkrieg". Er beinhaltet eine Einleitung, die Entwicklung der Fotografie, die Bedeutung der Fotografie für die Geschichtswissenschaft, eine Analyse verschiedener Fotobände zum 1. Weltkrieg, eine Schlussbetrachtung und ein Literaturverzeichnis.
Welche Entwicklung der Fotografie wird im Text beschrieben?
Der Text beschreibt die Entwicklung der Fotografie von der ersten Aufnahme im Jahr 1826 über die ersten Kriegsfotos im amerikanisch-mexikanischen Krieg (1848) und das erste Wildtierfoto (1855) bis hin zur Verbreitung der Fotografie im Alltag mit der ersten Familienfotos und der Kodak-Boxkamera (1888) und der Brownie-Kamera (1900).
Welche Bedeutung hat die Fotografie für die Geschichtswissenschaft laut dem Text?
Die Fotografie wird als historische Quelle betrachtet, die die Geschichtswissenschaft durch den 1. Weltkrieg erstmals zugänglich wird. Sie ermöglichte eine neue Art der Dokumentation und bot eine scheinbar objektive Perspektive auf Ereignisse, im Gegensatz zu den oft subjektiven schriftlichen Quellen. Der Text thematisiert die Problematik der Zensur und Manipulation von Fotografien und die Notwendigkeit einer kritischen Einordnung.
Was wird bei der Analyse verschiedener Fotobände zum 1. Weltkrieg untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf Regimentsfotobände, die von privaten Fotografen erstellt wurden, um Kameraden eine Erinnerung zu hinterlassen. Es wird untersucht, wie diese Bände den Kriegsweg chronologisch dokumentieren, sowohl das Kriegsgeschehen als auch das Alltagsleben der Soldaten abbilden und wie sich die Darstellung im Laufe des Krieges verändert.
Was ist die Schlussbetrachtung des Textes?
Die Schlussbetrachtung betont die Bedeutung von Fotos als Quelle für die Geschichtswissenschaft, weist aber auf die Notwendigkeit einer genauen Überprüfung und Interpretation hin. Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos nicht immer die gesamte Wahrheit zeigen und ebenso wie schriftliche Quellen Schwächen aufweisen. Die Kombination von schriftlichen Quellen und Fotos wird als Schlüssel zur Herstellung objektiver Forschungspositionen gesehen.
Welche Literatur wird im Text angegeben?
Der Text listet verschiedene Bücher und Artikel auf, die sich mit der Thematik Kriegsfotografie und der Bedeutung der Fotografie für die Geschichtswissenschaft befassen. Dazu gehören Werke von Ernst Friedrich, Anton Holzer, Bernd Hüppauf und Barbara Duden, sowie Informationen zur Kodak Firmengeschichte und ein Werk über die Badener im Weltkrieg 1914/1918.
- Quote paper
- Robert Weber (Author), 2005, Die Bedeutung der privaten Fotografie im 1. Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110183