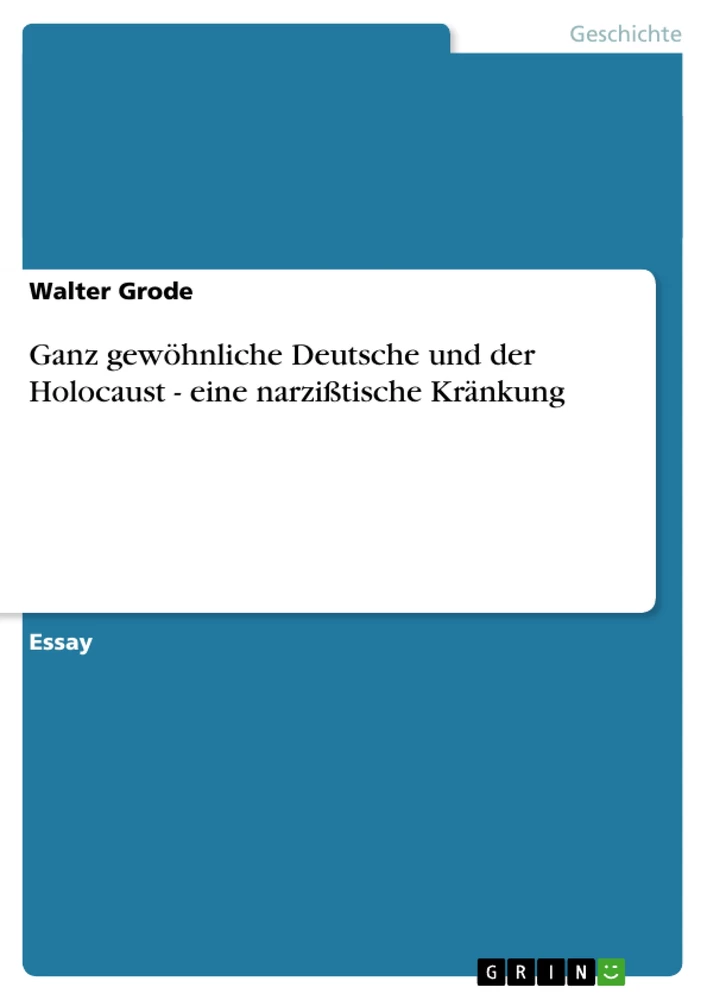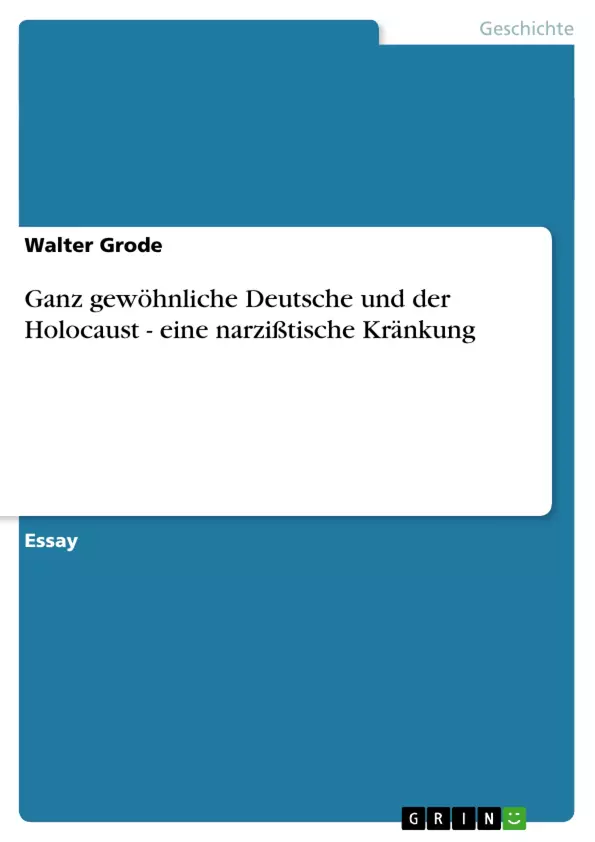Walter Grode
Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust - eine narzißtische Kränkung
Rezensionsessay zu: Daniel Jonah Goldhagen: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz ge-wöhnliche Deutsche und der Holocaust. Aus dem Englischen von Klaus Kochmann. Siedler Verlag. Berlin 1996
(Erschienen in: >Lutherische Monatshefte< Kirche im Dialog mit Kultur, Wissenschaft und Politik,, Heft 12, Dezember 1996)
Goldhagens Befund ist eindeutig: Der Holocaust fand in Deutschland statt und nur in Deutschland, weil nur hier drei Faktoren zusammentrafen: Hier kamen die entschlossensten, giftigsten Antisemiten in der Menschheitsgeschichte an die Macht und beschlossen, eine mörderische Phantasie zum Zentrum der staatlichen Politik zu machen. Das geschah in einer Gesellschaft, die die entscheidenden Ansichten dieser Leute über die Juden weithin teilte. Der dritte Faktor war, daß nur Deutschland sich in der geopolitischen Lage befand, einen Völkermord dieser Größenordnung durchzuführen. An dieser Mahnung ist nichts herumzurelativieren, sie wird auf ewig wie ein Fels in der deutschen Geschichte stehen.
Wenn das Erscheinen von Goldhagens Werk (fast ein Jahr nach dem Ende des Gedenkjahres 1995) so viel Staub aufgewirbeln konnte, so wohl weniger deshalb, weil er als Historiker auf der Singularität des Zusammentreffens dieser drei Faktoren besteht, sondern weil er zugleich eine spezifische, ausschließlich auf den deutschen Antisemitismus bezogene, soziologische und psychologische Perspektive einfordert, eine Perspektive, die die individuelle Mentalität der Täter zum zentralen Element der Untersuchung macht.
Der Autor breitet dokumentarisches Material aus, mit dem sich die Wissenschaft bisher allenfalls am Rande und allein unter historischen Gesichtspunkten befaßt hat. Dies gilt für die Beteiligung der deutschen Polizeibataillone, insbes. aber für die Bedingungen in den Arbeitslagern, in denen Juden bei sinnlosen und sich wiederholenden Arbeiten ohne ausreichende Nahrung, ohne Schlaf buchstäblich zu Tode gearbeitet wurden. Und es gilt für das Verhalten der Wachen während der Todesmärsche in der letzten Kriegsphase, als sie trotz eines Befehls von Himmler, die Juden nicht weiter zu mißhandeln, ihrem anscheinend tiefsitzenden mörderischen Haß auf ihre Opfer verhaftet blieben.
Goldhagens Ergebnisse sind schockierend: So sei der Kreis der Täter sehr viel größer als bislang angenommen, die Täter seien in erster Linie ganz gewöhnliche Deutsche gewesen, motiviert durch einen tief verwurzelten, "eliminatorischen" Antisemitismus, der fast die gesamte deutsche Bevölkerung jener Zeit durchdrungen habe. Und diese deutschen Täter, schreibt Goldhagen, waren individuell urteilsfähig. Doch sie standen ihren Taten nicht neutral oder gar ablehnend gegenüber, wie sämtliche bisherigen Erklärungsansätze, mögen sie ansonsten noch so unterschiedlich sein, unisono behaupten. Sie handelten also nicht etwa aus einem Befehlsnotstand heraus, noch nicht einmal aus einem subjektiven, sondern "aus freien Stücken" und aus Überzeugung.
Goldhagen argumentiert simplifizierend und monokausal. Souverän erklärt er fast sämtliche Ergebnisse der NS-Forschung für irrelevant. Dafür betreibt er eine filmreife Inszenierung des Grauens. Mit Hilfe solcher (zumindest diesem Thema unangemessener) Stilmittel, rührt er jedoch an zwei noch immer noch wirksame Tabus: Die Vorstellung, die große Mehrheit der Deutschen habe vom Judenmord nichts gewußt und habe ihn auch nicht gewollt. Und an das zweite, viel stärker wirkende, die Täter seien gar nicht der Überzeugung gewesen, es sei gerechtfertigt die Juden zu töten.
Beides läßt Goldhagen nicht gelten. Kaum verhüllt begeht er einen ungeheuerlichen Tabubruch : Er setzt die deutschen Täter des Holocaust - die nach seinen abschließenden Worten nur das wurden, was auch die meisten Deutschen hätten werden können - (kaum verhüllt) mit denen in Ruanda oder Liberia gleich.
Doch vor einer Auseinandersetzung mit dieser nationalen narzißtischen Kränkung, weichen sowohl die nachgeborenen Kritiker der TAZ-Generation, als auch die der FAZ-Generation abblockend und insinuierend zurück. Mit dem ironischen Ergebnis, daß das Buch eine Aussöhnung zwischen den Generationen zuwege brachte, auf die die FAZ-Generation, vierzig Jahre lang vergeblich hatte warten müssen.
Fast alle Kritiker unterstellten Goldhagen, er postuliere erneut eine Kollektivschuld oder schlimmer noch - einen unveränderlichen deutschen Nationalcharakter. Viele zahlten es Goldhagen heim, indem sie nicht nur seine wissenschaftliche Reputation, sondern auch die persönliche Integrität in Zweifel zogen. Nicht nur dieser Unredlichkeiten wegen, hätten seine deutschen Kritiker mit Goldhagen besser umgehen sollen: Denn mit seinem
Beharren auf einer spezifisch deutschen, orts- und zeitgebundenen Mentalität, entlastet Goldhagen ja nicht nur die zivilen Gesellschaften des Westens und die deutschen Generationen der Nachgeborenen, sondern (zumindest partiell) auch die Tätergeneration.
Hier stößt Goldhagens anerkennenswerte und glänzend vermarktete Absicht, den Holocaust nicht nur als historisches Phänomen zu begreifen, an von ihm selbst errichtete kulturanthropologische Grenzen. Denn unter universell soziologischem oder sozialpsychologischem Blickwinkel, den Goldhagen jedoch als angeblich ahistorisch ablehnt, erscheint mir der Holocaust und vor allem auch das in ihm eingekapselte Grausamkeitspotential, sehr viel mehr als ein Phänomen der Moderne und weniger als ein generationen- und kulturgebundenes, deutsches Spezifikum.
Erinnert sei z.B. an die Schlußsätze Hannah Arendts in ihrer Studie über den Eichmann-Prozeß. Das eigentliche Verbrechen Eichmanns, schrieb sie, sei gewesen, daß er sich angemaßt habe, darüber zu entscheiden, wer das Recht habe, auf dieser Erde zu leben. Genau das aber ist der Stachel, der jede tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Holocaust zu einer fortwährenden und gleichermaßen zu einer nicht zu bewältigenden macht. Denn unsere gesamte (westliche) Lebensweise, mit allen ihren zivilisatori- schen Fortschritten, hat diese schlummernde Hybris (geweckt z.B. durch die "Fortschritte" in der Embryonenforschung oder der Transplantationsmedizin) zu ihrer immanenten Voraussetzung.
Häufig gestellte Fragen zu "Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust - eine narzißtische Kränkung"
Worum geht es in dem Essay von Walter Grode?
Der Essay ist eine Rezension von Daniel Jonah Goldhagens Buch "Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust." Grode fasst Goldhagens These zusammen und setzt sich kritisch mit ihr auseinander.
Was ist Goldhagens Hauptthese?
Goldhagen argumentiert, dass der Holocaust in Deutschland stattfand, weil es dort eine einzigartige Kombination aus entschlossenen Antisemiten an der Macht, einer weit verbreiteten antisemitischen Gesinnung in der Bevölkerung und der geopolitischen Möglichkeit zur Durchführung eines Völkermords gab. Er betont die Rolle des "eliminatorischen" Antisemitismus als Hauptmotiv der Täter.
Welche Kritik übt Grode an Goldhagens Werk?
Grode kritisiert Goldhagens simplifizierende und monokausale Argumentation. Er wirft ihm vor, frühere Forschungsergebnisse der NS-Forschung zu ignorieren und das Grauen filmreif zu inszenieren. Außerdem bemängelt er, dass Goldhagen die deutschen Täter des Holocaust mit Tätern in anderen Völkermorden gleichsetzt, was Grode als nationale narzisstische Kränkung betrachtet.
Was sind die Tabus, die Goldhagen laut Grode bricht?
Grode zufolge bricht Goldhagen zwei Tabus: die Vorstellung, die meisten Deutschen hätten nichts vom Judenmord gewusst und ihn nicht gewollt, und die Annahme, dass die Täter nicht von der Rechtfertigung des Judenmords überzeugt gewesen seien.
Welche positiven Aspekte sieht Grode in Goldhagens Arbeit?
Grode räumt ein, dass Goldhagens Beharren auf einer spezifisch deutschen Mentalität die zivilen Gesellschaften des Westens und die nachfolgenden Generationen entlastet. Er sieht auch ein kathartisches Potenzial für das deutsche Geschichtsbild, ähnlich wie bei Fritz Fischers Buch über den Ersten Weltkrieg.
Welche übergeordneten Perspektiven fehlen Goldhagen laut Grode?
Grode vermisst einen universell soziologischen oder sozialpsychologischen Blickwinkel, der den Holocaust als ein Phänomen der Moderne und weniger als ein generationen- und kulturgebundenes deutsches Spezifikum begreift. Er verweist auf Hannah Arendts Analyse über die Anmaßung, über das Lebensrecht anderer zu entscheiden, als einen wesentlichen Aspekt.
Welche Wirkung könnte Goldhagens Perspektive auf das deutsche Geschichtsbild haben?
Grode vergleicht die potenzielle Wirkung von Goldhagens Werk mit der von Fritz Fischers Buch über den Ersten Weltkrieg. Er sieht die Möglichkeit, dass Goldhagens Sichtweise zu einer kathartischen Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem Antisemitismus führen könnte.
- Quote paper
- Dr. phil. Walter Grode (Author), 1996, Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust - eine narzißtische Kränkung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110244