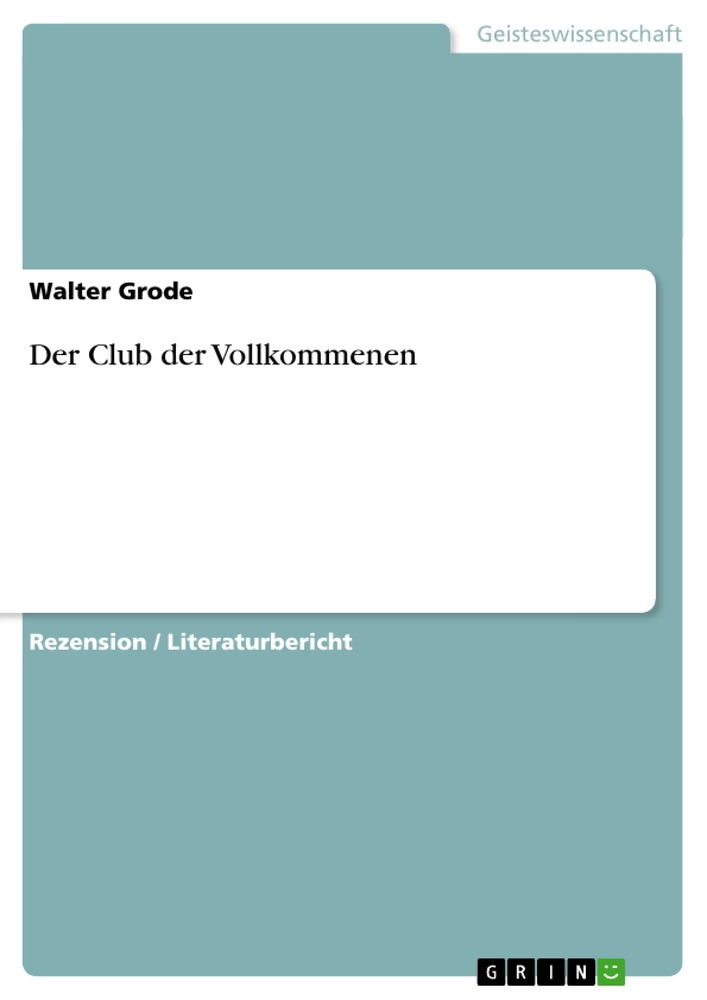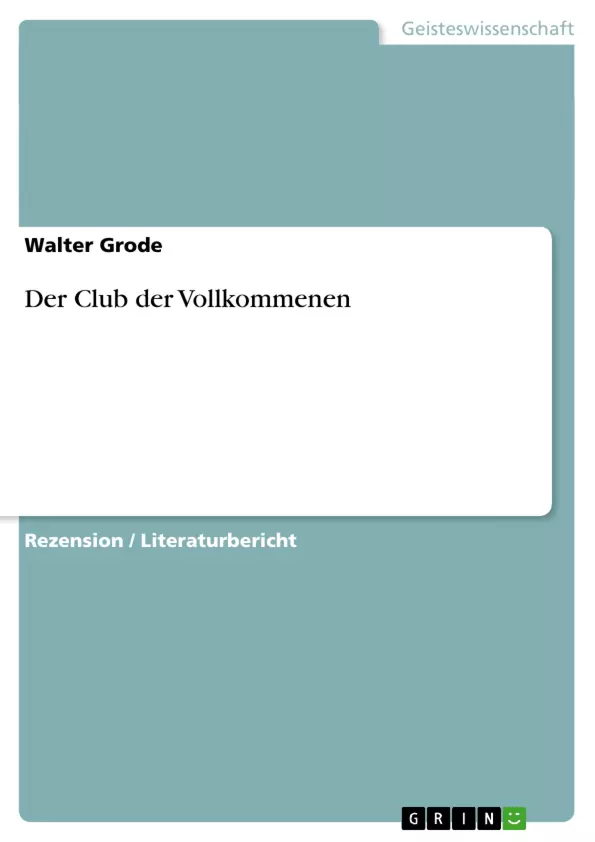Walter Grode
DER CLUB DER VOLLKOMMENEN
Genetische Makellosigkeit könnte ein Privileg der Reichen und Mächtigen werden
In: zeitzeichen (Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft), Heft 6/2001
(Kopftext der Redaktion)
In der Ausstellung "Der (im-)perfekte Mensch" im Dresdner Hygiene Museum wird in zeitgemäß perfekter technologischer Inszenierung für >das Recht auf Unvollkommenheit< geworben. Walter Grode nimmt dies zum Anlaß, über einen künftig möglichen Graben in der Gesellschaft nachzudenken: hier die genetisch Perfekten, dort die Unvollkommenen.
Unter Zypressen und weitem Himmel eine Herde friedlich weidender Schafe. Die Genrelandschaft des 18. Jahrhunderts ruft Hesiods Goldenes Zeitalter zurück, jenes ursprüngliche Arkadien, bevor Prometheus das Feuer raubte und die Arbeit in die Welt brachte. Am Ende wiederum Schafe. Diesmal als Installation, die Leiber aufgerollt aus >wolligen< Telefonschnüren, statt Beine Hörer angesetzt, und auf dem Rumpf ein Telefonapparat. Der Urgrund des Lebens mutiert zur >Information< schlechthin, von der der Modephilosoph Peter Sloterdijk behauptet, sie sei die >Geist< und >Materie< versöhnende Kraft. >Dolly< das Klonschaf, als Fleisch gewordene Überwindung der Streitfrage des philosophischen Dualismus.
Dazwischen liegt der mühsame Aufstieg des >Mängelwesen< Mensch, dessen technischer Geist, so Arnold Gehlen, in seiner berühmten Nachkriegsbetrachtung, nur darauf abziele, seine >natürlichen Organisationsmängel< auszugleichen. Eingelassen in die aufsteigenden Serpentinen menschlicher Zivilisation sind die Werkzeuge zur Naturbearbeitung (Rad, Fernglas, Leiter, Feuerzeug, Joystick) und schließlich zu ihrer Beherrschung. Was ursprünglich eine Geschichte der Entlastung schien, droht sich nun gegen den Menschen selbst zu richten: Unbehagen in der Kultur allenthalben künden die Spruchbänder am aufgespannten Horizont.
In einem düsteren Raum steht ein Rollstuhl. Von Videos blicken drei Frauen >von oben herab<, der sich in den Rollstuhl setzt. Über den wird nun geredet. Wie es wohl passiert sein könnte und wie leid es ihnen tut und was Du doch nur für ein armes Würstchen bist. Doch dann sensibilisiert eine künstlerische Installation für andere Ausdrucksweisen und Mitteilungsformen. u
Ein >Erlebnispark< zu den Themen >Sehen<, >Hören<, >Verstehen<, >Berühren< und >Bewegen<, sowie Ausschnitten aus Video-Interviews, lädt ein, noch andere als gewöhnliche Wahrnehmungsweisen zu entdecken. Zweimal in der Stunde wird dieser Saal vollständig verdunkelt, bis die Besucher nichts mehr sehen können. In dieser für Sehende etwas irritierenden Situation wird über Lautsprecher eine Textpassage vorgelesen, in der die Empfindungen einer blinden Schwimmerin beschrieben werden.
Und was bedeutet es, wenn man nicht mehr hören kann? In gebärdensprachlicher Übersetzung von Erzählungen und Musik wird die Komplexität der auf das Visuelle konzentrierten Wahrnehmung deutlich. Eine Trommel vermittelt den Hörenden das ungewöhnliche Erlebnis, Musik allein durch Schwingungen wahrzunehmen.
Zwischen Leben und Erleben
Mit dem letzten Raum schließlich, vom Veranstalter >Lichtung< genannt, ist eine Art Diskussionsforum entstanden. Per Kopfhörer kann man die Positionen von bekannten Wiissenschaftlern, Politikern und Fernsehmoderatoren zu Bioethik, Gentherapie und Sterbehilfe hören. Gegen diese Übermacht von Diskursen haben es die Betroffenen, die per Videoeinspielung von ihrem Leben mit der Behinderung berichten - genau wie im realen Leben - schwer, sich differenziert durchzusetzen, ohne in purer Umwertungslogik ihr So-Sein als Glücksversprechen zu glorifizieren.
Das dieser durchaus schiefe Eindruck entstehen kann, liegt vor allem an jener Dauerausstellung, die tagtäglich im Herzen unserer Konsumwelt stattfindet. Auch hier geht es um nicht weniger als um die große Frage >Wie wollen wir leben?< bzw. in unsere heutige Alltagssprache übersetzt, um die Frage: >Was wollen wir erleben?<. Und die ist, insbesondere von Skeptikern und Moralisten, in unserer ubiquitären Spaßgesellschaft allemal schwieriger zu stellen, als die einfache Frage >Was wollen wir essen?<, die noch bis vor sechs Monaten, also vor der BSE-Krise, fast unisono mit einem >Alles und zwar sofort< beantwortet wurde.
Dabei könnte ein bewußter(er) Umgang mit Behinderung, oder allgemeiner gesprochen, mit existentiellen Lebenssituationen (wie Krankheit, Geburt und Tod), einen ganz anderen Maßstab für den Umgang mit der eigenen Natur und der gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt zutage fördern: Nicht unbedingt sofort eine >Begrenzung aus Freiheit<, wie Bischof Wolfgang Huber sie angeregt hat, aber vielleicht eine >Begrenzung aus Einsicht<, die sich auf die eigenen (natürlich begrenzten) Ressourcen besinnt und damit zugleich die eigenen Glücksversprechen und Hoffnungen bewahrt, in der simplen Erkenntnis, daß es geradezu kontraproduktiv ist, alles uns mögliche (sofort) haben zu wollen und/oder (unverzüglich) tun zu müssen.
Doch eine solche Lebenshaltung steht, wie es scheint, im Widerspruch zum Funktionieren unserer allumfassenden Warenwelt, in die immer neue Lebensbereiche, und momentan, durch die vermeintlichen >Fortschritte< der Gentechnologie, sogar das Leben selbst hineingezogen wird.
Hier nun liegt auch der kaum zu thematisierende gesellschaftliche Widerspruch, der den Wunsch des >(im)perfekten Menschen< augenblicklich zerreißt: In dem Maße wie Behinderte als Teil gesellschaftlicher Pluralität anerkannt werden; in dem Maße, wie sie zumindest als exotischer Teil sozialer >Vielfalt< massenmedial vermarktet werden und sie zumindest in der öffentlichen Rede akzeptiert scheinen, wächst mit der scheinbar realen Möglichkeit andererseits auch der Wunsch, Behinderung, Alter und Schwäche unter allen Umständen zu vermeiden.
: Schönheit, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Autonomie, Rationalität, Perfektion und Genußfähigkeit sind zu Kategorien geworden, die die >moderne< Vorstellung von einem vollkommenen Leben prägen.
Jede Ratio hat ihren Preis Er besteht im Ausschluß dessen, was sich gewohntem Verständnis und der Verständigung entzieht. Dabei ist >Normalität< begrifflich und tatsächlich auf das angewiesen, was es ausschließt: Ohne >Irr-sinnige< kein Sinn, ohne >Krüppel< kein Maß-nehmen und keine Maß-nahme, ohne >Störung< kein Idealfall reibungslosen Verkehrs.
Jede moderne, rationale Konkurrenzgesellschaft bringt - weil sie die >Normalität< als allgemeinen Maßstab benötigt - also ganz automatisch auch das Nicht-Normale, das Nicht Angepaßte, das Behinderte hervor. Würde dies (z.B. durch die aktuell avisierten >Fortschritte< der Humangenetik) beseitigt, so würden zukünftig ganz neue, heute noch völlig >normale< Menschen an ihre Stelle treten, die nunmehr als >unnormal< gelten würden.
Zutritt für wenige
>Keine Angst<, beruhigt uns deshalb schon heute die Koalition aus Neuro- und Bio-, aus Börsen- und Computertechnologie, die sich vor unseren Augen zu einer neuen allgemeinen >Lebenswissenschaft< aufzuschwingen scheint: >Das ist alles nur eine Frage der permanenten Selbstoptimierung!<
Doch diese allseitige Aufforderung zur Perfektion hat einen generellen Haken: Sie inszeniert sich nämlich als Privileg: Wie einst das Angebot exklusiver Schulen oder heute das Angebot exklusiver Wohnsiedlungen, so verheißen morgen die Angebote der Genforschung und Humanprotetik nicht bloß das vermeintlich gute Leben, sondern vor allem auch gesellschaftliche Distinktion.
Zu diesem >Club der genetisch Vollkommenen< werden nur verhältnismäßig wenige Zutritt haben. Man kann davon ausgehen, schreibt der Soziologe Zygmunt Bauman, daß die enormen Kosten der Mitgliedschaft in diesem keine Kinderkrankheit einer neuen Technologie darstellen, sondern ihr ständiges Merkmal bleiben werden.
(Hervorheb. Der Red.)
Die Ersetzug von "schadhaften" Genen wird in Zukunft zu dauernden Aufgabe
Es wird immer wieder neue, unvermutet auftauchende Leiden zu kurieren geben, immer wieder neue Gene, denen die Gunst entzogen wird und die ersetzt werden müssen. Man kann sich dieses Privilegs also sicher sein - während die meisten traditionellen Privilegien von Tag zu Tag wackliger und zweifelhafter werden.
Das neue Privileg scheint lohnender zu sein als jedes andere. Die Distinktion wird nämlich nicht mehr so fragwürdige und umstrittene Begriffe wie mindere Intelligenz, geringeren Schneid, oder Fleiß, der rangniederen Sterblichen bemühen müssen.
Gegen Statusüberlegenheit der Höhergestellten läßt sich Protest anmelden, wenn ihr sozialer Rang eine Klassenfrage, glücklicher Zufall oder einfach nur Skrupellosigkeit war. Aber wer will schon gegen die Gene protestieren?, fragt Zygmunt Bauman.
Die Vorfahren dieser Privilegierten, die die wunderbaren Erfindungen der Gentechnologie und der Humanprothetik demnächst für sich nutzen werden, wähnten einst die Götter auf ihrer Seite. Wir aber sollten es den neuen falschen Göttern nicht so leicht machen. Wir könnten zum Beispiel damit aufhören, uns selbst aus der eingangs skizzierten >Dritte-Person-Perspektive< zu betrachten, aus der herab seit jeher soziale Ameisen untersucht und gelenkt wurden und aus der heraus, wie zu befürchten ist, die neuen >Biowissenschaften< ihre Menschenbilder optimieren.
Dresdner Hygienemuseum:
"Der (im-)perfekte Mensch".
Ausstellung bis zum 12. August 2001.
Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag,
Freitag 9 bis 17 Uhr;
Samstag, Sonntag, Feiertage
10-18 Uhr.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Artikel "DER CLUB DER VOLLKOMMENEN"?
Der Artikel "DER CLUB DER VOLLKOMMENEN" von Walter Grode, erschienen in zeitzeichen 6/2001, thematisiert die mögliche Entstehung einer Zweiklassengesellschaft basierend auf genetischer Perfektion. Er untersucht die ethischen und sozialen Implikationen der Gentechnologie und die Gefahr, dass genetische Makellosigkeit zu einem Privileg der Reichen und Mächtigen werden könnte.
Welchen Anlass gibt die Ausstellung "Der (im-)perfekte Mensch" im Dresdner Hygiene Museum für den Artikel?
Die Ausstellung, die für das "Recht auf Unvollkommenheit" wirbt, dient als Ausgangspunkt für Grodes Überlegungen über die potenziellen gesellschaftlichen Gräben zwischen genetisch perfekten und unvollkommenen Menschen.
Was kritisiert der Autor an der modernen Gesellschaft?
Der Autor kritisiert die zunehmende Fixierung auf Perfektion, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Autonomie in der modernen Gesellschaft. Er warnt davor, dass diese Ideale zu einer Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen oder anderen vermeintlichen "Mängeln" führen können.
Wie bewertet der Artikel die Rolle der Gentechnologie?
Der Artikel sieht die Gentechnologie kritisch. Er betont die Gefahr, dass sie zur Schaffung einer neuen Form der sozialen Ungleichheit beitragen könnte, in der der Zugang zu genetischer Verbesserung ein Privileg weniger wäre.
Was ist das "Privileg der Vollkommenheit", von dem im Artikel die Rede ist?
Das "Privileg der Vollkommenheit" bezieht sich auf die Möglichkeit, durch Gentechnologie und Humanprothetik vermeintliche "Mängel" zu beseitigen und sich somit einen Vorteil in der Gesellschaft zu verschaffen. Dieses Privileg wäre jedoch nicht für alle zugänglich, sondern vor allem für die Reichen und Mächtigen.
Welche Kritik übt der Autor an der Idee der "Selbstoptimierung"?
Der Autor argumentiert, dass die allgegenwärtige Aufforderung zur "Selbstoptimierung" als Privileg inszeniert wird und somit soziale Distinktionen verstärkt. Er warnt davor, dass die Jagd nach Perfektion zu einer Ausgrenzung derer führen kann, die diesen Standard nicht erreichen können.
Wie sollen wir uns laut Artikel verhalten, um die drohende Zweiklassengesellschaft zu verhindern?
Der Artikel fordert dazu auf, sich nicht aus einer distanzierten "Dritte-Person-Perspektive" zu betrachten, aus der heraus Menschen untersucht und gelenkt werden, und die neuen "Biowissenschaften" daran zu hindern, ihre Menschenbilder zu optimieren.
Was sagt der Artikel über "Normalität"?
Der Artikel argumentiert, dass jede moderne Gesellschaft das "Nicht-Normale" hervorbringt, da "Normalität" nur durch den Ausschluss dessen definiert werden kann, was von der Norm abweicht. Der Autor warnt davor, dass die Beseitigung des "Nicht-Normalen" durch Gentechnologie lediglich dazu führen würde, dass neue Gruppen als "unnormal" gelten.
Was kann man aus dem Artikel über das Dresdner Hygienemuseum lernen?
Der Artikel wirbt für die Ausstellung "Der (im-)perfekte Mensch" im Dresdner Hygienemuseum und gibt Informationen zu Öffnungszeiten und Internetauftritt des Museums.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Walter Grode (Autor:in), 2000, Der Club der Vollkommenen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110252