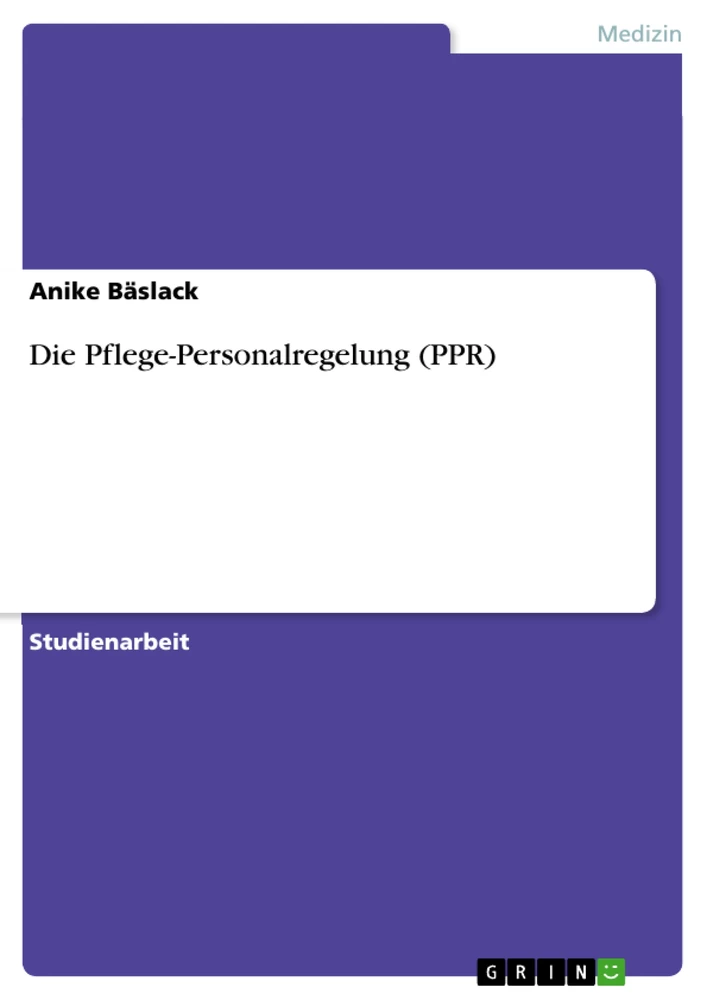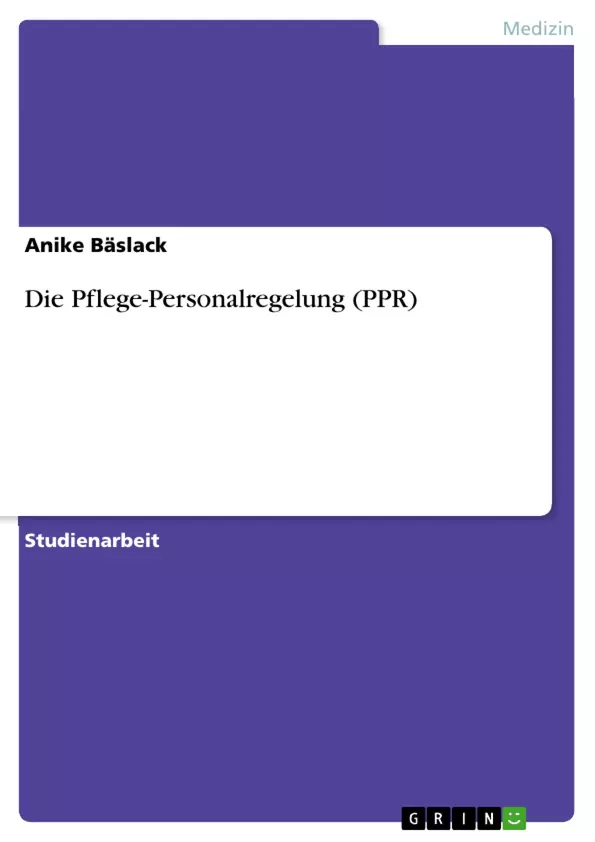Erstmals wurden 1969 sogenannte „Anhaltszahlen“ zur Berechnung des Pflegepersonals in den Krankenanstalten von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) publiziert. Die Frage, wie viele Patient(inn)en durch eine Pflegekraft versorgt werden sollten, konnte damit näherungsweise beantwortet werden.
1978 wurde durch die DKG auf den Umstand hingewiesen, dass die zugrundegelegten Kriterien wie z. B. das Patient(inn)enalter und die Art der Erkrankung einem stetigem Wandel unterliegen, sodass o. g. Anhaltszahlen nur als Annäherungswert und Orientierungshilfe anzusehen wären.
Die DKG initiierte deshalb vier Jahre später Neuverhandlungen über die Personalbedarfsmessung an allgemeinen Krankenhäusern; jedoch scheiterten zahlreiche Verhandlungsrunden im Laufe der Jahre.
In den darauf folgenden Jahren kam es auf Grund der Zunahme diagnostischer und therapeutischer Verfahren, sowie des wachsenden Anteils älterer Patient(inn)en, von Multimorbidität und chronischen Erkrankungen zu einer erheblichen Leistungsausweitung in der stationären Krankenpflege, verbunden mit einer höheren Qualifikationsanforderung an die Pflegenden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Entwicklung der PPR
- 1.1 Geschichtliche Entwicklung
- 1.2 Grundsätze und Ziele
- 2 Umsetzung der PPR
- 2.1 Systematik und Datenerhebung
- 2.2 Chancen
- 2.3 Risiken und Probleme
- 3 Auswirkungen der PPR
- 3.1 Quantitative Auswirkungen
- 3.2 Auswirkungen auf die Qualitätssicherung
- 4 Aufhebung der PPR
- 4.1 Begründung
- 4.2 Interne Weiterführung
- 5 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Pflege-Personalregelung (PPR), ihren geschichtlichen Entwicklung, ihrer Umsetzung, Auswirkungen und letztendlich ihrer Aufhebung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der PPR und ihrer Relevanz für die Krankenpflege zu vermitteln.
- Geschichtliche Entwicklung der PPR und die Herausforderungen, die zu ihrer Einführung führten.
- Grundsätze, Ziele und Systematik der PPR.
- Chancen und Risiken der Umsetzung der PPR.
- Quantitative und qualitative Auswirkungen der PPR auf die Krankenpflege.
- Gründe für die Aufhebung der PPR und mögliche interne Weiterführung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Entwicklung der PPR: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der PPR. Es beginnt mit den "Anhaltszahlen" der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) aus dem Jahr 1969, die als erste Ansätze zur Berechnung des Pflegepersonals dienten. Die darauffolgenden Jahre zeigten jedoch die Grenzen dieser Zahlen aufgrund des Wandels in der Patientenstruktur und des medizinischen Fortschritts. Die zunehmende Multimorbidität und der wachsende Anteil älterer Patienten führten zu einer höheren Leistungsanforderung an die Pflegekräfte. Die Notwendigkeit einer neuen, patientenorientierten Bedarfsermittlung führte letztendlich zur Einberufung einer Expert(inn)engruppe und zur Entwicklung der PPR, die 1993 in Kraft trat. Das Kapitel verdeutlicht den langwierigen Prozess der Entwicklung und die Herausforderungen, die es zu bewältigen galt.
2 Umsetzung der PPR: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung der PPR. Es erläutert die Systematik der Datenerhebung und die damit verbundenen Chancen und Risiken. Die Chancen liegen in der Verbesserung der quantitativen und qualitativen Sicherung der Krankenpflege und der Schaffung von Transparenz. Die Risiken könnten in den Schwierigkeiten der Umsetzung und der möglichen Ineffizienz der standardisierten Verfahren liegen. Dieser Abschnitt vertieft sich vermutlich in die detaillierte Anwendung der PPR in verschiedenen Krankenhauskontexten und die Herausforderungen bei der Implementierung eines standardisierten Systems in einem dynamischen Umfeld wie der Krankenpflege.
3 Auswirkungen der PPR: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den Auswirkungen der PPR, sowohl quantitativ als auch qualitativ. Die quantitativen Auswirkungen betreffen sicherlich den Personalschlüssel und die damit verbundenen Kosten. Die qualitativen Auswirkungen konzentrieren sich wahrscheinlich auf die Auswirkungen auf die Pflegequalität, die Patientenzufriedenheit und die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals. Das Kapitel wird vermutlich eine detaillierte Analyse dieser Aspekte liefern, möglicherweise mit empirischen Daten oder Fallstudien, um die Auswirkungen der PPR zu belegen.
4 Aufhebung der PPR: Dieses Kapitel behandelt die Gründe für die Aufhebung der PPR und mögliche interne Weiterführungen. Es beleuchtet die Gründe für die Entscheidung, die PPR außer Kraft zu setzen und analysiert die damit verbundenen Konsequenzen. Es wird wahrscheinlich eine Diskussion über alternative Modelle der Personalbedarfsplanung und die Herausforderungen bei der Umstellung auf ein neues System beinhalten. Der Abschnitt könnte auch Lösungsansätze und zukünftige Perspektiven für die Personalplanung in der Krankenpflege aufzeigen.
Schlüsselwörter
Pflege-Personalregelung (PPR), Pflegepersonalbedarf, Krankenpflege, Krankenhausfinanzierung, Patientenstruktur, Pflegestandards, Qualitätssicherung, Gesundheitswesen, Personalschlüssel.
Häufig gestellte Fragen zur Pflege-Personalregelung (PPR)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Pflege-Personalregelung (PPR). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der geschichtlichen Entwicklung der PPR, ihrer Umsetzung, den Auswirkungen und schließlich ihrer Aufhebung.
Welche Themen werden in diesem Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die geschichtliche Entwicklung der PPR, beginnend mit den „Anhaltszahlen“ der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) bis hin zur endgültigen Aufhebung. Weitere Themen sind die Grundsätze und Ziele der PPR, ihre praktische Umsetzung inklusive Datenerhebung, Chancen und Risiken, sowie die quantitativen und qualitativen Auswirkungen auf die Krankenpflege. Schließlich wird die Aufhebung der PPR begründet und mögliche interne Weiterführungen diskutiert.
Wie ist die PPR entstanden?
Die PPR entstand aus der Notwendigkeit, den Pflegepersonalbedarf patientenorientierter zu ermitteln. Die vorherigen „Anhaltszahlen“ der DKG erwiesen sich aufgrund des Wandels in der Patientenstruktur (zunehmende Multimorbidität und älterer Patienten) und des medizinischen Fortschritts als unzureichend. Eine Expert(inn)engruppe wurde einberufen, um eine neue Bedarfsermittlung zu entwickeln, was schließlich 1993 zur Einführung der PPR führte.
Wie wurde die PPR umgesetzt?
Die Umsetzung der PPR umfasste ein System zur Datenerhebung. Das Dokument beschreibt die damit verbundenen Chancen (Verbesserung der quantitativen und qualitativen Sicherung der Krankenpflege, Schaffung von Transparenz) und Risiken (Schwierigkeiten der Umsetzung, mögliche Ineffizienz standardisierter Verfahren). Die detaillierte Anwendung in verschiedenen Krankenhauskontexten und die Herausforderungen der Implementierung in einem dynamischen Umfeld werden vermutlich vertieft behandelt.
Welche Auswirkungen hatte die PPR?
Die PPR hatte sowohl quantitative als auch qualitative Auswirkungen. Quantitativ betraf dies den Personalschlüssel und die damit verbundenen Kosten. Qualitativ konzentrierten sich die Auswirkungen auf die Pflegequalität, die Patientenzufriedenheit und die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals. Das Dokument deutet auf eine detaillierte Analyse dieser Aspekte mit möglichen empirischen Daten oder Fallstudien hin.
Warum wurde die PPR aufgehoben?
Das Dokument behandelt die Gründe für die Aufhebung der PPR und mögliche interne Weiterführungen. Es analysiert die Konsequenzen der Aufhebung und diskutiert wahrscheinlich alternative Modelle der Personalbedarfsplanung sowie die Herausforderungen bei der Umstellung auf ein neues System. Lösungsansätze und zukünftige Perspektiven für die Personalplanung in der Krankenpflege könnten ebenfalls beleuchtet werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Pflege-Personalregelung (PPR), Pflegepersonalbedarf, Krankenpflege, Krankenhausfinanzierung, Patientenstruktur, Pflegestandards, Qualitätssicherung, Gesundheitswesen, Personalschlüssel.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument umfasst die Kapitel: 1. Entwicklung der PPR, 2. Umsetzung der PPR, 3. Auswirkungen der PPR, 4. Aufhebung der PPR und 5. Diskussion. Jedes Kapitel wird detailliert in Form einer Zusammenfassung beschrieben.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Pflegewirtin (FH) Anike Bäslack (Autor:in), 2003, Die Pflege-Personalregelung (PPR), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110265