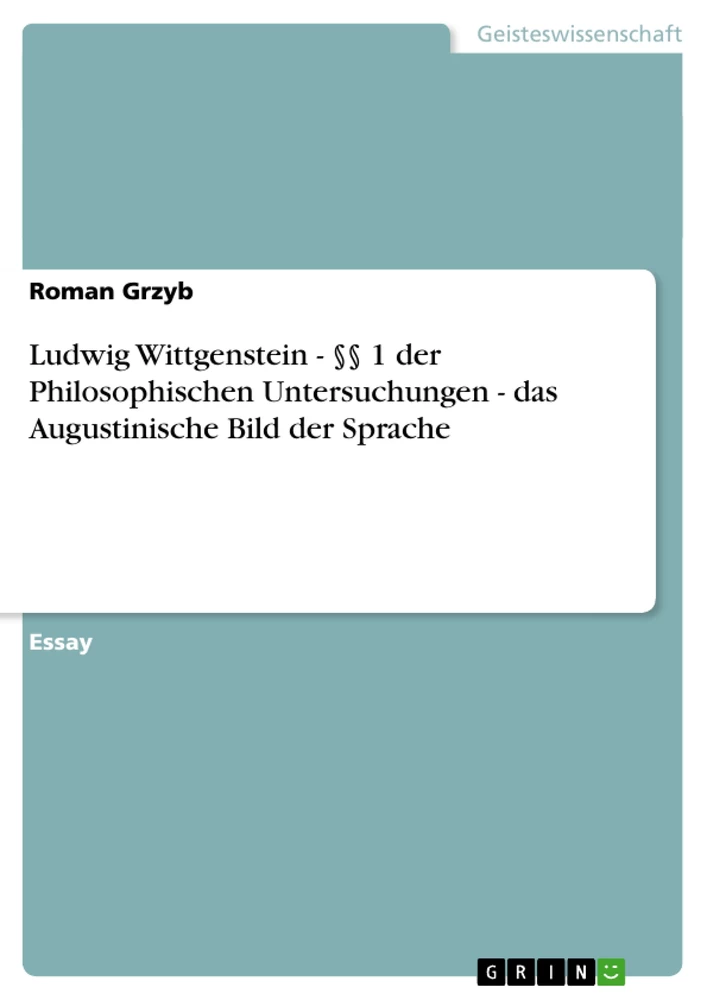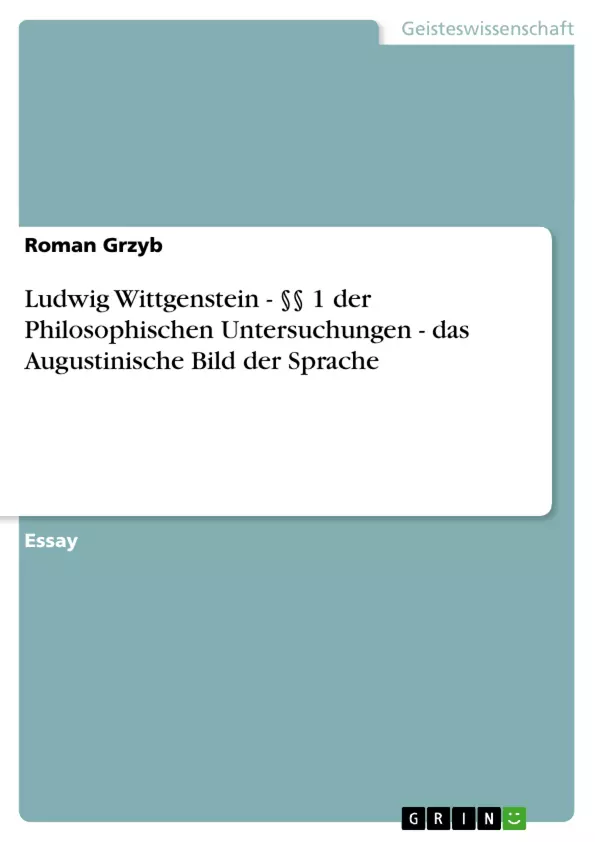Wittgenstein erläutert in seinem Werk der Philosophischen Untersuchungen am Beispiel eines Zitat von Augustinus, ein klassisches und pragmatisches Bild der Spracherlernung eines Kindes. Nach Augustinus Auffassung lernt das Kind die Sprache, indem es Gegenstände, auf welche die Eltern, in Form von Gebärden und Mimik hinweisen, mit den dazugehörigen Lauten bzw. Wörtern zu verbinden und diese dann in der richtigen Kombinatorik zu verwenden. Die Mimik und Gestik wird in diesem Falle als Koppelinstrument verwendet. Der Vorteil der Verwendung von Gestik und Mimik scheint mir, genau wie auch Augustinus, passend bzw. die einzigste Möglichkeit, da sie eine Sprache der Gefühle ist und Ausdrucksform von Empfindungen. Augustinus bezeichnet diese als die Ursprache aller Völker, wobei ich glaube, dass dies aufgrund der "Wortlosigkeit" dieser Kommunikation auch zutrifft, da Worte ein, durch den Menschen entwickeltes Medium sind, welches den natürlichen Irrtümern und Denkverwirrungen des menschlichen Verstandes aufheben. Viele Gefühlszustände werden auf der ganzen Welt auf gleiche Art und Weise dargestellt und sind unabhängig von unterschiedlichen kulturellen Strömungen. Trotzdem werden Laute, also Sprache, benutzt da diese sich den jeweiligen Geflogenheiten und Strömungen des jeweiligen Umfeldes anpasst und einfach nur genauer differenziert.
Inhaltsverzeichnis
- Das Augustinische Bild der Sprache
- Augustinus' Sprachauffassung
- Kritik an Augustinus' Bild der Sprache
- Die Bedeutung von Wörtern
- Wittgensteins Kritik an Augustinus
- Das Beispiel mit den fünf roten Äpfeln
- Die Bedeutung des Wortes "Fünf"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert das Augustinische Bild der Sprache, welches in Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen dargestellt wird. Das Ziel ist es, die wesentlichen Merkmale dieser Sprachauffassung herauszuarbeiten und Wittgensteins Kritik an Augustinus' Thesen zu erläutern.
- Das Augustinische Bild der Sprache und seine Funktionsweise
- Wittgensteins Kritik an der Begriffsbildung in Augustinus' Sprachauffassung
- Die Bedeutung von Wörtern im Kontext der Sprache
- Die Rolle von Gestik und Mimik in der Sprachaufnahme
- Die Frage nach der Erlernbarkeit von Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Das Augustinische Bild der Sprache
Der Essay beginnt mit einer Beschreibung des Augustinischen Bildes der Sprache, das auf dem Prinzip der Verbindung von Gegenständen mit Lauten bzw. Wörtern basiert. Hierbei spielen Gestik und Mimik eine entscheidende Rolle, da sie als „Ursprache aller Völker“ dienen.
Kritik an Augustinus' Bild der Sprache
Wittgenstein kritisiert das Augustinische Bild der Sprache, indem er argumentiert, dass die bloße Zuordnung von Wörtern zu Gegenständen nicht ausreicht, um die Bedeutung von Wörtern zu verstehen. Er führt das Beispiel mit den fünf roten Äpfeln an, um zu zeigen, dass die Bedeutung des Wortes „Fünf“ nicht durch einen konkreten Gegenstand repräsentiert werden kann.
Wittgensteins Kritik an Augustinus
Der Essay analysiert Wittgensteins Kritik an Augustinus' Sprachauffassung, indem er die Bedeutung des Wortes „Fünf“ im Kontext der Sprache und die Rolle der Logik bei der Sprachvermittlung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Der Essay fokussiert auf folgende Schlüsselwörter: Augustinische Bild der Sprache, Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Bedeutung, Gestik, Mimik, Sprache, Sprachvermittlung, Logik, Kombinatorik, Begriff, Erkenntnis.
- Citation du texte
- Roman Grzyb (Auteur), 2002, Ludwig Wittgenstein - §§ 1 der Philosophischen Untersuchungen - das Augustinische Bild der Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11029