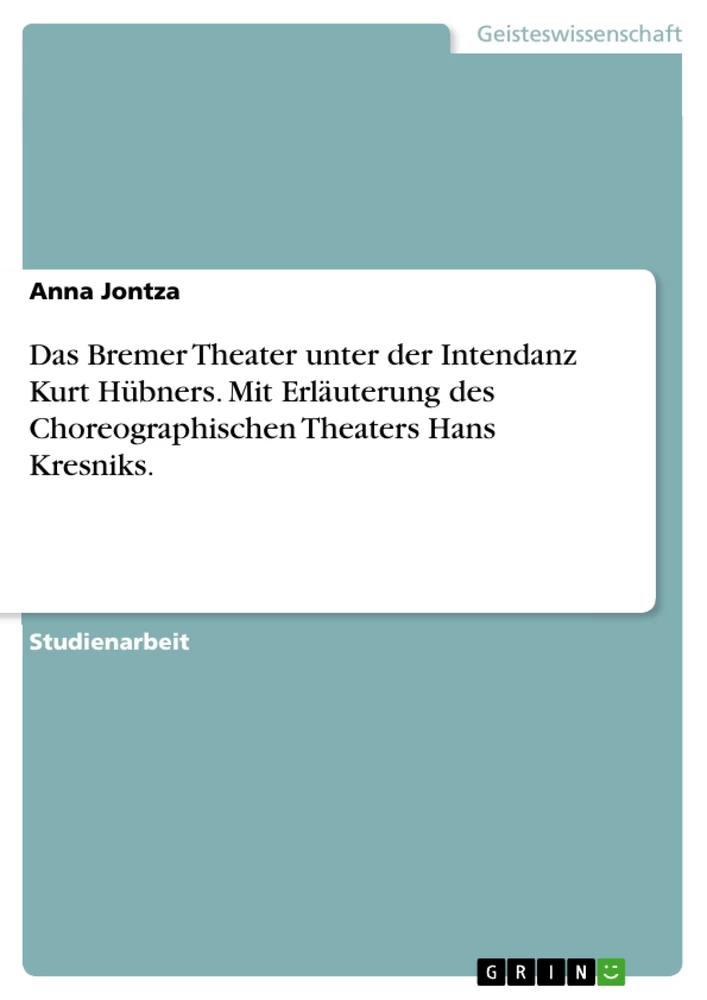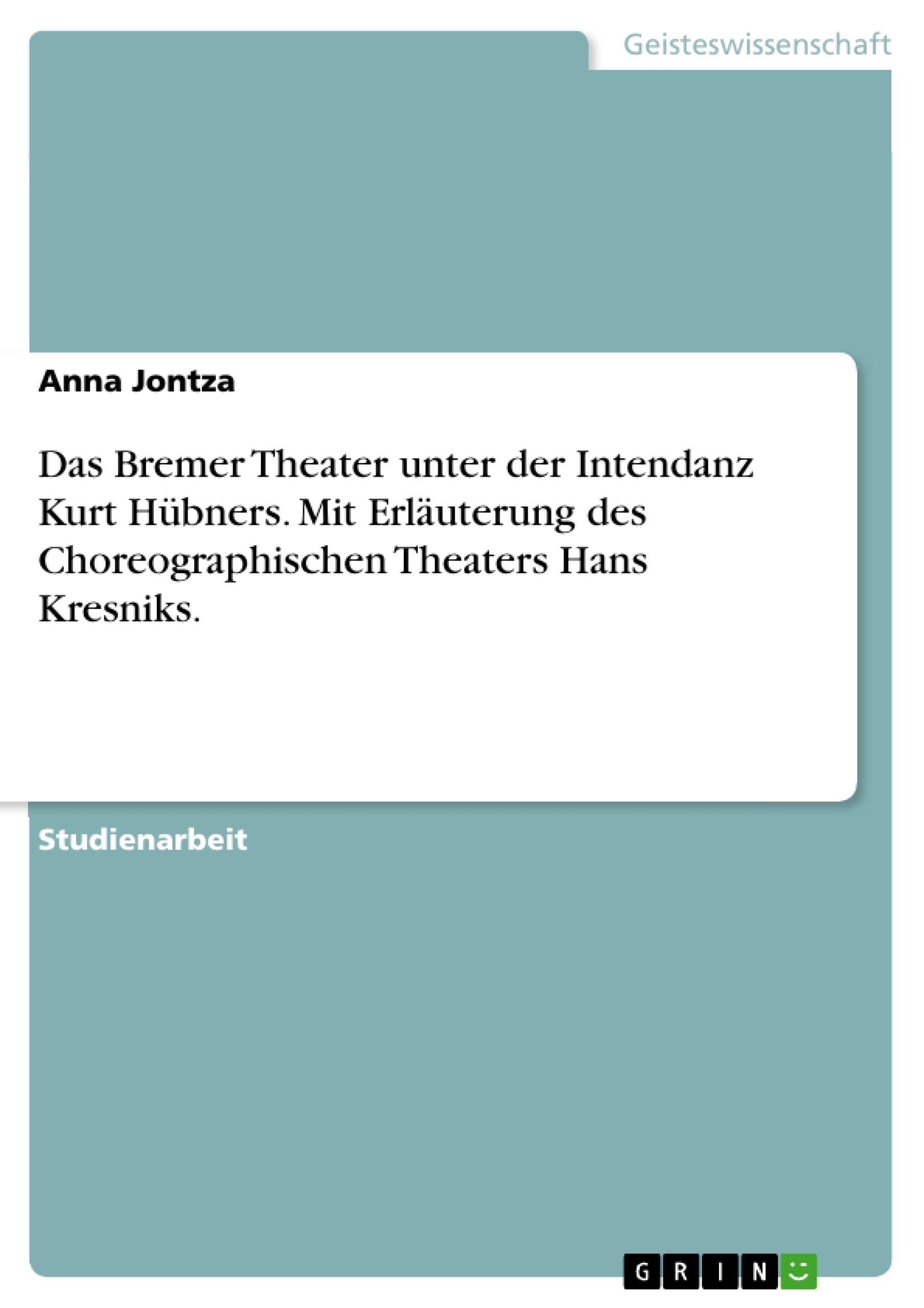Das Bremer Theater unter der Intendanz Kurt Hübners. Mit Erläuterung des Choreographischen Theaters Hans Kresniks.
Historischer Kontext: Die 60er Jahre
Da das Theater welches von Hübner gefördert wurde, sich in großem Maße mit dem Zeitgeschehen auseinander setzte, kann man auf eine grobe Darstellung der allgemeinen Stimmung und der Ereignisse in dieser Zeit nicht verzichten.
Wolfgang Kraushaar bezeichnet die Zeit von 1961 bis 1967 als Inkubationszeit für die radikaldemokratische Kritik, die nach dem Attentat auf Rudi Dutschke im Jahr 1968 extreme Züge annahm.
Man kann die gesellschaftlichen Veränderungen in den 60er Jahren nicht als eine einheitliche Bewegung, sondern muss sie als das Nebeneinander vieler unterschiedlicher theoretischer Gedankenmodelle betrachten. Allen Strömungen gemeinsam, war die intellektuelle Suche nach einem neuen Gesellschaftsmodell, da in den Augen der neuen Generation die bestehenden Verhältnisse nicht tragbar waren. Allgemein kritisierten die Bewegungen die unzureichende Thematisierung und Verarbeitung der NS-Vergangenheit der Deutschen, die soziale Ungerechtigkeit und Ausbeutung aufgrund der herrschenden Wirtschaftsordnung und die Unterjochung der Länder der Dritten Welt. Es wurde der Marxismus wiederentdeckt und man wollte nicht mehr, dass Deutschland als antikommunistisch galt.
Das geistige Fundament lieferten Adorno, Bloch, Horkheimer, Kracauer, Marcuse oder Habermas. Ihre Theorien wurden jedoch radikalisiert, was nicht unbedingt ihrem Sinn war.
1964 machte der Begriff des Bildungsnotstandes die Runde und man forderte eine Reformation des Universitätsbetriebes und die Chancengleichheit für sozial schwächere Studenten.
Man forderte eine breitere Öffentlichkeit, die als Kontrollinstanz für die Politik galt, sowie die uneingeschränkte Pressefreiheit. Hierin orientierten sich besonders die politisierten Studenten an den Theorien von Jürgen Habermas, kämpften für mehr Öffentlichkeit, für öffentliche Diskussionen und damit die Möglichkeit der offenen Kritik an der Politik.
Eine weitere Forderung war die Offenlegung und Verarbeitung der NS-Vergangenheit und die Strafverfolgung der Täter.
Der Ausgang der Wahlen 1966, nach denen eine große Koalition in Deutschland zustande kam, führte zu weiteren Protesten. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) sah sich angesichts dieser Situation verpflichtet eine Außerparlamentarische Opposition (APO) zu bilden. Deren Anführer war Rudi Dutschke, auf den am 11.04.1968 (Gründonnerstag) auf offener Straße ein Attentat verübt wurde. Zu diesem Attentat hatte die Springerpresse die Leser förmlich aufgehetzt und dies führte zu den schweren Unruhen von 1968.
Die Kritik an der Politik lag darin, dass die Parteienlandschaft zwar immer pluralistischer wurde aber nur einheitliche Meinungen vorherrschten.
In der Abwehr des Faschismus, der Bewegungen der 60er Jahre, war die Ablehnung der Autoritäten enthalten. Man ging davon aus, dass autoritäre Persönlichkeiten die Entwicklung der Demokratie gefährden würden. Werte wie Sauberkeit, Erfolgesstreben, Ordnungsliebe, Unterwürfigkeit und Diskriminierung von Fremden oder Schwachen, die autoritären Personen zugerechnet wurden, wurden als faschistoid betrachtet.
Die Ereignisse der 60er Jahre beschränken sich nicht nur auf Deutschland, sondern fanden in ganz Europa statt, und wurden durch die Ereignisse in der dritten Welt angestoßen. Die Entkolonialisierung war eines der zentralen Themen. Die Gewalt der unterdrückenden Mächte konnte nur durch Gegengewalt bekämpft werden, so die gängige Meinung. In Deutschland fühlte man sich mit Guerilla-Kämpfern in Bolivien und Venezuela verbunden. Kraushaar schreibt hierzu:
„Absicht war es, einen ökonomischen Rahmen zu skizzieren, der die Unabhängigkeitsbewegungen in der Dritten und die Oppositionsbewegungen in der Ersten Welt in einem global gedachten Revolutionskonzept miteinander verband.“[1]
Insgesamt kann man erkennen, dass von der 68er-Bewegung eine deutliche Kritik an allem gesellschaftlich Etablierten ausging. Ein besonderes Merkmal war die Geschwindigkeit, mit der nicht nur Theorien diskutiert, erprobt und wieder verworfen wurden, sondern auch im Vorgehen und in der Entwicklung neuer Gruppierungen und letztendlich im „Aufstieg und Fall“ der 68er-Bewegung. Den Geist dieser Zeit kann man deutlich in den Strömungen der Theaterlandschaft erkennen und gerade am Theater in Bremen waren, mit Zadek und ab 1968 Kresnik, zwei besonders gesellschaftskritische Theatermacher engagiert, die vom Intendanten Kurt Hübner zu ihrem oftmals radikalen Theater ermuntert wurden.
Kurt Hübner: „Die große Spürnase“
Kurt Hübner war von 1962 bis 1973 Intendant des Bremer Theaters. Diese Zeit wird in der Presse gleichstimmig positiv als das wichtigste Kapitel des europäischen Theaters bezeichnet, in der Hübner die Rolle des Entdeckers, Aktivators und Motivators für das deutsche Theater übernahm.
Tatsächlich engagierte Hübner in dieser Zeit viele junge Künstler, die heute zur Elite der Theaterwelt gehören und maßgeblich die Entwicklung der Theaterlandschaft im deutschsprachigen Raum prägen.
Das Bremer Theater war ein klassisches Dreispartentheater. Ein Auszug aus der „Personalliste“ dieser elf Jahre liest sich wie ein „Who is Who“ der Theaterlandschaft. In Bremen inszenierten die Regisseure Peter Zadek, Peter Stein, Rainer Werner Fassbinder, Alfred Kirchner, Peter Palitzsch, Eberhard Fechner, Johannes Schaaf, Hans Neuenfels, und Klaus Michael Grübner, für Kostüm und Bühnenbildgestaltung waren Wilfried Minks, Karl-Ernst Herrmann, Jürgen Rose und Erich Wonder verantwortlich. Zum Schauspielensemble gehörten u.a. Jutta Lampe, Edith Clever, Werner Rehm, Bruno Ganz, Traugott Buhre, Margit Carstensen, Buddy Elias, Hannelore Hoger, Vladim Glowna, Brigitte Janner, Monika Hansen und Mechthild Grossmann. Der Musiker Peer Raben sowie der Opernregisseur Götz Friedrich und der Choreograph Hans Kresnik gehörten zum Stab der Künstler des Bremer Theaters.
Hübner, der 1916 in Hamburg geboren wurde, wurde 2000 er für seine widerständige Haltung gegenüber einer fragwürdigen Kulturpolitik mit dem Peter-Weiß-Preis der Stadt Bochum ausgezeichnet, und zum 85. Geburtstag durfte er sich in das Goldene Buch der Stadt Bremen eintragen, was wie ein Versöhnungsangebot erscheint.
Ihm wurde 1973 der Vertrag schlicht nicht verlängert, was einem Rausschmiss gleichkommt. Daraufhin war er von 1973 bis 1986 Intendant an der Freien Volksbühne in West-Berlin. Seine Tatkraft und Ruhelosigkeit war hier nicht geringer und auch während, der Intendanz in Ulm (1959-1962) genauso mutig und experimentierfreudig wie in Bremen, dennoch hat diese Phase in Bremen etwas besonderes, wie Hübner selbst sagt:
„Es waren aufregende, wilde, schwierige Zeiten. Und das Wilde wurde von den Politikern reflektiert und war eine Last. Es sollte doch mit der Kunst, mit dem Theater angenehm bequem bleiben, nicht ständig neue Auseinandersetzungen! Das war denen vielleicht unheimlich.“[2]
Hübner rieb sich ständig an der Kulturpolitik in Bremen und kämpfte hart gegen Kürzungen des Budgets. Überregional hatte das Theater einen sehr guten Ruf. Inhaltlich wollte Hübner kein gefälliges Theater, sondern ein aufrüttelndes und auch polarisierendes. Nicht die Provokation war sein Ziel, sondern ein lebendiges Theater zu schaffen, was die Menschen wach macht, und nicht aus dem Theater vertreibt, denn natürlich wünschte er sich für die Vorstellungen, während all seiner Intendanzen, einen vollen Zuschauerraum. Sein Verdienst war es in der Bremer Zeit, dass wieder junge Menschen ins Theater kamen und sich eine „gesunde Streitkultur“ entwickelte, wie er selbst betont.
Nachdem Hübner Bremen verlassen musste, verlor der Standort an Bedeutung, dennoch schwebt der Mythos Hübner bis heute über Bremen. Und die Stadt schmückt sich mittlerweile mit dem Glanz der damaligen Zeit.
Bremer Stil
Im Zusammenhang mit der Ära Hübner in Bremen, taucht immer wieder der Begriff „Bremer Stil“ auf, zu dem Hübner selbst nur zu sagen weiß: „Das Bemerkenswerte am Bremer Stil war, dass es ihn überhaupt nicht gab.“ (BerlinOnline Feuilleton 30.10.01)
Bei der Vielfältigkeit der Persönlichkeiten, die dort zusammenkamen ist dieser Ausspruch einleuchtend. Dennoch muss dieses Kollektiv an Künstlern etwas Gemeinsames gehabt haben, sodass ein solcher Begriff überhaupt entstehen konnte. Susanne Schlicher[3] beschreibt den „Bremer Stil“ oder auch das „anarchistische Regietheater“ als die gemeinsame Suche der Künstler nach einer veränderten Bildsprache. Die Sinnlichkeit und Autonomie des Theaters sollte wieder entdeckt werden. Die Künstler setzten sich mit der Tradition des eigenen Mediums, den überlieferten Stücken und Spieltraditionen auseinander und gingen mit dem überlieferten Kulturgut dabei äußerst respektlos um. Die Ästhetik der Raumgestaltung und der Requisiten änderte sich dahingehend, dass die Szenischen Mittel im Sprech- und auch Tanztheater überdimensioniert und verfremdet wurden. Die Inszenierungen insbesondere von Zadek und Kresnik, die Elemente aus der Populärkultur aufgriffen, waren aggressiv und laut. Die Ausgangsfrage für alle Künstler war: Was ist Kunst und was ist in der Kunst machbar?
In Bremen machten die Künstler, gefördert und gefordert von Hübner, Theater aus dem Bedürfnis zur eigenen Zeit Stellung zu beziehen. Diese Antriebsfeder machte das Theater in Bremen zu einem politischen Theater, welches in der Tradition von Erwin Piscator und Berthold Brecht einzuordnen ist.
Das Choreographische Theater des Hans Kresnik
Hans Kresnik wurde 1939 in Bleiburg (Kärnten) geboren. Die Tanzausbildung im klassischen Ballett begann er 1958 in Graz. Seine Kariere als klassischer Tänzer endete nach dem Engagement in Köln 1968, wo er bereits erste choreographische Gehversuche gemacht hatte, mit der Anstellung als Ballettmeister und Choreograph für das Ballettensemble in Bremen. Dieses Engagement endete 1978.
Über Kurt Hübner sagt Kresnik in einem Interview:
„Kurt Hübner war ein Phänomen gewesen. Er konnte vom Schauspieler bis zum Regisseur, die nichts kannten und nichts konnten und nichts wussten, so viel rausholen und rausfiltern.[…] Und er war jemand, der, wenn es das erste Mal schief ging, nicht gesagt hat: Raus. […] Hübner hat gesagt: Du machst weiter, ich glaube an dich.“[4]
In Bremen wurden folgende Stücke aufgeführt und Inszeniert:
1969 „Ballett-Uraufführung“ und die Wiederaufnahme, des in Köln entstandenen Stückes, „O sela pei“, sowie „Susi Cremechees“, dass zunächst in Berlin Uraufgeführt wurde. 1970 entstanden „Kriegsanleitung für jedermann“ nach der Vorlage von „Der totale Widerstand“ von Major von Dach, „Frühling wurd´s…“ das Aktionsstück nach einer Ballade von Brecht und „PIGasUS“. Darauf folgen 1971 „Jaromir“ nach der literarischen Vorlage „Die Ahnfrau“ von Franz Grillparzer, „Schwanensee AG“ Kresniks Auseinandersetzung mit traditionellen Stoffen, 1973 “Traktate“, 1974 „Die Nibelungen“, 1975 „Romeo und Julia“, 1976 „Bilder des Ruhmes“ und zuletzt in Bremen „Jesus GmbH“ nach Adolf Holls „Jesus in schlechter Gesellschaft“.
Viel zitiert ist der Satz „Ballett kann kämpfen“ von Kresnik. Seine Stücke sind Kritik und Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, die er als alptraumhaft darstellt. Kresniks erste Stück verändern sich von den Anfängen, in denen er sehr provokant und plakativ Anklagt hin zu den späteren Werken, die komplexe Entkleidungen des Faschismus in der zivilisierten Gesellschaft sind, oder in denen er Gewalt und Brutalität im Alltag aufdeckt. Er geht weg von der Politisierung zu einer allgemeinen Zivilisationskritik und der Auseinandersetzung mit Mythen.
Die Inhaltliche Veränderung wird auch in der Form der Stücke erkenntlich. Zunächst sind die Inszenierungen wie „O sela pei“ oder „Kriegsanleitung für Jedermann“ Revuen. Diese Form hat des Theaters hat er dem Sprechtheater entlehnt und befindet sich damit formal und inhaltlich in der Tradition des dokumentarischen Theaters von Piscator. Es ist keine zusammenhängende Handlung vorhanden, die Stücke sind collagenartig zusammengesetzt und sind in ihrer Form offen. Diese Form bietet den Vorteil, dass man sonst nicht zusammen passende Elemente vereinen kann, dass man den Blickwinkel zu verändern und unterschiedliche Ebene einer Thematik zu beleuchten vermag.
Die Revue erlaubt zudem die Verbindung von politischen Inhalten und Anarchiegebärden mit trivialen bis kitschigen Komponenten und Unterhaltung.
Kresnik übt die Kritik mit klaren und überzeugenden Bildern, die die gesellschaftlichen Verhaltensweisen und Prozesse darstellen.
Er beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen dem Öffentlichen und Privaten, zwischen der Gesellschaft und den Außenseitern.
Er entwirft ein hässliches Bild der Gesellschaft und demaskiert das allgemeine Verständnis von Normalität.
Die Figuren seiner Stücke handeln nicht nur in ihrem privaten Raum, sondern sind auch immer in den historischen gesellschaftspolitischen Rahmen eingebettet.
Die Räume seiner Stücke entwirft er zu Anfang selbst. Sie zeichnen sich durch eine Sterilität und Aggressivität aus, die den Anspruch der Makellosigkeit, der von der Gesellschaft an das Individuum gestellt wird, verdeutlichen. Es ist keine Privatsphäre vorhanden. Zum Teil sind es stilisierte Zitate realer Orte und für „Jesus GmbH“ entwarf Joseph Beuys das Bühnenbild.
Kresniks Tanzstil ist sehr klassisch geprägt, da er selbst in dieser Tradition steht und er kann sich kaum davon lösen. Allerdings ist der Tanz extrem körperlich und die Bewegungen erscheinen kaum realisierbar. Der Tanz fungiert bei Kresnik als Ausdrucksträger und ist in den Gruppenszenen auch am stärksten und emotionalsten.
Die Zusammenarbeit mit den Tänzern ist sehr wichtig. In der Entwicklung eines Stückes haben sie ein Mitspracherecht und können ihre Ideen von Beginn an einbringen, da sie auch sofort Einblick in die Thematik des Stückes erhalten. Kresnik arbeitete mit einem festen Ensemble zusammen, das bewusst auch diese Art von Tanztheater produzieren wollte. Inszenierungen an anderen Theatern waren häufig nicht so fruchtbar.
Kresnik war in dieser Zeit schwer zu vermarkten und er selbst weigerte sich seine Stücke in das Abonnenten-Programm des Theaters aufzunehmen, da er die Menschen nicht enttäuschen wollte, die eine klassische Inszenierung sehen wollten und sich nicht permanent auf die „Werktreue-Diskussion“ einlassen wollte, die er für unsinnig hält.
In den 80er Jahren, als seine Stücke oft Biographien bekannter Personen, wie Sylvia Plath, Ulrike Bader-Meinhof oder Pierre Pasolini aufgriffen, wurde seine Arbeit auch populärer.
Kresnik kritisiert auch heute noch die Missstände in der Gesellschaft, hat seinen Fokus aber mittlerweile auf das Familiäre gelegt und ist in seinen Analysen differenzierter und in seinen Bildern subtiler geworden. Der Ansatz der Politisierung ist seinen Stücken aber erhalten geblieben.
Quellen:
Deutsches Tanzarchiv Köln (Hg.) (2000): „Tanzgespräche. Zeitgenössischer
Tanz im Dialog“. Köln.
Kraushaar, Wolfgang (2001): „Denkmodelle der 68er-Bewegung“ in
„Politik und Zeitgeschichte“.
http://www.bpb.de/publikationen/N86ETU,0,0,Denkmodelle_der_68erBewegung.html
Lazarowicz, Klaus/ Christopher Balme (Hg.) (1991): „Texte zur Theorie des
Theaters“. Stuttgart.
Pierwoss, Klaus (2001): „Die Große Spürnase“. In: „Berliner Zeitung“. Ressort:
Feuilleton, 30.10.2001.
http://www.berlinonline.de/wissen/berlier_zeitung/archiv/2001/1030/feuilleton/0026
Rinke, Moritz (2000): „Der Menschensammler“. In: „Tagesspiegel“, 12.11.2000
http://www.google.com/search?q=cache:4R-bURAWvYgC:www2.tagesspiegel.de/archiv/2000/11/11/ak-ku-12749.html+Menschensammler+H%C3%BCbner&hl=de&ie=UTF-8
Schlicher, Susanne (1987): „TanzTheater. Traditionen und Freiheiten. Pina
Bausch, Gerhard Bohner, Reinhild Hoffmann, Hans Kresnik,
Susanne Linke“. Reinbeck.
Schürmann, Frank (2000): „Kurt Hübner im Interview“. In: „Xzeit Magazin“ Nr.5
September/Oktober 2000.
http://www.xzeit.de/Artikel%20Nr.%205/HÃ1/4bner.htm
Schürmann, Frank (2001): „Die Rückkehr des Unbequemen“. In: „Die Welt“,
29.10.2001
http://www.welt.de/daten/2001/10/29/1029brf292078.htx
Werner, Carsten (2001): „Provokation? Quatsch!“. In: „TAZ Bremen“ Nr. 6589,
1.11.2001, S. 27
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Das Bremer Theater unter der Intendanz Kurt Hübners. Mit Erläuterung des Choreographischen Theaters Hans Kresniks"?
Der Text behandelt die Ära von Kurt Hübner als Intendant des Bremer Theaters von 1962 bis 1973. Er beleuchtet den historischen Kontext der 60er Jahre, Hübners Rolle als Förderer junger Künstler und die Bedeutung des Bremer Theaters in dieser Zeit. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Choreographischen Theater von Hans Kresnik.
Wer war Kurt Hübner?
Kurt Hübner war ein einflussreicher Theaterintendant, der von 1962 bis 1973 das Bremer Theater leitete. Er gilt als Entdecker und Förderer vieler bedeutender Künstler der Theaterwelt.
Was war das Besondere am Bremer Theater unter Kurt Hübner?
Das Bremer Theater unter Hübner zeichnete sich durch seine Experimentierfreudigkeit, seine gesellschaftskritische Haltung und die Förderung junger Talente aus. Es galt als eines der wichtigsten Theater in Europa.
Was bedeutet der Begriff "Bremer Stil"?
Der Begriff "Bremer Stil" bezieht sich auf die gemeinsame Suche der Künstler des Bremer Theaters nach einer veränderten Bildsprache und die respektlose Auseinandersetzung mit überliefertem Kulturgut. Es gab eine Vielfalt der Persönlichkeiten, die aber dennoch etwas Gemeinsames hatten.
Wer war Hans Kresnik?
Hans Kresnik war ein Choreograph, der von 1968 bis 1978 als Ballettmeister und Choreograph am Bremer Theater tätig war. Er entwickelte das "Choreographische Theater", das sich durch seine gesellschaftskritischen und provokanten Inszenierungen auszeichnete.
Was ist das "Choreographische Theater" von Hans Kresnik?
Das Choreographische Theater von Hans Kresnik ist eine Form des Tanztheaters, die sich mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzt und diese in oft provokanten und verstörenden Bildern darstellt. Seine Stücke sollen kämpfen und zur Auseinandersetzung anregen.
Welche Themen behandelte Hans Kresnik in seinen Stücken?
Kresniks Stücke thematisierten unter anderem Faschismus, Gewalt, Brutalität im Alltag, Zivilisationskritik und Mythen. Er setzte sich mit der Beziehung zwischen dem Öffentlichen und Privaten auseinander und entwarf ein hässliches Bild der Gesellschaft.
Was war das Verhältnis von Kurt Hübner und Hans Kresnik?
Kurt Hübner förderte Hans Kresnik und ermöglichte ihm, seine oft radikalen und provokanten Stücke am Bremer Theater zu inszenieren. Hübner glaubte an Kresniks Talent und unterstützte ihn auch bei Rückschlägen.
Welche anderen bekannten Künstler waren am Bremer Theater unter Kurt Hübner engagiert?
Zu den bekannten Künstlern, die am Bremer Theater unter Kurt Hübner engagiert waren, gehörten unter anderem die Regisseure Peter Zadek, Peter Stein, Rainer Werner Fassbinder, sowie Schauspieler wie Jutta Lampe, Edith Clever und Bruno Ganz.
Was waren die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Ära Hübner in Bremen?
Die Ära Hübner in Bremen fiel in die Zeit der 60er Jahre, die von gesellschaftlichen Umbrüchen, Studentenprotesten und einer kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit geprägt war. Das Bremer Theater wurde zu einem Ort der politischen Auseinandersetzung und des gesellschaftlichen Diskurses.