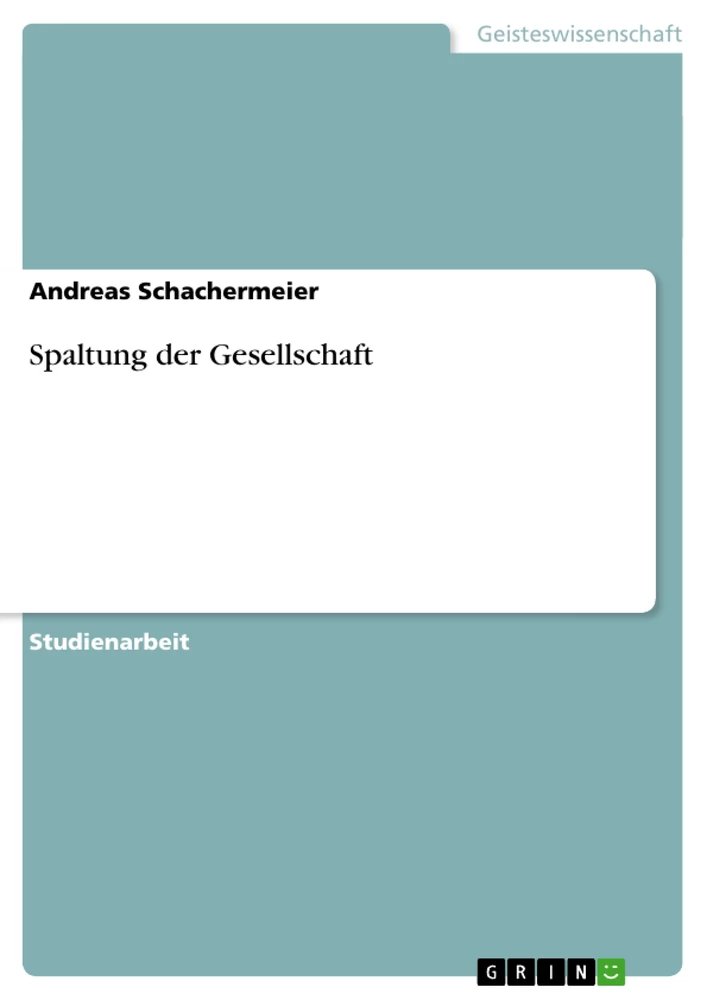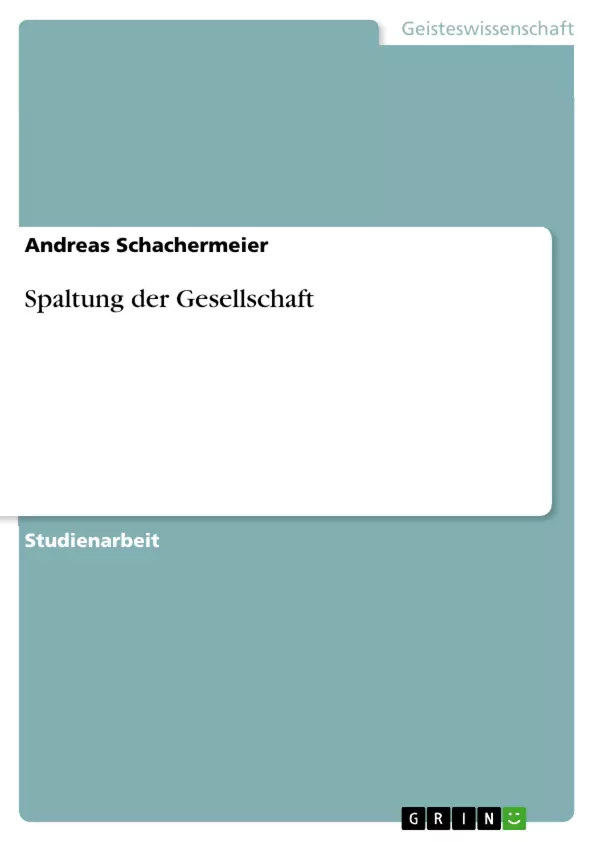Ausgehend von einer kurzen Diskussion der Fragestellung zur Spaltung der Gesellschaft folgt eine Bestandsaufnahme über soziale Ungleichheit, Reichtums- und Armutsentwicklung. Anschließend wird die Wahrnehmung von sozialer Spaltung in der Bevölkerung beschrieben, sowie die Tendenzen von Desintegration in der Wahrnehmung der Bürger dargestellt.
Im Folgenden werden kurz die Zusammenhänge von sozialer Lage, antizipierten Desintegrationspotentialen und wahrgenommener sozialer Spaltung sowie die Zusammenhänge mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vorgestellt und beschrieben.
Schlagwörter: Soziale Ungleichheit – soziale Spaltung – Desintegration - Menschenfeindlichkeit
Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung….…
2. Fragestellungen und Überblick
3. Bestandsaufnahme über soziale Ungleichheit, Reichtums- und Armutsentwicklung
4. Wahrnehmung von sozialer Spaltung in der Bevölkerung
4.1 Tendenzen von Desintegration in der Wahrnehmung der Bürger
4.2 Zusammenhänge von sozialer Lage, antizipierten Desintegrations-potentialen und wahrgenommener sozialer Spaltung
5. Zusammenhänge mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
5.1 Soziale Lage, Desintegrationserfahrungen und wahrgenommene soziale Spaltung als Ursachen
5.2 Desintegrationserfahrung und wahrgenommene Spaltung als Moderatoren
5.3 Wahrgenommene soziale Spaltung als Verstärkerfunktion von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in desintegrations- gefährdeten Gruppen
6. Diskussion.
Literaturverzeichnis
1. Zusammenfassung
Ausgehend von einer kurzen Diskussion der Fragestellung zur Spaltung der Gesellschaft folgt eine Bestandsaufnahme über soziale Ungleichheit, Reichtums- und Armutsentwicklung. Anschließend wird die Wahrnehmung von sozialer Spaltung in der Bevölkerung beschrieben, sowie die Tendenzen von Desintegration in der Wahrnehmung der Bürger dargestellt.
Im Folgenden werden kurz die Zusammenhänge von sozialer Lage, antizipierten Desintegrationspotentialen und wahrgenommener sozialer Spaltung sowie die Zusammenhänge mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vorgestellt und beschrieben.
Schlagwörter: Soziale Ungleichheit – soziale Spaltung – Desintegration - Menschenfeindlichkeit
2. Fragestellungen und Überblick
Jedes Jahr finden Erhebungen der GMF Surveys (Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit) statt und im Rahmen dieser Erhebungen stellte Heitmeyer (2005) fest, dass es einen Zuwachs des Personenkreises gab, der unsere Gesellschaft als gespalten wahrnimmt. Die Ergebnisse lagen zwischen 85% und 90%.
Doch was ist GMF eigentlich?
GMF beschreibt ein Syndrom, das heißt: Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Islamphobie, Sexismus, Etabliertenvorrechte und Heterophobie – die generelle Ablehnung von „Andersartigen“ – hängen zusammen, ohne dasselbe zu sein. Menschen mit einer starken Ausprägung in einer dieser Komponenten neigen oft auch zu hohen Werten in den anderen Merkmalen des Syndroms.
Aufgrund des doch sehr deutlichen Bildes dersubjektivenWahrnehmung der Bundesbürger stellt Heitmeyer nun die Frage, ob es möglich ist,objektiveStrukturentwicklungen nachzuweisen, die für die Spaltungstendenzen innerhalb unserer Gesellschaft verantwortlich sind und vor allem, welche Folgen sich daraus ergeben. Wichtig ist auch, in welchem Zusammenhang stehen soziale Abstiegs- und Desintegrationserfahrungen, die Anzipitation von Desintegrations-gefahren und die Wahrnehmung von Spaltungstendenzen mit Ideologien der Ungleichwertigkeit, derGruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit,also der Abwertung von schwachen Gruppen (Heitmeyer, 2005).
Um diese Fragen klären zu können, muss man den objektiven Entwicklungen zu Ungleichheitslagen in einem Zusammenhang mit der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung dieser Veränderungen setzen.
3. Bestandsaufnahme über soziale Ungleichheit, Reichtums- und Armutsentwicklung
Die Art und Weise, wie man soziale Ungleichheit definiert, hat sich im Laufe der letzten Jahre verändert. Begriffe wie „soziale Klassen“ und „Schichten“ können durch das komplexe Statusgefüge unserer modernen Gesellschaft nicht mehr hinreichend beschrieben werden. Daraufhin hat man seit Beginn der 80er Jahre das Instrumentarium zur Analyse von Ungleichheitslagen modifiziert, erweitert und zum Teil erneuert. Diese Veränderungen der Sozialstrukturanalyse geschahen vor allem durch die Hinwendung zu Lebensläufen (z.B. Berger/Sopp, 1995) und damit einhergehend durch die dynamische Armutsforschung (z.B. Leibfried/Voges, 1992) auf der einen Seite und durch die Millieu- (z.B. Vester, 1998) und die Lebensstilforschung (z.B. Schulze, 1992) auf der anderen Seite.
Unterschiede zwischen spezifischen sozialen Gruppierungen auf der horizontalen Ebene (z.B. Werthaltungen und Lebensstile) sind unumstritten, jedoch wurden Zweifel an der Gültigkeit vertikaler Strukturmodelle angemeldet. Heitmeyer und Mansel sind jedoch der Meinung, dass die traditionellen vertikalen Ungleichheitsstrukturen nach wie vor relevant sind.
Der Begriff derIndividualisierungspielte bei der Diskussion um die Veränderungen vertikaler sozialer Ungleichheitsstrukturen eine große Rolle. Individualisierung meint hier, dass alte gesellschaftliche Zuordnungen wie Stand und Klasse obsolet würden, zunehmender Zwang zur reflexiven Lebensführung mit einer Steigerung der Bildung einher geht, die Pluralisierung von Lebensstilen weiter zu nimmt, Identitäts- und Sinnfindung wird zur individuellen Leistung.
Dies wird durch eine Veränderung des staatlichen und ökonomischen Rahmens weiter gefördert.
Erwin K. Scheuch legte bereits 1961 ein Instrumentarium vor, das der Beschreibung und Ermittlung von vertikalen Ungleichheitslagen diente. Bei diesem Instrumentarium spielen Aspekte wie die soziale Positionierung und das berufliche Sozialprestige, die Bildungsbeteiligung, die Verteilung des Einkommens (sowie die Entwicklung von relativer Armut, der Arbeitslosenquoten und des Anteils der Sozialhilfeempfänger auf der einen und der Anteil der Einkommensmillionäre auf der anderen Seite) und des privaten Vermögens die entscheidende Rolle um den Sozialstatus von Personen und/oder Haushalten zu beschreiben.
Bevor wir jedoch auf die einzelnen Betrachtungen eingehen, sei vorangestellt, dass die letzten Jahrzehnte von einer enormen Reichtumsentwicklung gekennzeichnet sind. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank stieg das private Geldvermögen in Deutschland von 524 Milliarden DM im Jahr 1970 auf 4974 Milliarden DM (= 2543 Milliarden €) im Jahr 2002 und hat sich somit in den letzten 30 Jahren annähernd verzehnfacht. Die soll jedoch keineswegs bedeuten, dass es allen Personen gleichermaßen besser geht.
Die wirtschaftliche Entwicklung, die Technisierung und die Rationalisierung der Arbeitsabläufe sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland brachte für viele Deutsche einen sozialen Aufstieg mit sich. So ging z.B. der Anteil der in unteren sozialen Positionen und in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen (Arbeiter) tätigen Personen von fast der Hälfte (44,7 %) im Jahr 1950 auf 33.2 % in 2002 zurück. Einem nicht unerheblichen Anteil gelang damit ein Wechsel in besser bezahlte Angestelltenpositionen. Ihr Anteil an den Beschäftigten stieg von einem Sechstel (16.5 %) auf über die Hälfte an (51.8 %). Im entsprechenden Zeitraum stieg infolge der Bildungsexpansion der Anteil der jungen Menschen, die das Schulsystem mit dem höchsten Schulabschluss, der Hochschulreife, verlassen von 5 % auf 33 %. Diese Entwicklungen verleiteten auch viele Soziologen zu der Annahme, dass vertikale Ungleichheitslagen zunehmend an Bedeutung verlören.
Allerdings profitieren von dieser Wohlstandmehrung nicht alle Bevölkerungsteile gleichermaßen. So ist z.B. für ein Kind aus einer Beamtenfamilie die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Gymnasium besucht, gegenüber dem aus einer Arbeiterfamilie über das Fünffache erhöht (82.2 % versus 15.9 %). Und nicht wenige, die in den letzten Jahren noch in scheinbar sicheren Arbeitsverhältnissen tätig waren, sehen sich infolge der Auslagerung von Fertigungsvorgängen und Dienstleistungsabläufen aus den Grußunternehmen gezwungen, sich als kleine
Selbständige (Arbeitskraftunternehmer oder auch Ich-AG) in einem Zulieferbetrieb ihren Broterwerb zu verdienen. Dass dies nicht selten mit sozialen Einbrüchen einhergeht, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass der Zahl der Betriebsgründungen (2002: 723.333 Gewerbeanmeldungen) eine nur wenig kleinere Zahl von Konkursanmeldungen gegenübersteht (2002: 645.890 Gewerbeabmeldungen). Gleichzeitig hat sich seit 1995 in einem nur kurzen Zeitraum von fünf Jahren die Zahl der geringfügig Beschäftigten mehr als verdoppelt (1995: 1.164 Mill, 2000: 2.416 Mill.).
Und während sich auf der einen Seite in einem nur relativ kurzen Zeitraum die Zahl der Einkommensmillionäre (1983: 10.000, 1995: 27.000) fast verdreifacht hat, lebt ein wachsender Bevölkerungsteil in relativer Armut, sind immer mehr Menschen im Verlaufe ihres Erwerbslebens infolge von Werksschließungen oder betriebsbedingten Kündigungen von (langfristiger) Arbeitslosigkeit betroffen oder auf laufende Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger ist in der Bundesrepublik Deutschland seit den 60er Jahren (0.5 Mill.) um fast das Sechsfache auf annähernd drei Mill. im Jahr 2002 angestiegen.
Ganz deutlich manifestieren sich die sozialen Unterschiede in den Vermögensverhältnissen. Rechnet man zum privaten Geldvermögen das in Lebensversicherungen angelegte Kapital hinzu, verfügten 1998 Personen des oberen Viertels durchschnittlich über einen Besitz in Höhe von 42450 €. Das ist mehr als 13mal so viel wie Personen aus dem unteren Viertel, die im Mittel nur über einen Besitz in Höhe von 3090 € ihr Eigen nennen können (Abb. 1).
Abbildung 1: Nettogeldvermögen privater Haushalte in Euro
Viele Menschen können ihren eigenen Lebensunterhalt nicht mehr selbst bestreiten und sind zur Befriedigung auch elementarer Bedürfnisse auf staatliche Transferleistungen angewiesen oder müssen sich verschulden. Zunehmend mehr Menschen (nach Schätzungen täglich 500.000) - auch aus scheinbar ganz normalen Familien - sehen sich gezwungen öffentliche Essensausgaben in Anspruch zu nehmen.
Zumindest an den Rändern sind damit soziale Spaltungsprozesse nicht mehr zu leugnen. Die Abstände zwischen Armen und Reichen nehmen offenbar zu.
4. Wahrnehmung von sozialer Spaltung in der Bevölkerung
Im Folgenden werden zwei wesentliche Aspekte im Zusammenhang mit sozialer Spaltung näher beleuchtet. Zum einen, in welchem Ausmaß werden soziale Spaltungstendenzen in der Bevölkerung wahrgenommen und zum anderem, welche Bedeutung werden diesen Tendenzen zugemessen. Hier sei vorwegzunehmen, dass eine gering angesiedelte Bedeutung eher keine unmittelbaren Folgen auf das soziale Klima haben würde, während Spaltungstendenzen, die von der Bevölkerung stark wahrgenommen werden, sich höchstwahrscheinlich negativ auf vor allem sozial schwachgestellte Randgruppen auswirken könnten. Im Wettbewerb um Integrationsmöglichkeiten, wären Randgruppen leicht zum „Sündenbock“ stilisiert.
Der Anstieg an wahrgenommener Spaltung in der Gesellschaft lässt sich durch folgender Aussage kennzeichnen: „Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer“, stimmten laut dem GMF-Surfey im Jahr 2002 noch 53,0% voll und ganz zu, im Jahr 2004 waren es schon 61,4% (Abb. 2). Generell zeigt die Studie, dass zwischen 85% und 90% der Bevölkerung soziale Spaltungstendenzen erkennen und damit ein hohes Konfliktpotential innerhalb der Gesellschaftsschichten geschaffen ist und sich in den Polen „Arm“ und „Reich“ manifestiert. Entscheidend bei der Bedeutung die diesem zugeschrieben wird, ist vor allem die subjektiv wahrgenommene eigene Position in der Gesellschaft. Je schlechter die eigenen Entwicklungschancen beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt oder im Bildungssektor beurteilt werden, desto eher führt dies zu einer Übergewichtung der Spaltung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Soziale Spaltung im Bewusstsein der Bundesbürger. Angaben in Prozent
4.1 Tendenzen von Desintegration in der Wahrnehmung der Bürger
Die GMF-Studie legt für die subjektive Bewertung von Integration drei bedeutsame Aspekte zugrunde:
1. Individuell-funktionale Systemintegration
2. Kommunikativ-interaktive Sozialintegration
3. Kulturell-expressive Sozialintegration
Die individuell-funktionale Systemintegration bezieht sich auf gesellschaftlich wichtige Teilsysteme, wie unter anderem dem Zugang zum Bildungssystem, die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, gleichverteilte Chancen am Konsumwaren- oder Kulturangebot und ähnliches.
Die kommunikativ-interaktive Sozialintegration zielt auf die subjektive Einschätzung der Partizipationschancen ab, das heißt, wie empfindet der Bürger seine Möglichkeiten an politischen und öffentlichen Entscheidungen teilzunehmen oder diese beeinflussen zu können.
Die kulturell-expressive Sozialintegration betrifft das unmittelbare soziale Umfeld. Wie nimmt sich der Bürger innerhalb seiner Bezugsgruppe wahr, fühlt er sich integriert, unterstützt, eingebunden.
Von zentraler Bedeutung für eine subjektiv wahrgenommene Integration beziehungsweise Desintegration ist die eigene Erwerbstätigkeit. Arbeitslosigkeit stellt noch immer einen der größten Einschnitte im Leben dar, daher werden Entwicklungen am Arbeitsmarkt besondere Gewichtung zuteil und können schnell zu starker Verunsicherung bei den Bürgern führen. Bei einem zunehmend größer werdenden Anteil der Bevölkerung lösen die Geschehnisse am Arbeitsmarkt Sorgen und Ängste aus. Lag der Anteil der befragten Erwerbstätigen im Jahr 2002 bei 10,3%, so waren es 2004 15,5%, die einer großen Angst vor Arbeitslosigkeit zustimmten (Abb. 3). Damit wächst also der Anteil derer, die die eigene Situation als nicht gefestigt und unsicher ansehen. Arbeitslosigkeit und häusliche Arbeiten werden als sinnlos und überflüssig in der Gesellschaft empfunden, die eigene Rolle wird nach wie vor über das Erzielen von Einkommen definiert. Die durch solche Verunsicherung ausgelösten Ängste übertragen sich auf die allgemeine Sicht der Lage. So ist auch bei der Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen und finanziellen Situation ein anhaltender Negativtrend zu beobachten, ebenso wird unzureichende Absicherung im Alter oder bei eintretender Krankheit befürchtet. Ein größer werdender Personenkreis ist unzufrieden und glaubt einen Mangel an Erwünschtem zu erleiden, sieht sich persönlich benachteiligt, sozial isoliert. 2002 glaubten 29,9% „weniger als ihren gerechten Anteil zu erhalten“, 2004 bereits 35,4%.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung. 3: Entwicklung der Angst vor Arbeitslosigkeit bei Erwerbstätigen und bei auf das Erwerbseinkommen des Haushaltsvorstandes angewiesenen Familien-angehörigen. Angaben in Prozent
4.2 Zusammenhänge von sozialer Lage, antizipierten Desintegrationspotentialen und wahrgenommener sozialer Spaltung
Zusammenfassend lässt sich laut GMF-Studie sagen, dass mit sinkender sozialer Stellung, die Desintegrationsgefahren stärker wahrgenommen werden. Je prekärer die eigene Situation eingeschätzt wird, desto stärker ist das Bedrohungsempfinden, die gesellschaftliche Position nicht verbessern beziehungsweise nicht halten zu können und desto eher werden Spaltungstendenzen in der Gesellschaft gesehen.
Tendenziell beeinflusst der berufliche Status, wie Situationen am Arbeitsmarkt wahrgenommen werden, das Haushaltseinkommen die empfundene soziale Isolation und Benachteiligung, die soziale Randständigkeit das Bedrohungsempfinden.
5. Zusammenhänge mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
Im letzten Teil soll es darum gehen, die bisher aufgeführten Fakten, Zahlen und Tendenzen in einen Zusammenhang zu bringen. Dabei sollen vordergründig die Ursachen der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit beleuchtet werden. Drei übergeordnete Hypothesen werden von Wilhelm Heitmeyer diesbezüglich vorgestellt und im Folgenden genauer erläutert.
5.1 Soziale Lage, Desintegrationserfahrungen und wahrgenommene soziale Spaltung als Ursachen
Die zentrale Annahme der Studie ist, dass Personen, die von Desintegrationsprozessen bedroht sind, mit der Abwertung schwacher beziehungsweise konkurrierender Gruppen reagieren. Mit diesem Verhalten geht eine Aufwertung der eigenen Position oder der eigenen Person einher. In Bezug auf Arbeitsplätze und soziale Anerkennung kommt es entsprechend zu einer Konkurrenz zwischen Personen in den unteren Positionen des sozialen Statusgefüges und Zugewanderten. Damit geht einher, dass insbesondere Personen mit Desintegrationserfahrungen ein starkes Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit aufweisen. (Abb. 4) Es wird deutlich, dass die Soziallage wie ein niedriger Schulabschluss oder ein niedriges Haushaltseinkommen und Desintegration wie beispielsweise eine schlechte soziale Absicherung oder Prekarität am Arbeitsplatz, stark mit Fremdenfeindlichkeit korrelieren. Ähnliche, wenn auch weniger deutliche Korrelations-Ergebnisse sind bei Islamophobie ersichtlich. Außerdem erweisen sich besonders verpasste Bildungschancen und erfahrene Machtlosigkeit bei politischen und öffentlichen Entscheidungen als bedeutsam für das Ausmaß von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Weniger wichtig für den Zusammenhang zwischen Soziallage, wahrgenommenen Desintegrationserfahrungen und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit scheint Heterophobie oder Antisemitismus zu sein. Die Korrelationswerte sind vergleichsweise niedrig. (Heitmeyer, 2005)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Zusammenhänge zwischen Soziallage, wahrgenommenen Desintegrations-potentialen (einschließlich sozialer Spaltung) und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Bivariate Korrelationskoeffizienten und erklärte Varianz.
5.2 Desintegrationserfahrung und wahrgenommene Spaltung als Moderatoren
Ein weiterer Schwerpunkt der Studie ist die Frage danach, ob und wie Desintegrationserfahrungen und wahrgenommene soziale Spaltung den individuellen Menschen in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit beeinflussen. Es liegt dabei die Frage zu Grunde, ob unabhängig von der Soziallage, die Personen mit Abwertungen gegenüber Minderheiten reagieren, die aus einer sozial gefestigten Situation heraus den Zustand der Gesellschaft bemängeln oder ob es Personen sind, die desintegrationsgefährdet sind und aus dieser Situation entsprechend soziale Spaltungsprozesse beklagen. Dazu wurden die Befragten in vier Gruppen aufgeteilt, dessen Desintegrationstendenzen und wahrgenommene Spaltung jeweils hoch oder niedrig eingestuft wurden (Abb. 5). Der Vergleich lieferte einige Ergebnisse, die einem durchgängigen Muster entsprechen. Generell zeigt sich, dass die Effekte von Desintegrationserfahrungen im Vergleich zur wahrgenommen Spaltung deutlich bedeutsamer für menschenfeindliche Einstellungen sind. Das geringste Ausmaß an Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zeigte sich demnach erwartungsgemäß bei den Personen, die von Desintegrationserfahrungen unterdurchschnittlich betroffen sind und auch die soziale Spaltung als eher gering einschätzen. Werden allerdings beide Faktoren als überdurchschnittlich hoch eingestuft, wird von einem problematischen Ausmaß Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gesprochen. In der Gruppe, in der die Desintegrationstendenzen als hoch eingeschätzt, die wahrgenommene soziale Spaltung hingegen tendenziell als eher gering betrachtet wurde, kam es zu den zweithöchsten Werten.
Alle Ergebnisse entsprechen der These, dass Tendenzen der Desintegration allgemein problematischer zu betrachten sind. Sind Personen also sozial gut integriert führt eine kritische Haltung gegenüber der Gesellschaft infolge der bestehenden Ungleichheitsstrukturen kaum zu einer Erhöhung menschenfeindlicher Auffassungen. Ist die soziale Lage allerdings gefährdet, ohne dass Kritik auf den sozialen Zustand der Gesellschaft geäußert wird, bewahrt das nicht vor der Abwertung von bestimmten Menschengruppen. Die Ergebnisse des eben beschriebenen Vergleichs veranlasste Heitmeyer sich stärker mit Personen zu befassen, die am Rande der Gesellschaft stehen und desintegrationsgefährdet sind (Heitmeyer, 2005).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung. 5: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Abhängigkeit von individuell-funktionaler-Systemintegration und dem Ausmaß der antizipierten sozialen Spaltung. (Mittelwerte).
5.3 Wahrgenommene soziale Spaltung als Verstärkerfunktion von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in desintegrations-gefährdeten Gruppen
Anlehnend an die vorigen Ergebnisse wurde festgestellt, dass der Zusammenhang von wahrgenommener Spaltung und menschenverachtenden Einstellungen verschärft wird wenn die Personen sozial am Rande stehen. In Abbildung 6 wird der Zusammenhang zwischen wahrgenommener sozialer Spaltung und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in ausgewählten sozialen und desintegrationsgefährdeten Gruppen dargestellt. Es ist ersichtlich, dass wenn Personen Bildungschancen verwehrt wurden oder sie keine hinreichende Anerkennung infolge der alltäglich ausgeübten Tätigkeiten beklagten, eine vergleichsweise geringe Verstärkung des Zusammenhangs von wahrgenommener sozialer Spaltung und dem Ausmaß menschenfeindlicher Einstellungen festgestellt werden kann.
Besonders deutlich wurde Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wenn Personen bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter nur schlecht abgesichert sind. Hervorstechend sind hier vor allem Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie. Die Korrelation liegt hier bei 0.30 bzw. 0.24. Wichtig zu erwähnen ist allerdings, dass die Korrelation in der Gesamtbevölkerung ebenfalls am größten ist und die Werte somit im Ganzen betrachtet werden müssen (Abb. 6). Auch bei den Personen, die sich infolge ihrer beruflichen, sozialen und finanziellen Situation selbst am unteren Rand der Gesellschaft einschätzen sind klare Menschenfeindlichkeitstendenzen bemerkbar. Ebenfalls sind die Korrelationen bei Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie am deutlichsten, wobei wieder der Gesamtbevölkerungswert berücksichtigt werden muss. Trotzdem ist in dieser desintegrationsgefährdeten Gruppe der Zusammenhang zwischen wahrgenommener sozialer Spaltung und Fremdenfeindlichkeit um fast das Doppelte gegenüber der Grundbevölkerung erhöht. Auch Rassismus ist geht mit den Personen einher, die sich selbst am unteren Ende der gesellschaftlichen Hierarchie einstufen. Zwar ist in diesem Fall die Korrelation zur Gesamtbevölkerung eher klein (0.04), doch in der benannten Gruppe ist sie fast um das Vierfache erhöht. Des Weiteren lassen sich Korrelationen mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bei Personen finden, die über ein geringes Haushaltseinkommen verfügen.
All diese Ergebnisse bestärken die folgenden Zahlen: In der Gesamtbevölkerung stimmen 29,4% dem Statement „Es leben zu viele Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland“ zu. Von denjenigen, die eine soziale Spaltung wahrnehmen und beklagen sind es 44,7%. Die Personengruppe, die gleichzeitig eine soziale Spaltung beklagen und sich selbst am unteren Rand der Gesellschaft einordnen stimmen diesem Statement sogar 57,6% zu (Heitmeyer, 2005).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Zusammenhänge zwischen wahrgenommener sozialer Spaltung und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in ausgewählten sozialen und desintegrationsgefährdeten Gruppen. (Bivariate Korrelationskoeffizienten).
6. Diskussion
Die erläuterten Zusammenhänge lassen darauf schließen, dass die wachsenden Unterschiede zwischen Armen und Reichen zu einem Bestandteil im Bewusstsein einer breiten Bevölkerungsmehrheit geworden ist. Im Gegensatz zu Personen mit sozial gefestigten Positionen, sind bei Personen aus desintegrationsgefährdeten Gruppen Abwertungen gegenüber Minderheits-gruppen bemerkbar. Gestützt auf die Ergebnisse der Studie lässt sich eine voranschreitende soziale Spaltung, zumindest an den Polen der Gesellschaft kaum noch zurückweisen. Die durch Desintegrationsprozesse entstehenden Bedrohungsgefühle können sich im Zusammenhang mit wahrgenommener sozialer Spaltung auf das Zusammenleben von Menschen auswirken und negativ beeinflussen. Die Zahl derjenigen, die sich orientierungslos fühlen steigt stetig, was mit einem Anstieg des rechtspopulistischen Potentials einhergeht. Auch die Tatsache, dass sich immer mehr Menschen vor der Politik zurückziehen und Engagement diesbezüglich als sinnlos betrachten, verstärkt den beschriebenen Trend.
Für uns stellt sich die Frage, in wie weit die Mittel zur Datenanalyse in Heitmeyers Studie aussagekräftig sind. Besonders auffällig zeigt sich diese Problematik in den Tabellen, die die Zusammenhänge zwischen Soziallage, wahrgenommenen Desintegrationspotentialen und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit darstellen, sowie in jener, die die Zusammenhänge zwischen wahrgenommener sozialer Spaltung und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in desintegrationsgefährdeten Gruppen. Es ist fraglich, in wie fern die ermittelten Werte den tatsächlichen Zusammenhang widerspiegeln.
Literaturverzeichnis:
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument befasst sich mit der Wahrnehmung sozialer Spaltung in der deutschen Bevölkerung, den Ursachen und Folgen von Desintegration und der Rolle von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Es analysiert die Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit, Reichtums- und Armutsentwicklung, Desintegrationserfahrungen und der Wahrnehmung von sozialer Spaltung.
Was sind die wichtigsten Schlagwörter im Zusammenhang mit diesem Dokument?
Die wichtigsten Schlagwörter sind: Soziale Ungleichheit, soziale Spaltung, Desintegration und Menschenfeindlichkeit.
Was versteht man unter Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF)?
GMF beschreibt ein Syndrom, das verschiedene Formen der Ablehnung von "Andersartigen" umfasst, darunter Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Sexismus, Etabliertenvorrechte und Heterophobie. Menschen, die in einer dieser Komponenten stark ausgeprägt sind, neigen oft auch zu hohen Werten in den anderen Merkmalen des Syndroms.
Welche Aspekte der Integration werden in der GMF-Studie berücksichtigt?
Die GMF-Studie legt drei bedeutsame Aspekte für die subjektive Bewertung von Integration zugrunde: individuell-funktionale Systemintegration, kommunikativ-interaktive Sozialintegration und kulturell-expressive Sozialintegration.
Wie wirkt sich Arbeitslosigkeit auf die Wahrnehmung von Desintegration aus?
Arbeitslosigkeit stellt einen der größten Einschnitte im Leben dar und führt zu Verunsicherung. Entwicklungen am Arbeitsmarkt werden daher besonders gewichtet und können schnell zu starker Verunsicherung bei den Bürgern führen, was sich wiederum auf die allgemeine Sicht der Lage auswirkt.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen sozialer Lage und der Wahrnehmung von Desintegrationsgefahren?
Laut der GMF-Studie werden Desintegrationsgefahren mit sinkender sozialer Stellung stärker wahrgenommen. Je prekärer die eigene Situation eingeschätzt wird, desto stärker ist das Bedrohungsempfinden und desto eher werden Spaltungstendenzen in der Gesellschaft gesehen.
Welche Rolle spielt die wahrgenommene soziale Spaltung in Bezug auf Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit?
Die Studie zeigt, dass Personen, die von Desintegrationsprozessen bedroht sind, mit der Abwertung schwacher oder konkurrierender Gruppen reagieren. Die wahrgenommene soziale Spaltung verstärkt diese Tendenzen insbesondere bei Personen, die sich am Rande der Gesellschaft befinden.
Wie beeinflusst die eigene wirtschaftliche Situation die Wahrnehmung sozialer Spaltung?
Je schlechter die eigenen Entwicklungschancen, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt oder im Bildungssektor, beurteilt werden, desto eher führt dies zu einer Übergewichtung der Spaltung. Die subjektiv wahrgenommene eigene Position in der Gesellschaft ist also entscheidend.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit?
Ja, verpasste Bildungschancen und erfahrene Machtlosigkeit bei politischen und öffentlichen Entscheidungen erweisen sich als bedeutsam für das Ausmaß von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Was ist die zentrale Annahme bezüglich der Ursachen von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit?
Die zentrale Annahme ist, dass Personen, die von Desintegrationsprozessen bedroht sind, mit der Abwertung schwacher beziehungsweise konkurrierender Gruppen reagieren, um die eigene Position oder Person aufzuwerten.
- Quote paper
- Andreas Schachermeier (Author), 2005, Spaltung der Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110308