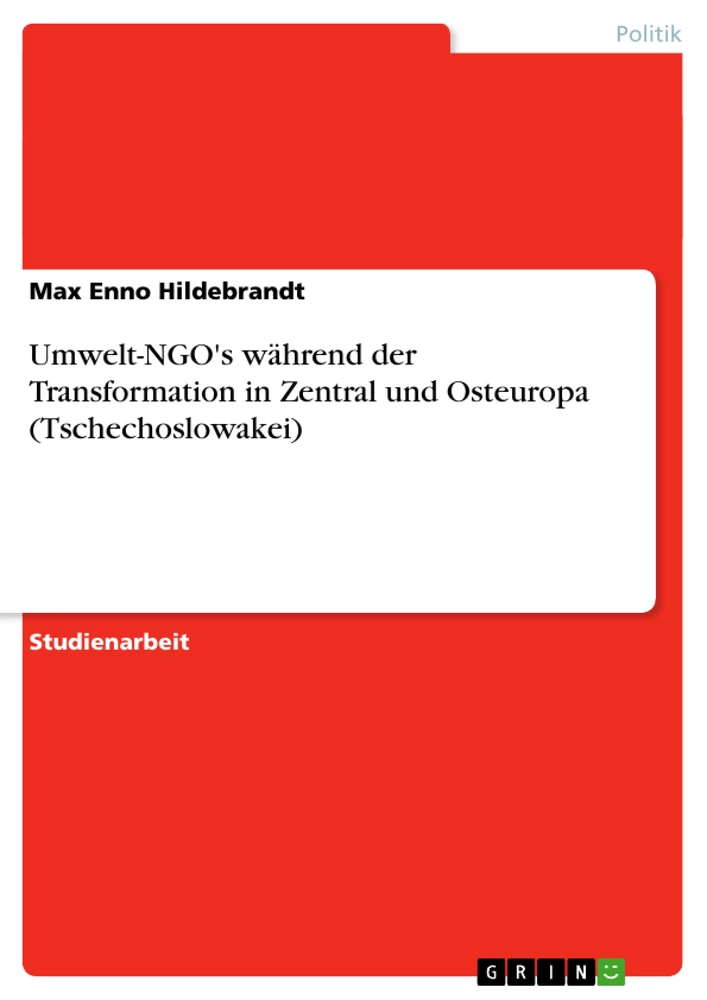Inhalt
1. Einleitung
1.1 Einführung in das Thema und die Fragestellung
1.2 Politische Relevanz des Themas
2. Exkurs: Umweltprobleme in den sozialistischen Staaten Zentral- und Osteuropas
3. Bestimmung der Variablen: Umweltbewegungen und Umweltgesetzgebung
3.1 Umweltbewegungen und -NGO’s – Definition und Operationalisierung der unabhängigen Variablen
3.2 Umweltgesetzgebung – Definition und Operationalisierung der abhängigen Variablen
4. Theoretischer Hintergrund und Hypothesenbildung
4.1 Theoretischer Hintergrund zivilgesellschaftlicher Aktivitäten im Transformationsprozess
4.2 Hypothesenbildung
5. Fallbeispiel Tschechoslowakei
5.1 Einfluss von Umwelt-NGO’s in den ersten Jahren der Transformation (unabhängige Variable)
5.1.1 Rückblick: Die Umweltbewegung bis zum Umbruch von
5.1.2 Die Umweltbewegung 1989-1993 – Ressourcen, Probleme und Partizipationsmöglichkeiten
5.2 Die Umweltgesetzgebung in den ersten Jahren der Transformation (abhängige Variable)
5.2.1 Rückblick: Die Umweltgesetzgebung vor dem Umbruch von
5.2.2 Die Umweltgesetzgebung 1989-1993 – Gesetze und Verordnungen
5.3 Einfluss der Umweltbewegung auf die Gesetzgebung – Ergebnis der Hypothesenprüfung
5.4 Der indirekte Einfluss der EU als intervenierende Variable
6. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Einführung in das Thema und die Fragestellung
„Die natürliche Umwelt in den ost- und mitteleuropäischen Ländern (…) ist unter dem Druck von extensiver Wachstumsstrategie und der Ineffizienz des zentralistischen Planungssystems sehr stark geschädigt worden.“ (Welfens 1993: 13). Diese Aussage aus dem Jahre 1993 weist auf eines der schwerwiegendsten Probleme ehemals sozialistischer Staaten hin: Umweltschäden in beträchtlichem Ausmaß. Im Rahmen von wirtschaftlicher und politischer Systemtransformation Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts traten die Umweltprobleme deutlich zu Tage und sorgten in den betroffenen Gesellschaften für großes Aufsehen. Die Folge war die Gründung umweltpolitisch motivierter Organisationen, welche oft eine entscheidende Rolle beim Sturz des jeweiligen kommunistischen Regimes spielten und gleichzeitig erste Elemente einer neu entstehenden Zivilgesellschaft[1] darstellten.
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle der genannten Umweltbewegungen in den ersten Jahren der Transformation bis 1993 und soll zuerst Stärke und Bedeutung der Bewegungen ermitteln, daran anschließend soll ein möglicher Einfluss auf die Umweltgesetzgebung in der Übergangsphase geprüft werden. Der Einfluss auf die Gesetzgebung ist insofern von Interesse, als untersucht werden kann, welche Rolle zivilgesellschaftliche Gruppierungen bei der Institutionalisierung der Demokratie gespielt haben. Die Fragestellung lautet also: Wie stark und in welcher Form konnten Umweltbewegungen und unabhängige Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) ihre Interessen in die (umwelt-)politischen Ordnungen der sich in der Transition befindlichen Staaten Zentral- und Osteuropas einbringen? Die unabhängige Variable des vermuteten Zusammenhangs ist die Stärke der zivilgesellschaftlichen Umweltbewegungen, welche sich unter anderem an der Anzahl der bestehenden Organisationen und deren Beteiligungsmöglichkeiten messen lässt. Die zu erklärende, abhängige Variable ist der Prozess der Umweltgesetzgebung durch die zuständigen Akteure in der Administration, welche sich an Gesetzen, Verordnungen und der Festlegung von Grenzwerten sowie deren Implementierung messen lässt. Neben der bereits dargestellten erklärenden Variablen wird im entsprechenden Abschnitt auf weitere mögliche Einflussfaktoren wie zum Beispiel die Politik der Europäischen Union (EU) und anderer internationaler Akteure eingegangen, um den Einfluss intervenierender Variablen nicht außer acht zu lassen.
Die Untersuchung ist als Einzelfallstudie angelegt, welche die Fragestellung anhand des Beispiels der Tschechoslowakei[2] bearbeitet. Die Durchführung als Einzelfallstudie hat den Vorteil, dass das ausgewählte Land sehr ausgiebig betrachtet werden kann, dies geschieht allerdings teilweise auf Kosten der Universalisierbarkeit der Ergebnisse. Nichtsdestotrotz werden diese sich durchaus auf von der Entwicklung her ähnliche Länder wie Polen, Ungarn oder Slowenien übertragen lassen.
Um einen angemessenen Überblick über die Ausgangsbedingungen im Bereich Umweltpolitik zu gewährleisten, werden im zweiten Abschnitt der Einleitung die bereits erwähnten Umweltschäden und ihre Folgen in den ehemals kommunistischen Staaten skizziert. Im folgenden Kapitel werden die abhängige und die unabhängige Variable definiert und operationalisiert, darauf folgend werden Überlegungen zum theoretischen Hintergrund der Untersuchungen vorgenommen und die Hypothese der Arbeit erläutert. Im vorletzten Kapitel der Arbeit wird diese Hypothese anhand des Fallbeispiels überprüft. Das Fazit am Ende dieser Hausarbeit beinhaltet neben einer kurzen Zusammenfassung der vorausgegangenen Untersuchungen eine Erläuterung möglicher Gründe für das Ergebnis der Arbeit.
Die verwendete Literatur besteht größtenteils aus Sekundärtexten, wobei ein Großteil der Zeitschriftenartikel und Monografien schon in den 1990er Jahren entstanden ist. Auf Entwicklungen, welche den EU-Beitritt und andere aktuelle Entwicklungen in den besprochenen Ländern betreffen, wird also nicht eingegangen, dies würde den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen.
1.2 Politische Relevanz des Themas
Die politische Relevanz des Themas ergibt sich aus der anhaltenden Diskussion[3] um die Rolle zivilgesellschaftlicher Elemente in ehemals sozialistischen Staaten. Dabei steht die in dieser Arbeit untersuchte Thematik der Umweltbewegungen im Transformationsprozess vormals autoritärer Staaten beispielhaft für die gesamte Entwicklung zivilgesellschaftlicher Organe. In vielen Demokratisierungsprozessen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war zivilgesellschaftliches Engagement der Bürger ein wichtiger Faktor, man kann eine „besondere (…) Demokratiefunktion der Zivilgesellschaft für die Transformation politischer Systeme“ (Croissant/Lauth/Merkel 2000: 11) konstatieren. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Bedeutung dieser Form des Bürgerengagements in künftigen Transformationsprozessen weiterhin bestehen bleibt.
Auch mit Hilfe des für diese Arbeit gewählten theoretischen Hintergrunds – der Transformationstheorien – lassen sich Aspekte der politischen Relevanz herleiten. Bezogen auf den Einfluss zivilgesellschaftlicher Elemente in Transformationsprozessen werden von den Transformationstheoretikern drei Phasen unterschieden, welche die zivilgesellschaftlichen Entwicklungs- und Einflussprozesse charakterisieren (vgl. Croissant/Lauth/Merkel 2000: 33). Am Anfang steht die Aufschwungphase, welche eine Situation des „Wiederauflebens von Zivilgesellschaft“ (Croissant/Lauth/Merkel 2000: 33, nach O’Donnell/Schmitter 1986) darstellt, es folgen die Boomphase und später die Abschwungphase [4]. Ist diese Darstellung auch stark vereinfacht, beschreibt sie doch die wesentlichen Charakteristika zivilgesellschaftlicher Entwicklungsprozesse in den in dieser Arbeit behandelten Zeiträumen. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird deutlich, dass sich auch die Entwicklung von Umweltbewegungen ungefähr in dem eben vorgestellten theoretischen Schema bewegt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Erkenntnisse der nachfolgenden Untersuchungen auch in anderen Transformationsprozessen relevant sind und sich die Entwicklung des Einflusses von zivilgesellschaftlichen Akteuren im Allgemeinen und Umweltbewegungen im Besonderen bis zu einem gewissen Punkt voraussagen lässt. Des Weiteren ist die Thematik der Umweltbewegungen in Zentral- und Osteuropa als Beispiel für eine aktive zivilgesellschaftliche Entwicklung zu betrachten, welche oft schon vor dem Sturz des alten Regimes begann. Denn, „the environment had never been but on the black list as a subject for public discussion“ (Jancar-Webster 1998: 70).
Ein weiterer Beleg für die politische Relevanz des bearbeiteten Themas über das Fallbeispiel Tschechoslowakei hinaus ist die Erkenntnis über ein besonderes Dilemma umweltpolitischer Themen in Krisensituationen. Dieses Dilemma besteht in dem oft schlagartig nachlassenden Interesse an Angelegenheiten von Umwelt und nachhaltiger Entwicklung im Falle von ökonomischen Notsituationen, beispielsweise dem drohenden Verlust des Arbeitsplatzes (vgl. hierzu u.a. Nissen 1994: 49, ECE 1993: 36f. Kundrata 1992: 32).
2. Exkurs: Umweltprobleme in den sozialistischen Staaten Zentral- und Osteuropas
Im folgenden Abschnitt soll in die Problematik von Umweltschäden in sozialistischen Planwirtschaften eingeführt werden. Auf diese Weise können einerseits die Gründe und Auslöser für Protestbewegungen besser nachvollzogen werden, andererseits wird die Bedeutung von ökologischen Reformen und Umweltgesetzen – der abhängigen Variablen dieser Arbeit – deutlich.
Die Umweltbelastung in den planwirtschaftlich geführten Staaten Zentral- und Osteuropas war in fast allen Bereichen größer als in Westeuropa, vor allem seit Beginn der achtziger Jahre spitzte sich die Situation mehr und mehr zu (vgl. Welfens 1993: 14). In der Tschechoslowakei, die das Fallbeispiel dieser Arbeit darstellt, war die in manchen Gebieten extrem hohe Luftbelastung eines der größten Probleme. Durch die ineffiziente und technisch rückständige Verfeuerung von Braunkohle in Kraft- und Heizwerken war die Schwefeldioxid(SO2)-Belastung sehr hoch. Die Luftbelastung im „ökologischen Notstandsgebiet“ (Welfens 1993: 57) Nordböhmen wirkte sich in erheblicher Weise negativ auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung aus. Ein weiteres Problem war die in fast ganz Zentral- und Osteuropa großflächige Verschmutzung von Wasserressourcen wie Flüssen und Seen (vgl. Welfens 1993: 59, 72ff.), welche kombiniert mit einer relativen Wasserarmut eine Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung darstellte.
Seit den siebziger Jahren gab es Initiativen zur Verbesserung des Umweltzustandes, die Implementierung neuer Verordnungen war jedoch denkbar schwierig und der Erfolg folglich begrenzt. Dies ist wiederum durch ein Beispiel aus der Tschechoslowakei zu belegen, dort wurde ein Mitte der achtziger Jahre verabschiedetes Programm zur Bekämpfung von Luft-, Wasser- und Bodenverunreinigungen nie implementiert (vgl. ECE 1993: 27f.). Die Hauptgründe für die untergeordnete Rolle von Umweltthemen waren unter anderem das vollständige Fehlen von Anreizen für qualitatives Wachstum und qualitative Verbesserungen der Produktion und der damit einhergehende Mangel an Innovationspotential. Ein weiteres Problem war die hohe Energieintensität bei der (industriellen) Produktion und eine geringe Effizienz im Bereich der Energiewirtschaft, welche ein hohes Emissionsniveau an Schadstoffen verursachten (vgl. Welfens 1993: 14).
Eine andere Ursache für die Rückständigkeit im Bereich der Umweltpolitik war ein allgemeines Defizit an Umweltbewusstsein in der Bevölkerung. Kundrata führt dieses Defizit unter anderem auf die „totally materialistic and anthroprocentric ideology of the (...) regime“ (Kundrata 1992: 31), den Mangel an Umweltbildung und das permanente Herunterspielen oder geheim halten von Daten zu Umweltproblemen durch die Staatsführung zurück.
Im Rahmen der Bearbeitung des Fallbeispiels wird zu klären sein, wie sich die Umweltschäden auf der einen Seite und das geringe Interesse an Umweltfragen in der Bevölkerung auf der anderen Seite auf die Entwicklung zivilgesellschaftlicher umweltpolitischer Akteure auswirkte.
3. Bestimmung der Variablen: Umweltbewegungen und Umweltgesetzgebung
Die in der Einleitung skizzierte Fragestellung dieser Arbeit soll am Ende der Untersuchung des Fallbeispiels in zwei Schritten beantwortet werden: Erstens werden die Stärken und Schwächen der zivilgesellschaftlichen Umweltbewegung zusammengefasst, zweitens soll der Einfluss der Umweltbewegung auf die Umweltgesetzgebung beurteilt werden. Dieses Vorgehen verlangt eine genaue Definition einer unabhängigen (erklärenden) und einer abhängigen (zu erklärenden) Variablen, diese wird in den folgenden Punkten 3.1 und 3.2 vorgenommen.
3.1 Umweltbewegungen und -NGO’s – Definition und Operationalisierung der unabhängigen Variablen
Das erklärende Element dieser Arbeit ist die Bedeutung der Umweltbewegungen und ihr Einfluss während der Transformationsphase. Ein Teil der Umwelt-NGO’s in der Tschechoslowakei entstand schon in der Periode der kommunistischen Herrschaft und spielte eine wichtige Rolle beim Sturz des Regimes im Jahre 1989 (vgl. Kundrata 1992: 38ff.). Es soll allerdings auch angemerkt werden, dass nicht alle mit umweltbezogenen Themen befassten Bewegungen politisch motiviert waren, diese Organisationen werden in den folgenden Untersuchungen nicht mit einbezogen.
Zur Definition der unabhängigen Variablen soll mit Hilfe unterschiedlicher Daten ein möglichst umfassendes Bild der Umwelt-NGO’s gezeichnet werden. Einerseits werden geschichtliche Fakten zu Rate gezogen, auf der anderen Seite sollen die Organisationen als Akteure im politischen System der transformierenden Tschechoslowakei betrachtet werden[5]. Die konkrete Operationalisierung wird weiterhin einen Überblick über die Anzahl der aktiven NGO’s beinhalten.
Mit Hilfe des beschriebenen Vorgehens wird zum einen ein umfassendes Verständnis für die Situation der Umwelt-NGO’s hergestellt, zum anderen wird die Beurteilung des möglichen Zusammenhangs zwischen abhängiger und unabhängiger Variable ermöglicht.
3.2 Umweltgesetzgebung – Definition und Operationalisierung der abhängigen Variablen
Das zu erklärende Element dieser Untersuchungen ist die Beschaffenheit der Umweltgesetzgebung von Ende 1989 bis Anfang 1993 in der Tschechoslowakei. Um die Umweltgesetzgebung erfassen und beurteilen zu können, werden zuerst Aspekte der geschichtlichen Entwicklung umweltpolitischer Gesetzgebung in der sozialistisch beherrschten Tschechoslowakei erläutert. Des Weiteren werden im entsprechenden Abschnitt des Fallbeispiels die für die Umweltgesetzgebung während der Transformationsphase relevanten Akteure und Institutionen vorgestellt, darauf folgend werden einzelne Gesetze und Verordnungen sowie Aspekte ihrer Implementierung untersucht. Dieses Vorgehen gewährleistet eine umfassende Definition der abhängigen Variablen und ermöglicht die Messung und Beurteilung eines möglichen Einflusses der zivilgesellschaftlichen Akteure.
4. Theoretischer Hintergrund und Hypothesenbildung
4.1 Theoretische Hintergründe zivilgesellschaftlicher Aktivitäten im Transformationsprozess
Drei Überlegungen aus dem Bereich der Transformationstheorien sollen als Hintergrund der Untersuchungen dieser Arbeit dienen: Erstens die grobe Einteilung des Transformationsprozesses in aufeinander folgende Phasen, zum Zweiten Annahmen der so genannten Akteurstheorien, außerdem wird eine These zur Bedeutung der zivilgesellschaftlichen Partizipation in transformierenden Staaten vorgestellt.
Merkel teilt den Transformationsprozess von einem autokratischen oder totalitären zu einem demokratischen System in die drei Phasen Ende des autokratischen Regimes, Institutionalisierung der Demokratie und Konsolidierung der Demokratie ein (vgl. Merkel 1999: 120). Ähnlich zu dieser Einteilung kann auch das Agieren zivilgesellschaftlicher Elemente in unterschiedliche Phasen unterteilt werden, Mansfeldová/Szabó tun dies mit explizitem Bezug auf die Entwicklung in Zentral- und Osteuropa. Sie unterscheiden zwischen der Phase der Krise, in welcher soziale Bewegungen die restriktive staatliche Kontrolle durch Proteste aufweichen. Es folgt die Phase des Wandels, in welcher die zivilgesellschaftliche Mobilisierung ihren Höhepunkt erreicht und die Auflösung des alten Regimes ihren Lauf nimmt. Die abschließende Phase der Institutionalisierung und Konsolidierung leitet die Institutionalisierung der vormals spontanen Bewegungen ein und führt zu einer Ausdifferenzierung des Systems zivilgesellschaftlicher Akteure (vgl. Mansfeldová/Szabó 2000: 91ff.). Die letzte Phase ist oft durch eine Schwächung der aus spontanem Protest heraus entstandenen zivilgesellschaftlichen Akteure gekennzeichnet. Auch wenn sich die beschriebenen Phasen in der Realität überschneiden, so bilden sie doch eine grundlegende Struktur, welche sich wohlmöglich auch auf die Entwicklung der Umweltbewegungen und -NGO’s übertragen lässt. Interessant ist in diesem Zusammenhang außerdem, ob sich die oben beschriebenen Phasen auch in dem Einfluss widerspiegeln, welchen Umwelt-NGO’s auf die entstehenden administrativen und legislativen Organe hatten.
Ein weiterer aufschlussreicher Aspekt ist die Betrachtung des Fallbeispiels vor dem Hintergrund akteurstheoretischer Überlegungen. Im Gegensatz zu struktur- und systemtheoretischen Ansätzen „setzen Akteurstheorien auf der Mikroebene der handelnden Akteure an“ (Merkel 1999: 102, ohne die Hervorhebung im Original) und konzentrieren sich deswegen auf das Verhalten der am Transformationsprozess beteiligten Akteure. Vermutungen über die Struktur der Gesellschaft und des Staates, das heißt über die äußeren Bedingungen einer erfolgreichen Transformation, werden dabei nicht außer acht gelassen, stellen jedoch nur den Rahmen für selbstständig handelnde Akteure dar. Merkel fasst die Annahmen über die Bedeutung des Akteursverhaltens folgendermaßen zusammen:
„ Die Entscheidung für oder gegen die Demokratie wird von [den Akteurstheorien] letztlich als das Ergebnis einer situationsgebundenen, kontinuierlichen Neudefinition wahrgenommener Präferenzen, Strategien und Handlungsmöglichkeiten durch die relevanten Akteure angesehen“ (Merkel 1999: 102, nach Przeworski 1986, 1991)[6].
Bezogen auf die Fragestellung dieser Arbeit lassen sich die Annahmen der Akteurstheoretiker auf folgende Weise interpretieren: Die Entscheidung für ein Engagement im Bereich der Umweltpolitik wird immer wieder neu getroffen und verändert sich mit den Präferenzen von Personen und Gruppen sowie den allgemeinen Umständen. So kann zum Beispiel die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage einer Person oder einer NGO zu einem Nachlassen umweltpolitischen Engagements führen, da die Präferenzen neu ausgerichtet werden müssen. Diese Interpretation akteurstheoretischer Überlegungen stellt ein weiteres Erklärungsmodell für den möglicherweise schwankenden oder nachlassenden Einfluss von Akteuren der Umweltbewegung in den ersten Jahren der Transformation dar und soll im Rahmen der Analyse des Fallbeispiels wieder aufgegriffen werden.
Zum Ende dieses Kapitels soll nun – angelehnt an Mansfeldová/Szabó – eine wichtige These zur Arbeitsweise zivilgesellschaftlicher Akteure vorgestellt werden. Es geht dabei um die Beschaffenheit der Bedingungen, welche in neu entstehenden Demokratien für die Partizipation zivilgesellschaftlicher Elemente geschaffen werden. Durch den „legalisierten Freiraum für Widerspruch und Protest“ besteht demnach die Möglichkeit, „Ansprüche an die bestehende politisch-soziale Ordnung in verfassungsmäßig geregelten Prozessen zu artikulieren und für die gesetzten Ziele materielle Ressourcen in der Öffentlichkeit zu mobilisieren“ (Mansfeldová/Szabó 2000: 94). Diese Partizipations- und Mitsprachemöglichkeiten sind ein eminent wichtiger Faktor und somit im Zusammenhang mit der Fragestellung zu beachten. Wenn den Umwelt-NGO’s Partizipationsmöglichkeiten verwehrt werden oder diese unfähig zur Partizipation sind, ist die aufgrund der Fragestellung zu untersuchende Einflussnahme auf Legislative und Administration um einiges schwieriger. Wir haben es hier also mit einem Faktor zu tun, welcher einen möglichen fehlenden Einfluss der unabhängigen auf die abhängige Variable erklären könnte.
4.2 Hypothesenbildung
Fasst man die bisherigen theoretischen Überlegungen zusammen, so lässt sich folgende zweigeteilte Hypothese aufstellen:
1. Die umweltpolitischen Bewegungen in der Tschechoslowakei waren im Zeitraum kurz bevor und kurz nach dem Sturz des Regimes Ende des Jahres 1989 sehr präsent und hatten großen Anteil am Ende der kommunistischen Herrschaft. Es gelang ihnen jedoch nicht, ihren Einfluss auf die Umweltpolitik der neuen Regierung vollständig zu stabilisieren und vor allem zu institutionalisieren.
2. Deshalb kann in den folgenden Jahren, ungefähr ab 1991, kein stetiger Einfluss der Umwelt-NGO’s auf die Gesetze und Verordnungen der Regierung festgestellt werden. Die fehlenden NGO-Aktivitäten beeinträchtigten die Umweltgesetzgebung negativ, weil dem Gesetzgeber eine antreibende und kontrollierende Kraft fehlte.
Die anfängliche Stärke und das darauf folgende Abklingen des Einflusses sind mit den in Kapitel 4.1 erläuterten Phasen des zivilgesellschaftlichen Wandels im Rahmen Transformation zu erklären. Demnach verändern sich vor allem in der Phase der Institutionalisierung und Konsolidierung die Form und das Auftreten der zivilgesellschaftlichen Akteure. Die Hauptgründe für die damit einhergehende Schwächung dürften die abklingende Euphorie und das hierdurch bewirkte Nachlassen der Mobilisierungsfähigkeit sowie die zunehmende Konkurrenz durch etablierte Organe wie Parteien sein (vgl. Mansfeldová/Szabó 2000: 93, Merkel 1999: 115f.). Als Erklärung für den mangelnden Einfluss auf die gesetzgebenden Akteure könnten – den Akteurstheorien folgend – die ständig wechselnden Präferenzen und unterschiedlichen Interessen auf beiden Seiten dienen, welche eine kontinuierliche Zusammenarbeit erschwerten und ein Hemmnis im Hinblick auf die Etablierung dauerhafter Partizipationsstrukturen darstellten.
5. Fallbeispiel Tschechoslowakei
In diesem Kapitel sollen die bisherigen theoretischen Überlegungen anhand des Fallbeispiels Tschechoslowakei[7] geprüft werden. Die Auswahl des Fallbeispiels ist den interessanten Entwicklungen im Rahmen des Niedergangs der kommunistischen Herrschaft geschuldet. Es gab in der Tschechoslowakei einen schnellen, aber praktisch gewaltfreien Übergang zum Reformprozess im November 1989, häufig als „samtene Revolution“ bezeichnet (vgl. Juchler 1994: 322). Recht schnell nach dem Übergang begannen sich Elemente einer bis heute bedeutenden Zivilgesellschaft zu bilden. Die in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehende zivilgesellschaftliche Umweltbewegung kann in diesem Zusammenhang als Beispiel für die allgemeine zivilgesellschaftliche Entwicklung angesehen werden.
5.1 Einfluss von Umwelt-NGO’s in den ersten Jahren der Transformation (unabhängige Variable)
Im folgenden Kapitel werden die in Abschnitt 3.1 dargelegten Kriterien für die unabhängige Variable auf die Situation in der Tschechoslowakei angewendet, Ziel ist eine aussagekräftige Beurteilung der Stärke und Einflussmöglichkeiten der Umwelt-NGO’s zwischen 1989 und 1993. Die Untersuchungen sollen in zwei Abschnitten stattfinden, zuerst soll ein kurzer Rückblick auf die Zeit vor 1989 gegeben werden, da Aktivitäten während der kommunistischen Herrschaft durchaus Einfluss auf die Entwicklungen während der Transformation haben können. Darauf folgend werden die Fortschritte und Probleme der Umweltbewegung nach 1989 dargestellt.
5.1.1 Rückblick: Die Umweltbewegung bis zur Revolution von 1989
Die Umweltbewegung hat in der Tschechoslowakei eine lange Tradition, schon im 19. Jahrhundert und vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts bildeten sich Naturschutzbünde und -klubs. Auch in der Zeit des kommunistischen Regimes gab es Umweltvereinigungen (vgl. Kundrata 1992: 38), diese waren allerdings größtenteils ins System der staatlichen Organisationen eingebunden und entwickelten nur vereinzelt kritisches Potenzial. Ende der 1980er Jahre hatten die vier größten Gruppen ČSOP, SZOPK[8], Brontosaurus und Strom Života ungefähr 50 000 Mitglieder, von denen sich jedoch längst nicht alle an den Aktivitäten ihrer Organisation beteiligten (vgl. Kundrata 1992: 39). Die Bewegungen zeichneten sich durch „altruism and the will to act“ aus und stellten sich gegen die „social apathy and alienation from the environment in the period of stagnation“ (Kundrata 1992: 40). Trotz des durch die Arbeit der Umweltorganisationen steigenden Interesses an Umweltproblemen in der Bevölkerung veränderte sich das Verhalten der meisten Bürger jedoch nicht, es kam stattdessen zu einem Anstieg der „discrepancy between knowledge and behaviour“ (ECE 1993: 36) innerhalb der Gesellschaft.
Die für die Untersuchungen dieser Arbeit bedeutsame Politisierung der Umweltbewegungen entstand oft aus Konfrontationen mit Teilen der lokalen oder nationalen Administrative im Rahmen von umstrittenen Projekten wie zum Beispiel der Abholzung von Auenwäldern an der Donau. Teilweise konnten umweltschädigende Projekte verhindert werden (vgl. Kundrata 19992: 40f.), dies trug zur Stärkung der politischen Strömung innerhalb der Umweltbewegung bei und ebnete den Weg für eine führende Rolle bei der „samtenen Revolution“ 1989.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Voraussetzungen für eine starke zivilgesellschaftliche Umweltbewegung in der Tschechoslowakei und ihren Nachfolgestaaten geschichtlich durchaus angelegt waren, denn gerade im letzten Jahrzehnt der kommunistischen Herrschaft bildete sich eine beachtliche Basis an engagierten Gruppen.
5.1.2 Die Umweltbewegung 1989-1993 – Ressourcen, Probleme und Partizipationsmöglichkeiten
Bei der Betrachtung der Ressourcen und Partizipationsmöglichkeiten der Umweltbewegung ergibt sich ein sehr zwiespältiges Bild, dessen unterschiedliche Seiten im Folgenden dargestellt werden sollen. Einerseits verzeichneten die tschechoslowakischen Umwelt-NGO’s nach der Revolution von 1989 einen sprunghaften Anstieg im Bezug auf Popularität, Ressourcen und Beteiligungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite gab es eine Reihe negativer Entwicklungen, welche im Verlauf der weiteren Transformationsphasen immer deutlicher zu Tage traten.
Der Sturz des kommunistischen Regimes eröffnete den Mitgliedern der Umweltbewegung auf einen Schlag eine erhebliche Anzahl neuer Möglichkeiten und Chancen, was sich nicht zuletzt in einem starken Anstieg der Neugründungen von Umwelt-NGO’s niederschlug. Die Angaben über die Anzahl der NGO’s im Jahre 1989 bewegen sich zwischen ungefähr 800 und 1000 Organisationen (vgl. Fagin 2002: 187, ECE 1993: 36), diese bestanden jedoch zum größten Teil nur aus einer Handvoll Mitglieder. Sowohl die schon während der kommunistischen Herrschaft tätigen als auch die neu gegründeten Umwelt-NGO’s konnten ihre räumliche und technische Situation erheblich verbessern, dies geschah sowohl mit Hilfe einiger der neu entstandenen Ministerien der Tschechoslowakei als auch durch die Unterstützung ausländischer Organisationen. Unterstützung durch Sachspenden und Expertenwissen war allerdings wesentlich einfacher zu bekommen als finanzielle Zuschüsse (vgl. Kundrata 1992: 43f.).
Auch der für die Frage nach der Beteiligung der NGO’s an der Regierungsarbeit wichtige Aspekt der Partizipationsmöglichkeiten entwickelte sich zum Anfang in eine für die Umweltbewegung sehr erfreuliche Richtung. Der erste Umweltminister Bedřich Moldán etablierte das so genannte „Green Parliament“, welches als Austauschplattform zwischen NGO’s und Ministerium diente und den Aufbau informeller Beziehungen zwischen Administrative und Umweltbewegung erleichterte (vgl. Fagin 1994: 490). Ein mindestens ebenso wichtiges Mittel der Kooperation und Einflussnahme waren die zahllosen persönlichen Beziehungen zwischen Akteuren der Administration, Legislative und Umweltbewegung. Direkt nach der „samtenen Revolution“ hatten viele Umweltaktivisten die Seite gewechselt und teilweise einflussreiche Positionen in der neuen Administration erlangt (vgl. Fagin 1994: 490.). Die hierdurch ermöglichten informellen Beziehungen – Fagin bezeichnet sie als „somewhat unusual overlap between activist and policymaker“ Fagin 2002: 187) – waren eines der wichtigsten Mittel zur Einflussnahme von Umwelt-NGO’s auf die Gesetzgebung und sind deswegen für die Bearbeitung der Fragestellung dieser Arbeit von großer Bedeutung.
Auch wenn die informellen Einflussmöglichkeiten im Prinzip als sehr hilfreich für die Umwelt-NGO’s angesehen werden konnten, deutete ihr Vorhandensein doch auf ein Problem der Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Administration hin: Die formellen, offiziellen Wege der Einflussnahme und Beteiligung waren auch nach der Revolution eher begrenzt, das oben bereits erwähnte „Green Parliament“ löste sich schon im Laufe des Jahres 1991 wieder auf und war spätestens nach dem Wahlerfolg der Konservativen unter Führung von Václav Klaus obsolet geworden (vgl. Fagin/Jehlička 1998: 121). Damit wurden die für die Umweltbewegung so wichtigen Möglichkeiten zur Partizipation wieder eingeschränkt und es kam zu einer Schwächung der NGO’s. Dies führt zu den weiteren Problemen der umweltpolitischen Akteure der Zivilgesellschaft, welche im Fortgang der Transformation aufkamen. Neben der Verschlechterung der Beteiligungsmöglichkeiten kam es zu Konflikten innerhalb der Umweltbewegung, da durch die neu gewonnene Freiheit eine erhebliche Differenzierung der Ansichten und Ziele möglich wurde (vgl. Fagin 2002: 188). Außerdem schwand das Interesse an umweltpolitischen Themen und damit die Bereitschaft zu umweltpolitischem Engagement in der Bevölkerung nach der großen Euphorie des ersten Jahres rapide. Für diesen regelrechten Einbruch der öffentlichen Unterstützung lassen sich mehrere Gründe anführen, an erster Stelle steht sicherlich die in den meisten Fällen sehr unsichere wirtschaftliche Situation, welche die Sorgen um andere Themen verdrängte. An dieser Stelle sei an das in Kapitel 2. erwähnte Paradox erinnert, wonach gesellschaftliche Aufmerksamkeit für umweltpolitische Themen oft nur für kurze Zeit bestehen bleibt, die ECE drückt es in Bezug auf die Tschechoslowakei so aus: „The shock caused among the public after 1989 by the publication of data on the critical state of environment has passed and ‚ecological apathy’ has prevailed“ (ECE 1993: 37).
Bei eingehender Betrachtung der aufgezählten Fortschritte und Probleme lässt sich auch in der Entwicklung der tschechoslowakischen Umweltbewegung das in Abschnitt 4.1 vorgestellte Theorem der unterschiedlichen Phasen des Transformationsprozesses erkennen. Nach einer anfänglichen Dynamisierung der Entwicklung kommt es zu aufgrund unterschiedlicher interner und externer Faktoren einer Rezession der zivilgesellschaftlichen Aktivitäten. Auch akteurstheoretischen Annahmen zu wechselnden Präferenzen der Akteure lassen sich erkennen, unter anderem in der erwähnten Differenzierung innerhalb der Umweltbewegung und der Marginalisierung der Umweltpolitik nach dem Regierungswechsel 1992.
Somit kann der erste Teil der Hypothese, welcher ein Abnehmen des Einflusses der Umwelt-NGO’s analog zu den Phasen der Transformation voraussagt, als bestätigt angesehen werden. Nach der nun folgenden Untersuchung der Umweltgesetzgebung wird in Abschnitt 5.3 zu klären sein, ob sich auch die zweite Annahme der Hypothese bestätigt und sich die Umweltgesetzgebung mit dem schwindenden Einfluss der Umweltbewegung verändert hat.
5.2 Die Umweltgesetzgebung in den ersten Jahren der Transformation (abhängige Variable)
Im folgenden Kapitel werden die in Abschnitt 3.2 dargelegten Kriterien für die abhängige Variable auf die Situation in der Tschechoslowakei angewendet. Ziel ist eine Beurteilung der Umweltgesetzgebung im Zusammenhang mit den Einflussmöglichkeiten von Umwelt-NGO’s zwischen 1989 und 1993.
5.2.1 Rückblick: Die Umweltgesetzgebung vor der Revolution von 1989
Obwohl der negative Einfluss des Menschen auf den Zustand der Umwelt auch in kommunistischen Staaten schon in den 1960er Jahren erkannt wurde, kann im Fall der Tschechoslowakei vor 1989 nicht von einer erfolgreichen Umweltgesetzgebung gesprochen werden. Zwar wurde 1967 ein Gesetz zur Bekämpfung der Luftverschmutzung erlassen, dieses war jedoch weder umfassend noch konnte es erfolgreich implementiert werden (vgl. Fagin 1994: 485). Auch in den 1970er Jahren gab es Initiativen zur Verbesserung der Umwelt, es wurde unter anderem ein Beirat für Umweltfragen auf Bundesebene eingerichtet, die institutionelle Zersplitterung im Umweltbereich blieb jedoch bestehen (vgl. Welfens 1993: 113). Was Verordnungen und Gesetze zum Umweltschutz anging, musste man 1989 also fast bei Null anfangen.
5.2.2 Die Umweltgesetzgebung 1989-1993 – Gesetze und Verordnungen
Nach der Revolution wurden schon bald erste Gesetze zum Schutz der Umwelt erlassen, außerdem wurden wichtige Institutionen wie Umweltministerien und Umweltbehörden geschaffen. Zwischen 1990 und 1992 wurde eine stattliche Anzahl von Umweltgesetzen und Grenzwerten verabschiedet (vgl. Fagin 2002: 181), dies soll im nächsten Absatz anhand der Entwicklung der Verordnungen zum Thema Luftverschmutzung dokumentiert werden.
Die schon in 2. Kapitel angesprochene extrem starke Verschmutzung der Luft in Teilen der Tschechoslowakei (vgl. ECE 1993: 29) sorgte in diesem Bereich der Umweltgesetzgebung für einen erhöhten Handlungsdruck. So wurde 1991 der „Clean Air Act“ und 1992 der „Act on Air Pollution” (Fagin 2002: 181) verabschiedet, diese Gesetze und Regulationen glichen die Grenzwerte für den Ausstoß von Luftschadstoffen an das Niveau der EU und USA an (vgl. Fagin 1994: 487).
Neben der Frage der Luftverschmutzung wurden auch andere Bereiche der Umweltpolitik reguliert (vgl. ECE 1993: 40f.), einen „Höhepunkt“ der Gesetzgebung bildete dabei der 1992 verabschiedete „General Act on the Environment“. Dieser beinhaltet unter anderem die Verpflichtung zum Prinzip der nachhaltigen Entwicklung, zur Bewahrung der Umwelt für zukünftige Generationen und zu freiem Zugang zu Informationen über den Zustand der Umwelt (vgl. Fagin 1994: 487). Trotz dieser auf den ersten Blick sehr gewissenhaften und fortschrittlichen Gesetzgebung sollte aber bedacht werden, dass die Implementierung der Gesetze in vielen Bereichen hinter den festgeschriebenen Ansprüchen zurückblieb (vgl. Fagin 1994: 487).
Betrachtet man diese kurze Zusammenfassung der Verordnungen und Gesetze, so scheinen sich die Aktivitäten in diesem Bereich zumindest bis Ende des Jahres 1992 auf gleich bleibendem Niveau bewegt zu haben, die im Abschnitt 5.1 herausgearbeiteten Schwankungen der zivilgesellschaftlichen Entwicklung sind jedenfalls nicht zu erkennen. Dies führt zu der Annahme, dass die Umweltgesetzgebung auch durch andere Interessen als die der NGO’s bestimmt wurde, der zweite Teil der die Hypothese scheint sich also nicht zu bestätigen. In den folgenden Abschnitten soll dieses Ergebnis verdeutlicht werden, außerdem werden als intervenierende Variablen in Frage kommende Einflüsse auf die Gesetzgebung erläutert.
5.3 Einfluss der Umweltbewegung auf die Gesetzgebung – Ergebnis der Hypothesenprüfung
Wie schon angedeutet, kann nur der erste Teil der Hypothese bestätigt werden, wonach die Umwelt-NGO’s nach der Revolution sehr einflussreich waren. Dieser Einfluss stützte sich vor allem auf das anfangs breite öffentliche Interesse an umweltpolitischen Themen, vor allem aber auf die vielen informellen Verbindungen zwischen NGO’s und Administration. Spätestens ab dem Jahr 1991 ging der Einfluss aber eher zurück. Die Hauptgründe für die Schwächung dürften den vorhergehenden Untersuchungen vor allem in der mangelnden gesellschaftlichen Anerkennung der Arbeit für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung liegen. Außerdem wurden die Partizipationsmöglichkeiten im Laufe der unterschiedlichen Transformationsphasen eher schlechter als besser, nicht zuletzt durch den Machtwechsel von 1992. Insgesamt war es das unglückliche Zusammenspiel mehrerer Faktoren – steigendes Desinteresse der Bevölkerung, Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Gruppen, Abwanderung von fähigen Personen (vgl. Jancar-Webster 1998: 74) – welches den teilweisen Niedergang der Umweltbewegung Anfang der 1990er Jahre forcierte.
Doch wie lässt sich dann die Konstanz erklären, welche die Umweltgesetzgebung zumindest bis zum Ende des Jahres 1992 auszeichnete? Auf diese Frage gibt es keine endgültige Antwort, sowohl Fagin als auch Jancar-Webster führen allerdings den Einfluss der Akteure aus dem westlichen Ausland ins Feld. Dieser Einfluss kann als intervenierende Variable gelten, welche den Einfluss der inländischen Umweltorganisationen bis zu einem gewissen Grad ersetzen oder verdrängen konnte, und wird im nächsten Abschnitt kurz erläutert.
5.4 Der indirekte Einfluss der EU – eine intervenierende Variable
Auch wenn im Jahre 1990 ein Beitritt zur EU noch ein weit entferntes Ziel war, bestimmte der Wunsch nach einem Anschluss an die europäische Gemeinschaft schon früh das Bewusstsein der für die Gesetzgebung zuständigen Akteure (vgl. Jancar-Webster 1998: 75f.). Auch und gerade in der Umweltgesetzgebung spielte dieses Anliegen eine Rolle, Fagin drückt es so aus: „ The desire of succesive post-communist Czech governments to join the EU has encouraged the drafting of new environmental legislation in line with the EU directives and norms” (Fragin 2002: 192). Deshalb lässt sich der indirekte Einfluss der EU und anderer westlicher Organisationen als intervenierende Variable bezeichnen, welche von Beginn an parallel zu dem Wirken der Umweltbewegung die Umweltgesetzgebung beeinflusste. Auf diese Weise ließe sich die über das Jahr 1991 hinaus andauernde Konsequenz der Administration im Bereich von Umweltverordnungen und -gesetzen erklären.
Es ist noch anzumerken, dass sich der direkte und indirekte Einfluss der EU nicht immer positiv auswirkte, oft führte er zu oberflächlichem Aktionismus und verhinderte langfristige Konzepte zum Schutz der Umwelt (vgl. Fagin/Jehlička 1998: 126). Die aufgezeigte intervenierende Variable ist im Hinblick auf die Implementierung eines Konzepts nachhaltiger Entwicklung also eher negativ zu beurteilen.
6. Fazit
Nach den theoretischen Überlegungen, der Aufstellung der zweigeteilten Hypothese und der Untersuchung des Fallbeispiels sind folgende Ergebnisse festzuhalten: Die Hypothese konnte nur insofern bestätigt werden, als sich die Entwicklung der NGO’s anhand der transformationstheoretischen Überlegungen vorhersagen ließ. Der zweite Teil der Hypothese, welcher eine Schwächung der Gesetzgebungsaktivitäten analog zu einer Schwächung der NGO’s vorhersagte, konnte nicht bestätigt werden. Dies ließ sich teilweise mit dem festgestellten Einfluss der intervenierenden Variablen „Einfluss der EU“ erklären.
Zur Bewertung und Erklärung dieses Ergebnisses sowie zur Entwicklung nach 1993 nun zwei abschließende Anmerkungen:
1. Eines der Anliegen dieser Arbeit war das Aufzeigen der Dynamiken innerhalb eines Transformationsprozesses. Diese Dynamiken ergeben sich – so die Annahme – einerseits aus den ständig wechselnden Präferenzen der Akteure und andererseits aus den genauso schwer vorhersehbaren Änderungen der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen. Diese Veränderungen hängen jedoch eng zusammen, dies lässt sich am Beispiel des – zumindest partiell – festgestellten Zusammenhangs zwischen dem Handeln der Umweltbewegung und den verabschiedeten Umweltgesetzen zeigen.
2. Der relativ kurze Zeitraum zwischen 1989 und Anfang 1993 wurde bewusst gewählt, um einen fest definierten und nicht zu umfangreichen Rahmen für die Untersuchung von unabhängiger und abhängiger Variable zu haben. Da die Ereignisse nach 1993 aus heutiger Sicht jedoch keine „Black Box“ sind, ist anzumerken, dass die herausgearbeitete Schwächung der NGO’s eher ein vorübergehender Zustand war. Schon Ende 1994 konstatierte Fagin eine „improving [relationship between NGO’s and the Environmental Ministry] after a period of relative deadlock” (Fagin 1994: 493).
Literaturverzeichnis
Croissant, Laurel / Lauth, Hans-Joachim / Merkel, Wolfgang 2000: Zivilgesellschaft und Transformation: ein internationaler Vergleich. In: Merkel, Wolfgang (Hrsg.): Systemwechsel 5. Zivilgesellschaft und Transformation. Opladen. S. 9-49.
Economic Commission for Europe (ECE) 1993: Economics and Environment in the former Soviet Union and Czechoslowakia. UN ECE Discussion Papers Volume 2, No. 4. New York.
Fagin, Adam 1994: Environment and Transition in the Czech Republic. In: Environmental Politics, Volume 3, Number 3, Autumn 1994. S. 479-494.
Fagin, Adam / Jehlička, Petr 1998: Sustainable Development in the Czech Republic: A Doomend Process? In: Environmental Politics, Volume 7, Number 1, Spring 1998. S. 113-128.
Fagin, Adam 2002: The Czech Republic. In: Jänicke, Martin / Weidner, Helmut (Hrsg.): Capacity Building in National Environmental Policy. A Comparative Study of 17 Countries. Heidelberg. S. 177-200.
Gosewinkel, Dieter 2003: Zivilgesellschaft – eine Erschließung des Themas von seinen Grenzen her. WZB Discussion Paper Nr. SP IV 2003-505.
Einzusehen unter: http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2003/iv03-505.pdf (Zugriff am 19.08.06)
Jancar-Webster, Barbara 1998: Environmental Movement and Social Change in Transition Countries. In: Environmental Politics, Volume 7, Number 1, Spring 1998. S. 69-90.
Juchler, Jakob 1994: Osteuropa im Umbruch. Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen 1989-1993. Gesamtüberblick und Fallstudien. Zürich.
Kundrata, Miroslav 1992: Czechoslovakia. In: Davis, Claire / Fisher, Duncan / Juras, Alex / Pavlović, Vukašin (Hrsg.): Civil Society and the Environment in Central and Eastern Europe. Belgrad, Bonn, London. S. 31-50.
Mansfeldová, Zdenka / Szabó, Máté 2000: Zivilgesellschaft im Transformationsprozess Ost-Mitteleuropas: Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei. In: Merkel, Wolfgang (Hrsg.): Systemwechsel 5. Zivilgesellschaft und Transformation. Opladen. S. 89-114.
Merkel, Wolfgang 1999: Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung. Opladen.
Nissen, Sylke 1994: Die ökologische Transformation sozialistischer Arbeitsgesellschaften. In: Jordan, Peter / Tomasi, Elisabeth (Hrsg.): Zustand und Perspektiven der Umwelt im östlichen Europa. Frankfurt am Main. S.33-56.
Welfens, Maria J. 1993: Umweltprobleme und Umweltpolitik in Mittel- und Osteuropa. Ökonomie, Ökologie und Systemwandel. Heidelberg.
[...]
[1] Der Begriff „Zivilgesellschaft“ ist sehr vieldeutig und nicht unumstritten, deswegen folgende Anmerkung: Zivilgesellschaft wird in dieser Arbeit verstanden als ein Raum für soziales und politisches Handeln, welcher sich zwischen den Bereichen des Staates, der Wirtschaft und des Privaten befindet (vgl. hierzu Gosewinkel 2003: 1-7). Diese Definition ist nicht völlig umfassend, sollte für die Zwecke dieser Arbeit jedoch genügen.
[2] Da sich der Zeitraum dieser Untersuchungen nur bis Anfang 1993 erstreckt und die Teilung der Tschechoslowakei erst in diesem Jahr wirksam wurde (vgl. Juchler 1994: 342f.), wird in dieser Arbeit ausschließlich von der Tschechoslowakei die Rede sein. Die meisten Angaben und in der Arbeit beschriebenen Entwicklungen beziehen sich allerdings auf die spätere Tschechische Republik.
[3] Zur aktuellen Diskussion über die Rolle der Zivilgesellschaft in Osteuropa, siehe z.B. BBC News, 23.11.05: „Russian MPs act to 'curb' NGOs“ (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4462366.stm, Zugriff am 19.08.06)
[4] Für weitere Erläuterungen hierzu siehe Abschnitt 4.1.
[5] Vgl. hierzu auch die Erläuterung des theoretischen Hintergrundes in Kap. 4.1.
[6] Im weiteren Verlauf der Erläuterungen zu den Akteurstheorien wird zwischen deskriptiv-empirischen und rational choice-Ansätzen unterschieden (vgl. Merkel 1999: 103-107). Diese Differenzierung soll an dieser Stelle jedoch außer acht gelassen werden, da die Grundannahme einer akteurszentrierten Betrachtungsweise eine hinreichende Grundlage für die folgenden Untersuchungen darstellt.
[7] Wie bereits erwähnt bezieht sich ein Großteil der verwendeten Literatur auf die Situation in der späteren Tschechischen Republik, die Entwicklungen in der späteren Slowakei spielen in dieser Arbeit keine Rolle.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit?
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle von Umweltbewegungen in der Tschechoslowakei in den ersten Jahren der Transformation bis 1993. Ziel ist es, Stärke und Bedeutung der Bewegungen zu ermitteln und ihren Einfluss auf die Umweltgesetzgebung in der Übergangsphase zu prüfen.
Welche Fragestellung wird untersucht?
Die Fragestellung lautet: Wie stark und in welcher Form konnten Umweltbewegungen und unabhängige Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) ihre Interessen in die (umwelt-)politischen Ordnungen der sich in der Transition befindlichen Staaten Zentral- und Osteuropas einbringen?
Welche Variablen werden untersucht?
Die unabhängige Variable ist die Stärke der zivilgesellschaftlichen Umweltbewegungen, gemessen unter anderem an der Anzahl der bestehenden Organisationen und deren Beteiligungsmöglichkeiten. Die abhängige Variable ist der Prozess der Umweltgesetzgebung durch die zuständigen Akteure in der Administration, gemessen an Gesetzen, Verordnungen und der Festlegung von Grenzwerten sowie deren Implementierung.
Welches Land wird als Fallbeispiel untersucht?
Die Untersuchung ist als Einzelfallstudie angelegt, welche die Fragestellung anhand des Beispiels der Tschechoslowakei bearbeitet.
Welche theoretischen Hintergründe werden verwendet?
Es werden Überlegungen aus dem Bereich der Transformationstheorien verwendet, insbesondere die Einteilung des Transformationsprozesses in Phasen, Annahmen der Akteurstheorien und eine These zur Bedeutung der zivilgesellschaftlichen Partizipation in transformierenden Staaten.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Hypothese lautet: 1. Die umweltpolitischen Bewegungen in der Tschechoslowakei waren im Zeitraum kurz bevor und kurz nach dem Sturz des Regimes Ende des Jahres 1989 sehr präsent und hatten großen Anteil am Ende der kommunistischen Herrschaft. Es gelang ihnen jedoch nicht, ihren Einfluss auf die Umweltpolitik der neuen Regierung vollständig zu stabilisieren und vor allem zu institutionalisieren. 2. Deshalb kann in den folgenden Jahren, ungefähr ab 1991, kein stetiger Einfluss der Umwelt-NGO’s auf die Gesetze und Verordnungen der Regierung festgestellt werden. Die fehlenden NGO-Aktivitäten beeinträchtigten die Umweltgesetzgebung negativ, weil dem Gesetzgeber eine antreibende und kontrollierende Kraft fehlte.
Welche Umweltprobleme gab es in der Tschechoslowakei?
Zu den größten Problemen gehörten die hohe Luftbelastung, insbesondere durch die ineffiziente Verfeuerung von Braunkohle, und die großflächige Verschmutzung von Wasserressourcen.
Welche Rolle spielten Umwelt-NGOs vor 1989?
Schon vor 1989 gab es Umweltvereinigungen, die jedoch größtenteils ins System der staatlichen Organisationen eingebunden waren. Ende der 1980er Jahre hatten die größten Gruppen ca. 50.000 Mitglieder, von denen sich jedoch längst nicht alle an den Aktivitäten ihrer Organisation beteiligten.
Welche Möglichkeiten und Probleme hatten die Umwelt-NGOs nach 1989?
Nach der Revolution gab es einen sprunghaften Anstieg der Popularität, Ressourcen und Beteiligungsmöglichkeiten der Umweltbewegung. Gleichzeitig gab es aber auch Probleme wie Konflikte innerhalb der Bewegung, ein schwindendes Interesse an Umweltthemen in der Bevölkerung und begrenzte formelle Wege der Einflussnahme.
Wie entwickelte sich die Umweltgesetzgebung in den Jahren 1989-1993?
Nach der Revolution wurden erste Gesetze zum Schutz der Umwelt erlassen und wichtige Institutionen geschaffen. Es gab eine stattliche Anzahl von Umweltgesetzen und Grenzwerten, insbesondere im Bereich der Luftverschmutzung. Die Implementierung der Gesetze blieb jedoch oft hinter den Ansprüchen zurück.
Welchen Einfluss hatte die EU auf die Umweltgesetzgebung in der Tschechoslowakei?
Der Wunsch nach einem Anschluss an die europäische Gemeinschaft bestimmte früh das Bewusstsein der für die Gesetzgebung zuständigen Akteure. Der indirekte Einfluss der EU kann als intervenierende Variable bezeichnet werden, welche von Beginn an parallel zu dem Wirken der Umweltbewegung die Umweltgesetzgebung beeinflusste.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Hypothese konnte nur insofern bestätigt werden, als sich die Entwicklung der NGOs anhand der transformationstheoretischen Überlegungen vorhersagen ließ. Der zweite Teil der Hypothese, welcher eine Schwächung der Gesetzgebungsaktivitäten analog zu einer Schwächung der NGOs vorhersagte, konnte nicht bestätigt werden. Dies ließ sich teilweise mit dem festgestellten Einfluss der intervenierenden Variablen „Einfluss der EU“ erklären.
- Quote paper
- Max Enno Hildebrandt (Author), 2006, Umwelt-NGO's während der Transformation in Zentral und Osteuropa (Tschechoslowakei), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110380