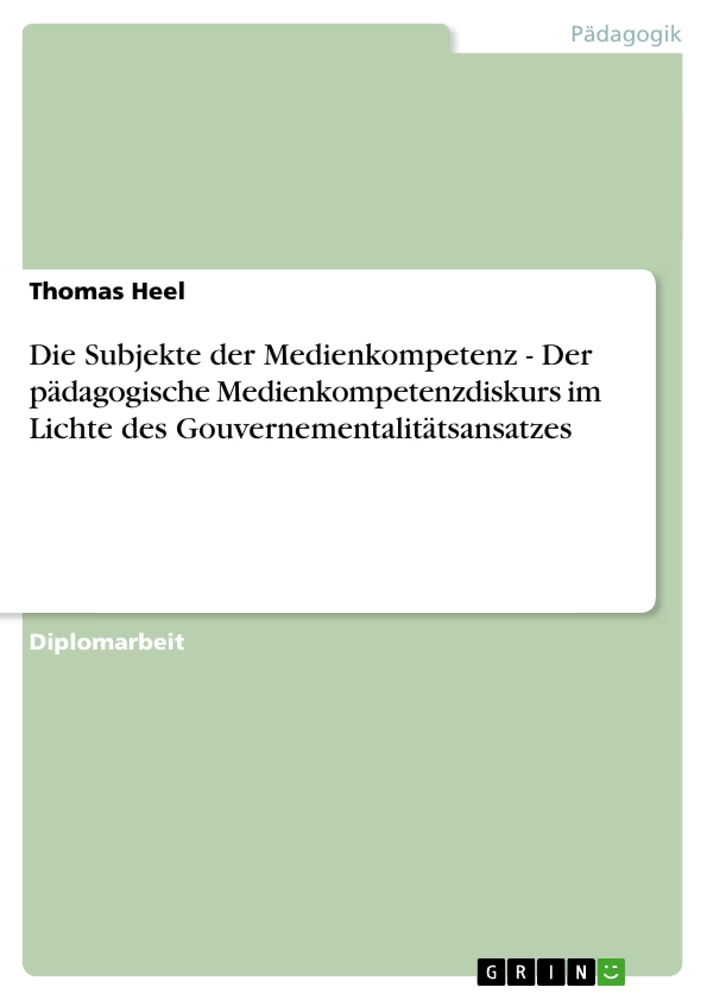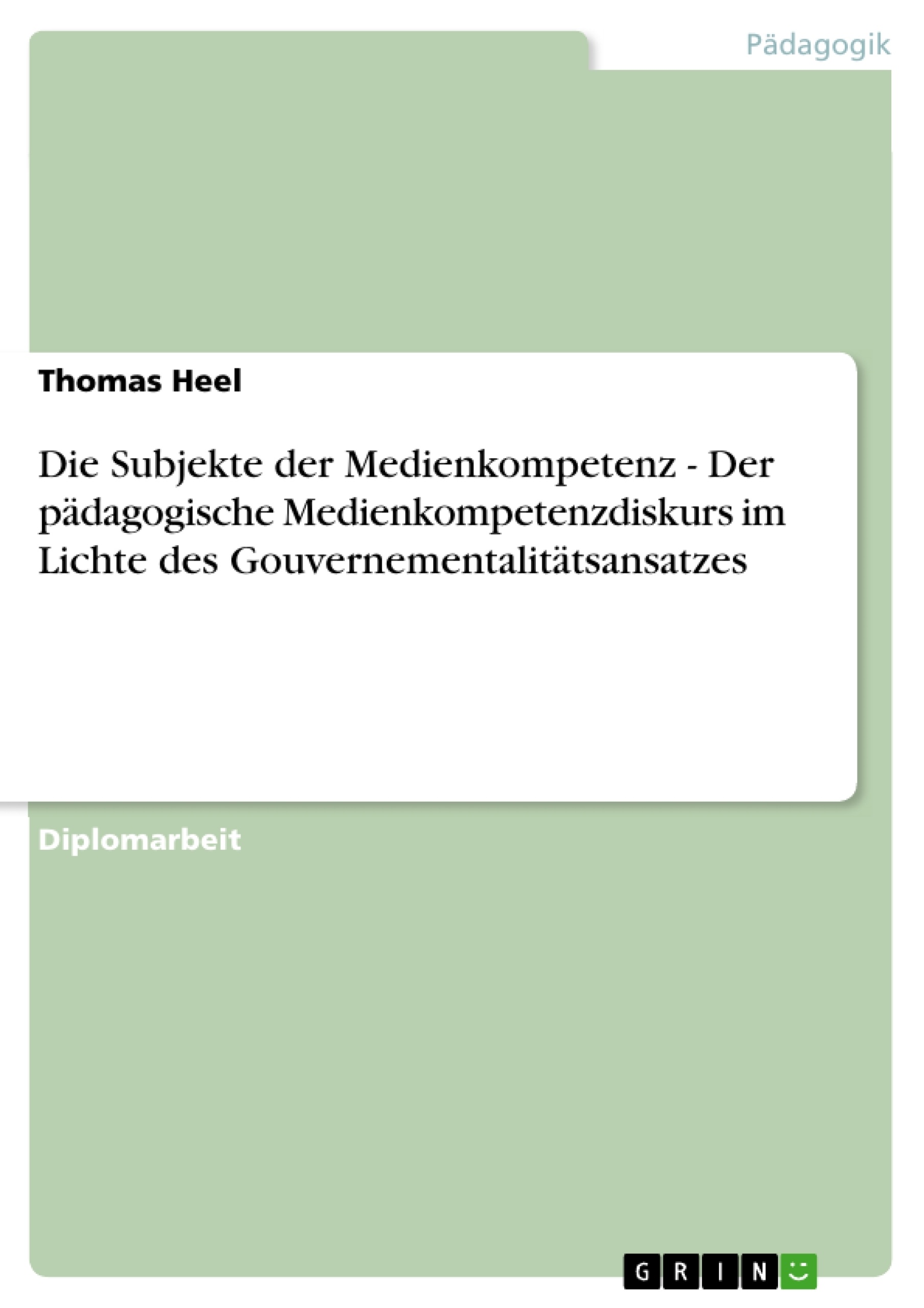Stellen Sie sich vor, die Medienpädagogik, einst Bollwerk gegen Manipulation und Trägheit, ist selbst zum Instrument der Macht geworden. Dieses Buch enthüllt eine intriguente Wahrheit: Wie der Diskurs um Medienkompetenz, einst als Schlüssel zur Emanzipation gepriesen, subtil zur neoliberalen Regierungstechnik mutiert ist. Anstatt mündige Bürger zu formen, produziert er den "homo competens," einen anpassungsfähigen, selbstoptimierenden Unternehmer seiner selbst, der unermüdlich an seiner Verwertbarkeit arbeitet. Der Gouvernementalitätsansatz, inspiriert von Michel Foucault, dient hier als scharfes Analysewerkzeug, um die verborgenen Mechanismen dieser Transformation freizulegen. Die Analyse dekonstruiert den vermeintlich neutralen Begriff der Medienkompetenz und zeigt, wie er in den Dienst von Ökonomisierung und Pädagogisierung gestellt wird, um konforme Subjekte für die Wissensgesellschaft zu formen. Dabei werden kritische Fragen aufgeworfen: Wie lässt sich Medienkompetenz von einer bloßen Anpassungsleistung abgrenzen? Welche Rolle spielen Kreativität, Selbsttechniken und die allgegenwärtige Evaluation in diesem Dispositiv? War Foucault selbst medienkompetent? Und ist die Medienpädagogik gar inkompetent? Das Buch bietet keine einfachen Antworten, sondern eröffnet einen kritischen Dialog, der die vermeintliche Eindeutigkeit des Medienkompetenz-Diskurses hinterfragt und neue Perspektiven für eine selbstbestimmte Mediennutzung aufzeigt. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich mit Medienpädagogik, Erziehungswissenschaft, Cultural Studies und der kritischen Analyse gesellschaftlicher Machtverhältnisse auseinandersetzen und verstehen wollen, wie Medienkompetenz zur Technologie des Selbst wird. Schlüsselwörter: Medienkompetenz, Medienpädagogik, Gouvernementalität, Foucault, Diskursanalyse, Neoliberalismus, Selbsttechnologien, Kritik, Erziehungswissenschaft, Cultural Studies, Kontrollgesellschaft, Überwachung, Ökonomisierung, Pädagogisierung, Subjektivierung, Kreativität, Medienkritik, Gesellschaftskritik,Ideologiekritik,Postfordismus,Kybernetisierung, Macht, Wissen, Subjekt, Norm, Kompetenzbegriff, Medien, Kontrolle, Digitale Medien, Gesellschaftliche Entwicklung, Medientechnologien,Erziehung.
Inhalt
0. Vorwort
1. Einleitend
1.1 Medienkompetenz als Plastikwort
1.2 War Foucault medienkompetent ?
1.3 Ist die Medienpädagogik inkompetent ?
1.3.1 Eine (doppelte) Bindestrich-Wissenschaft
1.3.2 Kausalitätsmythen
2. Kritik und / als Methode
2.1 Harald Gapskis Wissenssoziologische Medienkompetenz- Diskursanalyse
2.2 Pädagogik, Kritik und Gouvernementalität
2.3 Diskursanalyse und / als Ideologiekritik
2.4 Eine alternative kritische Subjektivität?
3. Der pädagogische Medienkompetenz-Diskurs
3.1 Medienverwahrlosung
3.2 Das Kompetenz-Theorem
3.2.1 Von der Kompetenz zum Programm
3.2.2 und zurück zum Suffixoid -kompetenz
3.3 Bedeutungsfelder und Dimensionen von Medienkompetenz
3.3.1 Bedeutungsfelder des Medienkompetenzbegriffs
3.3.2 Dimensionen von Medienkompetenz
4. Der Gouvernementalitätsansatz
4.1 Zur Rezeption Michel Foucaults
4.2 Der Gouvernementalitätsansatz
4.2.1 Liberaler Code versus kulturtheoretische Perspektive des Politischen
4.2.2 Die Programmatik der gouvernementalen Perspektive
4.3 Beispiele pädagogischer Rezeption
4.3.1 „Lernen lebenslänglich“ (D. Wrana)
4.3.2 The autonomous Chooser (J. Marshall)
5. Die pädagogische Medienkompetenz im Lichte des Gouvernementalitätsansatzes
5.1 Pädagogisierung und Ökonomisierung
5.2 Der homo competens
5.3 Das Kompetenz-Dispositiv
5.4 Kybernetisierung
5.5 Das kompetente Subjekt technischer Medien
5.5 1 Rolltalk
5.5.2 ‚Das neue Fernsehen’
5.6 Kreativität
5.6.1 Der kreative Imperativ
5.6.2 Die Vor-läufigkeit der Technik (W. Sesink)
5.6.3 Kreativitäts - und andere Selbst techniken
6. Eine gouvernementalistische Medienpädagogik?
6.1 Die Allianz von Cultural Studies und Critical Pedagogy als Kontrastfolie
6.2 Prolegomena zu einer gouvernemental reflektierten Medienkompetenz
6.2.1 Eine Relativierung des Gouvernementalitätsansatzes
6.2.2 Vom Nutzen des Gouvernementalitätsansatzes für die Medienpädagogik
7. Bibliografie
0. Vorwort
Jede Medienpädagogik, die sich nicht von vornherein dem technoökonomischen Diktat der Medienfröhlichkeit unterordnen oder der Entwicklung von Strategien der Gewissens-beruhigung für Technokraten verschreiben will, wird um eine differenzierte Auseinan-dersetzung mit medienkritischen und sozial-wissenschaftlichen Denkangeboten nicht he-rumkommen.
(Hug 2001 a: 5)
Die vorliegende Arbeit stellt sich zwei Fragen: Wie wird mit(tels) Medienkompetenz regiert und wie kann die Kunst (= Kritik im Sinne Foucaults als Kunst der freiwilli-gen Unknechtschaft) aussehen, nicht dermaßen von ihr regiert zu werden?
Sie schließt damit an Harald Gapskis Medienkompetenz-Diskursanalyse an, die ihrerseits – allerdings auf systemtheoretischer Grundlage – von Was -Fragen (Was ist Medienkompetenz?) auf Wie -Fragen (Wie und von wem wird Medienkompetenz de-finiert? Wie wird der Begriff verwendet?) umgestellt hat (vgl.Gapski 2001 b: 23).
Regieren wird hier im Sinne des Gouvernementalitätsansatzes als Führung durch Selbstführung verstanden. Die Affinität der Führung durch Selbstführung, im Gou-vernementalitätsansatz als neoliberale oder neosoziale Regierungstechnik interpre-tiert, zur pädagogischen/erzieherischen Praxis und Reflexion als Führung zur Selbst-führung ist augenscheinlich:
Fasst man den Begriff der Regierung […] als Technologie der Regulation von Be-völkerungen und Transformation der Subjektivitäten von Individuen, dann erscheint die Pädagogik als eine der modernen Künste der Gouvernementalität par exzellence. (Wrana 2003: 108)
Thomas Höhne begreift dementsprechend die Pädagogisierung bzw. die Durch-setzung einer spezifischen pädagogischen Form als eine komplementäre Bewegung zur Generalisierung der ökonomischen Form, als welche die neoliberale Transfor-mation in den Gouvernementalitätsstudien beschrieben wird:
Es handelt sich [...] um originär pädagogisches Wissen um Subjektivität, die unab-dingbar für die Etablierung neoliberaler Logiken in unterschiedlichen sozialen Be-reichen ist und nicht schlicht unter ökonomische Formen subsumiert werden kann. (Höhne 2003 a: 237)
So gesehen setzt die neoliberale Gouvernementalität bereits das als gegeben voraus, was die Pädagogik herstellen will/soll, nämlich das autonome Subjekt. Der Prozess der Pädagogisierung (als Prozess der Verallgemeinerung eines spezifischen Wissens und einer Rationalität, die sich wesentlich durch die Definition von dem, was Subjek-te vermögen und durch Entwicklung zu erreichen imstande, auszeichnet; ebd., im Orig. kursiv) bedeutet allerdings keine „Aufwertung“ der Pädagogik als Disziplin, im Gegenteil.
Nun kommt kaum eine Arbeit im Bereich der Gouvernementalitätsstudien ohne ei-nen Hinweis auf Gilles Deleuzes Postskriptum über die Kontrollgesellschaften als update von Foucaults Disziplinargesellschaft aus:
In der Disziplinargesellschaft hörte man nie auf anzufangen (von der Schule in die Kaserne, von der Kaserne in die Fabrik); während man in den Kontrollgesellschaf-ten nie mit etwas fertig wird: Unternehmen, Weiterbildung, Dienstleistung sind me-tastabile und koexistierende Zustände ein und derselben Modulation […]. (Deleuze 1993: 257)
Die für die Kontrollgesellschaften typischen Maschinen sind für Deleuze die Infor-mationsmaschinen und die Computer – und sie sind es für die Medienpädagogik nicht minder.
Insofern, so die Grundthese dieser Arbeit, müsste dieser Wandel von der Disziplinar-gesellschaft zu den Kontrollgesellschaften in einer gouvernementalen Rekonstruktion der Medienkompetenz als Kernbegriff der Medienpädagogik doppelt ablesbar sein: Einerseits, weil in dieser Sicht die Pädagogik, wie gesagt, die moderne Kunst der Gouvernementalität par excellence sein soll, andererseits, weil die Medienpädagogik eben die für die Kontrollgesellschaften typischen Maschinen in ein pädagogisches Verhältnis zu den Subjekten setzt und sie demnach also die – zumindest innerhalb der Pädagogik – aktuellste Form der Gouvernementalität repräsentieren müsste.
Ein solcher Zusammenhang ist meines Wissens bisher explizit noch nicht gestiftet worden, wiewohl der Gouvernementalitätsansatz bereits (oder endlich) in der deutschsprachigen Pädagogik „angekommen“ ist (z.B. Ricken / Rieger-Ladich 2004).
Die Arbeit der vorliegenden Arbeit wird zuvorderst darin bestehen, diese persönliche Evidenz argumentativ-dialogisch und methodisch gestützt zu plausibilisieren, das Medienkompetenz-Konstrukt also in die Gegengeschichte des Gouvernementalitäts-ansatzes (vgl. Reckwitz 2004) zu integrieren, wobei dieser Ansatz hier aber nicht als der „Weisheit letzter Schluss“ fungiert, sondern – im Sinne einer ideologiekritischen Diskursanalyse – als kontrastiver Diskurs.
Der Versuchung oder Anmutung, voreilig einen „positiven“, „konstruktiven“ und „praktisch verwertbaren“ Gegenent wurf zu liefern, soll hier nicht erlegen werden; wenn überhaupt, dann wird ein solcher Entwurf Thema meiner medienwissen-schaftlichen Dissertation sein. Im Gegenzug werden Rolle und Funktion der Kritik in der Pädagogik bzw. der Pädagogik als Kritik (vgl. Pongratz u.a. 2004, Benner u.a. 2003) thematisiert.
Freilich soll hier nicht ausgeschlossen werden, dass dennoch etwas (für wen und wie auch immer) Verwertbares aus der intensiven Beschäftigung mit diesen Fragestel-lungen heraus kommt, zumal es sich hier nicht um ein Vor wort ex post handelt.
1. Einleitend
1.1 Medienkompetenz als Plastikwort
Das sprachliche Spiel erzeugt eben kei-neswegs nur Phrasen oder fachmännisches Geplapper. Das wäre harmlos. Seine wirk-samsten Elemente – und beschränkt man die Spiele auf die Plastikwörter, dann wird das erkennbar – sind die Fertigbausteine unse-rer Welt. Natura fictionem sequitur. Die Natur folgt ihren Erfindern. Und sie hat zur Zeit die Neigung, ziemlich schlechte ‚fiction‘ zu sein. Ramsch. Eine Welt aus beweglichem Ramsch ist das Abbild einer in dieser Art beweglichen Sprache.
(Pörksen 1988: 83)
Der Begriff „kommunikative Kompetenz“ wurde von Dieter Baacke (1973) in die erziehungswissenschaftliche Diskussion eingeführt. Er ist in unterschiedlichen Aus-differenzierungen bis heute im Kontext von Theorie und Praxis der Bildungs-, Sozi-al- und Kulturarbeit sowie insbesondere im Hinblick auf die aktuellen medienpäda-gogischen Debatten bedeutsam geblieben [...]. Im Zuge dieser Ausdifferenzierungen ist in den letzten Jahren der Ausdruck ‚Medienkompetenz‘ (‚media literacy‘) zum Schlüsselbegriff der medienpädagogischen Bemühungen avanciert [...]. (Hug 2002: 201)
Medienkompetenz ist heutzutage nicht nur der Schlüssel- oder Leitbegriff in der medienpädagogischen Diskussion, er ist zudem
- momentan sehr sexy (Aufenanger 1998: 8),
- eine Leerformel (Schorb 2001: 12),
- ein Drehtürbegriff, der sowohl in wissenschaftlichen als auch in wirt-schaftlichen, politischen und pädagogischen Kontexten Verwendung findet (Hug 2002: 202),
- ein Missing LINK (Klammer 2000: 2),
- unspezifisch und vieldeutig (Wermke 1997: 135),
- zu einem Schlagwort verkommen, das von verschiedensten gesellschaft-lichen Gruppen für die Durchsetzung spezifischer Interessen instrumen-talisiert wird (Spanhel 2002 b: 48),
- mit Abstand einer der grauzonigsten Begriffe, die in die Diskussion der letzten Jahre injiziert wurden (Lorenz 2000: 1),
- zur Entlastungsvokabel schlechthin geworden (Stenzel 2001: 12),
- ein Kampfbegriff der Medienpädagogik (Mikos 1999: 1),
- ein Feld schillerndster Vorstellungen mit enormer begrifflicher Unübersichtlichkeit (Vollbrecht / Mägdefrau 1999: 54),
- ein Alibi gegenüber der Öffentlichkeit und […] Fetisch für die Pädagogen (Fischbach 1998: 2),
- eine populäre Universalkonzeption (Koziol / Hunold 2002),
- die Lieblingsmetapher der Medienpädagogik (Kübler 1996: 11),
- ein Zauberwort (Stang 1996: 147),
- eine Art Vodoo, mit der man die Zukunft steuern will (Lorenz 2000: 2) und endlich
- ein Begriff, der auf den ersten Blick alles andere als liebenswürdig erscheint, vielmehr abstrakt, damit abweisend; vieldeutig, darum schwierig. Wie kommt es zu solch einer Konjunktur? (Baacke 1998 a: 1)
Eine einfache Google -Abfrage führt zu folgendem Ergebnis (1.12.2003, 8.00 Uhr):
- Medienkompetenz 92 700 Einträge
- media competence 795 700 Einträge
- media literacy 2 180 000 Einträge
Nun ist es aber nicht so, dass die Medienkompetenz derart schillert, weil hier etwa zwei inkompatible Begriffe sich zu einem Oxymoron verbänden. Mit „Begriffswirr-warr und Metaphernsalat“ bedenkt Faulstich (2002: 19) den Diskurs um den Begriff Medium, und es ließe sich leicht eine Liste anführen, die sowohl den Sprach- und sonstigen Gebrauch von Medien wie von Kompetenz isoliert als ähnlich blumig bis schwammig diagnostiziert wie das daraus gebildete Kompositum.
Die quantitative Relevanz und die semantische Omnipotenz, die der Medienkom-petenz verliehen wird, macht sie inflationär irrelevant: Sie wird beinahe zu einem eigenen Kanal, auf dem sich dazu berufen Fühlende mit Ratschlägen, Definitions-versuchen, Empfehlungen, Warnungen, Dekonstruktionen usw. als Medienkom-petente oder darum Besorgte bzw. dafür zu sorgen Habende (Medienpädagogen) outen können.
Kein Zweifel: Medienkompetenz ist ein Plastikwort, ein neureicher Neffe der Wissen-schaft in der Umgangssprache (Pörksen 1988: 38), das sich folgendermaßen charak-terisieren lässt:
A. Es entstammt der Wissenschaft und ähnelt ihren Bausteinen. Es ist ein Stereotyp.
B. Es hat einen umfassenden Anwendungsbereich, es ist ein „Schlüssel für alles“.
C. Es ist inhaltsarm. Ein Reduktionsbegriff.
D. Es faßt Geschichte als Natur.
E. Konnotation und Funktion herrschen vor.
F. Es erzeugt Bedürfnisse und Uniformität.
G. Es hierarchisiert und kolonisiert die Sprache, etabliert die Elite der Experten und dient ihr als „Ressource“.
H. Es gehört einem noch recht jungen internationalen Code an. (Pörksen 1988: 38)
Sämtliche Merkmale, die Pörksen hier für die Plastikwörter anführt, treffen auch auf die Medienkompetenz zu. Bedauerlicherweise hat Pörksens Essay wenig Resonanz gefunden – wiewohl er durch seine Übertragung des LEGO-Prinzips (alle Steine passen zusammen) in Zeiten allseitiger Anschlussfähigkeit eigentlich anschlussfähig sein müsste (zumindest für Beobachter zweiter Ordnung).
Hier jedoch soll daran leitmotivisch angeknüpft werden, zumal die oben stehende Merkmal-Liste lediglich eine Kurzform darstellt. Pörksens Plastikwörter werden in dieser Arbeit deshalb eine erste, zunächst oberflächliche heuristische Folie neben anderen abgeben, wobei sie vorerst nur als simple Sprachkritik erscheinen mag, die Metaphorisierung via Metaphorisierung kritisiert.
Gleichzeitig ist Medienkompetenz als Programm aber auch ein Kandidat für das Glossar der Gegenwart (Bröckling u.a. 2004), für das Kompendium der Schlüssel-begriffe der Gouvernementalität der Gegenwart; während Pörksen die sinnentleerte Kombinatorik im öffentlichen Sprachschaum ins Zentrum rückt, untersucht dieses Glossar Stichworte von Aktivierung bis Zivilgesellschaft als „Programme des Re-gierens, die Probleme definieren, sie in einer bestimmten Weise rahmen und Wege zu ihrer Lösung vorschlagen“:
Programme formen die Realität, indem sie Diagnosen stellen und Therapien empfeh-len. Sie prägen Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Handlungsweisen, indem sie Ziele anvisieren und Verfahren bereitstellen, um diese zu erreichen oder ihnen zu-mindest näher zu kommen. Sie rufen Menschen an, sich als Subjekte zu begreifen und sich in spezifischer Weise – kreativ und klug, unternehmerisch und voraus-schauend, sich selbst optimierend und verwirklichend usw. – zu verhalten, und för-dern so bestimmte Selbstbilder und Modi der „inneren“ Führung. (Bröckling u.a. 2004: 12).
Im Unterschied zu Bröckling/Krasmann/Lemke, die ihr Glossar vom Inventar der Plastikwörter unterschieden wissen wollen (ebd. 11), sehe ich – gerade auf Grund der Betonung des Programmatischen – eher die Kontinuität als einen Bruch: (Secunda) natura fictionem sequitur.
1.2 War Foucault medienkompetent?
Fast zwangsläufig muß uns Foucault heute als Kronzeuge jener Fortschrittseuphoriker gelten, die das elektronische Netz der Netze als ein Nebeneinander unkontrollierbarer Ströme, als machtfreien Raum begrüßten. Doch gerade dieses Vertrauen in den Vor-sprung durch Technik ist er uns schuldig geblieben.
(Engelmann 1999: 217)
In einem anonym veröffentlichten Interview (Der maskierte Philosoph) entwirft Michel Foucault 1980 ein sehr optimistisches Bild der RezipientInnen:
Man beklagt sich immer, daß die Medien die Leute manipulieren. Etwas Menschen-verachtung steckt in dieser Vorstellung. Demgegenüber glaube ich, daß die Leute reagieren; je mehr man sie überzeugen will, desto mehr stellen sie sich Fragen. Der Geist ist nicht weich wie Wachs. Er ist eine reaktive Substanz. Und der Wunsch, mehr und besser und anderes zu wissen, wächst in dem Maße, wie man die Schädel vollstopft. (Foucault o.J.: 17)
Parallel dazu entdeckt die Medienpädagogik die/den aktive(n) Rezipientin/en, und die Cultural Studies postulieren, dass die vermeintlich passiven RezipientInnen keine Deppen seien, sondern sich Medienbotschaften sogar widerständig aneignen (kön-nen, wollen, sollen, dürfen und es vielleicht manchmal auch tun…) (vgl. Hepp 22004).
Gleichzeitig hegt Foucault scheinbar eine Art Internet -Traum, wie ihn beispielsweise Vilém Flusser (allerdings mit Hinblick auf einer auf dem Telefonnetz basierenden Dialogik) ähnlich auch schon geträumt hat – wobei dieser Internet-Traum avant la lettre bei Foucault durchaus neoliberal eingefärbt klingt:
Ich träume von einem neuen Zeitalter der Wißbegierde. Man hat die technischen Mittel dazu; das Begehren ist da; die zu wissenden Dinge sind unendlich; es gibt Leute, die sich mit dieser Arbeit beschäftigen. Woran leidet man? Am „Zuwenig“: ungenügende, quasi-monopolisierte Kanäle. Es geht nicht darum, eine protektionis-tische Haltung anzunehmen, um zu verhindern, dass die „schlechte“ Information durchkommt und die „gute“ erstickt. Man müßte eher die Hin- und Her-Wege und
-Möglichkeiten vermehren. […] Was nicht heißen soll, wie man es oft befürchtet, Uniformierung und Nivellierung von unten aus. Sondern im Gegenteil, Differen-zierung und Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Netze. (Foucault o.J: 18)
Die Forderungen nach Chancengleichheit sowie nach lebenslangem Lernen finden sich auch bei Foucault, wenn er das Recht auf Wissen nicht auf ein Lebensalter und bestimmte Kategorien von Individuen beschränkt wissen will – vielmehr müsse man dieses Recht „ohne Stillstand und in vielfältigen Formen“ ausüben können (ebd.: 20). Das Ziel einer Bildungsreform nach Foucault wäre also dieses:
Es war eine Hauptfunktion des Unterrichts, die Bildung des Einzelnen mit der Be-stimmung seines Platzes in der Gesellschaft zu verbinden. Heute müsste man den Unterricht so gestalten, dass er dem Einzelnen ermöglichte, sich nach eigenem Er-messen zu verändern, was aber nur unter der Bedingung möglich ist, dass die Lehre eine „permanent“ angebotene Möglichkeit ist. (Ebd.: 20 f)
Foucault fordert, dass der „Anschluß der Leute an die Kultur nicht aufhören darf und so polymorph wie möglich sein soll“; eine Trennung zwischen Bildung, die erfahren wird, und Information, der man ausgeliefert ist, solle es nicht geben (ebd.: 22).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Lego“-Foucault
(erhältlich unter www.theory.org.uk)
Wenn man also unbedingt will, kann man/frau sich aus diesen und anderen ver-streuten Bemerkungen einen (Lego-)Foucault als Medienkompetenz -Euphoriker zusammenbauen oder versuchen, ein Medienkompetenz -Konzept im Anschluss an Foucault zu entwerfen.
Ebenso gut kann mein einen Foucault-Medien-Reader wie Jan Engelmann heraus-geben; dieser wundert sich zwar mit der „deutschen Medientheorie, die zuallererst eine technische ist“, dass der Archivar Foucault die Materialität der Kommunikation ausklammere, warum er kein „ technisches Apriori in seine Wissensarchäologie“ ein-führe – weshalb bei ihm diesbezüglich geradezu von einem „blinden Fleck“ gespro-chen werden müsse –, untergründig („beinahe unkenntlich gemacht“) aber arbeite Foucault stellenweise dennoch mit einer „übertragungswissenschaftlich fundierten Medientheorie“ (Engelmann 1999: 219 ff).
Im Sinne des Selbst-Marketings jedenfalls war Foucault gewiss äußerst medienkom-petent. Als Star -Philosoph war er medial ein Powerpoint, eine philosophische Ich-AG, die erfolgreicher nicht hätte sein können. Aber er war auch so medienkompetent, dass sich das Medienkompetenzkonstrukt mit Hilfe seines Werkzeugkastens hoffent-lich kompetent rekonstruieren lässt.
1.3 Ist die Medienpädagogik inkompetent ?
Nichts wäre zynischer und zugleich faschis-toider als dies: Ein work-minded Modell von Medien im Blick auf ein close-minded-Mo-dell von Gesellschaft mit einem power-minded Modell von Pädagogik therapeutisch behandeln zu wollen.
(Bauer 2003: 23)
Unlängst hat der Medienphilosoph Rudolf Maresch die Medienpädagogik scharf attackiert; zunächst einmal wirft er ihr vor, nicht zu wissen, was sie überhaupt will bzw. wie sie sich disziplinär positionieren soll:
Unschlüssig, ob sie Menschen zum rechten Umgang mit Medien befähigen oder doch eher Auftragsforschung für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft betreiben, ob sie den Medienalltag kritisch begleiten oder nur empirisch beobachten, ob sie Eigen-ständigkeit demonstrieren oder dienende Funktion für etablierte Fächer ausüben soll, pendelt das Fach zwischen wissenschaftlichem Anspruch und praktischer Ausrich-tung, technischer Orientierung und pädagogischen Wunschfantasien ständig hin und her. (Maresch 2004: 1).
Eine solche Schelte ehrt die Medienpädagogik mehr, als dass sie sie verheert. Da ist offensichtlich einer, der die Spannung zwischen ‚Theorie und Praxis’ nicht aushält und bekannte Oppositionen strapaziert: zweckfreie Wissenschaft versus Auftrags-forschung, Theorie versus Empirie, disziplinäre Identität versus ‚parasitäre’ Inter- und Transdisziplinarität. Maresch kritisiert die Medienpädagogik – anscheindend im Namen irgendeiner ‚Reinheit’oder Hygiene – als ‚Weder-Noch’. Zwar skizziert er die aktuelle Umcodierung der emanzipatorischen Ziele der 68-er in neoliberale Herr-schaftsrhetorik m.E. durchaus zutreffend:
Dezentralisierung und Interaktion, Kollaboration und Selbstorganisation, Dialogi-sierung der Kommunikation und Befähigung der Empfänger zu potentiellen Sendern sind […] nach wie vor Leitlinien und Inhalt jeder aktiven Medienarbeit. Allenfalls die Semantik, Jargon und Gestus, mit dem diese Vorstellungen und Ziele erhoben und verbreitet werden, haben sich im Laufe der Jahre geändert. Noch immer spukt die Idee „konträrer Öffentlichkeiten“ zu den massenmedial geprägten in den Köpfen von Medien-Pädagogen herum. […] Noch immer träumt man den unendlichen Traum von Kommunikationsstrukturen, die die sozialen Verhältnisse verbessern und den Demokratisierungsprozess vorantreiben. […] Und noch immer hängt man an wohlfeil klingenden Ideen und erzieherischen Idealen, die man an Kindern und Er-wachsenenen realisieren will. Nach Start-Up- und Dotcom-Fieber, nach PISA-Schock und Hartz-Gesetzen heißen diese nun nicht mehr: Autonomie, Emanzipation und Subjektwerdung, sondern Selbstorganisation und Eigeninitative, Selbststeuerung und „Selbstbemächtigung“. […] Ziel allen medienpädagogischen Strebens ist dem-nach die Ich-AG […]. (Ebd.: 2)
Mit dieser Umcodierung befinde sich die Medienpädagogik auf der „Höhe der Zeit“ und gebärde sich „fortschrittlich“ (ebd.: 3). Die Reproduktion des postmodernisti-schen Gebräus, das Maresch jedoch als „Beleg“ für seine These Nicht der Mensch macht etwas mit Medien, sondern der Mensch wird von Medien gemacht und geformt (ebd.: 9) als angeblicher Succus der Systemsoziologie und einer historisch verfahren-den Medienwissenschaft, anführt, erspare ich mir. Was hier von Interesse ist, ist, dass die Medienpädagogik immerhin noch ein Anlass für ein elaboriertes Ärgernis sein kann, das überdies in eine medienpädagogische Zeitschrift Eingang findet:
Für die Medien-Pädagogik muss das aber nicht unbedingt Arbeitslosigkeit bedeuten. Mehr als früher bedarf es kompetenter Mediennutzer, die sich des Medienparks in-telligent bedienen und medialen Lug und Trug durchschauen. Einer engeren Anleh-nung an die Pädagogik braucht es dafür aber ebenso wenig wie der Rückversiche-rung hehrer pädagogischer Ideale. Weshalb man sich von ihren „Gespenstern“ am besten, aber auch von der Hybris der Pädagogen verabschieden sollte. (Ebd.)
Lug und Trug gibt es demnach auch für Maresch, der den Medien Subjektposition einräumt; die eigentliche Subjektposition reserviert er aber dennoch für sein mediati-siertes Ich, das – als Medium der Medien – sich offensichtlich fähig wähnt, Lug und Trug einer solchen Konstruktion zu durchschauen. (Sich?) Bedienen und zugleich Durchschauen: eine seltsame Mischung, die für Maresch möglicherweise die Über-flüssigkeit der (Medien-)Pädagogik markiert, in anderen Lesarten aber gerade ihre Notwendigkeit und Eigenart begründet.
1.3.1 Eine (doppelte) Bindestrich-Wissenschaft
2002 resümiert Hans-Dieter Kübler die Entwicklung der bundesdeutschen Medien-pädagogik der letzten 30 Jahre folgendermaßen:
Für eine wissenschaftliche Disziplin hat Medienpädagogik vergleichsweise rasch Bekanntheit, Reputation und sogar eigenes standing in Studiengängen, akademi-schen Stellen, Kongressen, wissenschaftlichen Vereinigungen und Publikationen erlangt. In der öffentlichen Debatte hat sie sogar – zumindest vordergründig – fast Tabu-Status erreicht: Gegen Medienpädagogik kann eigentlich niemand sein – weder in der Medienbranche selbst noch in den scientific communities, so wenig wie gegen Medienethik, sonst würde er seine Seriosität und seine mindestens demonstrierte Verantwortlichkeit aufs Spiel setzen. (Kübler 2002 b: 169)
Das ist freilich ein zweischneidiges Lob (wenn es denn überhaupt eines sein soll, zumal Hans-Dieter Kübler als Meister der internen medienpädagogischen Polemik gelten kann). Tabu-Status kann einfach auch bedeuten, dass sich kaum eine/r dafür wirklich interessiert.
Eine „doppelte Bindestrich-Disziplin“ ist die Medienpädagogik als Disziplin, die zu-dem den Status einer praktischen und theoretischen Wissenschaft beansprucht, im Rahmen der Wissenschaftssystematik für Kübler insofern, als sie einerseits in die Er-ziehungswissenschaft bzw. Pädagogik (die in sich bereits die Dualität von normativ-hermeneutischer und empirisch- analytischer Disziplin trägt und an die Medienpäda-gogik weiter gebe) gehöre bzw. aus dieser stamme, andererseits sei sie aber auch den „nicht weniger heterogen begründeten und aktuell diffusen“ Medien- und Kommuni-kationswissenschaften zuzurechnen (ebd.: 188 f). Diese „doppelte Bindung“ nun in-terpretiert Thomas Bauer als „Sollbruchstelle“ und besondere Qualität der Medienpä-dagogik; er zeichnet ein ähnliches Bild wie Kübler, wenn er den Stellenwert der Me-dienpädagogik – für Bauer eine irreführende Kurzbezeichnung (Bauer 2004: 1), die als Freud’sche Fehlleistung missoniarischer Pädagogik, wenn nicht überhaupt als Ausdruck der theoretischen Kompetenzschwäche aufgedeckt werden sollte (ebd.: 3) – innerhalb der Kommunikationswissenschaft so einschätzt:
Ihre Auftritte sind jedenfalls nicht zu übersehen. Es gibt sie, sie meldet sich zu Wort, sowohl im wissenschaftlichen Diskurs wie auch im Mediendiskurs […], man macht ihr Platz und schenkt ihr Zeit – meist im Rahmen von lange Abhandlungen ab-schließenden Konklusionen. […] Nachdenklichkeit ist nie falsch am Platz und macht sich gut im zunehmend technisch bzw. ökonomisch ausgerichteten Mediendiskurs. (Bauer 2002: 22).
Inhaltlich allerdings habe die Medienpädagogik der Kommunikationswissenschaft nichts zu bieten, zumal sie weder neue Theorien hervorgebracht noch gängige wider-legt und zudem keine eigenen Methoden hervorgebracht habe; Medienpädagogik fröne zudem der Besserwisserei, und Bauer rät ihr, sich als „offenes Kommunika-tionsmodell“ zu verstehen, als „kommunizierte Beobachtung der Gegenwart und des Aktuellen“ (ebd.: 23), was letztlich auf Medienpädagogik als eine Art Journalismus hinausliefe. Bauer offenbart hier seine eigene wissenschaftliche Poetik; so schreibt er fünf Jahre zuvor, als die Postmoderne eigentlich schon post aktuell war, unter dem Titel „Neue Medien und Neue Pädagogik“:
Nichts von dem, was die aufklärerische Medienpädagogik zu erreichen versucht hat, hat sie erreicht. Nichts von dem ist gültig geworden. […] Das Wissen um die Dis-kontinuität, Heterogenität und Vielgestaltigkeit der Prämissen der gesellschaftlichen Verhältnisse zwingt eigentlich zum offenen, heterodoxen wissenschaftlichen Um-gang, in dem auch die intuitive Interpretation Platz hat. […] Es geht um den Erwerb der kritischen, subjektiven und autonomen Interpretationsfähigkeit des einzelnen im Leben mit Computer und Medien. (Bauer 1997: 8)
Thomas Bauer vollführt hier eine ähnliche Volte wie Maresch: Worauf zielt „auf-klärerische“ Medienpädagogik denn sonst ab als auf den Erwerb kritischer, subjek-tiver und autonomer Interpretationsfähigkeit des einzelnen im Leben mit Computer und Medien ?
Die Muster der Kommunikation, in denen man sich gibt und nimmt, geben Auskunft über die Muster der Gesellschaft, mit der man lebt. Erfährt man dies und will man daran etwas ändern, muss man die Kommunikation ändern, mit der man sich ver-gesellschaftet. So findet man sich in einer Sollbruchstelle. (Bauer 2002: 28)
Medienpädagogik ist in Bauers Verständnis so etwas wie eine kommunikative/ kom-munikationsgesellschaftliche Wunde, ein Stigma (Bauer hat bezeichnenderweise auch Theologie studiert – wie der Stifter der Medienkompetenz, Dieter Baacke, auch). Sie trägt den Bruch in sich, sie ist der Bindestrich, der als erstes bricht, wenn kommunikative Bindungen sich verändern. Insofern misst Bauer der Medienpäda-gogik seismographische und Perspektiven aufschließende Qualitäten zu, ohne dass sie wirklich etwas zu sagen hätte – sie ist eine symptomatische kommunikative Störung, also nicht einmal eine Zweitwissenschaft; sie irritiert höchstens (was ja auch nicht wenig wäre: Desautomatisierung durch Schock? Medienpädagogik als wissenschaftliches Neo- Dada ?; vgl. Kirschenmann 2001).
1.3.2 Kausalitätsmythen
Die genannten Autoren attestieren der Medienpädagogik eine gewisse, wenn auch nicht unsympathische Inkompetenz im Rahmen der Wissenschaftssystematik – gleichsam als Kompensation für ihre Konjunktur und öffentliche Attraktivität, die sie genießt (Stichwort Medienkompetenz). Trotzdem wird ihre Integrität nicht angezwei-felt, da sie ja gleichermaßen als Satellit von Pädagogik/Erziehungswissenschaften bzw. Kommunikations-/Medienwissenschaften situiert wird – solange die Medien-pädagogik von der Basis aus gesteuert wird, liefert sie wertvolle Informationen. Wehe aber, der Satellit verlässt selbstreflexiv die vorgegebene Umlaufbahn und liefert Daten, die nicht ins Konzept passen…
Wenn Hans-Dieter Kübler etwa den Beitrag der Medienpädagogik für die Kommuni-kations- und Medienwissenschaften darin sieht, dass sie die letzteren „durch ihren prägnanten Anspruch, das Subjekt in all seiner Individualität und Kontingenz vor-rangig auch im Rezipienten zu sehen und im Medienprozess ernst zu nehmen“ (Kübler 2002 b: 189), nachdrücklich beeinflusst habe, so ist dies eine Meldung von der pädagogischen „Bodenstation“, die über den medienpädagogischen Satelliten an die Kommunikationswissenschaften adressiert ist. Rudolf Maresch’ Kritik wiederum formuliert im Grunde dessen überzogenes Glaubensbekenntnis Die Medien machen die Menschen, das in dieser Form inzwischen ziemlich dümmlich wirkt und dem Phantasma eines technologischen Subjekts der Geschichte (Schröter o.J.) nachjagt. Wäre es etwas weniger bestimmt – Medien machen Menschen –, wäre es mögli-cherweise konsenstauglich.
Kurzum: Es geht offensichtlich um konfligierende Deutungsmuster, um verschiedene story lines (vgl. Keller 2001: 134), was Wirkungen (und damit Wirkmächtigkeit oder einfach Macht) der Medien einerseits, der Pädagogik andererseits anbelangt, es geht um das Wissen der unterschiedlichen Disziplinen (bzw. um ihre Wissenschaftlich-keit) und es geht um Subjekt positionierungen (der RezipientInnen, der Medien, der ForscherInnen) - also um jene interagierenden Themen, die auch für Michel Fou-caults Werk zentral sind.
Simola/Heikkinen/Silvonen zeichnen ein verschachteltes Dreieck als ein nicht nur für die erziehungswissenhschaftliche Forschung anwendbares Extrakt aus Foucaults Werk, welches nicht auf eine „große Theorie“ abzielt, sondern als „Katalog von Möglichkeiten“, als „heuristisches Werkzeug“, als „meta-methodologische Vorrich-tung“ fungieren soll (Simola u.a. 1998: 71). Dieses Dreieck gibt hier eine zweite heuristische Folie ab.
„Macht“
(WARUM)
(Simola u.a. 1998: 70; Übersetzung T.H.).
Einerseits sind die angerissenen interdisziplinären Kontroversen zwischen Medien-philosophie, Medien- und Kommunikationswissenschaft und Medienpädagogik um Zuständigkeiten und Kausalattribuierungen (Ohn-/Mächtigkeit der Medien, der Wissenschaften, der Rezipienten) als Machtspiel innerhalb des Wissenschaftsdis-positivs lesbar, andererseits sind sie ein Reflex und gleichzeitig Selbstdarstellung in Richtung auf ihr Außen und dessen (ökonomische) Vorgaben. In diesem Sinne hat Frank-Olaf Radtke unlängst die Erziehungswissenschaft der OECD als den Strate-gien der Ökonomisierung und Technologisierung der Erziehung verpflichtet analy-siert; diese Strategien beruhen demnach auf „starken Kausalitätsannahmen“, d.h. „Staat und Wirtschaft sehen in der Erziehung ein zwar dringend zu optimierendes, aber grundsätzlich funktionales Instrument, wenn nur die Organisationen der Er-ziehung effektiv gesteuert und Individuen zuverlässig formiert werden können“ (Radtke 2003: 118). Die laut Radtke von den OECD-Bildungspolitikern geforderte (und geförderte) Forschung hat „belastbare, d.h. auf mechanische Kausalität redu-zierte Befunde“ über den „Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen in der Er-ziehung und im Verhältnis von Erziehung und Wirtschaft“ zu liefern (ebd.: 119).
„Intellektuelle Problematisierungen der Handlungsprämissen“, welche die „Voraus-setzung für eine sinnvolle Praxis erst schaffen könnten“, sind dagegen nicht gefragt (ebd.). Erhaltens- und förderungswürdig seien nur noch Vorhaben, „wenn sie den Nachweis ihrer direkten Nützlichkeit für die Schul- und Unterrichtspraxis und die Lehrerausbildung führen können – oder sie laufen aus“ (ebd.: 119 f): „Den Natur-wissenschaften würde man so etwas wohl kaum zumuten“.
Roswitha Lehmann-Rommel (2004: 277 f) kommt zu einem ähnlichen Ergebnis wie Radtke, wenn sie feststellt, dass die im Schulentwicklungskontext wirksame Ratio-nalitätsform im Bann von rationalistischen, mechanischen Modellen stehe, was mo-nokausale Zuschreibungen und vereinfachende Schlussfolgerungen begünstige.
Die Entwertung der Geistes- und Kulturwissenschaften zugunsten der Naturwissen-schaften im Namen der Nützlichkeit und mit Hilfe eines überholten und unterkom-plexen Kausalitätsverständnisses, auf die Radtke anspielt, wurde unlängst in der ZEIT (Nr. 18 – 21/2004) wieder einmal debattiert. Der Soziologe Armin Nassehi zeichnet darin ein (vermutlich ironisch konterkariert) machtvolles Bild der Sozial- und Kulturwissenschaften, das die polit-ökonomischen Nützlichkeitserwägungen vorderhand mit ihrer Technologie- und Effizienzrhetorik ernst nimmt; es gebe keine „produktnähere“ Form von Wissenschaft als die Kultur- und Sozialwissenschaften, denn:
Sie sind die eigentlichen Technologiezentren der modernen Welt. Sie produzieren nichts Geringeres als jene Denk- und Erfahrungschiffren, mit denen wir uns in un-serer Welt bewegen. Gäbe es die Idee des selbstverantwortlichen, leistungsstarken und mit sich identischen, zugleich aber revisionsfähigen Subjekts ohne seine kultur-wissenschaftliche Erfindung? […] Könnten wir wirklich als Individuen „handeln“, würden wir nicht mit jener Idee versorgt, dass alles, was im sozialen Raum ge-schieht, auf die Intentionen von Akteuren zurückgeht? […] Gäbe es Bildung und Ausbildung ohne die Erfindung der menschlichen Bildsamkeit? […] Ist nicht das Beobachtungsschema „Kultur“ das erfolgreichste Technologicum, das in den letzten zwei Jahrhunderten produziert wurde? Kann es sich nicht gar mit der Kernspaltung messen, oder ist es nicht wenigstens so wirkmächtig wie das Klonen? (Nassehi 2004: 38)
Nassehis Fragenkatalog wurde auf die hier thematisch relevanten Fragen gekürzt. Der Autor konzipiert darin die Kultur- und Sozialwissenschaften als sehr gefährli-che, daher notwendig verantwortungslose, weil auf Wahrheits er findung verpflichtete Wissenschaften – als anthropologische Hexenküchen gleichsam, deren Ergebnisse (in Analogie zu den Physikern) eben nur Technologien sind, „deren politische, öko-nomische und pädagogische Umsetzung ebenso zerstörerische wie aufbauende Kraft freisetzen kann“ (ebd.).
Die Idee des selbstverantwortlichen, leistungsstarken und mit sich identischen, zu-gleich aber revisionsfähigen Subjekts als strategische Grundfigur neoliberaler Gou-vernementalität wird somit als „produktnahe“ Erfindung der Kulturwissenschaften hochstilisiert, Haftung wird aber keine übernommen. Das zweifelhafte Angebot der Kulturwissenschaften an die ökonomischen, politischen und pädagogischen „Um-setzer“ solcher Ideen besteht im Versprechen, auch in Zukunft derartige instrumen-talisierbare Anthropologismen für Technologien der Macht zu liefern, welche wahr-heitstechnologischer Unterfütterung bedürfen.
Die Medienpädagogik wäre in dieser Hinsicht eine doppelt „gefährliche“ Wissen-schaft, insofern sie nicht nur solche Antrhopologismen mit konstruiert, sondern sich auch noch um deren Implementierung in den Köpfen der Menschen und in Institutio-nen bemüht.
Kann man bei Nassehi zumindest noch ironische Marker finden, die für eine Kari-katur sprechen, so halten Heiner Keupp u.a. nach dem Zusammenbruch der „großen Erzählungen“ große Aufgaben auch für die Medienpädagogik bereit:
[…] Menschen im Bildungsbereich, im Kultursektor und in der Medienbranche. Das sind die heutigen Deutungseliten, die Inhalte, neue Symbole und Metaerzählungen in Kurs setzen. Metaerzählungen und kollektive Identitäten waren von jeher Konstrukte von Intellektuellen und Deutungseliten […]. Das stellt sich in der spätmodernen Ge-sellschaft ebenso dar, nur sitzen heute die wirkmächtigen Erzähler – um es metapho-risch zu sagen – nicht mehr auf einem Lehrstuhl, sondern auf einem Regiestuhl. Um adäquate Metaerzählungen zu befördern, müßten sich die Professionellen in Kultur, in den Medien und in der Bildung stärker zu ihrer Verantwortung als Kulturbildner bekennen. […] Es müssen neue Erzählungen erzählt werden, neue Erzählungen für eine inzwischen neu formierte soziale Welt. (Keupp u.a. 1999: 293)
Medienkompetenz als eine Metakompetenz wird im Folgenden als Baustein solcher Metaerzählungsversuche analysiert – was jedoch nicht bedeutet, dass die hier vor-geschlagene Perspektive einer die Gesellschaft programmierenden Software-Elite geteilt wird. Denn, um Vilém Flusser zu zitieren, welcher m.E. zu Unrecht entweder als Scharlatan geprügelt wird oder aber als kommunikologischer Säulenheiliger her-halten muss:
Ein „Operator“ (oder Apparatschik) ist ein „Mensch“ in einem neuen, posthistori-schen Sinn. Weder ist er „tätig“ (ein Handelnder, ein „Held“), noch ist er „leidend“ (ein Behandelter, ein „Dulder“), sondern er funktioniert in Funktionen von Funktio-nen, die in seiner Funktion funktionieren. Dieses nach-geschichtliche Dasein, dieses Dasein nicht nur jenseits von gut und böse, wahr und falsch, schön und häßlich, son-dern überhaupt jenseits der Kategorie aktiv-passiv, umgibt uns seit Jahrzehnten von allen Seiten (Beispiele: Eichmann, Manager, Parteisekretär, General, kurz: „Funktio-när“) [...]. (Flusser 1998: 151)
Zwischen den extremen Sichtweisen der Medienpädagogik als stammelndes Symp-tom an der Fuge der Lebenswelt-System-Architektonik einerseits und der geniehaf-ten Neuverfugung der gesellschaftlichen Architektur, zwischen diesen „Alles-oder-Nichts-Argumentationen“ hinsichtlich der Medienpädagogik, zwischen „virtuell“ und „virtuos“: Die textuelle Batterie ist geladen und hinreichend polarisert:
Wie für die Erziehungswissenschaft und Pädagogik insgesamt gilt für die Medien-pädagogik erst recht: sie wird einerseits gerne maßlos überschätzt und andererseits nicht selten unterschätzt, gelegentlich auch für bedeutungslos erklärt. Beide Extre-me verkennen ihrer Möglichkeitsräume […]. (Hug 2002: 195)
2. Kritik und / als Methode
Überall, wo man nach der linken Depression der frühen 90-er Jahre den Faden einer ma-terialistischen Kritik der Gegenwart wieder aufgreift, wird Foucault als theoretischer Anspielpartner in Szene gesetzt.
(Brieler 2004)
2.1 Harald Gapkis Wissenssoziologische Medienkompetenz-
Diskursanalyse
Harald Gapski hat bereits eine Diskursanalyse zur Medienkompetenz durchgeführt. Seine methodologischen Vorbemerkungen dazu füllen jedoch nicht einmal eine Buchseite, da er darauf verzichtet, einer theoriegeschichtlichen Verästelung zu fol-gen (vgl. Gapski 2001 b: 30 f).
Im Rahmen einer Abhandlung über Medienkompetenz, die ja auch so etwas wie kri-tisches Diskursbewusstsein (vgl. Fairclough 2001) einschließt, verwundert eine sol-che en passant -Behandlung der Methodik. Es mag sein, dass sich Gapski angesichts der labyrinthischen Selbstbezüglichkeiten, in die ihn die Beschäftigung mit Medien-kompetenz stürzt, eine Methodendiskussion ersparen wollte:
Medienkompetenz als Forschungsgegenstand führt in eigentümlicher Weise zu einer selbstbezüglichen Erkenntnisstruktur, denn auch die Schrift ist ein Medium, dessen Nutzung (Sprach-, Schreib- und Lese-)Kompetenzen voraussetzt. Angefangen bei der medialen Darstellung des Themas (darf sie überhaupt exklusiv in Schriftform er-folgen?), über die medientheoretische Reflexionsebene, Medienkompetenz als „ei-nen sich selbst beschreibenden Gegenstand“ auszuweisen, bis hin zur mediengebun-denen Thematisierung und Förderung von Medienkompetenz, verwickelt sich die Behandlung dieses Themas zwangsläufig in selbstbezügliche und verschachtelte Be-schreibungsverhältnisse. (Gapski 2001 b: 22).
Medienkompetenz jedenfalls ist ein heterogenes Konstrukt. Die einzige Gemeinsam-keit der verschiedenen Medienkompetenz -Diskurse (medientechnisch, biologistisch, linguistisch, soziologisch, medienpädagogisch, institutionell im Bildungsbereich, medienwirtschaftlich, medienpolitisch, medienrechtlich, medienethisch) ist nach Gapskis Medienkompetenz -Diskursanalyse eine Verschiebung der Fremdsteue-rung zu Prinzipien der Selbstorganisation und Selbstverantwortung (ebd.: 156). An die Stelle von konkreten Ziel- und Steuerungsvorgaben trete verstärkt die Gestal-tung von Rahmenbedingungen und „Umwelten“ im jeweiligen pädagogischen, wirtschaftlichen oder medienrechtlichen Zusammenhang: „Betrifft diese Verlagerung allein das Individuum, so liegt der Verdacht einer Steuerungskrise auf systemisch-institutioneller Ebene nahe“ (ebd.).
Auch die inhaltsanalytische Aufbereitung von 104 Definitionsversuchen der Medien-kompetenz bringt ein ähnliches Ergebnis; es herrsche „eine subjekt- und individuen-gebundene Auffassung vor, die Medienkompetenz als ein[en] Komplex verschiede-ner kognitiver Fähig- und Fertigkeiten in Bezug auf den Umgang mit Medien be-schreibt“ (ebd.: 193).
Gapskis Arbeit der Bestandsaufnahme ist verdienstvoll; das diskurs- und inhaltsana-lytische Bild, das er entwirft, ändert sich kaum, wenn man die Medienkompetenz-definitionen der Jahre 2000 ff mit einbezieht.
Ich gehe davon aus, dass Harald Gapski „sauber“ gearbeitet hat, d.h. seine Diskurs- und Inhaltsanalyse methodisch nach den Regeln der „Kunst“/ techne („objektive So-zialwissenschaft“) durchgeführt hat, auch wenn seine Arbeit den Eindruck vermit-telt, hier werde – publizistikwissenschaftlich gesprochen – ein Bericht mit dem Kommentar synchronisiert.
Denn die Subjektzentrierung der Medienkompetenzkonstrukte und -definitionen ist für ihn willkommener Anlass, den Ball gleichsam wieder zurück zu spielen: Nicht nur die Individuen müssen medienkompetent werden, sondern auch Organisationen und ganze Gesellschaften; er plädiert für die Soziologisierung und eine Depädagogi-sierung (vgl. Gapski 2003) des Medienkompetenzkonstruktes, wobei er unter Sozio-logisierung die Luhmannsche Systemtheorie versteht, welche mit Subjekten ohnehin wenig anfangen kann.
Somit versucht Gapski eine Beobachterperspektive zweiter Ordnung für den analy-sierten Diskurs handhabbar zu machen, d.h. die Beobachterposition zu verlassen und in der ersten Ordnung „fruchtbar“ zu werden. Das nüchterne Fazit allerdings lautet:
Zwar ist der universalistische Anspruch systemtheoretischer Beschreibungen auf die breite aktuelle Fundierung des Medienkompetenz-Begriffs projizierbar, das abstrakte systemtheoretische Sprachspiel jedoch bewirkt mitunter eine diskursive Isolation und handlungspraktische Entfremdung. (Gapski 2001 b: 241)
– also genau das, was Medienkompetenz programmatisch nicht bewirken soll.
Harald Gapski bezieht sich in seinen kurzen diskursanalytischen Vorüberlegungen auf Reiner Keller, dessen Konzeption einer Wissenssoziologischen Diskursanalyse sich für ein semantisches Feld wie die Medienkompetenz (als ursprünglich fachspe-zifischer Terminus, der inzwischen zum Plastikwort mutiert ist) als das „Forschungs-programm“ bzw. die „Forschungsperspektive“ (Keller 2001: 127) schlechthin an-bietet, zumal sie auf der hermeneutischen Wissenssoziologie basiert, diese aber, gestützt auf Michel Foucault, auf die institutionelle Wissensproduktion ausweitet.
Während Keller bei Berger/Luckmann (2004) einen anti-intellektuellen Impetus ortet, der zu einer Konzentration auf Prozesse sozialer und interaktiver Konstruk-tion, auf gesellschaftliche Objektivierung und sozialisatorische Aneignung basaler Wissensbestände aus der Erfahrungsperspektive einzelner Gesellschaftsmitglieder führe und somit „kleine Lebenswelten“ im Hinblick auf Verstehens- und Interpre-tationsleistungen der Akteure unter Aussparung von Formen kollektiver Wissens-produktion und -vermittlung untersuche (vgl. Keller 2001: 120 f), also in erster Linie an Mikroanalysen des Wissens interessiert sei (vgl. Keller 2004: 58), so moniert er an Foucaults Ansatz, dass dieser zu sehr die „Emergenz, Autonomie und Eigenwil-ligkeiten der Wissensordnungen oder -strukturen“ akzentuiere und sich polemisch gegen die „Hermeneutik als endlose, unkontrollierbare Sinnauslegung und vergebli-che, eigene Vor-Urteile projizierende Suche nach Tiefenstrukturen“ (Keller 2001: 124) abgrenze:
Unser Weltwissen ist nicht auf ein angeborenes, kognitives Kategoriensystem rück-führbar, sondern auf gesellschaftlich hergestellte symbolische Systeme und Ordnun-gen, die in und durch Diskurse produziert werden. Die Wissenssoziologische Dis-kursanalyse untersucht diese gesellschaftlichen Praktiken und Prozesse der kommu-nikativen Konstruktion, Stabilisierung und Transformation symbolischer Ordnungen sowie deren Folgen: Gesetze, Statistiken, Klassifikationen, Techniken, Dinge oder Praktiken bspw. sind in diesem Sinne Effekte von Diskursen und ‚Voraus’-Setzun-gen neuer Diskurse. Der Wissenssoziologischen Diskursanlyse geht es dann darum, Prozesse der sozialen Konstruktion, Objektivation, Kommunikation und Legitima-tion von Sinn-, d.h. Deutungs- und Handlungsstrukturen auf der Ebene von Institu-tionen, Organisationen bzw. sozialen (kollektiven) Akteuren zu rekonstruieren und die gesellschaftliche Wirkung dieser Prozesse zu analysieren. (Keller 2004: 57)
Kellers Ansatz versteht sich allerdings nicht explizit als engagierte Forschung mit emanzipatorischem Anspruch, die in die Praxis und die sozialen Beziehungen ein-greifen will (ein solches Selbstverständnis hat etwa die Critical Discourse Analysis um Ruth Wodak und Norman Fairclough – vgl. Keller 2004: 26 ff)
Keller scheint es dagegen primär darum zu gehen, die bzw. sein Konzept einer Wis-senssoziologischen Diskursanalyse als qualitative sozialwissenschaftliche Methode zu etablieren und sie in die Sozialwissenschaftliche Hermeneutik zu integrieren (vgl. Keller 2004: 61).
Wenn Keller seinen Überblick über die Diskursforschung bzw. die Wissenssoziolo-gische Diskursanalyse resümiert, bleibt nicht viel übrig: die Feinanalyse ist mehr oder weniger eine Beschäftigungstherapie, ein Gesamtergebnis kann kaum reliabel und valide – da eben qualitativ – hervorgebracht werden, Interpretation wird ledig-lich als Aufgabe skizziert, dafür wird die Präsentation als Medienkompetenz -Problem der Diskursforschung wie der qualitativen Sozialforschung generell thematisiert: Es gehe um Credibility, also um „ erfolgreich vermittelte Glaubwürdigkeit und Aufrich-tigkeit der ForscherInnen“, welche „die Rezeption einer Untersuchung beeinflussen“ (Keller 2004:113; Hervorh. im Original) soll.
Obwohl Kellers Konzeption einer Wissenssoziologischen Diskursanalyse in ihrem Begründungszusammenhang mit einem Bein auf Foucaults Machtanalytik fußt, fehlt diese Referenz in der interpretativen Rahmung. Was bleibt, ist das Angebot einer qualitativen, diskursanalytischen Strategie der Reduktion von Textkomplexität (Kel-ler 2001: 139) als Antwort auf die Konjunktur der Diskursforschung, welche der ex-ponentiellen Zunahme der Wissensproduktion (Sichtwort Wissensgesellschaft) sowie der „enorme[n ]Verbreitung von professionalisierten Kommunikationsprozessen und -technologien, d.h. der strategisch-instrumentellen Bearbeitung der Sprachpraxis in den verschiedenen gesellschaftlichen Handlungsfeldern“ (Keller 2004: 9) geschuldet sein soll.
In diesem Licht – der Entkontextualisierung einer Methode nämlich, die sich be-scheiden als Forschungsprogramm gibt, aber eine diskursanalytische Komplexitäts-reduktion einer durch Informations- und Wissensüberproduktion charaktersierten Unübersichtlichkeit des gegenwärtigen Diskursdschungels verspricht – erscheint Harald Gapskis oberflächlicher methodischer Rekurs auf die Wissenssoziologische Diskursanalyse den Intentionen Kellers zu entsprechen: „Die Methode, der Weg, wird zum Symbol für Wissenschaftlichkeit“ (Merkens 2003: 51). Gerade die von Keller genannten professionalisierten Kommunikationsprozesse beziehen ihren An-spruch u.a. aus ihrer Berufung auf sozialwissenschaftliche Methoden der Komplexi-tätsreduktion – tatsächlich funktionieren sie aber als Komplexitätsgeneratoren, die sich gleichzeitig als Vehikel zu Lösungen jener Probleme gerieren, die sie (mit)ver-ursachen.
Kurzum: Gapski rekurriert adäquat auf die Wissenssoziologische Diskurskursana-lyse, nämlich kurz – als wäre sie eine verbürgte Methode, die keiner weiteren Dis-kussion bedarf –, wobei er an deren Symbol (isierung) für Wissenschaftlickeit mit-wirkt, indem er sie einfach in Betrieb nimmt, ohne die methodologischen Implika-tionen zu reflektieren. Bei all den Selbstbezüglichkeitsfallen der Medienkompetenz braucht es oder er offensichtlich zumindest ein methodologisch nicht hinterfragtes Standbein, selbst wenn dieses – prima vista – eine Prothese ist.
Wäre die Wissenssoziologische Diskursanlyse demnach tatsächlich nur eine Art Dienstleistung akademischer Wissens- und Informationsmanager an und in der Wissensgesellschaft ?
2.2 Pädagogik, Kritik und Gouvernementalität
Ihre ursprünglich kritischeAufgabe [die der Erziehungswissenschaften bzw. der Informa-tionspädagogik; T.H.] wandelt sich in eine genealogische, die nach Zusammenhängen sucht, ohne sich selbst immer gleich be-troffen fühlen zu müssen, d.h. kritisch Stel-lung zu beziehen – eine Angelegenheit, die in der fabelhaft gewordenen einstigen wahren Welt nicht mehr besonders sinnvoll er-scheint, höchstens noch von der vergange-nen Epoche der Ideologiekritik kündet.
(Schönherr-Mann 1998: 47 f)
Die vorliegende Arbeit setzt da an, wo Harald Gapski die Systemtheorie als Lösung einsetzen will, nämlich nach der Bestandsaufnahme des Medienkompetenzdiskurses. Die von ihm konstatierte Verschiebung der Fremdsteuerung zu Prinzipien der Selbst-organisation und Selbstverantwortung bei gleichzeitiger Subjektzentrierung legt nicht notwendigerweise den Verdacht einer Steuerungskrise auf systemisch-institu-tioneller Ebene nahe. Im Rahmen des Gouvernemenatlitätsansatzes wird die hier am Beispiel der Medienkompetenz rekonstruierte Verschiebung nämlich bereits als Lö-sung, genauer als eine neue Form der Regierung, als neoliberale Gouvernementa-lität beschrieben.
Mit der von Gapsiki konstatierten Verschiebung von der Fremdsteuerung zur Selbst-steuerung korrespondiert dabei die für den Gouvernementalitätsansatz zentrale, in Gilles Deleuzes’ Essay Postskriptum über die Kontrollgesellschaften (1990) behaup-tete Verschiebung von der Disziplin zur Kontrolle:
Disziplin und Kontrolle werden zu Chiffren zweier Paradigmen, die verschiedene gesellschaftliche Bereiche durchkreuzen. Sie markieren einen Umbruch der Ratio-nalität, den Deleuze etwa bezüglich des Strafvollzugs, der Bildung und der Arbeit andeutet. In letzter Konsequenz verweist die Rede von Disziplin und Kontrolle auf eine epistemische Schwelle, die sich über die modernen Trennungslinien zwischen dem Ökonomischen, dem Juridischen, der Wissenschaft und der Politik hinweg voll-zieht; überall zeichnen sich die Konturen eines neuen Systems der Akzeptabilität ab. (Opitz 2004: 89)
Ein Symptom dieser Verschiebung ist, wie bereits angedeutet, die Umcodierung, die Reterritorialisierung, der Frontenwechsel, die Enthebung ehemals gesellschaftskri-tischer Vokabulare – wie Autonomie, Selbstbestimmung, Kritik usw. – aus ihren Kon-texten (vgl. Opitz 2004: 112; Merkens 2002: 8; Masschelein 2003: 129 f) und ihre Etablierung als mobilisierende Metaphern des neoliberalen Aufbruchs (Merkens 2002: 8).
Dieses Vokabular war wesentlich auch das der kritischen Erziehungswissenschaft und verschiedener kritischer Pädagogiken, weshalb Thomas Höhnes Vorschlag, die Pädagogisierung bzw. Durchsetzung einer spezifischen pädagogischen Form als Komplementärbewegung zur Gouvernementalisierung im Sinne einer Ökonomisie-rung des Sozialen zu sehen, durchaus plausibel ist. Zumindest semantisch kann so von einer unfreiwilligen ‚Mittäterschaft’ der Kritik bzw. der kritischen Pädagogik (Münte-Goussar 2001: 18) die Rede sein.
Die verdrehte Situation, die durch die Um- und Recodierung emanzipatorischer Ziele in neoliberale Techniken des Regierens enstanden ist, verlangt tatsächlich die Über-arbeitung ganzer theoretischer Vokabulare, die „lange Zeit ein angemessenes Ver-ständnis sozialer Prozesse ermöglichten und wirksame Kriterien der Kritik bereit-stellten“ (Opitz 2004: 112). Euler konkretisiert dies für die Pädagogik:
Die Pädagogik befindet sich gegenwärtig faktisch im Zugriff verschärfter Vergesell-schaftung. In ihrer Theorieproduktion zeigt sich das einerseits in ultraangepassten neoliberalen Theoremen (im Kern die konstruktivistische Selbststeuerungssemantik), andererseits aber auch in radikal selbstkritischen Entwürfen unterschiedlichster Art. […] Die Revision der Kritik wirft angesichts neoliberaler Ökonomisierung und einer forcierten Technologisierung der Selbst- und Weltbeziehungen die Frage nach neuen Formen sozialkritischer Pädagogik auf, die den Ansprüchen der radikalisierten Sub-jekt- und Identitätskritik Stand halten muß, ohne einer unkritischen Allgemeinver-gessenheit zu dienen […]. (Euler 2004: 22 f)
Die Kritik selbst ist in diesem Wandel zum Plastikwort geworden, für Masschelein (2003 a: 130) ist sie inzwischen gar „der am meisten verbreitete aller Allgemein-plätze“, weshalb es darum gehe, Kritik sowie eine kritische Erziehungswissenschaft aufs Neue zu denken – in einer Zeit, in der „Subversion der Ordnung wesentlicher Teil ihrer Optimierung“ (ebd.: 139) und in der Kritik selbst zum „integralen Bestand-teil“ einer gesellschaftlichen Modernisierung geworden ist, welche die „Abweichung von der Norm propagiert“ und damit selbst zur Norm wird (Bröckling u.a. 2004: 14). Aufgrund eines solchen Konformismus’ des Andersseins hat Norbert Bolz bereits das „Ende des Kritik“ ausgerufen (Bolz 1999).
Theoretischer Anspielpartner (Brieler 2004) einer solchen Kritik der Pädagogik bzw. einer Pädagogik als Kritik (Masschelein u.a. 2004) ist zunehmend Michel Foucault. Während dessen Werke von der Erziehungswissenschaft und den Humanwissen-schaften lange als genereller Affront wahrgenommen wurden, wird Foucault nun als ernsthafte Herausforderung begriffen, „die geeignet ist, einen überfälligen Prozess der Selbstkritik auszulösen und neue Reflexionshorizonte zu stimulieren“ (Ricken/ Rieger-Ladich 2004: 8). Insbesondere die Forschungsrichtung der governmentality studies, die quer zu thematischen und disziplinären Grenzziehungen liegt (Lemke u.a. 2000: 7), verspricht nicht- naive (d.h. post- ideologiekritische) Perspektiven für das Neudenken von Kritik jeneits von dichtotomen Beschreibungsmustern (wie Auto-nomie-Heteronomie, Mündigkeit-Unmündigkeit, Selbstbestimmung-Fremdbestim-mung, Freiheit-Macht):
[…] während einerseits vielerorts das neoliberale ‚Credo’ bloß pädagogisch wieder-holt wird, findet man sich anderseits unter der Hand in alten ideologiekritischen Fahrwassern wieder, die – entlang der traditionellen Opposition von Ökonomisie-rung und Humanisierung – auf einen ‚Wahren Kern’ oder das ‚Eigentliche’ der Bil-dung zurückzugreifen suchen und sich so in essentialistischen Fahrwassern und po-larisierenden Diskursen bewegen wie verhaken, ohne dabei in wissenschaftlichen Theorieentwicklungen noch eine Basis zu haben. (Lehmann-Rommel 2004: 262)
2.3 Diskursanalyse und/als Ideologiekritik
Andreas Hirseland und Werner Schneider schlagen im Anschluss an Michel Foucault eine diskurstheoretische Reformulierung des Ideologiebegriffs vor, die für die vor-liegende Arbeit brauchbar erscheint. Unter Ideologie verstehen sie den Versuch, die zwangsläufig partikulare Perspektive jeder Diskursformation mit dem (hegemonia-len) Anspruch zu versehen, einen totalisierenden und universalisierenden Sinnhori-zont aufzuspannen, eine Darstellung zu liefern, wie die Welt vorgeblich ‚wirklich’ so und nicht anders ist (Hirseland/Schneider 2001: 392). Das Ideologische besteht für Hirseland und Schneider demnach darin, eine vorhandene gesellschaftliche Situation „in einer ‚mythischen’ Weise lesbar zu machen“; als ein Beispiel dafür führen die Autoren den Versuch des Neoliberalismus an, „wahrgenommene gesellschaftliche Probleme auf Störungen der prästabilisierten Harmonie ‚freier Märkte’ durch ‚Re-gierungsversagen’ und ‚Überregulierung’ des öffentlichen und privaten Sektors zu-rückzuführen“ (ebd.).
Nach Sven Opitz führen die Begriffe der Ideologie und des Dikurses folgende Im-plikationen und Konsequenzen mit sich (tabellarisches Extrakt aus Opitz 2004: 43 ff):
Ideologie(kritik)
Diskurs(analyse)
Annahme einer wahren Realität, einer wahren Subjektivität, eines wahren Wissens „hinter“ der Ideologie.
Die Wahrheit ist von dieser Welt; Analytik von Wahrheitswirkungen innerhalb von Diskursen, die in sich weder wahr noch falsch sind.
Den Subjekten wird die Fähigkeit abge-sprochen, ihre Situation angemessen wahrzunehmen (Diagnose der Entfrem-dung).
Der Diskurs eröffnet einen Raum diffe-renzierter Positionen und Funktionen, die das Subjekt zu bestimmten Bedingungen einnehmen muss (produktiver Macht-begriff).
Dualismus von vernünftiger Wahrheit und instrumenteller Macht: Konstruktion einer von Machtmechanismen durch-drungenen Gesellschaft, Verlegung der Wahrheit in ein mythisches gesellschaft-liches Jenseits.
Der Diskurs wird nicht von einem mächtigen Subjekt eingesetzt oder instrumentalisiert.
In ähnlicher Weise fasst David Owen den Unterschied zwischen Ideologiekritik und der Genealogie als Praxis kritischer Reflexion mithilfe der Differenz zwischen ideologischer Gefangenschaft und Aspektbefangenheit.
Ideologische Gefangenschaft als „falsches Bewusstsein“ impliziert, dass bestehende Überzeugungen einerseits falsch sind und andererseits ein Weltbild konstituieren, das bestimmte repressive soziale Institutionen legitmiert (vgl. Owen 2003: 124); Ideolo-giekritik ist dann erfolgreich, wenn die ideologisch gefangenen Akteure durch das Initiieren eines Prozesses der Selbstreflexion in die Lage versetzt werden, sich aus dieser Gefangenschaft zu befreien und sich dank dieser Aufklärung auch dazu moti-viert sehen, „an einem Emanzipationsprozeß teilzunehmen, d.h. gegen die in Frage stehende repressive soziale Institution zu kämpfen“ (ebd.: 131).
Die Genealogie als Praxis kritischer Reflexion zielt ebenfalls auf einen Aufklärungs- und Emanzipationsprozess ab, der allerdings nicht mehr auf die Wahrheit/Falschheit unserer Überzeugungen zielt, also an die Freilegung eines Widerspruchs zwischen unseren Überzeugungen und unseren epistemischen Grundsätzen gekoppelt ist:
Insofern Aspektbefangenheit durch die Tatsache gekennzeichnet ist, daß Akteure so über sich nachdenken bzw. sich so zu sich verhalten, daß sie ein gegebenes Bild oder eine gegebene Perspektive als das einzige ihnen verfügbare Bild oder die einzige ihnen offenstehende Perspektive begreifen, verfolgt die Genealogie zunächst das Ziel, die Akteure zu einer Loslösung von ihrer Aspektbefangenheit zu befähigen, indem sie ihnen die Möglichkeit anderer Bilder oder Perspektiven aufzeigt. (Ebd.: 132)
Eine solche Aspektbefangenheit wäre demnach der subjektive Effekt von Ideologien im Sinne Hirseland/Schneiders: Die notwendig partikulare Perspektive einer hege-monialen Diskursformation bewirkt beim Subjekt tendenziell Monoperspektivismus. Entscheidend aus genealogischer Perspektive ist nicht der Umstand, in einem Bild oder einer Perspektive gefangen zu sein, sondern, dass „diese Gefangenschaft uns in den für uns wichtigen Hinsichten daran hindert, uns als Subjekte oder Akteure zu begreifen“ (ebd.: 133). Owen formuliert hier etwas vage bzw. vorsichtig: sich in wichtigen Hinsichten als Subjekte oder Akteure erfahren oder von dem abgeschnitten werden, worum wir uns sorgen und woran wir uns gebunden fühlen (ebd.) – zurecht, denn er formuliert knapp an der Grenze zu einem essentialistischen Verständnis vom Subjekt (das wahre, das eigentliche Ich), welches mit der propagierten Genealogie wenig verträglich ist.
Hirseland/Schneider gehen von den folgenden theoretischen Prämissen für ihre Konzeption einer ideologiekritischen Diskursanalyse aus:
- Eine Welt jenseits gesellschaftlich gegebener Wissensordnungen ist uns nicht zugänglich (epistemologische Grundannahme).
- Subjekte wie Objekte werden durch die entlang sozial konstruierter Regeln der Bedeutungsvermittlung geordnete soziale (diskursive) Praxis erzeugt.
- Ideologie als Konzept schärft den erkenntnis- und herrschaftskriti-schen Blick auf die in Diskursen (auch in wissenschaftlichen) enthal-tenen impliziten Theorien und Annahmen über die ‚wahre Wirklich-keit’, die Durchdringung des Alltäglichen mit diesen Vorstellungen sowie die darauf bezogene Produktion von Subjektpositionen. (Vgl. Hirseland/Schneider 2001: 394)
Methodologisch orientiert sich dieses Konzept von Diskursanalyse als Rekonstruk-tion von Strukturbildungs- und Transformationsprozessen des Sozialen (Subjekte, Objekte, Regel/Praxis) in und durch Diskurse an folgenden Prämissen:
- Kontextualisierung und Historisierung und Kritik durch Kontrastierung
Diskurse und Diskursformationen werden als historisch kontingente, aber hegemoniale Artikulationen von bestimmten Interessen und Be-dürfnissen verstanden, über die Identitäten konstruiert werden:
Weil diese nur über die Konstruktion eines jeweiligen ‚Außen’ zu verstehen sind, das unausgesprochen im Inneren des jeweiligen Dis-kurses operiert, erfordert Diskursanalyse, nicht nur den einzelnen empirischen (Spezial-)Diskurs zu rekonstruieren, der ihren jeweils konkreten Forschungsgegenstand darstellt, sondern diesen in seine historischen und politischen, in Gegendiskursen oder anderen Dis-kursformationen aufscheinenden Kontexte zu setzen. (Ebd.: 395)
In der vorliegenden Arbeit fungiert der Gouvermentalitätsansatz als ein solcher kontrastiver Diskurs zum medienpädagogischen Kompe-tenzdiskurs.
- Offenlegung von Latenz
Diskurse
‚be-deuten’ immer mehr als sie sagen, indem sie sichtbar machen, verbergen sie zugleich. Aufgabe einer ‚ideologiekritischen’ Diskurs-analyse ist es, diese latenten Bezüge offenzulegen. (Ebd.)
- Analyse von Macht als Zeichenpraxis
Die Einbeziehung des Machtaspekts von den Diskursen in die Ana-lyse richtet den Blick darauf, wie durch Zeichenpraxis ‚bedeutungs-volle’ (Subjekt-Subjekt und Subjekt-Objekt) Beziehungen als Machteffekte geschaffen, strukturiert, stabilisiert und/oder trans-formiert werden. (Ebd.)
- De-Ontologisierung und Subjektrekonstruktion
Diskurse liefern eine immer nur perspektivische Repräsentation ihres durch sie konstruierten Gegenstandes, der ‚objektiviert’ und als ‚so und nicht anders’ institutionalisiert werden soll (z.B. durch die ideo-logischen Strategien der Mythifizierung, Naturalisierung, Verdrän-gung des Ausgeschlossenen). Das schließt ein bestimmtes Bild des ‚Subjektes’ ein […]. Diskurse produzieren bestimmte Formen von Subjektpositionierungen, beinhalten schon immer bestimmte Kon-zepte darüber, wie Subjekte zu sein haben, d.h. sie beinhalten einer-seits Identifikationsangebote und Integrationsprozeduren, anderer-seits aber auch Zumutungen an Subjekte und Ausschluß- bzw. Aus-grenzungsprozeduren. (Ebd.: 396)
Hirseland/Schneider bieten keine elaborierte diskursanalytische Methode an, sondern entwerfen vielmehr eine Forschungsperspektive, welche Diskurse nicht hierarchi-siert, sondern im je anderen Diskurs reinterpretiert bzw. rekonstruiert, zumal „alle Diskurse (im Prinzip) ‚ideologisch’“ sind (ebd.: 397). Das heißt, dass auch Hirseland /Schneider sich in einer notwendig ‚ideologischen’ Diskursformation bewegen; als Differenzkriterium zwischen ‚ideologischen’ und ‚theoretisch-wissenschaftlichen’ Diskursen führen sie an, dass sich die erstgenannten durch narrative Verfahren kenn-zeichen, welche semantische Dichotomisierungen erzeugen und in welchen die se-mantischen Verfahren des Aussagesubjekts nicht reflektiert würden, dass sie also letztlich monologisieren (vgl. ebd.), während der ‚wissenschaftlich-theoretische’ Diskurs selbstreflexiv auf Dialogik (vgl. Hug 1999) setze:
Eine Differenz zum Ideologischen kann sich in erster Linie nicht auf der Ebene der ‚Ergebnisse’ als Behauptungen über Wirklichkeit ergeben, sondern nur über die Ebe-ne des Zustandekommens dieser Behauptungen, also über die (Verfahrens-) Form des Diskurses selbst […]: Auch beim theoretischen Diskurs handelt es sich um einen aus dem ideologischen Diskurs hervorgegangenen speziellen Diskurs, der ebenfalls nicht universell ist, sondern als ‚Partialsystem’ kollektive Standpunkte und Interessen aus-drückt, sich hingegen aber durch eine dialogische, reflexiv-kritische Positionierung des Aussagesubjekts zu unterscheiden sucht. (Hirseland/Schneider 2001: 298)
David Owen differenziert innerhalb der Dialogik selbst verschiedene Formen einer Ethik des Dialogs. Während der Dialog in der Ideologiekritik ein Mittel zum Zweck sei, dem Zweck nämlich, der unverzerrten Sichtweise zum Druchbruch zu verhelfen, so sei er im Rahmen der Genealogie ein Mittel, die Aspektbefangenheit im Austausch verschiedener Perspektiven dadurch zu überwinden, dass „uns die Ausschnitthaftig-keit unserer Bilder und der Bilder anderer klar vor Augen tritt“ (Owen 2003: 142):
In einem solchen Dialog der wechselseitigen Erhellung geht es nicht um die Frage „wer hat recht?“ oder „wer ist im Besitz der Wahrheit?“. Die Frage lautet vielmehr: „Was wäre der Unterschied, wenn wir das Problem eher auf diese als auf jene Weise betrachten? [...]“ (Ebd.: 143)
Diese Differenz lässt sich mit Vilém Flusser auch als die zwischen jüdischem und griechischem Dialog fassen: Der griechische Dialog sei von der theoretischen Vision der Wahrheit geleitet, ziele also auf das Erreichen der Weisheit durch Überwindung der Meinungen, der jüdische Dialog hingegen ziele auf die „Erkenntnis des anderen und die Selbsterkenntnis im anderen“ (Flusser 1998: 296).
Sowohl Owen wie Flusser betonen die Komplementarität der beiden Dia -Logiken. Im folgenden Abschnitt entwerfen Jan Masschelein u.a. die Konturen eines alterna-tiven kritischen Ethos’ im Anschluss an Michel Foucualt – alternativ zum Ethos des modernen kritischen Intellektuellen, als dessen „rezenten Ausdruck“ sie Habermas’ Position einer kommunikativen Rationalität betrachten (Masschelein u.a. 2004 a: 19), wiewohl diese der oben geforderten Komplementarität der beiden Dia -Logiken zu-nächst gerecht zu werden scheint, nämlich indem sie Wahrheit in der lebensweltli-chen Kommunikation verortet.
2.4 Eine alternative kritische Subjektivität?
Das selbsterklärte Ziel moderner (Schul-)Bildung ist Freiheit als Autonomie. Aber der ‚Nomos’, der Freiheit gewährleistet, ist nicht länger eine Frage der göttlichen Ordnung, sondern der menschlichen Vernunft. In einem allgemeinen Sinne ist es das Tribunal der Vernunft, das charakterisiert ist durch seine universale und einheits-stiftende Art, die Freiheit gewährleistet. In Beziehung zu diesem Universum der Ver-nunft (gleichgültig, ob es in wissenschaftlichem Wissen, in der Kultur oder in der Gesellschaft verkörpert ist), bleibt der moderne Lehrer oder Pädagoge der Torwäch-ter des Bereichs der Wahrheit. Dazu allerdings ist eine pastorale Haltung erforder-lich, die Schüler als diejenigen betrachtet, die eine bestimmte Disposition brauchen, damit sie autonom werden können, damit sie Wahrheit sprechen können. Sie müssen fähig sein (werden), sich selbst als Subjekte zu betrachten, deren Anerkennung eines Tribunals der Vernunft wie auch als Ergebnis einer ‚aufklärenden’ Rolle von For-schung und Wissen produziert wird. (Masschelein u.a. 2004 a: 8)
Das wichtigste Merkmal des/r modernen kritischen Intellektuellen und damit auch kritischer pädagogischer ForscherInnen ist für Masschelein u.a. die pastorale Hal-tung, die immer auch eine souveräne Haltung ist und die sich in „Akten des Urtei-lens, Türhütens, Aufklärens, Adressierens, Zusprechens ausdrückt“ (ebd.: 21 f). Diese Akte implizieren eine Untwerfung unter ein Tribunal (das göttliche Tribunal, das humane Tribunal, das Tribunal der Vernunft, der Tradition, das kommunikative Tribunal bei Habermas, das ökonomische Tribunal usw., d.h. eine Instanz, die nach Prinzipien und Normen urteilt) als Legitimierung, wobei der Pastor in gewisser Wei-se als Person „abwesend“ ist, insofern er zwar Zugang zur Wahrheit hat, es aber nicht seine Wahrheit ist, sondern die Wahrheit einer rationalen Gemeinschaft oder einer gemeinsamen Tradition (vgl. ebd.: 22):
Der Pastor kann aufklären und ‚empowern’ durch seine pastorale Sorge, die den Zu-gang zum Reich der Wahrheit überwacht, „monitored“ und ermöglicht. Der kritische Forscher beansprucht genau diese ‚Position’. Und obwohl er/sie in neuerer Zeit eine klare Sicht auf das Reich (auf den ‚Nomos’ und das Tribunal) verloren zu haben scheint, möchte sie/er noch immer diese pastorale Position (diese Position des Tor-wächters oder Platzhalters oder Hüters) einnehmen. Dass er/sie über eine Legitima-tions- und Begründungskrise spricht, zeigt an, dass er/sie noch immer auf der Suche nach einem neuen Fundament ist, noch immer auf der Suche nach einer vermitteln-den Position, um pastorale Akte durchführen zu können. Anders gesagt, der Diskurs über Legitimation und Begründung zeigt nicht nur die Suche nach einem Fundament, sondern auch das Bedürfnis, sich anderen gegenüber so zu verhalten, als seien sie eine Herde, die Führung benötigt. (Ebd.)
Der kritische pädagogische Forscher betrachtet also sich selbst als Teil einer ratio-nalen Gemeinschaft, „als Einwohner des Reichs der Wahrheit und betrachtet andere – das Reich der Bürger, ihre Führung, ihr professionelles Wissen und ihre Forschung – so, als bedürften sie einer zusätzlichen, prinzipien- oder kriteriengeleiteten (An)-führung“, und ruft die Bürger dazu auf, „hinter die faktischen Regierungskonfigura-tionen zu schauen und sich selbst nach dem Gesetz der Vernunft zu disziplinieren“ (ebd.: 19).
Ein weiteres Charakteristikum der modernen kritischen Position ist für Masschelein u.a. eine spezifische Art und Weise, die Gegenwart zu ignorieren, indem diese zu ei-nem Ausdruck, einem ‚Beispiel’ oder ‚Fall’ eines unterliegenden Nomos’ wird; es handelt sich um eine Position der Vermittlung zwischen Vergangenheit und Zukunft, eine Positionierung des eigenen Selbst gegenüber der Gegenwart, wobei diese als der Führung bedürftig erscheint (vgl. ebd.: 22).
Die Figur einer alternativen kritischen Forscher-Subjektivität, die Masschelein u.a. in einer Art von ‚Science-fiction’ ausmalen, zeichnet sich denn auch zuerst dadurch aus, dass sie den Komfort einer ‚Position’ verweigert und sich in der Gegenwart und der Aktualität exponiert, wobei sie ihren Ausgangspunkt nicht darin finden soll, was wir als „notwendig oder universal für unsere Gegenwart“ betrachten, sondern darin, „was heute als fundamental und notwendig erfahren wird“ bzw. „was uns heute als Notwendigkeit präsentiert wird“ (ebd.: 23); als „Grenz-Haltung“ geht es dieser kri-tischen Praxis um die „Problematisierung der aktuellen Ordnung und des Sichtbar-machens und Infragestellens der Grenze des strategischen-epistemologischen Feldes verbunden mit einer (nicht-präskriptiven) Erkundung und Erfahrung“ (ebd.: 24). Sie bezieht sich nicht nur auf das Feld des Wissens (epistemologische Ebene), sondern bemüht sich auch um Selbst-Transformation (ethische/existentielle Ebene). Insofern diese Praxis keine neue, bessere Position in der Zukunft verspricht, sondern uns „heraus führt“, soll sie auch eine „E-dukation“ (ebd.: 25) sein. Der/die neue kritische ForscherIn öffnet oder bewacht nicht mehr das Tor zum Reich der Wahrheit, sondern verschickt eine „Einladung zur Erforschung“ (ebd.: 26) der Gegenwart, um sichtbar zu machen, „was bereits in der Gegenwart da ist und uns ermöglicht, die Gegenwart als eine Frage erscheinen zu lassen“ (ebd.: 25); folglich schreibt er/sie „Erfahrungs-bücher“ und keine „Wahrheits- oder Legitimationsbücher“ (ebd.: 26).
Diese sich auf Michel Foucault berufende „Fiktion“ (ebd.: 21) eines alternativen kri-tischen Forschungsethos’ bzw. einer „Grenz-Haltung“ (als eine Haltung von „Rezep-tivität und Empfänglichkeit für die Grenzen der Gegenwart“) erfindet Henry A. Gi-roux’ „Border Pedagogy“as a critical practice which would enable people to exa-mine their own conditions of existence by adopting ‚a position of nonidentity with their own positions’ (Grossberg 1994: 13) neu und bleibt eine ziemlich nebulöse An-gelegenheit. Wahrscheinlich deshalb, weil Masschelein u.a. darin eine notwendig problematische Synthese aus einer gouvernementalen Interpretation der Position des/ der modernen kritischen Intellektuellen/ForscherIn mit dem Selbst-Transformations-pathos der nachfoucaultschen Lebenskunstlesart versuchen (siehe auch Kapitel 4.1). Zudem ist die Konstruktion einer „aktuellen Ordnung“ (gemeint ist wohl eine hege-moniale) ein hinterfragbares Unterfangen, aber innerhalb dieses Entwurfs notwendig, um die anvisierte alternative kritische Subjektivität an deren Grenzen positionieren und so etwas wie Dissidenz inszenieren zu können; diese marginale Positionierung einer alternativen Kritik wäre nicht mehr als eine horizontale Projektion der moder-nen kritischen Position über den Dingen an die Grenzen der jeweils konstruierten „aktuellen Ordnung“ (und gleichzeitig konterdependent dazu).
Ähnlich ergeht es Jenny Lüders, wenn sie versucht, den Bildungsbegriff mit Fou-caultschen Konzepten und Überlegungen zu refomulieren und zu begründen (Lüders 2004). Die Bildungsinstanz bei ihr ist nicht mehr der Subjekt, sondern der Diskurs wird zum „Ort des Bildungsgeschens“:
Jeder Diskurs ist produziert und begrenzt durch ein Netz von Macht und Wissen. Dieser Begrenzeung kann sich nichts entziehen. Es gibt jedoch ereignishafte, dis-kursive Bewegungen, die diese Begrenzungen verschieben und unterlaufen. Diese Bewegungen entsprechen einer indirekten Annäherung an die eigenen Grenzen. In dieser Annäherung wird die Unterwerfung nicht negiert oder aufgehoben. Sie wird stattdessen in subersiver Weise selbst zum Gegenstand des Diskurses: Nämlich in-dem die Unterwerfung verdoppelt (also markiert) wird, und gleichzeitig in dieser Verdoppelung die markierten Grenzen maskiert, zerstreut und deplaziert werden. (Ebd.: 66)
Auch hier geht es also um Grenz-Akte, die nicht neue Wahrheiten oder Subjekte konstruieren, sondern um eine subversive Verdoppelung (Ironie, Maske, Zitat, Para-dox, Widersprüchlichkeit, Inszenierung) als eine zufällige Bewegung der „Brechung, Verschiebung und Öffnung“ des Diskurses in sich selbst (ebd.): Hier ein Karneval der diskursiven Ordnung also (welcher sonst in der Literatur gefeiert wird), während bei Masschelein u.a. kritische Forschung als Karneval der hegemonialen Ordnung inszeniert wird.
Slavoj Zizek, gewiss kein Verächter des diskursiven Karnevals, schlägt eine ganz konkrete Positionierung der Kritik vor, die m.E. dem pädagogisch-forscherischen Ethos eher ansteht als die auf permanente Selbst-Transformation als kritischen Selbstzweck sich kaprizierende und damit „Standpunkte“ denunzierende Vision Masscheleins u.a.; Zizek plädiert für die
[…] Infragestellung der konkret existierenden allgemeinen Ordnung aufgrund ihrer Symptome, derjenigen Teile in ihr also, die, obgleich sie der existierenden universa-len inhärent sind, keinen „eigentlichen Platz“ in ihr finden (so etwa illegale Einwan-derer oder die Obdachlosen in unserer Gesellschaft). Diese Prozedur der Identifika-tion mit dem Symptom ist das exakte und notwendige Komplement zur üblichen ideologiekritischen Bewegung, einen partikularen Inhalt hinter irgend einer abstrak-ten universalen Idee anzunehmen, das heißt, die neutrale Universalität als eine fälschliche zu denunzieren („der ‚Mensch’ der Menschenrechte ist tatsächlich ein weißer männlicher Begüterter…“). Man behauptet so den und identifiziert sich mit dem Punkt der inhärenten Ausnahme/des inhärenten Ausschlusses, mit dem „Abjekt“ der konkreten positiven Ordnung, als dem einzigen Punkt wahrer Universalität. (Zizek 2001: 85; Hervorhebung im Original)
Zizeks Konzept des „Abjekts“, für welches die hegemeoniale Ordnung der wirkliche Karneval ist, soll hier die dritte heuristische Folie abgeben.
3. Der pädagogische Medienkompetenz-Diskurs
3.1 Medienverwahrlosung
Einen provokativ unvernünftigen Vorschlag zum kritischen Umgang mit den Medien will Christian Swertz, Medienpädagogikprofessor in Klagenfurt, machen, wenn er das folgende Bild eines unhinterfragten, unreflektierten, hemmungs- und grenzen-losen, d.h. ekstatischen und damit gänzlich unvernünftigen Medienkonsum s (Swertz 2004: 4) ausmalt – gewissermaßen also das „Abjekt“ der Medienkompetenz:
Sie wollen Spaß sofort und ohne Ende? Ab in den Fernsehsessel! Konsumieren Sie Medien! Ohne Ende! Lassen Sie sich ohne jede Distanz drauf ein und genießen Sie alles, was Sie kriegen können. Schauen Sie sich alle Soaps an, stellen Sie einen Computer in Reichweite und surfen sie durch alle Internetseiten, die Sie finden kön-nen (und lassen Sie dabei auch die unmoralischen nicht aus). Verzichten Sie auf un-nötige Ablenkungen wie „Erwerbsarbeit“ oder „Behördengang“. Schmeißen Sie ihren Job – gehen Sie einfach nicht mehr hin. Man kann sich schließlich nicht um jeden Unsinn kümmern. Wozu auch die elende Maloche, wenn jeder Mensch das Anrecht auf einen Fernseher hat. Wenn Ihre Kinder dabei nerven und rumquengeln – schießen Sie die Balgen doch raus. Sollen sich Sozialpädagogen oder sonstige brave Bürger mit denen rumärgern – Sie können dann endlich die online bestellten DVDs ungestört anschauen. Wenn die Rechnung kommt – ignorieren Sie diesen bürokrati-schen Quatsch. Erklären Sie einfach Ihren persönlichen Bankrott; ohne Job haben Sie ohnehin nichts zu verlieren – oder wollen Sie sich von gewinnsüchtigen Kapita-listen vorschreiben lassen, was Sie zu tun haben? Für die Ernährung empfiehlt sich alles, was Sie online bestellen können. Gesundheitsfragen sollten dabei keine Rolle spielen – oder wollen Sie etwa ihrer der gesellschaftlichen Leistungsfähigkeit zuliebe auf Hamburger und Pizzen verzichten? Sport ist Zeitverschwendung (was Sie da al-les verpassen…), und Körperpflege nur dann angesagt, wenn’s Ihnen selbst stinkt: Wenn Sie aufgetakelte Tussis und Möchtegernschwarzeneggers sehen wollen, schau-en Sie in die Glotze, nicht in den Spiegel. Wenn jemand vom Arbeitsamt rumnervt – sagen Sie denen, dass Sie sich von Leuten, die nicht mal eine Online-Jobbörse an den Start bringen, schon gar nichts vorschreiben lassen. Und wenn sie jemand wegen eines Online-Interviews anhaut – verweisen Sie ihn an den ekligsten Bot, den Sie kennen. Versuchen Sie bloß nicht, die Gesellschaft irgendwie weiterzuentwickeln. Warum sollen Sie auch die Suppe, die andere uns eingebrockt haben, auslöffeln? Und zuletzt: Lesen Sie nicht solch abgehobenen Mist wie diesen Text. Nützt eh nie-mandem außer dem Autor was. Wollen Sie etwa meine Karriere- und Geltungssüchte ausbaden? Papier ist geduldig – und die Mülltonne auch. (Swertz 2004: 4 f)
Der Medienpädagoge Swertz komponiert diese Litanei, um gleichsam ex negativo zu beweisen, dass unvernünftiger, also nicht mediengebildeter, ekstatischer Medienkon-sum nicht zu Anpassung an gesellschaftliche Erwartungen und Konformismus führe, sondern im Gegenteil die gesellschaftlichen Strukturen sprenge. Swertz liefert damit aber auch ein ‚Schulbeispiel’ für die im letzten Kapitel angerissene Position des/r modernen kritischen Intellektuellen.
Swertz skizziert im diesem imperativen Text so etwas wie Medienverwahrlosung – ein Ausdruck, der unlängst in die Mediendebatte eingeworfen wurde (Pfeiffer 2003; vgl. kritisch dazu Kübler 2004). Aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Textsorte innerhalb des medienpädagogischen Diskurses um Medienkompetenz bzw. -bildung werde ich ihn im Folgenden kurz als bedeutsamen Text im Sinne der Wissenssozio-logischen Diskursanalyse analysieren (vgl. Keller 2004: 88), geleitet von der Annah-me, dass sich in dieser Äußerung ein wesentlicher Teil des Interpretationsrepertoires des Medienkompetenz-Diskurses durch eine Wendung ins Positive extrahieren lässt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auf der einen Seite haben wir also einen verfetteten, Pommes-Frites, Hamburger und Pizzas plus Sixpacks ordernden und vertilgenden, entsprechend verwahrlosten, un-(aus)gebildeten, arbeitslosen, arbeitsunwilligen, bildungsfeindlichen, asozialen, ver-antwortungs- und perspektivelosen Enddreißiger vor uns, der geschieden und dem die Obsorge für seine Kinder entzogen worden ist und der nur mehr vor dem Fern-seher hängt oder im Internet surft oder chattet, ansonsten aber keine „realen“ Außen-weltkontakte mehr pflegt – wie ein (unvernünftiges) Tier im (selbstgebauten) Käfig.
Auf der anderen Seite haben wir einen „braven Bürger“, der sich als „Planungsbüro in bezug auf seinen eigenen Lebenslauf“ (Beck 1986: 217) versteht, der distanziert-kritisch Optionen prüft, seine Wahl(en) nach vernünftigen Kriterien und moralisch begründet trifft, Partnerschaften, Karriere, Erziehung und Ausbildung der Kinder plant, sich fit hält für mögliche neue Optionen (Weiterbildung, Sport, Körperpflege) usw. – kurzum: hier haben wir die Erzählung von der „allseits fitten und allseits kon-sumierenden Person“, die multioptionale Lebenschancen zu nutzen vermag und ein sich psychisch selbst kontrollierendes Subjekt ist (Keupp u.a. 1999: 290). Die Me-dienkompetenz des „braven Bürgers“ bestünde folglich darin:
- bewußte Medien-/Programmwahl (impliziert Kenntnisse der Medienlandschaft, -struktur)
- distanzierte, kritische und reflektierte Perspektive, verant-wortungsvoller Umgang (z.B. kindgerechte Auswahl)
- moralische / ethische Maßstäbe
- mediale Fitness (im Sinne der allgemeinen Fitness Weiterbildung in Sachen Neue Medien und entsprechende gestalterische Fähig-keiten)
- gesellschaftliche Partizipation, Mitgestaltung via Medien
- Maßhalten (kein exzessiver Mediengebrauch, aber auch keine Medien-Abstinenz; „mediale“ Erfahrung und „reale“ Erfahrung halten sich im Gleichgewicht)
- Subjektzentrierung
Aus Swertz’ kleiner Provokation lässt sich demnach ein Medienkompetenzbegriff extrapolieren, der viele Elemente der gängigen Medienkompetenzbestimmungen ent-hält; es fehlt jedoch eine medienpädagogische Altersdifferenzierung (die Swertz al-lerdings in seiner Diskussion der pädagogischen Umsetzung theoretischer Analysen nachliefert), die Dimension der Genussfähigkeit/Affektivität ist auch nur schwer herauszulesen.
Wer oder was spricht überhaupt in Swertz’ Text? Swertz übernimmt hier die Rolle eines advocatus diaboli mediorum, oder es spricht hier – in Analogie zur mittel-alterlichen Frau Welt – die Tante Medium (Vorname: Pandora), hinter deren glatten, gestylten und designten (Bildschirm-)Oberfläche Lasterhaftigkeit, Zügellosigkeit, Egozentrik, Verantwortungslosigkeit, Zerfall usw. am Werke sind: Bunt flimmert das Verderben (Pfeiffer 2003).
Freilich hat der Text auch den Charakter eines Lehrstücks, das auf Selbsterkenntnis der LeserIn setzt. In seiner holzschnittartigen Hyperbolik transportiert er darüber hinaus ein monokausales Verständnis von (visuellen und Informations-) Medien als Verursacher allen Übels.
Was bei Swertz als Provokation gedacht ist und tatsächlich Widerspruch und ein Be-dürfnis nach Differenzierung hervorruft, ist bei Christian Pfeiffer, dem Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts (und Ex-Justizminister in) Niedersachsen, Ju-rist und Sozialpsychologe, tatsächlich ernst gemeint (gemäß der Wissenssoziologi-schen Diskursanlyse fungiert Pfeiffers Position als Aussageereignis im Sinne des Prinzips der maximalen Kontrastierung, wiewohl sie keine medienpädagogische im engeren, fachinternen Sinne ist; vgl Keller 2004: 88) . Gemeinsam mit einem Team von Neurobiologen versucht Pfeiffer, in einem von der Volkswagen-Stiftung mit 700 000 € (sic!) unterstützen Projekt namens „Medienverwahrlosung und Schulver-sagen“ die Hypothese Zuviel Fernsehen macht dumm, dick und traurig zu belegen (vgl. N.N. 2005 a: 1). Die simplen Schuldzuweisungen und Verdächtigungen Pfeif-fers sind für Kübler wiederholt „von Seiten der seriösen Wissenschaft, der Medien-wirkungsforschung und Lernpsychologie“ eingeschränkt worden, ebenso gelte es, sich vor unilinearen Erklärungen zu hüten und die in Frage kommenden Faktoren in ihrer vielfältigen Kontextuierung in ein angemessenes Bedingungsgefüge einzube-ziehen (Kübler 2004: 3).
Auf den ersten Blick mag Pfeiffers Projekt daher als Rückkehr in die Zeiten bewahr-pädagogischer Prävention und als eine Abrechnung mit dem Konzept der Medien-kompetenz erscheinen – in der Fernsehsendung Frontal 21 vom 30.11.2004 (ZDF), in welcher Pfeiffers Thesen und Projekt vorgestellt wurden, kommt auch der Schulpsy-chologe Werner Hopf akklamierend zu Wort:
Medienkompetenz im Sinne von Berufsvorbereitung, im Sinne von Vorbereitung hinsichtlich Technologiekenntnissen ist in Ordnung und notwendig. Medienkompe-tenz aber, verstanden als Jugendschutz, ist eine Illusion und eine Lüge. Seit 15 Jah-ren wird behauptet, mit Medienkompetenz kann man die Kinder stark machen, vor den Gefahren der Medien schützen. Fast nichts ist in diese Richtung passiert […]. (Zit. n. Deventer / Schmitz-Gümbel 2005: 3)
Somit wäre das medienpädagogische Projekt, das eben nicht nur auf instrumentelle Fähigkeiten gerichtet ist, sondern sein Selbstverständnis aus der Überwindung einer solchen technisch-instrumentellen Verkürzung von Medienkompetenz bezieht, in toto gescheitert.
Swertz’ Text ist insofern kaum provokant, Pfeiffers unterkomplexe Thesen hingegen sind es sehr wohl; zumal sein hoch gefördertes Forschungsprogramm, das sich neu-robiologische Rückendeckung holt und so harte Ergebnisse zu liefern verspricht, tat-sächlich nicht dem Nachweis dieser Thesen dient, sondern der Forderung von Staat und Wirtschaft genügt, dass Forschung belastbare, d.h. auf mechanische Kausalität reduzierte Befunde über den „Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen in der Erziehung und im Verhältnis von Erziehung und Wirtschaft (Radtke) liefern kann. Medienpädagogische Theorie, also die intellektuelle Problematisierungen der Hand-lungsprämissen, welche die Voraussetzung für eine sinnvolle Praxis erst schaffen könnten, ist dagegen nicht gefragt.
Pfeiffer konstruiert neurobiologisch rückversicherte harte Fakten („Dopamin-Du-sche“ des Gehirns durch Medienkonsum) als Grundlage für pädagogisches Handeln, das vermutlich folgende Form haben dürfte:
Medienkompetenz im Sinne: Die sollen selbst den Knopf drücken – ist eine Illusion bei Sechs- bis Achtjährigen, denn der ist von der Macht der Bilder gefangen. Da ge-hört Führung und Grenzen-Setzen dazu […]. (Schulpsychologe Werner Hopf in der ZDF-Sendung Frontal 21; zit. n. Deventer / Schmitz-Gümbel 2005: 3)
In dieses Bild passt auch Pfeiffers Forderung nach einer Erhöhung der Zahl von Ganztagsschulen (Pfeiffer 2003: 3) – also von Einschließungsmilieus, um der Me-dienverwahrlosung vorzubeugen (Nach dem Motto Besser verwahren statt verwahr-losen…).
Fassen wir zusammen: Während das medienkompetente Subjekt bei Swertz das provokativ und proaktiv erwachsene Positiv (Selbstkontrolle und -steuerung, Auf-schub, Planung, Sicherheit, Langeweile) zu dem auf Dauer gestellten Pubertären (provokativer Kontrollverlust oder -verzicht, Leben im intensivierten Augenblick, Kick, antisozialer Habitus, Pseudoautonomie; Swertz verballhornt hier den Fetisch der widerständigen Rezeption der Cultural Studies) ist und mit Medienkompetenz gewiss nicht die eine oder die andere Existenzweise, sondern vielmehr das Zapping zwischen beiden, zwischen kontrolliert-lustvollem Abtauchen in die Medien als Me-dium der Diffusion (die Lust am Text merkt man Swertz bei allem Aufklärungs-gestus und bei aller literarischen Unbeholfenheit an) und ekstatisch-instrumenteller Anschlusseuphorie an die Börsen der brachenspezifischen states of arts extrapolier-bar ist, so schaltet Pfeiffer auf die Option „Schwarz-Weiß“: Kinder haben ein wei-ches Gehirn. Fernsehen und Videospiele gehören zu den harten Drogen. Sind zu schnelle Licht- und Schattenspiele für weiche Gehirne. Erregen sie präsymbolisch allzusehr und machen alle Beschulungsbemühungen kaputt. Da keine Verarbeitung möglich, weil Dopamindusche. Effekt: Die Kids werden dumm, fett und depressiv.
Die Gemeinsamkeiten:
- Medien als Drogen: Beide Positionen implizieren eine Art Drogencharakter von Medien. Swertz’ malt exzessiven Medienkonsum ironisch als perpetuier-ten Rausch aus und entwirft dann ein klassisches Drogenmissbrauch-Szena-rio. Seine Kompromissformel, die gutwillig hinein interpretierbar ist, lautet: liberaler Medienge/missbrauch (auf der Grundlage von Selbstkontrolle). Pfeiffer entwirft ein hartes Forschungsszenario (heavy user of science…) der Medien als lebenslänglich abhängig machende Substanzen bei Erstkontakt und gleichzeitiger neuronaler Zerrüttung.
- Die Abhängigen sind männlich: Swertz inszeniert eine Kariktur, die, kom-plettiert mit ihrer Inversion, ein männliches Macher-Subjekt evoziert. Pfeiffer hat explizit Kinder und Jugendliche männlichen Geschlechts im Visier (auf der Grundlage von Schulversagensstatistiken).
- Medienverwahrlosung (als deviante/pathologische Form von Medien in kom-petenz) betrifft Kinder und Jugendliche: Wenn Swertz auch offensichtlich einen Erwachsenen vorführt, so ist es doch nur ein gealtertes Exemplar jener hirngeschädigten Kinder, die Pfeiffer als medienverwahrlost diagnostiziert.
- Medienverwahrlosung betrifft die Unterschicht: Swertz’ ekstatischer Me-dienkonsument ist augenscheinlich ganz unten; Pfeiffers Blick zielt auf die Kinder solcher ekstatischer Medienkonsumenten oder Kinder von Doppel-verdienern (Mac-Jobs), welche ihre Kinder verblödenden Dopamin-Duschen aussetzen, weil sie keine Ostblock-Nannies schwarz anstellen können. In der Folge erschießen solche Kids dann ihre LehrerInnen und MitschülerInnen…
- Medienkompetenz ist ein Attribut ‚braver Bürger’: Ex negativo ist bei Swertz erschließbar, dass ‚brave Bürger’ medienkompetent sein müssen, denn sonst wären sie keine ‚braven Bürger’ (der Haken dabei ist, dass ‚brav’ eine Bewertungskategorie von Erwachsenen für Kinder ist). Bei Pfeiffer muss die Sachlage anders sein: Entweder er ist so alt, dass er nie verheerenden Do-paminduschen ausgesetzt war, oder er war es doch und verheimlicht es (ähn-lich, wie (sekundäre) Analphabeten unheimlich kreativ sind, wenn es darum geht, diesen Mangel zu verbergen)…
- Medienkompetenz ist Erwachsenensache: Woher auch immer sie kommt, wenn man/frau erwachsen ist, ist man/frau auch medienkompetent – erwach-sen ist man/frau aber nur, wenn er/sie medienkompetent ist. Juvenil souverä-ner Umgang mit techno-symbolischem Equipment ist Präpotenz (oder Dopa-minduschendemenz) aus funktionell-reproduktiv-fixierter Sicht.
- Kontrolle löst Disziplin (im Sinne Deleuzes) nicht ab, beide operieren im Modus gleichzeitiger Ungleichzeitigkeit.
Entweder ist hier ein methodischer Fehler in der Auswahl der Texte im Sinne des Prinzips der maximalen Kontrastierung gemäß der Forschungsprogrammatik der Wissenssoziologischen Diskursanalyse unterlaufen oder es wurde hier nicht nach-vollziehbar argumentiert bzw. idiosynkratisch interpretiert: Jedenfalls wurde ein nicht erwartetes (Zwischen-)Ergebnis produziert, was ja durchaus im Sinne des Forschungsprogramms wäre.
Freilich könnten jetzt zwei Texte nach dem Prinzip der minimalen Kontrastierung ausgewählt werden, um einen politisch korrekten Diskurs methodisch zu generieren (z.B. Bischoff / Schriefers 2002 und Bickelmann / Sosalla 2002), sofern es gewollt würde (Auftragsforschung).
Diese Übung erspare ich mir zugunsten der kontrastiven Diskursivierung im Sinne Hirseland / Schneiders.
3.2 Das Kompetenz-Theorem
3.2.1 Von der Kompetenz zum Programm
Wenn die Medienpädagogik den Begriff der Medienkompetenz für sich reklamiert, dann tut sie es nicht ohne eine Art „historischen“ Stolz – zumal sie ihn von Dieter Baacke ableitet, der ihn ursprünglich zwar nicht explizit verwendet hat, aber dennoch so etwas wie den „Gründervater“ abgibt und das medienpädagogische „Copyright“ dafür sichert. Baacke räsoniert zwar selber angestrengt-erstaunt über die Konjunktur der Medienkompetenz als sich durchgesetzt habendes Produkt des 68-er-Geistes, also über die unerwartet effektive Performanz dieser Wortschöpfung.
Der Kompetenzbegriff im Anschluss an Noam Chomsky und Jürgen Habermas war für Baacke deshalb so attraktiv, weil er die Pädagogik auf den Plan rief:
Es ist die „Kompetenz“, die den Menschen einerseits erziehungsbedürftig macht, aber auch erziehungsfähig. Unabhängig davon, welcher sozialen Klasse, welchem Geschlecht, welcher Rasse, welchem kulturellen Kontext ein Mensch seine Herkunft verdankt – er unterscheidet sich in Hinsicht auf seine kommunikative Grundausstat-tung nicht von anderen und muss entsprechend behandelt werden. (Baacke 1998 a: 4)
In der folgenden Tabelle stellt Harald Gapski den Kompetenzbegriff der Lingusitik einem idealtypischen Medienkompetenzbegriff gegenüber, welchen er als Hilfskon-strukt aus der explorativen Durchsicht unterschiedlicher Definitionen von Medien-kompetenz gewonnen hat und der die übliche und vorherrschende Begriffsverwen-dung beschreiben soll (vgl. Gapski 2001 b: 58):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der locker eingeführte Sprung vom unterstellten universellen Sein zum Müssen (viel-mehr ein Sollen) bei Baacke offenbart, dass wir es bei seinem Entwurf mit einer Me-dienethik zu tun haben:
Ethischer Theorie inhäriert, sofern sie sich mit einigem Recht als Theorie konstituie-ren will, notwendig eine Universalisierungstendenz. Erst eine mit wenigstens einer gewissen Aussicht auf Erfolg in Anspruch genommene Universalität stattet Ethik mit dem notwendigen Geltungsanspruch und damit dem Versprechen eines Steuerungs-potentials aus. (Leschke 2001: 99)
Erst vor dem Hintergrund der Annahme, es handele sich bei Baackes Ansatz um eine Medien-Ethik und nicht um eine wertfreie Medien-Pädagogik (die es ja wohl auch nicht geben kann), wird dieser unvermittelte Übergang vom Sein zum Müssen plau-sibel.
Gewendet auf medienpädagogische Begründungen meint das Theorem: Jeder Mensch ist ein prinzipiell mündiger Rezipient, er ist aber zugleich als kommunika-tiv-kompetentes Lebewesen auch ein aktiver Mediennutzer, muss also in der Lage sein (und die technischen Instrumente müssen ihm dafür zur Verfügung gestellt werden!), sich über die Medien auszudrücken. (Baacke 1998 a: 4)
Weshalb muss jeder Mensch in der Lage sein, sich über die Medien auszudrücken?
Baacke hält an einem emanzipierenden und „chancen-ausgleichenden“, aber zirku-lären Programm fest, das die Herkunft über den universalisierten Hebel einer ange-borenen, aber zu pädagogisierenden Medienkompetenz zugunsten einer ebenfalls universalistisch gedachten, „herrschaftsfrei“ kommunizierenden Gemeinschaft der Zukunft hinter sich lässt, um die (Medien-) Pädagogik dafür zu ermächtigen, was ge-tan werden muss (vgl. auch Schorb 1999: 2). Die Medien haben in dieser Konzeption allenfalls instrumentellen Charakter, sie sind ein Anwendungsfall oder Mittel auf dem Weg zu diesem utopischen Ziel, von dem sich Baackes oft strapaziertes Müssen ableitet (vgl. 2.4).
Die Verwunderung jedoch über die Konjunktur der Medienkompetenz, die Baacke zur Schau trägt, ist gewiss nicht nur eine rhetorische; denn was sich im Anschluss an und unter Berufung auf sein Konzept abspielt, ist eine Umcodierung seiner hehren Ziele:
Freiheit als Vision des emanzipierten Selbst, wie sie beispielsweise von sozialen Be-wegungen der späten 60er Jahre formuliert wurde, wird in eine neoliberale Technik des Regierens umcodiert, in der Subjektwerdung und Subjektion wechselseitig auf-einander verweisen und eng miteinander verkoppelt sind [...]. (Pieper 2003: 151)
Weshalb? Auf den ersten Blick mag es vielleicht ratsam erscheinen, die „nativisti-schen und universalistischen Implikationen“ des Begriffs Medienkompetenz aufzu-geben (Hurrelmann 2003: 8):
Medienkompetenz ist weder angeboren noch universell, sondern wird durch historisch und kulturell spezifische Sozialisationsprozesse erworben. Was explizit aus der bisherigen wissenschaftssprachlichen Verwendung für die Auffassung von „Medien-kompetenz“ erhalten bleibt, sind lediglich die normativen Implikationen. Das heißt, der Begriff „Kompetenz“ ist immer mit einer positiven Wertung verbunden, die es allerdings in der wissenschaftlichen Konzeptualisierung explizit zu machen oder zu begründen gilt. (Ebd.; Hervorhebung T.H.)
Die positive Wertung bzw. normative Annahme nun, die in allen Reden von der Me-dienkompetenz mehr oder weniger enthalten sein soll, ist die Idee des gesellschaft-lich handlungsfähigen Subjekts, welches heute nicht mehr anders denkbar sei als mit Medienkompetenz ausgestattet (vgl. ebd.: 10) Diese Idee soll dabei den Status eines pragmatischen Grundwertkonzepts haben, „das selbst keiner Begründung bedarf“ (Hurrelmann 2002 b: 112):
Das Subjekt als Forschungsobjekt ist so zu konzipieren, dass ihm prinzipiell die Fähigkeit zu selbstbestimmtem Handeln, zur Reflexion und Selbstexplikation zu-getraut wird, ohne dass die Dimensionen unterschlagen werden, die zu einem nicht-rationalistisch verengten Subjektivitätsbegriff notwendig hinzugehören […]. (Ebd.: 124)
Baackes basses Erstaunen über die erstaunliche Performanz des Labels Medienkom-petenz, welche er damals noch neuronal hart (im Sinne der Naturwissenschaften als Garant für „wirkliche Wirklichkeit“ – vgl. das Forschungsprojekt von Pfeiffer, Kap. 3.1) rückgebunden hat, ist unter anderem auch jenes vor der Umcodierung des Mo-dell -Begriffs: vom Modell als Reduktion der komplexen sozialen Wirklichkeit auf ihre als wesentlich erachteten Determinanten (Modell von), dem ein utopischer Ge-genentwurf gegenüber gestellt wurde, zum Modell als Programm, nicht als Re -Duk-tion, sondern als „Führung“, also als Duktion (Modell für Wirk lichkeit). In diesem Sinne spricht auch Siegfried J. Schmidt von Wirklichkeitsmodellen (verstanden als im Laufe der Geschichte aus Interaktion und Kommunikation emergierte Modelle für Wirklichkeiten, nicht von Wirklichkeiten) von Gemeinschaften und Gesellschaften (vgl. Schmidt 2000: 34 und Schmidt 2003: 38).
Die Idee des gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekts ist demnach als ein prag-matisches Grundwertkonzept auf der Ebene der Wirklichkeitsmodelle angesiedelt, also nicht mehr begründungspflichtig, da die „Aktanten […] nur so lange und inso-fern Mitglieder einer Gemeinschaft oder Gesellschaft ‚sind’, als sie auf deren Wirk-lichkeitsmodell bezogen agieren“ (Schmidt 2000: 35). Auf dieser Ebene struktur-orientierter, also statischer semantischer Netzwerke (Schmidt 2003: 38) ist die Un-terscheidung gesellschaftlich handlungsfähiges, aktives Subjekt /gesellschaftlich nicht handlungsfähiges, passives Subjekt als Objekt essentiell. Handlungswirksam wird sie erst, wenn das Modell in ein Programm (Kultur als Programm, das der ge-sellschaftlichen Reproduktion und Kontrolle dient) übersetzt wird, im vorliegenden Fall in ein Medienkompetenz programm (Groeben, Hurrelmann u.a.), das eng an die Lesekompetenz geknüpft wird:
Die Kontrolle der Individuen erfolgt nicht durch kausale Verursachung, sondern durch kulturell programmierte Bedeutungen, wobei Sprache ein effektives Instru-ment kultureller Kontrolle darstellt. Sprachliche Sozialisation ist besonders rigide, und die Regeln gesellschaftlich korrekter Anwendung sprachlicher Mittel konden-sieren gesellschaftlich akzeptierte Erfahrungen, Affekte und Überzeugungen. (Schmidt 2000: 37).
(Kübler 2002 c: 21)
Die Umcodierung des von Baacke gestifteten Medienkompetenz-Konzepts, das für Schmidt hoch-gradig illusionär und reichlich alt-humanistisch ist (Schmidt 2000: 149 f), in ein Medienkompetenz- Programm, das man/frau unter Androhung des Aus-schlusses aus der Gesellschaft zugleich beherrschen und bedienen muss, mag zum Teil den „Konjunkturen“ von Medienkompetenz in Abhängigkeit von der technisch-medialen Entwicklung geschuldet sein (siehe Abb. oben); die Computerprogramm-Metaphorik bei Schmidt jedenfalls ist eine filia temporis.
Zu ergänzen ist die obige Abbildung um die großen paradigmatischen Wenden im intellektuellen Diskurs (vgl. Weber 2001: 1): 60er und 70er-Jahre Kritische Theorie und Kulturkritik, 80er und 90er-Jahre Dekonstruktion und französische Postmoderne, End-80er bis heute Cultural Studies, Konstruktivismus und Systemtheorie, wobei Ste-fan Weber eine stetige Zunahme an Affirmation attestiert. Da mag er richtig liegen, im Lichte des oben Gesagten ist die folgende Aussage aber schlichtweg falsch: „Der präskriptive und auch der normative Diskurs wurde von einem rein deskriptiven, von einer auf Unterscheidungslogik aufgebauten Beobachterperspektive abgelöst“ (ebd.).
Ähnlich, wie Hurrelmann (oder etwa Sutter/Charlton 2002 im Umfeld von Norbert Groeben, für welchen der Konstruktivismus endgültig diskreditiert und als theoreti-sche Verwirrung und haltlose Übertreibung enttarnt sein soll – vgl. Schmidt 2003: 23) den Kompetenzbegriff um nativistische und universalistische Implikationen zur reinen, explizit zu machenden Normativität abspeckt, versucht Schmidt, einen Kon-struktivismus ohne naturalistische und/oder kulturalistische Begründungsformen zu entwerfen, einen, der sich selbst begründet (vgl. Sandbothe 2003: 14) und normativ wirkt:
Seine [Siegfried J. Schmidts; T.H.] Nützlichkeitserwägungen beziehen sich auf die Wirkungen, welche die Geschichten&Diskurse-Philosophie auf ausgewählte Multi-plikatorinnen und Multiplikatoren (und vermittelt über diese dann auf Entschei-dungsträgerinnen und Entscheider in der globalen Wirtschaft und Politik) entfalten kann. (Ebd.: 20)
Wurde bei Nassehi (siehe 1.3.2) noch eine Karikatur vermutet, so stellen sich doch langsam Zweifel ein, ob solche elitären Omnipotenzfantasien nicht tatsächlich ernst gemeint sein könnten. Ganz im Sinne der Plastikwörter Pörkens’ schreibt Haupert:
Das Fatale an diesem Theorietyp ist die Tatsache, dass er die „soziale Welt“, die er zu beschreiben oder zu analysieren vorgibt, durch seine vermeintlichen Analysen semantisch konstruiert. Letztlich sind die so vorgetragenen Thesen ideologische Postulate. [...] Die neuen Oligarchien bedürfen einer renovierten Bildungsreligion um das Bündnis der Eliten zu kitten. (Haupert 2000: 8)
3.2.1 …und zurück zum Suffixoid - kompetenz
Jeder könnte, aber nicht alle können.
(Bröckling 2002 b)
Die allgemeine Attraktivität des von seinen nativistischen und universalistischen Im-plikationen bereinigten Kompetenzbegriffs als noch weitgehend faltenfreie Sprach-form (Orthey 2002: 4) verdankt sich nach Frank Michael Orthey folgender sprach-generativen Regel (ebd: 3 ff):
- Charme des unverbrauchten und damit positiv besetzbaren Begriffs, der mit Subjektbezug und der Nähe zum aufklärerisch ambitionierten Bildungsbegriff reizt.
- Kompetenz wird zur semantischen Projektionsfläche für Zuschreibungen, die etwas mit Fähigkeiten zu tun haben, die zum Lebens- und Arbeitsvollzug ge-braucht werden und deren Erwerb zugleich möglich ist.
- Eine auf Dauer gestellte Fähigkeit, die sich zugleich selbst (kompetent) weiterentwickelt: eine Fähigkeit zur Weiterentwicklung von Fähigkeiten.
Während der Qualifikationsbegriff immer auch eine externe Zweckbestimmung der Fähigkeiten beinhaltet, die er umfasst, ist der Kompetenzbegriff an das Subjekt ge-koppelt (vgl. ebd.: 4):
[Der Begriff Kompetenz] zeichnet sich gegenüber Bildung und Qualifikation gerade dadurch aus, dass er das Nutzlose des Ersten und das Unterworfene des Zweiten ver-meidet. Bildung und Qualifikation, so betonen die emphatischen Pädagog/-innen heutzutage, bilden keinen Widerspruch mehr. Wollen und sollen sind eins, „will“ und „skill“ gehen heute zusammen. (Wrana 2003: 128)
Aus der Perspektive der Unternehmen geht es nicht mehr um begrenzte Fähigkeits-bereiche von Menschen, „sondern um die Gesamtheit ihrer Kompetenzen und letzten Endes um ihre gesamte Persönlichkeit“:
Und wenn Unternehmen Mitarbeitern erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten einräu-men, dann geht es letztlich um einen umfassenden Zugriff auf die Person und ihre Potenziale – von betrieblicher Seite und in der Betriebswirtschaftlehre wird dies in-zwischen völlig offen so formuliert. (Egbringhoff u.a. 2003: 16)
Kompetenz formuliert demnach das Prinzip dieses umfassenden Zugriffs im Sinne des Humankapital ansatzes und erstellt ein „semantisches Profil, das der Postfordis-mus an seine Subjekte anlegt“ (Opitz 2004: 109), wobei der Zugriff für die jeweils nachgefragte Ressource spezifiziert werden muss.
Selbst wenn wir uns nur auf den sprachlichen Aspekt und die von Orthey versproche-ne, aber nicht gelieferte sprachgenerative Regel (zumal Orthey damit primär auf Chomsky anspielt, um damit zu signalisieren, dass er sehr wohl um die Falten und Furchen des Kompetenzbegriffs Bescheid weiß…) beschränken, so trifft auch hier das Prinzip des umfassenden Zugriffs. Kompetenz als Suffixoid (laut Fremdwörter-duden ein Wortbildungsmittel, das sich aus einem selbständigen Lexem zu einer Art Suffix entwickelt hat und das sich vom selbständigen Lexem unterscheidet durch Reihenbildung und Entkonkretisierung, also zum Plastikzapfen im Sinne Pörksens geworden ist; vgl. Bußmann 1983: 519 f) erweist sich dann als eine Art semantischer Staubsauger ohne Staubbeutel, der hinten lediglich verwirbelte heiße Luft hinaus-bläst. Exemplarisch führt dies Thomas Moritz in seiner – ich nenne sie hier so – Me-dienkompetenz-Kantate vor:
Medienkompetenz entwickelt sich immer mehr zu der Universalkompetenz in der postmodernen Mediengesellschaft schlechthin, bedeutet zunehmend Handlungskom-petenz in dieser Mediengesellschaft und beinhaltet auch eine Reihe von Sozial- und Basiskompetenzen wie Rezeptions- und Selektionskompetenz, Reflexions- und Inter-aktionskompetenz sowie Sprach- und Kommunikationskompetenz. Daneben enthält Medienkompetenz aber auch alle anderen technischen, sozialen, ökonomischen und ethischen Kompetenzen, die für ein autonomes Handeln in der Mediengesellschaft notwendig sind. (Moritz 2001: 56; fette Hervorhebung im Original, kursive von mir, T.H.).
Daraus folgt, dass die sprachgenerative Regel, wenn denn eine gefunden werden soll, sie nicht vor oder in, sondern nach der Suffixoidisierung zu suchen ist, in jener semantischen Perturbation, die sie hinterlässt und in der alle Partikel entropisch/ informationstheoretisch gleich informativ und unsinnig sind.
- X ist etwas, das jeder besitzt – ein anthropologisches Vermögen
- X ist etwas, das man haben soll – eine verbindliche Norm
- X ist etwas, von dem man nie genug haben kann – ein unabschließbares
Telos
- X is t etwas, das man durch methodische Anleitung und Übung steigern kann – eine erlernbare Kompetenz (Nach Bröckling 2004: 142)
X bezieht sich in Ulrich Bröcklings Original-Zitat zwar auf die Kreativität als Ein-trag im Glossar der Gegenwart, dennoch lässt sich etwa Medienkompetenz problem-los dafür einsetzen; auch wenn die Äußerung Medienkompetenz ist eine erlernbare Kompetenz scheinbar tautologisch wirkt, so trifft sie dennoch den Charakter der selbstbezüglichen/selbstähnlichen Kompetenzspirale, zumal die Erlernbarkeit noch nicht durch die Äußerung Medienkompetenz ist ein anthropologisches Vermögen impliziert wird. Zur kontrastiven Verdeutlichung kann man für X Musikalität als ökonomisch weitgehend irrelevante Ressource einsetzen: Musikalität ist zwar ein anthropologisches Vermögen (jeder kann irgendwie singen), aber keine Kompetenz-sache, sondern eher eine Frage des Talents. Kompetenzsache dagegen ist eindeutig die Vermarktung, die Kapitalisierung eines solchen Talents (siehe auch Kap. 5.1.1).
3.3 Bedeutungsfelder und Dimensionen von
Medienkompetenz
3.3.1 Bedeutungsfelder des Medienkompetenzbegriffs
Harald Gapski skizziert folgende Bedeutungsfelder von Medienkompetenz in ver-schiedenen gesellschaftlichen Bereichen bzw. Funktionssystemen.
Der pädagogische Begriff von Medienkompetenz ließe sich charakterisieren als in-dividuell und normativ fokussiert und altersspezifisch differenziert. Er wird häufig als Teil einer umfassenden Handlungskompetenz und kommunikativen Kompetenz verstanden. Immer dann, wenn dieser pädagogische Medienkompetenz-Begriff, etwa unter dem soziotechnischen Anpassungsdruck der Neuen Medien zu instrumentell und zu technisch wird, gewinnt die normative Referenz Mensch oder das aufkläreri-sche Menschenbild an Bedeutung: es geht um Selbstbestimmung und Emanzipation. […]
In der Wirtschaft ist Medienkompetenz ein Produktions- und Standortfaktor. Ge-genüber klassischer Qualifikation bieten Kompetenzen die Möglichkeiten der flexib-len Selbstanpassung an den wirtschaftlichen Wandel. Kompetenzen sollen möglichst messbar sein, damit sie besser als Produktions- und Standortfaktoren förderbar sind. [...]
Im Rechtssystem bedeutet „Medienkompetenz“ einerseits die Zuständigkeit in Fra-gen der Medienregulierung. Individuell gewendet liefert dieser Begriff eine Option der Verlagerung von Regulierungsproblemen angesichts neuer Medienentwicklun-gen vom Rechtssystem auf das Bildungssystem. [...] Da Medienordnungen und na-tionale Steuerungsmechanismen keine ausreichenden Lösungskonzepte mehr vor-schlagen können, wird nun die individualisierte Medienkompetenz in die Verantwor-tung genommen. Der Umgang mit den Konsequenzen marktwirtschaftlicher Deregu-lierung wird auf das Individuum verschoben.
In der Politik ist Medienkompetenz ein Wert zur Minderung verschiedener „Gaps“, „Digital Divides“ und Zugangsunterschiede: Chancengleichheit und Schließung von gesellschaftlichen Klüften unterschiedlicher Zielgruppen sind wichtige gesellschafts-politische Werte. [...]
Erfordern neue Techniken auch neue Kompetenzen? Jagt die Bildung der Technik hinterher, indem sie stets neue Kompetenzen vermitteln muss? [...] Medienkompe-tenzförderung erscheint dann als Herausforderung des Systemdesigns. Die För-derung von Medienkompetenz erfüllt sozio-technische Schnittstellenfunktion und fällt in den Bereich der Sozionik. (Gapski 2001 c: 2 f)
Tabellarisch zusammengefasst:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Gapski 2001 b: 155)
Gapski kritisiert vor allem die medienpädagogische Zentrierung auf das aktive, hand-lungsfähige und medienkompetente Subjekt bzw. das Dominieren dieser subjektzen-trierten, medienpädagogischen Fassung von Medienkompetenz in der Diskussion, obwohl die Medienpädagogik „nur ein Beobachter unter vielen in der Mediengesell-schaft“ (Gapski 2003: 68) sei. Für Gapski dagegen geht es „um viel mehr, als um die Kenntnisse, Fertigkeiten und das Handeln von Individuen“ (2001 c: 4), weshalb er für ein mehrdimensionales Medienkompetenz-Konzept plädiert, das nicht nur Ent-wicklungskonzepte für Individuen, sondern auch für medienkompetente Organisa-tionen und Institutionen, „ja sogar Diskurse für eine medienkompetente Gesellschaft integriert“.
Gapski erweitert somit den Medienkompetenzbegriff, um ihn vor der vermeintlich verkürzten Perspektive der Pädagogik zu retten, gleichzeitig aber universalisiert er die pädagogische Perspektive (Entwicklungskonzepte) auf Institutionen, Organisa-tionen, ja selbst auf Gesellschaft(en), die solchermaßen Subjektstatus erhalten, in-sofern sie „lernfähig“ sein sollen („Anthropomorphisierung“).
Ebenso universalisiert er „Medienkompetenz“; wenn er kritisiert, dass die individu-elle Fassung von Medienkompetenz sich in die jeweiligen Diskurse von Wirtschaft, Politik, Bildung und Recht füge und so deren jeweiligen Fortsetzungen sichere (Gap-ski 2003: 23), so ist dieser Befund auf der Basis des systemtheoretischen Ansatzes, auf dessen Grundlage er argumentiert, wenig verwunderlich, da ausdifferenzierte ge-sellschaftliche Subsysteme nun einmal an ihrer eigenen „Fortsetzung“ und nicht an gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen interessiert sind.
So gesehen ist Gapskis Plädoyer für eine Soziologisierung von Medienkompetenz, wobei hier unter Soziologie die Luhmannsche Systemtheorie gemeint ist, ein Plä-doyer für eine Rücknahme bzw. Überwindung der von der Systemtheorie beschriebe-nen gesellschaftlichen Ausdifferenzierung mit Hilfe einer Medienkompetenz, wel-che so heillos überfrachtet und mit einer gesamtgesellschaftlichen Mediations funk-tion (vgl. Bauer 2003) betraut wird, die sie aller Voraussicht nach nie bewältigen kann, zumal Gapskis Versuch ihrer systemtheoretischen Fundierung bereits herme-tisch und inkommunikabel ausfällt.
Da hier aber nicht die Kritik an Gapsiks Ansatz im Vordergrund steht, seien ab-schließend die Spezifika des pädagogischen Medienkompetenzdiskurses, die bereits verstreut festgehalten wurden, summarisch aus seiner diskursanalytischen Perspek-tive angeführt:
- Medienkompetenz greift den Selbstbewahrungsaspekt der Medienpädagogik auf, indem der Mediennutzer den Medienwirkungen – durch Kompetenz ausreichend „immunisiert“ – aktiv und nicht passiv, eher gestaltend als ausgeliefert, gegenüber-steht.
- Im medienpädagogisch-emanzipatorischen Diskurs über Medienkompentenz ver-bindet sich der Angeborenheits- und der Universalitätstopos des linguistischen Kom-petenzbegriffs mit den normativen und gesellschaftstheoretischen Postulaten der kommunikativen Kompetenz: Alle Menschen sind prinzipiell (medien-)kompetent und (medien-)mündig.
- Angereichert um entwicklungs- und sozialisationstheoretische Einsichten muss Me-dienkompetenz aus pädagogischer Perspektive altersspezifisch und entwicklungs-spezifisch differenziert werden und affektive Dimensionen der Mediennutzung entsprechend einbeziehen.
- Handlungs- und lebensweltorientierte Medienpädagogiken lassen sich direkt an den soziologischen Diskurs des Kompetenzbegriffs von Habermas anschließen, kritisch entfalten und normativ-ethisch begründen. Medienkompetenz kann somit in eine re-flektierte Relation zur Medienmündigkeit gebracht werden.
- Medienpädagogik und ihr Zielwert Medienkompetenz liegen im Spannungsfeld von normativer Zielvorstellung und soziotechnischem Anpassungsdruck. Das medienpä-dagogische Verständnis von Medienkompetenz hebt die Gefahr einer Verkürzung des Begriffs auf instrumentelle Dimensionen hervor und positioniert den Begriff in umfassendere, pädagogisch anschlussfähige Konzepte wie Bildung, Handlungskom-petenz oder Mündigkeit.
- Der Begriff Medienkompetenz fügt sich im Sinne des Beherrschens von (Neuen) Medien zur didaktischen Gestaltung von Lern- und Lehrprozessen in die bildungs-technologische Traditionslinie ein, die vor dem Hintergrund von Anwendungsfor-men wie Tele-Learning und Distance Learning an aktueller Bedeutung gewonnen hat. Hier ergeben sich Anschlussstellen für den bildungspolitischen und wirtschafts-politischen Diskurs der Medienkompetenz. (Gapski 2001 b: 78 f).
3.3.2 Dimensionen von Medienkompetenz
Auch wenn die Ausdifferenzierung von Dimensionen bzw. die Operationalisierung von Medienkompetenz insofern problematisch ist, als sie „immer wieder auf dem Hintergrund eines unreflektierten Komponentenenmodells“ erfolgt und durch eine solche additive Auflistung von Fähigkeiten und Zuständigkeiten dynamische Per-spektiven vernachlässigt werden (Hug 2002: 203), so ist eine solche Zerlegung in verschiedene Medienkompetenz-Bausteine oder -Module dennoch durchgängige diskursive Praxis. Wenn hier tabellarisch Beispiele solcher Ausdifferenzierungen des Medienkompetenzkonstruktes angerissen werden, dann nicht in der Absicht, diese gegeneinander auszuspielen oder Defizite auszuweisen; vielmehr dient diese exem-plarische Auflistung der Aufbereitung der Materie in Hinsicht auf die Kontrastierung mit dem Gouvernementalitätsansatz.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zur Auswahl: Dieter Baackes vierfache Ausdifferenzierung wird deshalb ausführ-lich dargestellt, weil sie in der Fachliteratur am meisten verbreitet ist und „Schlag-wörtern gleich […] repetiert“ wird (Kübler 2002 c: 20). Ebenso wird der der für Österreich gültige Grundsatzerlass breiter dargestellt, da er für eine gesetzliche Fest-schreibung von Medienkompetenz steht, welche als Unterrichtsprinzip im Unterricht wirksam werden soll (vgl. Lehrplan 2000: 31).
Die dazwischen angesiedelten Ansätze von Schorb, Tulodziecki, Groeben und Auf-enanger bieten weitere Beispiele theoretischer Auffächerungen, Modularisierungen bzw. Operationalisierungen von Medienkompetenz. Obwohl inhaltlich identisch (und vermutlich auch verwandt) mit Tulodzieckis Ausdifferenzierung, wird das „Portfolio Medienkompetenz“ dennoch gesondert angeführt: Das „Portfolio“ fungiert nicht als Zeugnis oder Zertifikat, mit welchem die SchülerInnen Medienkompetenz nachwei-sen sollen (zumal diese ja als unabschließbare Aufgabe konzipiert ist), sondern ist von vornherein als Teil von Bewerbungsmappen konzipiert – als Bestandteil eines individuellen Dossiers „als Form par excellence, in der Individualität eingeschrieben wird“ (Masschelein 2002: 196); denn es geht eben „nicht allein darum, sich ‚up-to-date’ zu halten, sondern sich mit anderen zu vergleichen und dafür zu sorgen, dass man im Vergleich zu anderen über das bessere ‚Portfolio’ verfügt“ (Simons 2004: 183).
4. Der Gouvernementalitätsansatz
Es gibt eine intrinsische Beziehung zwischen den intellektuellen und praktischen Techno-logien der Pädagogik, die sich in ihren prak-tischen Expertisen manifestieren, und der Art und Weise, in der politische Macht in unseren Gesellschaften ausgeübt wird und in der wir uns selbst führen.
(Masschelein 2003 a: 137)
4.1 Zur Rezeption Michel Foucaults
Suchte das akademisch-intellektuelle Deutschland derzeit seinen Superstar, er hieße wohl Michel Foucault. Dieser nämlich schrieb, wie wir mittlerweile wissen, bereits vor einem Vierteljahrhundert das – allerdings unvollendete – Buch zum Film, dem Film unserer Gegenwart, des Titels „Neoliberalismus“. (Lessenich 2003: 80)
Obwohl die Metaphern – Michel Foucault als „Drehbuchschreiber“, die gesellschaft-liche Gegenwart als „Film“ – unglücklich gewählt sind, bringt Lessenich (zumindest symptomatisch) den aktuellen Status, den Foucault gegenwärtig genießt, zum Aus-druck: ein intellektueller „Superstar“. Über die Emphase für den kritischen Rezep-tionsstrang der Gouvernementalitätsstudien vergisst Lessenich allerdings jenen der Lebenskunst, welcher sich ebenso auf den späten Foucault beruft (vgl. Schmid 1998, 2000). Ulrich Brieler spricht denn auch pointiert von einem Riss in der Foucault-Re-zeption: ein liberales Foucaultchen für die Lebenskunst einerseits, andererseits ein Funke, an dem sich die Kritik der Gegenwart entzündet (Brieler 2004).
Die vorliegende Arbeit w/sollte ursprünglich die mögliche Bedeutung der Lebens-kunst im Anschluss an Foucault für die (Sozial-)Pädagogik zum Gegenstand haben; allerdings stellte sich tatsächlich ziemlich bald heraus, dass „die Vorschläge dieser Lebenskunst à la Foucault […] eine so enge Verbindung mit den altbekannten Schar-latanen des ‚Du schaffst es!’ und ‚Sei du selbst!’ [unterhalten], dass man getrost von einer Matrix der neoliberalen Menschenführung reden kann“ (ebd.). Das bedeutet nun nicht, dass eine solche Lebenskunst für die Sozialpädagogik irrelevant wäre – zumal es hier ebenso um Menschenführung geht; allerdings verbrämt diese Lebens-kunst durch Moralismus, was die gouvernementale Perspektive kritisch analysiert und in Frage stellt.
Freilich sind die genannten Rezeptionsstränge der Lebenskunst und der Gouverne-mentalität nur zwei der aktuellen, durchaus heterodoxen Deutungen Foucaults. Es fehle Foucault die Voraussetzung einer „nur halbwegs homogenen Interpretations-gemeinschaft“, damit er auf „absehbare Zeit zu einem Klassiker im traditionellen Sinn werden“ könnte, stellt Axel Honneth anlässlich der Frankfurter Foucault-Kon-ferenz 2001 fest (Honneth 2003: 15). Eine solche homogene Interpretationsgemein-schaft wäre für Foucault natürlich ein Graus gewesen, zumal er seine Bücher als Werkzeugkiste verstanden wissen wollte.
In der vorliegenden Arbeit geht es demnach nicht um eine korrekte „Exegese“ des „Meisterdenkers“ Foucault, sondern um den Versuch einer Anwendung der inter-disziplinären Lesart der auf Foucault basierenden Gouvernementalitätsstudien auf das Medienkompetenzkonstrukt.
4.2 Der Gouvernementalitätsansatz
4.2.1 Liberaler Code versus kulturtheoretische Perspektive des
Politischen
Andreas Reckwitz steckt in der folgenden Skizze die Position des Gouvernementali-tätsansatzes im Rahmen von Theorien der Politik der Gegenwart ab (Reckwitz 2004: 36):
Kulturalistischen Theorien und Analysen der Politik kommt nach Reckwitz gegen-über dem in der westlichen Sozialwissenschaft der Nachkriegszeit dominierenden liberalen Code des Politischen zunächst ein parasitärer Status zu. Im liberalen Selbst-verständnis soll Politik einerseits eine legitime Repräsentation der in einer Gesell-schaft geltenden Interessen liefern (Denktradition der „Vertragstheorien“), anderer-seits soll sie eine effiziente Realisierung der idealerweise legitim zustande gekom-menen kollektiven Ziele in eine politische Steuerungspraxis liefern (systemtheo-retisch-kybernetische und ökonomistische Steuerungstheorien):
Die Analysen der Politik aus der kulturtheoretischen Perspektive betreiben keine bloße Ergänzung des legitimitäts- und steuerungstheoretischen Analyserahmens durch eine Berücksichtigung des „Überbaus“ von Ideen und Symbolen, wie sie die Politische Kulturforschung oder die Kultursoziologie und Kulturgeschichte in einem traditionellen Sinn geliefert haben. Die kulturtheoretische Perspektive zielt vielmehr auf eine Umstülpung des Bildes moderner Politik selbst ab, indem sie jene Struktu-ren des Politischen bewusst machen will, die in der liberalen Selbstbeschreibung als selbstverständlich vorausgesetzt werden. (Reckwitz 2004: 34)
Wo die liberale Selbstbeschreibung nach der Legitimität politischer Herrschaft als Ausdruck gesellschaftlicher Interessen und Werte fragt, geht es für die Kulturalisten um die Frage, „welche – stillschweigend vorausgesetzten oder konflikthaft einander gegenüberstehenden – Codes definieren, was diese Interessen und Werte sind, mithin die Frage, wie sich die Identität, das Selbstverstehen eines Kollektivs und seiner po-litischen Ziele bildet, vor deren Hintergrund das Legitimitätsproblem erst entstehen kann“ (ebd.: 35). Wo die liberale Selbstbeschreibung nach der effizienten Realisie-rung politischer Programme fragt, geht es den Kulturalisten um das Problem, „wel-che gesellschaftsstrukturierenden Effekte die Techniken des Regierens tatsächlich haben, und zwar auf jener Ebene, die das liberale Selbstverständnis als private, vor-politische Bedingung von Politik voraussetzt: die Ebene der Formierung von Sub-jekten und ihren Lebensformen, die Arbeit, Intimität, Konsum und biographische Strukturen umfassen“ (ebd.).
Das Analyseprogramm der Gouvernementalität vollzieht somit eine kulturalistische Umkehrung der Analyse liberaler Steuerungstheorien; „Steuerung“ erscheint jetzt als „institutionell-diskursiver Komplex, dessen implizite kulturelle Voraussetzungen und dessen kulturelle Effekte es freizulegen gilt“ (ebd.: 47):
Das Analyseprogramm der Gouvernementalität versteht Politik als Ensemble von Techniken, von Praktiken des Regierens. Ihr entscheidendes Merkmal ist der Ver-such einer Formierung von Subjekten, die mit einer bestimmten ‚Mentalität’ ausge-stattet werden, die einer bestimmten körperlich-mentalen Form folgen sollen, und zwar bis in die Selbsthermeneutik ihres subjektiven Verstehens hinein: selbstkon-trollierte Subjekte, konsumierende Subjekte, familienorientierte Subjekte, risikobe-wusste Subjekte etc. (Reckwitz 2004: 45 f)
Die Politik ebenso wie die kapitalistische Ökonmie hätten sich aufgrund der Sonder-entwicklung ihrer beiden sozialwissenschaftlichen Subdisziplinen, der Politik- und Wirtschaftswissenschaft, der Kulturanalyse weitestgehend entzogen und könnten so-mit auch nicht zu den Voraussetzungen des Politischen wie des Ökonomischen in den sozialen Praktiken und in den Diskursen vordringen; sobald sich das aber ändere, werde deutlich, dass „die kulturwissenschaftliche Perspektive gegnüber der dominie-renden liberal-rationalitätstheoretischen Sichtweise nur scheinbar parasitär, vielmehr das eigentliche Wirtstier“ sei (ebd.: 54).
4.2.2 Die Programmatik der gouvernementalen Perspektive
In einem 2001 geführten Interview liefert Thomas Lemke eine konzise, quasi defini-torische Darstellung des Gouvernementaltätsansatzes, die für die deutschsprachige Rezeption maßgeblich ist:
Das Konzept der Gouvernementalität geht auf Michel Foucaults umfassenden Be-griff von Regierung zurück, der sich nicht nur auf politische Prozesse oder staatliche Instanzen bezieht, sondern allgemeiner auf die Kunst der Menschenführung. Im Mit-telpunkt des Untersuchungsinteresses steht das Zusammenspiel von Wissensformen, Machtstrategien und Subjektivierungsformen. Analysiert werden jene Rationalitäten und Technologien, die auf die systematische Lenkung und Kontrolle von Individuen und Kollektiven zielen und gleichermaßen Formen der Selbst- wie Fremdführung enthalten.
Die theoretische Bedeutung dieser Perspektive liegt zum einen darin, dass sie tradi-tionelle sozialwissenschaftliche und politische Dualismen umgeht. Die Differenz von Ideologie und Wahrheit, Staat und Markt, Zwang und Konsens wird nicht als Aus-gangspunkt und Grundlage, sondern als Instrument und Effekt gesellschaftlicher Verhältnisse begriffen. Dies macht es zum anderen erforderlich, etablierte Kritik-muster zu überdenken. So weisen Kritikformen, die den ideologischen Charakter, den ökonomischen Gehalt oder die repressiven Effekte neoliberaler Praktiken in den Vordergrund rücken, auf wichtige Aspekte dieser Regierungstechnologie hin. Das Problem besteht jedoch darin, dass sie ihren Widerstand auf eben jene Konzepte stützen, die dem selbstformulierten Anspruch nach gerade Gegenstand der Kritik sein sollen. (Lemke 2001: 1)
Im Zentrum der analytischen Aufmerksamkeit des Gouvernementalitätsansatzes steht also die „neoliberale Gouvernementalität“. Der „Neoliberalismus“, den manche sei-ner Vetreter in einem Akt ideologischer Kindesweglegung (Kreisky 2001: 3) als Ge-spinst und Erfindung seiner Kritiker von sich weisen, wird in der Analytik der Gou-vernementalität nicht als „falsches Wissen“ oder als ideologische Rhetorik, als polit-ökonomische Realität oder als praktischer Antihumanismus kritisiert, sondern vor allem als politisches Projekt aufgefasst, das darauf abzielt, „eine soziale Realität her-zustellen, die es zugleich als bereits existierend voraussetzt“ (Lemke u.a. 2000: 9).
Das Programm der Gouvernementalität ist bei Foucault eher ein fragmentarischer Entwurf denn ein augearbeitete Theorie oder ein abgeschlossenes Forschungspro-gramm; es skizziert allenfalls ein analytisches Instrumentarium (vgl. Lemke 2003: 270) bzw. eine analytische Achse, mit der die Technologien der Macht in ihrem Zu-sammenhang mit kollektiven und individuellen Subjektivitäten in den Blick genom-men werden können:
Der Souverän scheint im Neoliberalismus mit den Untertanen verschmolzen zu sein, die Untertanen haben sich das Handeln des Souveräns zueigen gemacht. Die Gouver-nementalität verweist so auf die Totalität des Regierens, das den Geist und die Seele der Subjekte durchkreuzt und formt. In diesem Prozess bildet die repressiv-juridische Macht (puissance) die produktiv handlungsleitende Wirkkraft (pouvoir) der Macht aus. An diesem Punkt formen sich Subjektivitäten, die von den Kraftlinien der Macht bestimmt werden, diese Machtstränge aber auch unterbrechen, durchbrechen und wegbrechen. (Pieper / Rodriguez 2003: 11)
Die Subjekte erscheinen somit nicht mehr nur als Knotenpunkte im Netz von Macht und Wissen und als passive Objekte im Schnittpunkt von Macht und Wissensproduk-tion, sondern als sowohl produzierte und zugleich aktive, machtausübende, auf das Handeln anderer Einfluss nehmende und zur Selbstführung fähige Subjekte (vgl. Pieper 2003: 137 f):
Foucaults Überlegungen zur modernen Gouvernementalität zielen darauf zu verdeut-lichen, wie Regierung über die Selbstregulationsfähigkeit von Subjekten operiert und verkoppelt ist mit gesellschaftspolitischen und vor allem ökonomischen Zielen einer Profitmaximierung […]. (Ebd.: 138)
Die analytische Perspektive des Gouvernementalitätsansatzes konzentriert sich pri-mär auf programmatische Texte, insbesondere auf die Diskurse der aktuellen (neo-liberalen) Managementliteratur, deren Fluchtpunkt das „unternehmerische Selbst“ (oder das „selbstangetriebene Ich“, die „Ich-AG“, der „Arbeitskraftunternehmer“ etc.) bildet. Diese Fokussierung auf programmatische Texte bringt dem Gouverne-mentalitätsansatz den Vorwurf ein, einem linguistischen Idealismus zu frönen:
Weitgehend ungeklärt ist nämlich bisher, wie dieses in den Govermentality Studies konstatierte (Trans-)Formierungsgeschehen moderner Subjektivierungsweisen theo-retisch begriffen und empirisch beschrieben werden kann, ohne einerseits substanz-ontologische Auffassungen von Subjektivierung vorauszusetzen und ohne anderer-seits Subjektivierung diskursiv aufzulösen und so in die Fallstricke eines linguisti-schen Idealismus zu geraten. (Bührmann 2005: Absatz 47)
Die Anwendung der gouvernementalen Perspektive etwa im Glossar der Gegenwart zeigt bald einen Sättigungseffekt, oder, wie es Dirk Knipphals in einer Rezension ausdrückt, es „nervt […] manchmal schlicht, wenn alle zehn Seiten die in den Be-griffen liegenden erweiterten Handlungsmöglichkeiten, wenn die Verheißungen der Selbstverwirklichung, die sie ausdrücken, als gesteigerte Mechanismen der Macht entlarvt werden“ (Knipphals 2004). Wenn ohnehin klar ist, was in einer gouverne-mentalen Lektüre gezielt ausgewählter Reizwörter herauskommt, könnte man/ frau sich die Mühe sparen.
Insofern besteht hier tatsächlich ein Forschungsdefizit, allerdings weniger auf Grund der fehlenden Empirisierung, wie Bührmann moniert (zumal sich der Gouvernemen-talitätsansatz mit dieser programmatischen Ebene bescheidet und nicht auf die Unter-suchung der „Umsetzung“ oder „Anwendung“ dieser Programme in konkreten Indi-viduen abzielt), sondern auf Grund des Effektes einer theoretischen Monotonie. Das Glossar der Gegenwart liest die in ihm enthaltenen Leitbegriffe
als Programme des Regierens, die Probleme definieren, sie in einer bestimmten Wei-se rahmen und Wege zu ihrer Lösung vorschlagen. Programme formen Realität, in-dem sie Diagnosen stellen und Therapien empfehlen. Sie prägen Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Handlungsweisen, indem sie Ziele anvisieren und Verfahren be-reitstellen, um diese zu erreichen oder ihnen zumindest näher zu kommen. Sie rufen Menschen an, sich als Subjekte zu begreifen und sich in spezifischer Weise – kreativ und klug, unternehmerisch und vorausschauend, sich selbst optimierend und ver-wirklichend usw. – zu verhalten, und fördern so bestimmte Selbstbilder und Modi der „inneren Führung“.
[…] Offen bleibt dabei, in welchem Maße die Programme des Regierens und des Sich-selbst-Regierens das Denken und Tun der Menschen bestimmen. Die hier vor-gelegten Beiträge untersuchen nicht, ob Programme wirken, sondern welche Wirk-lichkeit sie schaffen. […] Analysiert wird kein Produkt, sondern ein Produktionsver-hältnis. (Bröckling u.a. 2004: 12 f)
Zwischen die Programme und die tatsächliche Wirkung schiebt sich offenbar so et-was wie eine Wirklichkeit, ein dispositive Institutionalisierung der programmatisch intendierten Wirkung, die dann handfeste Wirklichkeit für die Beinstitutionalisierten wird, mit der sie sich dann irgendwie arrangieren müssen. Das ist wohl mit Bühr-manns Foucault-immanentem Lösungsvorschlag für das selbstkonstruierte Dilemma zwischen der Skylla eines linguistischen Idealismus’ und der Charybdis einer Sub-stanz-Ontologie der Subjektivierung im zu empirisierenden Gouvernementalitätsan-satz gemeint. Dieser sei diskursanlytisch, ergo idealistisch orientiert, weshalb er dis-positivanalytisch -empirisch zu komplettieren sei; anzumerken ist, dass eine solche Polarisierung in eine idealistische Diskursanalyse und eine empirische Dispositiv-analyse mehr als fragwürdig ist:
Die Diskursanalyse unterstellt weder das Sprachmodell einer Repräsentation der äußeren Welt durch Sprache, noch eine Autonomie der Sprache oder eine radikale Konstruiertheit der Wirklichkeit durch sprechende Subjekte. Die Gegenstände wer-den vielmehr im Diskurs hervorgebracht, diese Produktion kann aber nicht durch einen einzelnen Sprechakt geleistet werden, der einzelne Sprechakt kann vielmehr die Illusion des Verweisens auf Gegenstände, die vor oder außer ihm liegen, erzeu-gen, weil die Produktion der Gegenstände im Diskurs aufgrund der Wiederholung, der Iteration der diskursiven Praktiken, bereits stattgefunden hat […]. (Wrana 2003: 113)
Der Gouvernementalitätsansatz behauptet mitnichten eine Homologie zwischen den aus programmatischen Texten gewonnenen Subjektformierungen und empirischen Subjekten (vgl. Pieper 2003: 155):
Eine absolute Korrespondenz beider würde auf einen absoluten Stillstand der Welt hinauslaufen. Positiv formuliert, ereignet sich in der Nische der Diskrepanz von Pro-gramm und Praxis die Geschichte, die möglicherweise zu einem Umbau der Gouver-nementalität führt. (Opitz 2004: 54)
Programme operieren im Modus der Problematisierung und setzen bestimmte Wis-senstypen mit der Absicht ein, systematische Änderungen zu erreichen; insofern be-finden sie sich damit an der Schnittstelle von Denk- und Handlungsformen bzw. an der Schnittstelle ihrer Reorganisation (vgl. ebd.).
Nur weil der Gouvernementalitätsansatz seine Aufmerksamkeit nicht auf die Mög-lichkeiten politischer Widerständigkeit richtet, heißt das noch lange nicht, dass er sich deshalb mit dem von ihm Analysierten verbrüdert und ironischerweise dessen Individualisierung und Totalisierung verdoppelt (was ihm von Brunnett / Gräfe 2003: 63 vorgeworfen wird) oder dass er deshalb herrschaftsaffirmativ sei (Langemeyer 2003: 8).
Die Enthaltsamkeit in Sachen Widerstand ist möglicherweise sogar ein Vorzug des Gouvernementalitätsansatzes, zumal die Haltung des Widerstands für Slavoj Zizek hegemonial und „gerade dieser Diskurs des „Widerstands“ heute die Norm und da-mit das größte Hindernis für die Enstehung eines Diskurses ist, der die bestehenden Verhältnisse tatsächlich in Frage stellt“ (Zizek 2003: 156).
Die Analyse gouvernementaler Rationalitäten ist also ein Modul einer vernetzten Analyse komplexer sozialer Realität unter anderen (vgl. Pieper 2003: 156), das durch empirische Analysen, wie sich konkrete Individuen zu den programmatischen Anru-fungen ins Verhältnis setzen und als Subjekte konstituieren, nicht erübrigt, sondern vervollständigt wird.
Ironischerweise nun wurde die monierte Forschungslücke nicht von jenen gefüllt, die sie beklagen. Es ist vielmehr ein Roman, nämlich der gouvernementale Roman von Kathrin Röggla namens wir schlafen nicht (Röggla 2004 a), der die Reibung zwi-schen den Ideologien und der Erfahrung (Röggla 2004 b: 3) atmosphärisch einfängt. Der Roman basiert auf zahlreichen Interviews mit Vertretern der Consulting -Branche und montiert Textpassagen daraus. Ihre Interviewtechnik bezeichnet die Autorin als hysterische Affirmation –
Wenn man da keinen Widerstand reinsetzt und sie so hineintreibt, entstehen schnel-ler Kippmomente. Zunächst erzählt dir jeder einmal, wie toll es ist, wie spannend es ist und was man alles machen kann. Und selbst wenn du sie bestärkst, kommt dann irgendwann recht schnell dieser Kipppunkt, an dem das alles abstürzt. (Ebd. 4 f)
–, eine wenig menschenfreundliche Version des narrativen Interviews also, ein inszenierter und forcierter Selbstleerlauf, der den gouvernementalen Denkansatz po-lyvalent gewinn- und preisträchtig illustriert, aber den Maßstäben ernsthafter Sozial-forschung freilich nicht genügt (weshalb es ja auch – wenig lustvolle – Literatur ist).
Fassen wir kurz zusammen: Der Gouvernementalitätsansatz wird für seine Fixie-rung auf Regierungsprogramme (im weitesten Sinne) kritisiert und, da er einen pro-duktiven Machtbegriff im Anschluss an Michel Foucault voraussetzt, teilweise sogar der Komplizenschaft mit den existierenden Herrschaftsverhältnissen bezichtigt. Statt-dessen solle analysiert werden, welche Wirkung die neoliberal propagierten Selbst-technologien und Selbstführungstechniken bei konkreten Individuen haben bzw. wie diese in widerständiger Weise damit umgehen. Strukturell erinnern die Positionen in dieser Kontroverse an das klassische Sender-Medium-Empfänger-Modell: Programm (Sender) – Selbsttechnologien (Medium) - Subjekte (Empfänger).
Der Gouvernementalitätsansatz analysiert dabei die Produktionsseite, also Pro-gramm-Diskurse, die soziale Realitäten herstellen wollen, indem sie dispositiv Sub-jektivierungstechniken und Möglichkeitsräume für Handeln mit freiheitlichem Aus-sehen forcieren und so die Individuen zu selbstverantwortlichen und selbstgesteuer-ten Subjekten dieser Programme und der so konstruierten sozialen Realität machen.
Die Kritik an dieser Vorstellung setzt das Subjekt bereits als selbstverantwotliches, zumindest aber nicht durch Programme vollständig determiertes und determinierba-res an, sondern als eigenwilliges, kritisches, kreatives… Subjekt – also genau jenes gouvernementale Subjekt, dessen Produktion bzw. Produktionsverhältnis der Gou-vernementalitätsansatz analysieren will.
Die beschriebene Konstellation zwischen dem Gouvernementalitätsansatz und der hier vorgetragenen Kritik daran erinnert zudem an das Verhältnis zwischen der Kri-tischen Theorie und den Positionen der Cultural Studies zu den populären Produkten der Kulturindustrie. Ähnlich wie die KritikerInnen am Gouvernementalitätsansatz setzten auch die Cultural Studies auf Seiten der Rezeption Kreativität und Subjekt-qualitäten an:
Nur das Vorhandensein eines Subjekts an dieser Stelle lässt umfassendere gesell-schaftliche Transformation überhaupt denkbar werden. Die eingreifende Praxis der Theorie benötigt einen Adressaten, an den sie sich mit einiger Hoffnung auf Reso-nanz zu wenden vermag. Insofern dürfte der Konstruktion gerade jene Sozialroman-tik zugrunde liegen, deren rigide Zurückweisung die Kritische Theorie zu ihrem Konzept einer negativen Totalität geführt hat. (Leschke 2003: 204)
Die – fiktive – Anwort lautet:
Die analytische Leistung der Gouvernementalitätsstudien ist zweifelsohne eine auf-klärerische, jedoch sie scheint an vielen Stellen von einem romantischen Wunsch ge-tragen, sich nicht nur von psychologischer, pädagogischer, unternehmerischer und politischer Gängelung zu befreien, sondern von den Existenzweisen selbst, in denen Reflexion, Selbstkontrolle und Gemeinwesenarbeit notwendig sind. Eine solche Existenzweise ist aber nur als Privileg vorstellbar und setzt damit Herrschaftsver-hältnisse voraus. (Langemeyer 2003: 18)
Langemeyer interpretiert hier die Perspektive zweiter Ordnung (Opitz) des Gouver-nementalitätsansatzes sozialkritisch als herrschaftlich-elitären Blick (argumentum ad hominem); denn die „Analytik der Regierung formuliert keine universellen Prinzi-pien, denen gegenüber sie die bestehende Realität als defizitär erklärt und zugunsten einer den Prinzipien gerecht werdenden, vollkommeneren Realität“ (Opitz 2004: 161), sie betreibt also keine Ideologiekritik im bereits dargelegten Sinne:
Ihr kritisches Ethos beruht auf dem Anliegen, aus einer Perspektive zweiter Ordnung Phänomene wie Zwang, Wissen, Macht und Freiheit in ihrer spezifischen Figuration zu beschreiben und auf ihre subjektivierenden Wirkungen hin zu befragen, ohne auf universelle Prinizipien Bezug zu nehmen. Somit generiert die Analytik eine distan-zierte Sichtweise, welche die epistemische Kontingenz der Regierungsmechanismen herausarbeitet und es ermöglicht, die Konsequenzen von spezifischen Denk- und Handlungsformen zu benennen. (Ebd.: 162)
Als distanzierte Perspektive zweiter Ordnung teilt der Gouvernementalitätsansatz mit dem Konstruktivsimus bzw. den verschiedenen konstruktivistischen Strömungen ei-nen Relativismus, der darauf gerichtet ist, „universalistische Reduktionismen und Letztbegründungen von Wahrheiten in den gegenwärtigen Diskursen zu bekämpfen“ (Reich 2001: 367); ebenso lässt sich bei Foucault ein impliziter Konstruktivismus ausmachen, insofern bei ihm immer wieder die Rede von den „unterschiedlichen so-zialen, machtbezogenen, lebensweltlichen usw. Konstruktionen von Wahrheit oder Praktiken (als wechselnder Ausdruck unterschiedlicher Verständigungsgemeinschaf-ten im sozialkulturellen Wandel)“ sei (ebd. 169). Theoretisch wären diese Ansätze also durchaus anschlussfähig.
Nun wird aber im Rahmen der pädagogischen Rezeption des Gouvernementalitäts-ansatzes insbesondere der pädagogische Theorieimport des Radikalen Konstruktivis-mus’ als herrschaftsaffirmativ und letzterer als Lieferant einer Durchsetzungsideolo-gie gebrandmarkt (z.B. Wrana 2003: 138); ein Kapitel in Ludwig A. Pongratz’ Auf-satz Konstruktivistische Pädagogik als Zauberkunststück heißt bezeichnenderweise Ideologieimport: Der (neoliberale) Tiger im (konstruktivistischen) Tank (Pongratz 2004 b: 127). Allerdings (siehe oben) trifft das „Verdikt“ der Herrschaftsaffirmation (wohl eher eine semantische Keule) den Gouvernementalitätsansatz gleichermaßen, zudem ist noch nicht ausgemacht, wie dieser auf die erste pädagogische Ordnung he-runtergebrochen werden wird (oder ob überhaupt), aber, wenn ich mich täusche, geht es in Richtung einer Renaissance oder eines Updatings einer kritisch-emanzipatori-schen Erziehungswissenschaft, die durch das poststrukturalistische Fegefeuer gegan-gen ist.
Insofern wird hier Schmidts Terminologie der Komplementarität von Wirklichkeits-modellen und Kulturprogrammen als durchaus vereinbar mit der gouvernementalen Perspektive betrachtet, welche, nebenbei, bei allen rhetorischen Abgrenzungsbe-mühungen nicht wirklich über die Plastikwörter Pörksens hinaus geht bzw. diese al-lenfalls aktualisiert. Auch Pörksen betrachtet seine Plastikwörter (u.a. „Kommunika-tion“) als „Bauelemente neuer Wirklichkeitsmodelle“:
Die neuen Wörter strahlen in die verschiedensten Sektoren aus und verändern das Gesicht der Welt. Seitdem sie durch die Wissenschaft hindurchgewandert sind, eig-nen sie sich für Entwürfe, werden sie zu Baumodellen von Modellen, denen dann die Wirklichkeit nachkommt. Wie aus einer Retorte lassen sich mit ihnen Wirklichkeits-modelle hervorzaubern, und der Schritt vom Wort zur Verwirklichung scheint sehr klein zu sein. (Pörksen 1988: 67)
Aus Schmidts Perspektive wären die Plastikwörter aber bereits auf der Ebene von Programmen anzusiedeln, zumal auf der Ebene der Wirklichkeitsmodelle im Sinne von strukturorientierten, statischen semantischen Netzwerken „im Prinzip alle Ka-tegorien mit allen Kategorien verbindbar wären“ (Schmid 2003: 39); Pörksen be-schriebe dann gleichsam dynamische semantische Netzwerke, die in sich allseitig ver-bindbar wären bzw. durch die SpielerInnen verbunden werden sollen bzw. müssen (vgl. zur Programm metapher auch Höhne 2003 b: 279 ff).
Rudolf Maresch präsentiert unter dem Titel Identitätszumutungen (nach Niklas Luh-mann) ein zumindest typographisch differenziertes Tableau, welches einen Aus-schnitt aus dem semantischen Netzwerk jener Spielsteine und Programmodule auf-führt, die, wie auch immer, gegenwärtig durchzuspielen sind:
Konzepte wie Aktivierung und Empowerment, Partizipation und Flexibilität, deren Wurzeln auf die Kämpfe sozialer Emanzipationsbewegungen zurückweisen, haben sich in institutionelle Anforderungen und normative Erwartungen verwandelt. Sub-version und Dissidenz sind inzwischen zur Produktivkraft geworden. Es scheint, als müssten die Menschen nicht mehr diszipliniert werden, sondern würden sich durch die ihnen auferlegten institutionellen Arrangements hindurch selbst realisieren; als müssten sie nicht angeleitet werden, sondern würden sich selbst mobilisieren. Zu-gleich verweisen Konzepte wie Lebenslanges Lernen, Prävention oder die allgegen-wärtige Evaluation darauf, dass Beobachtung, Überwachung und Kontrolle allgegen-wärtig und Selbstoptimierung unabschließbar geworden sind. (Maresch 2005: 6 f)
(Maresch 2005: 7; semantisches Netzwerk des „neuen Diskurses“ des „Selbstmanagements“)
Ein solches Schaubild illustriert allenfalls das gegenwärtige soziale „Klima“, es er-klärt aber nichts. Das erste Beispiel für die pädagogische Rezeption des Gouverne-mentalitätsansatzes – eine gouvernementalistische Studie zum Weiterbildungssystem von Daniel Wrana – zeigt, wie ein solches semantisches Netzwerk mit Hilfe der dia-chronen diskursanalytischen Kontrastierung zum Sprechen gebracht wird.
4.3 Beispiele pädagogischer Rezeption
Hier kann selbstverständlich keine Überblicksdarstellung der pädagogischen Rezep-tion der gouvernementality studies geleistet werden; ich beschränke mich deshalb auf zwei Beispiele, die pädagogische Phänomene aus gouvernementalistischer Perspekti-ve beleuchten und zugleich dem Argumentationsgang dienlich sind.
4.3.1 „Lernen lebenslänglich…“ (D. Wrana)
Das „lebenslange Lernen“ ist – wie „die Globalisierung“ – die „pädagogische Ent-grenzungsformel“ schlechthin.
(Seiverth 2005: 4)
Daniel Wrana untersucht in seiner Studie Lernen lebenslänglich… die Karriere des lebenslangen Lernens aus einer gouvernementalitätstheoretischen Perspektive mit Hilfe des diskursanalytischen Instrumentariums.
Wrana geht von Foucaults „diskursiven Formationen“ aus; die erste Instanz bilden dabei die Begriffe, die sich darin verfestigen (vgl. Maresch’ Schaubild); im Zusam-menhang des lebenlangen Lernens wählt Wrana (ebenfalls typografisch abgesetzte) Wörter, „die für die Kräfte des Individuums gesetzt werden“ (Wrana 2003: 112):
(Wrana 2003: 112)
Die zweite Instanz in den diskursiven Plateaus ist ein Feld von Gegenständen (nicht im Sinne vorsprachlich präexistenter, sondern im Diskurs hervorgebrachter Gegen-stände); im Fall des lebenslangen Lernens geht Wrana von vier Klassen von Gegen-ständen aus, die mit den Begriffen der ersten Instanz in Relation stehen:
(1) die Kraft einer Entität, irgendetwas zu erreichen oder zu tun, der Gegenstand, auf den diese Begriffe indizieren.
(2) die Entität, die Trägerin dieser Kraft ist, z.B. der Mensch, das Subjekt, das Individuum, der Lerner
(3) eine umfassende Entität, in der die Trägerin der Kraft eine bestimmte Position einnehmen kann, das ist eine Klasse von Gegenständen, die ich Gesellschafts-körper nenne.
(4) Regierungspraktiken: Handlungsweisen, die den Zweck haben, auf die ersten drei Gegenstände Einfluss zu gewinnen. (Ebd.: 113)
Auch Wrana analysiert nicht die Regierungspraktiken selbst, sondern Texte über die-se Praktiken, nämlich „wie zukünftige, erwünschte, geforderte, anzustrebende Re-gierungspraktiken zu einem Gegenstand für den Diskurs werden“ (ebd.). Wrana ana-lysiert vier Gutachten bzw. Programmpapiere unterschiedlicher Expertenkommissio-nen aus vier Jahrzehnten zum Thema Erwachsenen- und Weiterbildung, die auf einer „sehr basalen Ebene zunächst einmal die Gegenstände, von denen sie sprechen“, pro-duzieren (ebd.: 110): „Das Gutachten ist das sichtbare Ergebnis von Praktiken der Produktion von Wissen, die dem Feld erst Intelligibilität verleihen, es begreifbar und verstehbar machen und so die unabdingbare Voraussetzung für weitere Regierungs-praktiken sind“ (ebd.: 114).
Die dritte Instanz der diskursiven Formationen bilden die Äußerungsmodalitäten, die Art und Weise des Sprechens, die vierte Instanz sind die thematischen Wahlen bzw. thematischen Strategien, sie bezieht sich also auf die Relation, die die Begriffe und Gegenstände annehmen. Grafisch veranschaulicht Wrana dieses Netz aus Begrif-fen, Gegenständen und einer thematischen Wahl im folgenden Schaubild:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wrana wendet dieses analytische Raster auf die folgenden vier Gutachten an:
- 1960: „Zur Situation und Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung“ aus der Reihe „Empfehlungen und Gutachten des Deutschen Ausschusses für das Er-ziehungs- und Bildungswesen“
- 1970: „Strukturplan für das Bildungswesen“ aus der Reihe „Deutscher Bildungs-rat. Empfehlungen der Bildungskommission“
- 1984: „Weiterbildung. Herausforderung und Chance“. Bericht der Kommission Weiterbildung im Auftrag der Landesregierung von Baden-Würtemberg
- 1997: „Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungslage“. Teil 3 des Gut-achtens „Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in Deutschland“, Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen
In unserem Zusammenhang sind vor allem die Analysen des zweiten und des vierten Gutachtens von Interesse; 1970 deshalb, weil dort der gesellschaftliche Zusammen-hang entworfen wird, in welchem „Medienkompetenz“ die diskursive Bühne betritt; 1997 deshalb, weil hier die „Medienkompetenz“ bereits zur Schlüssel- und Univer-salkompetenz avanciert ist. Der Zeitraum 1970-1997 ist zudem jener, in welchem die bereits zitierte Umcodierung emanzipatorischer Ziele erfolgt.
- 1970: „Strukturplan für das Bildungswesen“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Wrana 2003: 120)
Kernzitate:
- In dieser diskursiven Formation bildet die Gesellschaft einen glatten Raum, das heißt, einen Raum, der nicht segmentiert ist, sondern von jedem Individuum be-liebig durchlaufen werden kann. Das Individuum steht also nicht in der Mitte, sondern es ist anhand der beiden Achsen beliebig verschiebbar. Die vertikale Achse ist wohlgemerkt nicht die Achse sozialer Ungleichheit wie im Schichtmo-dell, sondern der Lebenslauf. Eine soziale Differenzierung als Hierarchie von so-zialen Schichten existiert in diesem Raum nicht mehr, sie ist nur noch eine beruf-liche Differenzierung auf der horizontalen Achse. (Ebd.: 119)
- Das lernende Individuum gehört in diesen Raum, es ist nur in diesem glatten Raum denkbar und sinnvoll, weil es sich über seine Verschiebbarkeit definiert. Es kann – es hat jedenfalls das Recht dazu, es zu können – alles lernen und jede Po-sition erreichen. Dafür steht der Begriff der Chancengleichheit. (Ebd.: 121)
- Das lernende Individuum bewegt sich nicht nur in einem glatten Raum, sondern es nimmt selbst etwas von der Glätte des Raumes an. […] Erwachsensein heißt nicht mehr „mündig sein“, heißt nicht mehr „eine Identität gefunden haben und behalten“, sondern heißt, als flexibler Mensch in einem Raum ständiger Verfüg-barkeit „flüssig“ und „schmiegsam“ zu bleiben. (Ebd.)
- Qualifikation ist immer Qualifikation für etwas anderes als das Ich. Und dieses Andere ist die Erwerbstätigkeit. Aber in dieser Orientierung an der Erwerbstätig-keit sollen berufliche und allgemeine Qualifikationen immer miteinander verbun-den sein. Die allgemeinen Qualifikationen bilden eine „Überqualifikation“ und diese macht „frei“. (Ebd.: 121 f)
- Die Weiterbildung soll auch in sich ein System bilden, nämlich ein Baukasten-system, in dem das gesamte Lernen im Erwachsenenzeitalter zentral geplant und kontrolliert wird, und die einzelnen Angebote wie Bausteine aufeinander auf-bauen und sich gegenseitig ergänzen. Der Staat hat diese vereinheitlichende Auf-gabe, und zu den Mitteln, zu denen er infolgedessen greifen muss, gehört eine Melde- und Auskunftspflicht für Weiterbildungsangebote. (Ebd.: 122)
- 1997: „Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungslage“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Wrana 2003: 128)
Kernzitate:
- Die Träger der Kräfte – die Subjekt-Individuum-Menschen – erscheinen nicht mehr als passiv über die Qualifikationen verfügend, die die Arbeitgeber benöti-gen, sie müssen nicht mehr nur „mobil“ sein, um sich entsprechend anzupassen, sie haben nicht nur die „Schlüsselqualifikationen“, die ihnen die entsprechende Flexibilität in der Qualifikationsanpassung geben, all das bisherige lässt die Ini-tiative bei einem mysteriösen „Anderen“. Bisher zählte Anpassung. Das genügt jetzt nicht mehr. Benötigt wird der „Unternehmer seiner Selbst“ und dieser de-finiert sich geradezu durch die Form seiner inneren Kräfte: das Unternehmer-tum. (Ebd.: 126)
- [Der Begriff Kompetenz ] zeichnet sich gegenüber Bildung und Qualifikation gerade dadurch aus, dass er das Nutzlose des Ersten und das Unterworfene des Zweiten vermeidet. Bildung und Qualifikation, so betonen die emphatischen Pä-dagog/-innen heutzutage, bilden keinen Widerspruch mehr. Wollen und sollen sind eins, „will“ und „skill“ gehen heute zusammen.
Kompetent ist, wer unternehmerisch sich selbst gegnüber handelt. Die diskursive Funktion des Begriffs selbstgesteuertes Lernen gehört ebenfalls in diesen Zu-sammenhang, indem die kostenaufwändige Lehrtätigkeit auf die Ich-Unterneh-mer/-innen selbst abgewälzt wird. (Ebd.: 127)
- Der Mensch – anthropologisch gesagt – ist nicht mehr der Erwerbstätige, sondern der Unternehmer und nur insofern der Mensch ein Unternehmer ist, ist er ein Mensch, dies impliziert enorme Ausschlüsse im Gesellschaftskörper. […] Um die „Wirtschaft“ umzubauen, müssen große Teile der Bevölkerung – einmal ist von 80% die Rede – massive Gehaltseinbußen und damit eine Verminderung des Lebensstandards hinnehmen. In diesem Bereich gibt es eine sogenannte „Niedrig-lohnstrategie“, die damit verbunden ist, dass solche Leute „einfache Dienste“ an-nehmen. Diese werden vage spezifiziert: Kindermädchen, Haushälterin, Butler. (Ebd.)
- Welche Regierungspraktiken sind damit verbunden? Im Gutachten wird betont, dass es zunächst die Einstellungen sind, die verändert werden müssen und zwar massiv. […] Zunächst müssen nicht die Schwachen, sondern die Starken beson-ders gefördert werden, man muss zur Elitebildung zurückfinden. […] Aber das zentrale Regulationsinstrument ist der drohende finanzielle Abstieg, nur über die Drohung der Armut lassen sich Mentalitäten umbauen. (Ebd.: 128)
- Das Gutachten von 1997 fordert als äußerste „Schlüsselqualifikation“: die Bereit-schaft zum sozialen Abstieg. (Ebd.: 129)
- Alles sieht so aus, als ob unter den gegenwärtigen Bedingungen Verhältnisse der Ausbeutung nicht mehr ideologisch getüncht werden müssen, sondern direkt das Zeug zur gesellschaftlichen Selbstbeschreibung haben. (Ebd.: 135)
- Die Disziplin der Erwachsenenbildung reagiert auf eine Lage dieser Art nicht mit Analyse und Kritik. […] Vom diskursanalytischen Standpunkt aus gesehen sind die Thematisierungen der Erwachsenenbildung nur eine Umkehrung ihres Erbes, der kulturkritischen Position. Es ist nicht mehr en vogue zivilisationskritisch zu sein, daher befürwortet man nun rückhaltslos, was man zuvor verdammte. […] Für eine ganze Reihe von Vertreter/-innen der Disziplin erscheinen die neuen Lernkulturen und ihr lebenslanges Andauern als Prozess der Befreiung. Die The-men werden unablässig variiert, mit dieser Art und Weise der Problematisierung gerät die Disziplin aber in einen affirmativen Diskurs. Erwachsenenbildung in ihrer modernsten Form ist nicht mehr die Verantwortung von Gesellschaft oder Staat, sondern wird zur Infrastruktur der eigenen Lebensführung. Der einzelne wird beschworen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich um sein Können selbst zu kümmern. Das Modell des autopoietisch selbstlernenden Sub-jekts ist der Ausdruck dieses neuen Verständnisses vom lernenden Erwachsenen, von jenem „Teilnehmer“, der nicht mehr teilnimmt, sondern einfach nimmt, was er braucht […]. (Ebd.: 136 ff)
Woher aber weiß er/sie, was er/sie braucht?
4.3.2 The autonomous Chooser (J. Marshall)
An Foucault anschließende gouvernementalistische Studien im Sinne einer Neolibe-ralismuskritik auf dem Feld der Pädagogik wurden zuerst in jenen Ländern durch-geführt, in welchen in den 1980er Jahren ein neoliberaler Umbau des Wohlfahrts-staates in einen Wettbewerbsstaat und gleichzeitg die Kommodifizierung („Verwa-renförmigung“) von Bildung vorangetrieben wurden: Großbritannien (Thatcheris-mus), USA (Reaganomics) und in Neuseeland (The Newzealand Experiment; vgl Larner 2000), wobei Neuseeland die neoliberale Doktrin am konsequentesten um-gesetzt hat (weshalb dort schon von einer „post-neoliberalen Phase“ geredet wird), während die USA sie innerstaatlich nur inkonsequent verfolgen, international aber als Mittel der Wahl gegen alle Übel propagieren.
James Marshall, Pädagogikprofessor in Auckland, thematisiert unter dem Titel The autonomous chooser eine Modifikation von Foucaults Biomacht zur Busno-power, in der pädagogische Praktiken eine zentrale Rolle spielen sollen, weshalb er hier ange-führt wird:
Bio-power was directed at and through the body at the health and sexuality of the person and through that at populations. This new form of power, which I call busno-power, is directed at the subjectivity of the person, not through the body but through the mind, through forms of educational practice and pedagogy which, through choi-ces in education, shape the subjectivities of autonomous choosers. (Marshall 1995: 3)
In der Ausübung der Busno-power (abgeleitet von business) verschmelzen Ökono-mie, Gesellschaft und „Regierungsaktivität“ (Marshall 1998: 76); der autonomous chooser ist für Marshall ein neoliberales Substitut für die persönliche Autonomie im traditionellen Sinne:
The autonomy of the autonomous chooser is different from the autonomy of tradi-tional liberal theory that could or could not be exercised. Now, it seems, choice can-not be resisted. It is not just that human beings are autonomous, or that their autono-my can be developed, or that it is a duty to exercise autonomy. Instead there seems to be a constituent faculty of choice that is necessarily continously exercised on com-modities, and that sweeps aside or overrides the traditional categories and frame-works of human nature and the human sciences. (Ebd.: 77)
Diese extension of the market principle into non-economic area of life (Fitzsimons 2002: 2) überschreitet in den Augen Marhalls – der Foucault als einen naturalised Kantian liest (Peters 2004: 202) – „the fundamental rights of nonviolation of the individual and the individuals self-formulated purposes and projects of earlier liberal thought” (Marshall 1998: 77). Die Bedürfnisse und Interessen des autonomous chooser werden durch ideologies, discourses, and multimedia presentations from governmental agencies that emphasizie the need for skills erzeugt, zumal diese/r als perpetually responsive to the environment betrachtet wird, weshalb er/sie capable of infinite manipulation by the structuring of the environment sein soll: The logical im-plication is that one’s life becomes an enterprise – the enterprise of the autonomous chooser (ebd. 77 f).
Marshall steht für eine konservative Lesart Foucaults, was für manche eine contrad-icitio in adjecto sein mag; dennoch reißt sie zumindest alle Elemente an, die in der deutschsprachigen Rezeption des Gouvernementalitätsansatzes relevant werden. Es findet sich bereits hier das neue System der Akzeptabilität, welches die Trennungs-linien zwischen dem Ökonomischen, dem Juridischen, der Wissenschaft und der Po-litik überschreitet (vgl. Opitz 2004: 89) und von Michael Peters zur neuen Metaer-zählung erklärt wird:
The notion of the enterprise culture, designed for a postindustrial, information eco-nomy of the 1990s, can be seen in poststructural terms as the creation of a new meta-narrative, a totalizing and unifying story about the prospect of economic growth and development based on the triumvirat of science, technology, and education. This master narrative, which projects a national ideological vision, differs from the social democratic narrative: It does not adopt the language of equality of opportunity and it does not attempt to redress power imbalances or socio-economic inequalities. The neo-liberal metanarrative is based on a vision of the future: one sustained by ‘ex-cellence,’ by ‘technological literacy,’ by ‘skills training,’ by ‘performance,’ and by ‘enterprise.’ (Peters 2001: 65f)
Marhalls Begriffbildung der busno-power hat international allerdings wenig Reso-nanz gefunden, vermutlich deshalb, weil er seine Thesen zu pauschalisierend und zu wenig differenziert darlegt. Das Bild einer neoliberalen Instrumentalisierung der Pä-dagogik, das er entwirft, wird im folgenden Kapitel von Thomas Höhne insofern korrigiert, als er Ökonomisierung und Pädagogisierung nicht als konkurrierende, sondern als komplementäre Prozesse analysiert.
5. Der pädagogische Medienkompetenzdiskurs im Lichte des Gouvernementalitätsansatzes
Im Folgenden wird „der“ pädagogische Medienkompetenzdiskurs gouvernementa-listisch beleuchtet. Allerdings werden auch Interpretationsansätze berücksichtigt, welche sich selbst nicht ausdrücklich den Gouvernementalitätsstudien zuordnen, aber sich dennoch – explizit und implizit auf Foucault berufend – in diese Richtung bewe-gen.
Ein solches Vorgehen legitimiert sich dadurch, dass eine dezidiert gouvernementale Lesart sozialer Prozesse letztere als Anwendungsfall einer höheren (Beobachtungs-) Regel konzipiert, was exemplarisch im Glossar der Gegenwart vorgeführt wird, wo die Eröffnung der gouvernementalistischen Perspektive auf Grund des Verfahrens lexikalischer Addition letzlich in einer perspektivischen Schließung resultiert und so wieder das bekannte Schema moderner kritischer Forschung reproduziert (vgl. Ka-pitel 2.4). Dann erübrigte sich die vorliegende Arbeit bzw. könnte auf vier bis fünf Seiten erledigt werden. Insofern wird hier also die (pädagogische) Medienkompetenz zwar gouvernemental eingekreist, aber nicht erledigt bzw. als weiterer Musterfall des ohnehin Gewussten rubriziert. Es geht also nicht um einen Abschied von der Medien-kompetenz (Haase 2003), sondern um neue Ansichten der Medienkompetenz, die das analytische Beobachtungsinstrumentarium des Gouvernementaliätsansatzes gene-riert.
5.1 Ökonomisierung und Pädagogisierung
Wenn Leben zur ökonomischen Funktion wird, bedeutet Deinvestment Tod.
(Bröckling 2003 b: 22)
Thomas Höhne bestimmt Pädagogisierung als „Prozess der Verallgemeinerung eines spezifischen Wissens und einer Rationalität, die sich wesentlich durch die Definition von dem, was Subjekte vermögen und durch Entwicklung zu leisten imstande sind, auszeichnet“ (Höhne 2003 a: 238). Höhnes These ist, dass die pädagogische Macht im Unterschied zu anderen Machtformen wie juridische Macht, politische Macht oder ökonomische Macht eine spezifische soziale Beziehung in der Moderne dar-stelle: „Durch sie werden soziale und kommunikative Beziehungen gestaltet sowie ein neues Wissen etabliert, das – in die Praxis der Erziehung und Bildung übersetzt – die Subjekte spezifisch formt“ (ebd.: 235).
Neoliberale Transformationen als Generalisierung der ökonomischen Form (im Sin-ne eines Analyseprinzips und als Programm; vgl. Bröckling u.a. 2000: 16) sind dem-nach an die Durchsetzung einer spezifischen pädagogischen Form gebunden, wes-halb das originär pädagogische Wissen um Subjektivität „unabdingbar für die Eta-blierung neoliberaler Logiken in unterschiedlichen sozialen Bereichen ist und nicht schlicht unter die ökonomische Form subsumiert werden kann“ (Höhne 2003 a: 237). Höhne benutzt somit den Gouvernementalitätsansatz, der die unterschiedlichen „Ra-tionalitäten, Handlungsformen und Praxisfelder, die auf Steuerung und Kontrolle von Individuen und Kollektiven zielen und gleichermaßen Formen der Selbstführung wie Techniken der Fremdführung umfassen“ (Lemke 2003: 269), analysiert, um eine spe-zifische pädagogische Form/Macht bzw. Machtform zu postulieren, die soziale Praktiken und Diskurse generiert, welche das Politische bzw. das Ökonomische allererst mitermöglichen (vgl. 4.2.1):
Wie für Marx ist auch für Foucault die Trennung von Ökonomie und Kultur in un-terschiedliche Funktionssysteme oder Wertsphären kein unhintergehbarer Ausgangs-punkt, sondern ein historischer Effekt gesellschaftlicher Praktiken, dem er in einer „Ökonomie der Diskurse“ nachgeht. In dieser Hinsicht ist die Ökonomie nicht auf die materielle Reproduktion von Waren zu beschränken, sondern beruht ihrerseits auf der sozialen Reproduktion von Subjekten.
[…] Der Kapitalismus ist kein einheitliches Ensemble, sondern fragmentiert, weni-ger Ursache als kontingenter Effekt sozialer Praktiken, er ist nicht Ausgangs-, son-dern Endpunkt gesellschaftlicher Organisation. (Ebd.: 273 f)
Der Gouvernementalitätsansatz entgrenzt somit analytisch die Ökonomie, macht also, um mit Reckwitz zu sprechen, aus dem Wirten den Parasiten, allerdings nicht in der Absicht, ein oder mehrere eigentliche Wirte ausfindig zu machen, sondern eher, um ein symbiotisches System zu beschreiben, in dem entweder alle Elemente Wirte oder Parasiten oder aber Wirte und Parasiten zugleich sind. Aus dieser Per-spektive hat ein vermeintlich kritischer Apell wie der folgende allenfalls symptoma-tischen Wert:
Notwendig ist nicht eine Ökonomisierung der Pädagogik, was ansteht, ist eine Päda-gogisierung der Ökonomie, ein Beitrag zum Widerstand gegen den Prozess, in dem sich die „Großen Drei“, Naturwissenschaft, Ökonomie und Technik, die Zukunft unter den Nagel reißen. (Weiland 2001: 3)
Heißt das etwa, die Pädagogik solle sich die Zukunft unter den Nagel reißen, den Raubtierkapitalismus durch eine Raubtierpädagogik überwältigen? Will man/frau sich nicht mit dem Bonmot des Parasitologen Michel Serres begnügen „Je weniger Sinn in einem Diskurs, desto mehr nähert er sich der Macht“ (Serres 1987: 254), so stellt sich tatsächlich die Frage nach der „Komplizenschaft der Geburt des modernen Subjekts mit dem Individualitätsdispositiv der Pädagogik“, inwiefern „die Pädagogik (als Wissenschaftssystem und als Erziehungssystem) eine konstitutive Rolle gespielt hat und noch spielt in Subjektivierungspraktiken, die wesentlich sind für unsere heu-tige Situation, d.h. die Etablierung des Individualitäts- und Immunitätsdispositivs“ (Masschelein 2002: 205), wobei Masschelein mit Individualitäts- und Immunitäts-dispositiv das „Unternehmer-Ich“ im Sinne des Gouverneementalitätsansatzes um-schreibt. Wenn es nach Erich Ribolits geht, kann man/frau sich diese Mühe aber spa-ren:
Im Begriff der Pädagogisierung wird Pädagogik als das gesehen, was sie als Wissen-schaftsdiziplin stets zu relativieren versucht hat, zumindest in ihrer praktischen Um-setzung aber tatsächlich immer war: ein System der Zurichtung von Menschen zu angepassten und verwertbaren Mitgliedern der Gesellschaft – verbrämt mit dem Mythos von der Freisetzung der Vernunft […]. (Ribolits 2004: 4)
Stets und Immer war die Pädagogik nie und nimmer. Und wie wäre es mit der päda-gogischen Abrichtung von Menschen zu unangepassten Außenseitern ? Schließen wir die beiden letzten kritischen Zitate in einem ziemlich schrägen Syllogismus kurz:
MAIOR: Notwendig ist nicht eine Ökonomisierung der Pädagogik, was ansteht, ist eine Pädagogisierung der Ökonomie.
MINOR: Im Begriff der Pädagogisierung wird Pädagogik als das gesehen, was sie immer schon war: ein System der Zurichtung von Menschen zu angepassten und verwertbaren Mitgliedern der Gesellschaft.
MEDIUS: Was ansteht, ist eine Pädagogisierung der Ökonomie hin zu einem System der Zurichtung von Menschen zu angepassten und verwertbaren Mitgliedern der Gesellschaft.
Offensichtlich kollidieren hier divergierende Aufassungen von Pädagogisierung und damit auch von Ökonomisierung: Bei Ribolits ist die Pädagogik schon immer ein Hebel der Ökonomie (die für ihn als Konkurrenzkapitalismus zur Mutter aller Ratio-nalität hochstilisiert wird; ebd.: 2), wobei sich aber die Frage stellt, wie er selbst die-ser verzweckenden Zurichtung entkommen konnte (ähnlich wie Rudolf Maresch in 1.3 und Christian Pfeiffer in 3.1). Bei Weiland ist die Pädagogik der Hort einer hu-manistischen Vernunft, welchen die Ökonomie zu durchlaufen hätte, um gesell-schaftsfähig werden zu können; zugleich aber ist diese pädagogische Vernunft bei Weiland eine von den Großen Drei unterdrückte, ergo ist die Pädagogik bei ihm ein Kind, welches nicht belehrt werden muss, sondern von dem etwas zu lernen ist. Bei Ribolits dagegen ist sie ein Kind, das geformt und zugerichtet wird und in der Folge diese Zurichtung abrichtend weiter gibt.
Wenn Pädagogisierung auch sehr divergierend ausbuchstabiert wird, so besteht wenigstens Einigkeit darüber, dass sich gegenwärtig die Felder von Ökonomie und Pädagogik diskursiv überlagern und durchdringen (vgl. Höhne 2004: 59), dass es zur Zeit „anscheinend übereinstimmende Kernbegriffe sowohl im Bereich der Ökono-mie wie in der Bildungsdebatte“ (erweiterte Autonomie, Selbstständigkeit, Innova-tivität, Lernfähigkeit, Flexibilität, Projektorientierung, Teamfähigkeit, Selbstorgani-sation usw; Weiland 2001: 1) gibt:
Auf der Diskursebene (thematische Verknüpfungen, Argumentationen, Topoi usw.) beschreibt „Pädagogisierung“ im Kern drei Elemente: a) die Bezugsgröße aller päda-gogischen Bemühungen stellt das Subjekt dar, das im weiteren auch auf Institutionen und Gesellschaft allgemein bezogen werden kann und b) individuelle und soziale Veränderungen werden durch pädagogische Modi von Lernen, Erziehung oder Bil-dung begründet; c) schließlich gehört der Topos der systematischen Steigerungs-fähigkeit der Subjekte originär zum pädagogischen Wissen (Bildbarkeit, Perfektibi-lität), das sich seit dem 18. Jahrhundert entscheidend als Wissen um die Eigenlogik der Subjekte gerierte und die Entwicklungsfähigkeit der Subjekte gegenüber repres-siven Praktiken betonte (durch Erziehung zu entwickelnde Vernunft, vom Kinde aus usw.). (Höhne 2004: 60)[1]
5.2 Der homo competens
Der homo competens ist die Kombination zweier unterschiedlicher Menschenbilder, nämlich des homo oeconomicus und des homo discens (vgl. Höhne 2003 a: 22), wo-bei Höhne diesen homo competens als normative Variante des Menschen als selbst-referentielles System innerhalb des pädagogischen Lerndiskurses verortet (tabellari-sches Extrakt aus Höhne 2004: 46 f):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Kompetenzbegriff (neu) werde demnach zu einem pädagogisch-ökonomischen Grenzbegriff, der die positiv-normative Anthropologie des neoliberalen Diskurses auf den Begriff bringe – mit dem Effekt, „dass Formen der Selbstökonomisierung der Individuen begrifflich gar nicht mehr in ihren negativen, ehemals als (selbst)re-pressiv kritisierten Effekten erfasst werden (können), da sie nur noch positiv-norma-tiv im Sinne von individueller Kräftesteigerung umformuliert sind“ (ebd.: 49). Kom-petenzen werden so zu Selbsttechnologien im Sinne Foucaults, in denen unterschied-liche Anforderungen an die Subjekte formuliert werden; zudem stellen pädagogische Konzepte wie lebenslanges Lernen und Kompetenzerwerb „Selbstevaluationstechni-ken auf individueller Ebene“ (Höhne 2005: 11) dar.
Subjekttheoretisch besteht das qualitativ Neue darin, sich von dem synthetisch-ein-heitlichen Begriff des Subjekts, wie er sich in klassischen bildungstheoretischen Dis-kursen, aber auch in Vorstellungen von Beruf und Qualifikation widerspiegelt, zu lösen und durch einen Subjektbegriff einer polykontexturalen Subjektivtät zu er-setzen. (Höhne 2004: 54)
Höhne bezieht sich hier augenscheinlich auf Jochen Kade und Wolfgang Seitter, wel-che der Moderne die pädagogische Wissensordnung der „Bildung“, der reflexiven Moderne die pädagogische Wissensordnung des „Umgangs mit Wissen“ zuordnen; unter Wissensordnung verstehen sie einen „Komplex von sinnhaften, Wissen struk-turierenden Unterscheidungen und Schematisierungen, welche die kognitiv-symbo-lische Organisation der sozialen Wirklichkeit“ steuern (Kade/Seitter 2001: 90), pä-dagogische Wissensordnungen sind solche, „die darauf abzielen, einer vieldeutigen Welt eine eindeutig auf die Bildung des Subjekts gerichtete Form abzugewinnen“ (ebd.: 91). Die bildungszentrierte pädagogische Wissenordnung der Moderne als „vereindeutigende, auf dichte Integration und größtmögliche Einheit setzende syn-thetisch-harmonisierende pädagogische Denkform“ (ebd.: 89) wird jedoch durch die pädagogische Wissensform ‚Umgang mit Wissen’ der reflexiven Moderne, der inso-fern auch eine Vereindeutigungstendenz eignet, als sie auf eine struktural-kombina-torische Integration mit Blick auf ein kommunkationsfähiges Subjekt zielt, das Zu-gang zu Netzwerken hat (ebd.: 91) nicht obsolet – genau so, wie die Kontrolle die Disziplin nicht ablöst:
Beide Wissensordnungen sind […] wechselseitig aufeinander bezogen. „Bildung“ enthält als abgedunkeltes Moment, als Schatten die Wissensordnung „Umgang mit Wissen“ und umgekehrt. Vom Standpunkt der historisch neu sich entfaltenden Wis-sensordnung „Umgang mit Wissen“, bei der es um den Zugang zu Wissen durch Er-zeugung/Vermittlung von Netzwerken geht, läßt sich die Wissensordnung „Bildung“ als durch die Aneignung von Wissen geprägte Variante des Umgangs mit Wissen deuten; m.a.W., als Besonderung eines Allgemeinen, das heute erst als solches her-vortritt und seine Universalität relativiert. (Ebd.: 92)
So finde sich in der pädagogischen Wissensordnung „Umgang mit Wissen“ die Per-fektibilität, der unendliche und kontinuierliche Prozess der Subjektbildung der Wis-sensordnung „Bildung“ in Form des lebenslangen Lernens ebenso wieder wie das nun zentral werdende Verständnis des Subjekts als „Selbstverhältnis, als Produk-tionsverhältnis, als Selbstschöpfung“ (ebd.):
Der Unterschied der Wissensordnung „Umgang mit Wissen“ zu dieser Auslegungs-variante von Bildung besteht jedoch darin, dass im Kontext von Bildung dieses Pro-duktionsverhältnis im Inneren des Individuums angesetzt wird, das Subjekt in die-sem Sinne nicht substantialistisch verstanden wird, sondern – inhaltlich leer – als Selbstverhältnis, als Produktionsverhältnis, als Kraft. Im Falle der Wissensordnung „Umgang mit Wissen“ wird das Produktionsverhältnis in netzwerkförmig verbunde-nen sozialen Welten verortet, in die das Individuum eingebettet ist und zu denen es als Ressource dauerhaft Zugang hat, aus der es zur Entfaltung der eigenen Kraft, Kompetenz, Subjektivität schöpfen kann. (Ebd.: 92 f)
Diese Unterscheidung nun mutet ein wenig seltsam an, zumal gemeinhin einem ka-nonisierten Wissen eine Art substantielles Subjekt zugeordnet wird; Kade und Seitter erliegen hier der Innen-Außen-Metapher, dem Möbiusband von Subjektivität (für Foucault eine Faltung; vgl. 5.6).
Das eigentliche, wahre Ich humanistischer Pädagogiken erfährt in der Bewegung zu einer polykontexturealen Subjektivität hin eine Bedeutungsverschiebung. Das neoli-berale Subjekt soll einerseits zu einer „formale[n] Hülle bzw. Hohlform ohne bedeu-tungs- und sinnhaften Kern“ werden (ebd.: 48), andererseits muss es aber über einen funktionalen Kern verfügen, welcher eine „jeweilige Neuadjustierung und Rezentrie-rung des Subjekts ermöglicht, das dann in unterschiedlichen Kontexten agieren und bestehen kann“ (Höhne 2004: 54).
Erhellend sind in diesem Kontext Monica Grecos Ausführungen zur Alexithymie (wörtlich „ohne Worte für Emotionen“; Greco 2000: 266). Alexithymie beschreibt zwar kein eigenständiges Krankheitsbild, wird aber als ein Risikofaktor für somati-sche Erkrankungen betrachtet, gleichzeitig ist Alexithymie „symptomatisch für das Ausmaß, in dem westliche Kulturen Subjektivität mit der Dimension des Inneren identifizieren“ (ebd.: 271):
Wenn wir […] von einem alexithymischen „Subjekt“ oder „Selbst“ sprechen kön-nen, dann in einem Sinne eines Selbst, das nicht in der Lage ist, eine verborgene Wahrheit auszudrücken, also im Sinne eines „falschen Selbst“ […]. Im Unterschied dazu repräsentiert „wahre“ Subjektivität das Prinzip einer gesunden Flexibilität, das bloßen Objekten fehlt. (Ebd.: 273)
Ein authentisches Selbst ist aus dieser Perspektive der „Rohstoff, den die neoliberale Kunst des Regierens von Menschen bearbeitet“ und erscheint als eine „funktionale Voraussetzung sozialer Interaktion in zeitgenössischen (bzw. neoliberalen) Demo-kratien“ (ebd.: 277 f), womit Alexithymie einerseits als ein kulturgebundenes Syn-drom interpretiert wird. Als relativ neue Kategorie des medizinischen Denkens an-dererseits hebt das Konstrukt der Alexithymie „den Raum des Inneren und des Selbst, das dieser Raum definiert, in den Status einer organischen Norm “ (ebd.: 279) und pathologisiert somit Individuen, „die kein Inneres zu haben und keinen Konflikt zwischen ihrem Selbst und der externen Realität sozialer Normen zu erleben schei-nen“ (ebd.: 278). Freilich ist eine solche „Delegation subjektiver Verantwortung“ (ebd.: 228) mit der neoliberalen Responsibilisierung unverträglich: Der/Die Alexi-themikerIn wird so zum neoliberalen „Abjekt“ des flexiblen, autonomen, selbstbe-wussten, selbstdisziplinierten, zielorientierten und durchsetzungsfähigen, sich selbst kontinuierlich beobachtenden und transformierenden homo competens.
Die Kombination aus ökonomisch-liberalen Prinzipien wie Konkurrenz, Leistung und Wettbewerb und soziokulturellen Faktoren wie Distinktion sowie einer funk-tionalen Selbstverwirklichungsethik in subjekttheoretischer Hinsicht stellt das Sig-num neoliberaler Subjektivitätsdiskurse dar. (Höhne 2004: 55)
5.3 Das Kompetenz-Dispositiv
Wenn bereits von einem homo competens die Rede ist, dann kann auch ein Kompe-tenz-Dispositiv nicht weit sein, lässt sich mutmaßen. Fündig wird man/frau bei Kai van Eikels (Eikels 2003) mit einer randständigen Publikation an der Peripherie des akademischen Feldes (so umschreibt Axel Honneth als Frankfurter Zentripetaliker die deutschsprachige wissenschaftliche Rezeption bzw. akademische Infiltration Foucaults; vgl. Honneth 2003: 19). Eikels’ Essay zur Kompetenz ist zwar von einer gewissen Larmoyanz getragen, da er aus der Perspektive eines ambitionierten „Abj-ekts“ des von ihm analysierten akademischen Feldes schreibt und diese Beobachtun-gen verallgemeinert; dennoch, oder vielleicht gerade darum (siehe Zizek), stellt er notable Thesen zur gegenwärtigen Konjunktur des Kompetenz-Begriffs auf.
Eikels Beitrag ist insofern originell, als er – im Unterschied zur gängigen semanti-schen Forcierung ihrer Bedeutung als Fähigkeit/Vermögen – seine essayistische An-näherung an die der Kompetenz (die für ihn wesentlich Medienkompetenz ist) gleich-sam von hinten aufzäumt, nämlich von ihrer zweiten Hauptbedeutung als Zuständig-keit/Befugnis her, welche ansonsten im medienrechtlichen Kontext relevant ist (wo-bei auch hier – im Sinne einer gouvernementalen Responsibiliserung – eine Ver-schiebung der Zuständigkeit hin zum kompetenten Subjekt hin zu konstatieren ist).
Das klassische Beispiel des Mannes, der zum ersten Mal als Beifahrer neben seiner Frau oder Freundin sitzt und sie fortwährend kommandiert oder für ihre angeblichen Fehler rügt, zeigt, wie verschiedene Konstruktionen subjektiv-sozialer Identität im Spannungsfeld zwischen Fähigkeit und Zuständigkeit aufeinandertreffen: Zwar wurde der Frau mit dem Führerschein die Qualifikation, ein Fahrzeug zu führen, attestiert, doch das männliche Ego kämpft gerade im Moment der formalen Gleich-stellung ihrer Fähigkeiten um die Zuständigkeit für die Kontrolle über den Wagen […]. (Eikels 2003: 1)
Eikels Einstieg in die Thematik mag möglicherweise ein wenig deplaziert wirken, kann aber auf eine illustre Ahnengalerie verweisen (z.B. Georg Simmels „impressio-nistische“ Soziologie). Affinitäten zwischen Medien und Verkehr gibt es zweifelsoh-ne, auch wenn man mit dem wieder in Mode gekommenen Marshall McLuhan nicht gleich vom Medium Eisenbahn oder vom Medium Straße (vgl. Faulstich 2002: 21) oder auch vom Daten-Highway sprechen muss. Schon Adorno/Horkheimer extrapo-lieren ihre Kritik der Kulturindustrie auf den Individualverkehr (Isolierung durch Verkehr) und kommen zum Schluss: „Die Kommunikation besorgt die Angleichung der Menschen durch ihre Vereinzelung“ (Adorno/Horkheimer 1985: 198).
Ähnlich verfährt Jean Baudrillard (der hier stellvertretend für eine massenkommuni-kationskritische Haltung angeführt wird, die auch Vilém Flusser oder aber auch Jür-gen Habermas mit seinem Kolonialisierungstheorem teilt), für den Verkehr zum Me-tonym für („systematisch verzerrte“) Kommunikation im Unterschied zur direkten Interaktion wird:
Die Kommunikation, das ist diese seltsame, fremde Struktur, in der sich die Dinge (und die Wesen) nicht berühren, sondern gleichermassen wie Partikel ihre kinetische, kalorische, erotische oder informative Energie auf Distanz, auf prophylaktische Di-stanz austauschen. Alles kommuniziert, nichts berührt sich. Das schönste Beispiel dafür sind die Autobahnkreuze; nichts ist schöner, als zwei Strassen, die sich kreu-zen, aber das ist zu gefährlich. Es ist wie Blicke, die sich kreuzen: es ist wegen der Verführung zu gefährlich. Man muss deshalb Verkehrsstrukturen erfinden, in denen der Verkehr fliesst, ohne sich zu kreuzen, Beziehungsstrukturen, in denen es kom-muniziert, ohne dass es sich kreuzt oder berührt oder sieht. (Baudrillard 1989 a: 35)
Eikels verknüpft in seinem vermeintlich banalen Beispiel Kompetenz einerseits mit männlichem Dominanzstreben; Barabara Eppensteiner bemerkt diesbezüglich im Kontext der Medienkompetenzdiskussion völlig zurecht, dass ein Mangel an Me-dienkompetenz primär Kindern und Jugendlichen, Frauen und alten Menschen, Aus-ländern und Behinderten, klein- und mittelständischen Betrieben zugeschrieben wer-de, während Männer nach der Adoleszenz und vor der Pensionierung sowie große Unternehmen darüber verfügen bzw. dank der ihnen zugeschriebenen Definitions-macht dieses vermeintliche Defizit so bestimmen, „dass es sicher nichts mit ihnen zu tun hat“, woraus die Autorin berechtigter Weise schließt, dass Medienkompetenz „si-cher kein originär kritischer Begriff“ sei (Eppensteiner 2000: 6).
Andererseits ist für Eikels das Medium des Kompetenzstreits im gegebenen Beispiel und der daraus erwachsenden Selbstbehauptung des männlichen Subjekts ein techni-scher Apparat: „Kompetenz erweist sich im Verhältnis zum Apparat – sei es ein me-chanischer, oder elektronischer, ein institutionell sozialer oder ein psychosomatischer Apparat“ (Ekels 2003: 1). Tatsächlich reicht der sich auf Noam Chomsky berufende und ins Pädagogische, Soziolologische, Psycholgische und wohl auch Ökonomische gewendete Gebrauch von Kompetenz nicht zur Beschreibung ihrer gegenwärtigen Funktionalität aus; während die linguistische Kompetenz im Sinne Chomskys die Fähigkeit eines idealen Sprechers meint, durch Anwendung einer endlichen Anzahl von Operationen aus endlich vielen Wörtern unendlich viele neue Sätze zu bilden, bedeutet sie in den genannten Feldern nun – im Unterschied zu den Qualifikationen als Reproduktion gelernter Inhalte und deren Anwendung auf erwartete Situationen hin – die „Beherrschung von Strategien, die vor allem auch mit unerwarteten Situa-tionen zurechtkommen“ und zielt auf eine „Internalisierung von Lernprozessen und damit die prinzipielle Verknüpfung von Lernen und Selbstbehauptung“ (ebd.: 2): „Wer sich zuständig fühlt, ohne diese Zuständigkeit zu behaupten, ist nicht kompe-tent“ (ebd.: 3). Dabei falle die Behauptung von Zuständigkeit „um so umfassender [aus], je weniger sie zu demonstrieren hat“:
Die systematische Externalisierung des Zeigens aus dem Tun – d.h. die systemati-sche Spaltung des Handelns in eine Explikation von Zuständigkeit und ein „Fullfill-ment“, das im Erfolg(en) oder Nichterfolg(en) der Handlung bestehen kann – buch-stabiert das Alphabet des Handelns durchgehend neu. (Ebd.: 4)
Das Kompetenz-Dispositiv bestehe nun darin, dass die „Ordnung der Dinge keinem Einzelnen mehr zutraut, das zu können, was er kann“, vielmehr schiebe sich ins Han-deln selbst „ein prinzipielles Mißtrauen ein, das die Realität jeder Handlung erst er-mittelt, und die Aktivität, mit der sich das Subjekt in seinem Handeln geltend zu ma-chen versucht, konzentriert sich immer ausschließlicher darauf, dieses immanente Mißtrauen zu überwinden“ (ebd.: 28).
Wir sollten uns nicht einreden lassen, daß sich unsere Gesellschaft mit der Kompe-tenz-Orientierung weiterhin zur Leistungsgesellschaft entwickle, denn diese Gesell-schaft leistet schon viel mehr, als sie zu organisieren vermag. Es entwickelt sich viel-mehr eine Zuständigkeitsgesellschaft – das neue Regime ist die Assesokratie: die flä-chendeckende verinnerlichte Gutachterherrschaft mit ihrer unerbittlichen Evaluie-rung nicht der Leistung, sondern des Seins. (Ebd.)
Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang nun die „Apparate“ bzw. worin besteht der „zwanghafte Zusammenhang von Kompetenz und apparathafter Organi-sation von Wirklichkeit“ (ebd.: 4)? Eikels bestimmt den Apparat als „ Medium zur Vergegenständigung des Fühlens in einem Handeln, das seinem Wesen nach in ei-nem Statement besteht“ (ebd.), also als Medium der Kompetenz- bzw. Zuständig-keitsbehauptung. Dann wiederum soll jeder Apparat unter kybernetischen Gesichts-punkten eine „nichttriviale Maschine“ sein, in der Folge wird der Apparat zum Tech-nischen überhaupt, das im gegenwärtigen Verständnis „ausnahmslos um den Begriff des Mediums aufgebaut“ sein soll (ebd.: 5):
Die Handlung nimmt die Technik wie eine äußere Form an, in der die handelnde Hand als tätige selbst passiv wird, sich in ihrem harten, punktgenauen Agieren doch von der apparativen Technik als temporaler Agentur der Zeit flexibilisieren und ein-passen läßt. Das dementsprechende Verständnis oder Mißverständnis der Handlung, das die Welt, in der sie stattfindet, in etwas Aktives und etwas Passives zerlegt, um das Handeln nur in der Aktion zu lokalisieren, ist ein Effekt jenes Wartens, das der Apparat dem Handeln aufnötigt. Dabei geht es nicht um meßbare Sekunden, die ver-streichen, bis der Apparat benutzbar ist, oder seine eigene relative Langsamkeit im Verhältnis zu einer vorstellbaren (und stets projektierten) ‚Unmittelbarkeit’ des Funktionierens. Ungeachtet der erforderlichen Vorbereitung gibt es eine zeitliche Verfassung des Gebrauchs selbst, eine Zeitlichkeit in der Sache, eine Zeit, auf die sich der Handelnde mit der Handlung einlassen muss. Und diesbezüglich heißt der Apparat warten, zieht er das Handeln in eine Fiktion des Wartens und des Agierens im Zustand des Wartens hinein. (Ebd.)
Woraus für Eikels folgt: „Kompetenz ist Medienkompetenz, spezifizierte Zuständig-keit für das Warten auf einen Apparat“ (ebd.: 6) – eine singuläre Definition und Uni-versalisierung von Medienkompetenz.
Eikels Essay nur als „eleganten Unsinn“ (vgl. Bricmont/Socal 1999) abzutun, wäre allerdings zu einfach. Gewiss wechselt beispielsweise die Extension von Apparat vom Haupt- zum Nebensatz (vom Schließmuskel zum Computer bis zu dem, was man/frau früher System nannte) ohne jede argumentative Begründung, sondern auf der Grundlage semantischen Gleitens; ebenso unerträglich ist das artifizielle Zurück- Beamen gouvernementaler Interpretamente in ein philosophisches Idiom der 1930er bis 1950er-Jahre. Dennoch: Eikels versucht, den von ihm postulierten „Übergang von einer auf Souveränität gegründeten zu einer durch Kompetenzen bestimmten Ordnung“, von der „demonstrativen Selbstbehauptung“ zur „Behauptung von Zu-ständigkeit“ (Eikels 2003: 4) in seinem Versuch zu vereinen: indem er in einer de-monstrativen Selbstbehauptung (= der von ihm vorgelegte Text) Zuständigkeit für die Analyse des Übergangs zur „Behauptung von Zuständigkeit“ (also eine Art Meta-zuständigkeit) behauptet, fällt er gerade jenem Kompetenz-Dispositiv anheim, wel-ches er decouvrieren will.
Ich interpretiere damit in Eikels eine akademische „Abjekt“-Position hinein, zu-mindest aber, dass er sich während des Verfassens seines Essays in der „Warte-schleife“ befunden hat:
Der Ort der Arbeit wird künftig der Abstand zwischen Statement und Fullfillment sein. Um sich selber in der allgemeinen Dynamik zu etablieren, ist es notwendig, diesen Abstand zu vergrößern, ihn mit der eigenen persona auszukleiden, ihn nach allen Regeln der Kunst zu bewohnen (dieser Raum ist das neue Haus, der oikos der zeitgenössischen Ökonomie). (Ebd.: 27)
Das Realitätsprinzip einer solchen Ökonomie ist für Eikels autorepräsentativ, da es sich auf die „selbstgenerierte Faktizität jenes etwas, das durch eine Kompetenzbe-hauptung konstruiert wird“ (ebd.: 27), bezieht. Eikels Thesen hierzu sind allerdings nicht neu:
[…] die seit zweihundert Jahren als „Kriegsführung“ gegen die „rappelköpfigen Ar-beiter“ eingesetzten Maschinen zeitigen inzwischen ihre schon bei Marx prognos-tizierten Automationserfolge einer von Arbeit entsorgten Produktion. Unter Bezug auf diese Entsorgung konstatiert Günther Anders bereits Ende der fünfziger Jahre, dass die Arbeit durch ihre Automation nur mehr als „Gymnastik“ oder als „eine Ver-brämung von Nichtstun“ zu bezeichnen ist. […] Durch dieses neue Realitätsprinzip [der informationellen Steuerung] werden die Kunden der „Modernen Dienstleistung am Arbeitsmarkt“ zu einem, von Baudrillard so genannten „Arbeitsmannequin“, das die nicht mehr vorhandene Arbeit, als ob sie vorhanden wäre, simuliert. Denn als „Produktionsagent“, der nichts mehr produziert, ist das Arbeitsmannequin auf eine, von Günther Anders so benannte, ganz und gar „neuartige Arbeitslosigkeit“ des „Wartens“ in seiner Transitivform des „etwas Wartens“ verpflichtet. Wartend und also arbeitslos, wird etwas gewartet und also gearbeitet. (Treusch-Dieter 2003: 2)
Hierzu ist anzumerken, dass Anders eine Vorstellung des „etwas Wartens“ in der Art eines Angestelltenverhältnisses im Kopf hatte, während heute zunehmend oft die ein-zige Chance darin besteht, „sich seinen eigenen Arbeitsplatz zu kreieren, d.h. als (selbständiger oder organisatorisch abhängiger) Freelancer etwas als Zuständigkeit zu behaupten, was sein eigenes Wahrgenommenwerden zeitlich effektiv verwaltet“ (Eikels 2003: 26). In diesem Kontext kann der ansonsten völlig überzogenen Bestim-mung von Medienkompetenz durch Eikels im Sinne von Interpassivität (= etwas tun, nicht um etwas zu erreichen, sondern um zu verhindern , dass wirklich etwas ge-schieht, sich etwas Grundsätzliches verändert; vgl. Zizek 2002: 19) etwas abgewon-nen werden: Arbeitslose (bzw. „Freigesetzte“) werden, um die Arbeitslosenstatisti-ken zu schönen, in Arbeitssimulationsprogramme eingebunden, welche einen gere-gelten Arbeitsalltag (working from 9 to 5) nostalgisch wieder aufleben lassen und die in der Regel mit Computerschulungen zum Erwerb des „Computerführerscheins“ (und eines entsprechenden „Portfolios“) beginnen – gleichsam als basale Medien-kompetenzausstattung und Initiation für die „Kompetenzgesellschaft“, in der es nicht mehr darum geht, zu „wissen, was man tun will“:
Es geht vielmehr darum, jetzt bereits in der Zukunft identifizierbar zu sein. Die neue Drohung lautet: Wenn du nicht ab sofort beginnst, an deiner Identifizierbarkeit zu ar-beiten, läufst du Gefahr, zukünftig nicht zu existieren […] in einem System hocheffi-zient organisierter Beobachtungen, die nach Kompetenzen scannen und jenseits der Kompetenzgrenzen nichts wahrzunehmen vermögen. (Eikels 2003: 22)
Eikels Wunsch – Wunsch und nicht Forderung oder Programm, da er weder Adres-saten noch Mitstreiter ausmachen kann (Eikels kultiviert hier seine akademische „Abjekt“-Position bzw. kokettiert damit) – ist, wenig überraschend, der nach einem „wirklichen Handeln inmitten all der Simulation von Handlungsfähigkeit“ (ebd.: 29). Weiters wünscht er sich Können statt Kompetenz, das im Grunde nur ein erfolgrei-ches Kommunizieren sei, während mit dem Können auch eine wirkliche Begegnung verbunden sei (vgl. ebd.). Zudem möchte er der „gegenwärtigen Akzeleration im Rhythmus der Selbstbehauptung als Bedienung eines institutionellen Apparats mit ei-ner eigenen Beschleunigung des Handelns“ (ebd.) begegnen, die dann wohl eine Ent-schleunigung wäre. Kurzum: Eikels will zurück in die Zukunft.
Eikels Versuch ist zwar vielseitig anschlussfähig, wie es sich für einen Essay auch gehört; allerdings, so vermute ich zumindest, wären viele Anschlüsse zugleich jene Quellen, die seinen Essay speisen, ohne dass er sie kenntlich macht. Wenn Eikels die semantische Komponente der „Zuständigkeit“ im Kompetenzbegriff hervorhebt, so meint er zunächst damit das Selbstmarketing, das sich Anpreisen als attraktive Ware auf dem Arbeitsmarkt bzw. das Schaffen eines solchen Marktes/Problems für die ei-genen Kompetenzen/Lösungen; Zygmunt Baumann formuliert analog für das „Ex-pertenwissen“:
Größere Fortschritte in der Entwicklung von Fachwissen und seiner technologischen Hilfsmittel werden jetzt durch die Entdeckung und die Anpeilung von „Problemen“ gemessen, denen man „Lösungen“ verschaffen kann, statt dadurch, daß man Lösun-gen zu schon wahrgenommenen und artikulierten Problemen findet. Das schon akku-mulierte Wissen und Können sucht fieberhaft nach seiner Anwendung. (Baumann 1995: 264)
Eikels „wartet“ hingegen auf Einlass ins Reich der Universität (und erinnert ein we-nig an Franz Kafkas Parabel Vor dem Gesetz), also auf einen institutionellen Appa-rat. Im Unterschied dazu agiert die Ich-AG tatsächlich fieberhaft im Warten auf eine sich vielleicht einmal einstellende Nachfrage. Stellt sich diese nicht ein, so bedeutet das noch nicht den Beweis für die Inkompetenz der Zuständigkeitsbehauptung der Ich-UnternehmerIn, sondern nur, dass er/sie sich die negativen Folgen dieser nicht nachgefragten Zuständigkeit selber zuzuschreiben hat, woraufhin er/sie es mit einer anderen Zuständigkeitsbehauptung noch einmal versuchen kann:
Bei der heute beschworenen Kompetenz handelt es sich um die minimalste Semanti-sierung der Leere vollkommener Faktizität, wie sie der Pragmatismus des Erfolgs in allen wesentlichen Punkten durchsetzt. Nachdem das Streben nach Macht, Geld und jener Art von Glück, die der Pursuit of Happiness garantiert, als universelle Trieb-kraft nicht mehr verschleiert werden muß, stellt der Kompetenz-Begriff die vor-läufig letzte Umschreibung des nackten, wörtlichen „Es ist so“ dar. (Eikels 2003: 17)
5.4 Kybernetisierung
Kybernetik ist eine Regierung, die von der Störung oder Devianz lebt, die sie ununter-brochen produktiv macht. Jede Abweichung wird nachgeregelt, jede Verirrung vom System aufgefangen, jede Besonderheit ver-arbeitet. Es ist eine Technologie der un-unterbrochenen kleinen Eingriffe, die große Massen in Schach halten, eine Technologie der subtilen Korrekturen, die eine mächtige Bewegung auf dem richtigen Weg halten sollen.
(Pias 2003 b: 12)
Thomas Höhne konstatiert im Diskurs um die Wissensgesellschaft nicht nur eine Pä-dagogisierungs-, sondern auch eine Kybernetisierungstendenz, wobei er unter Kyber-netisierung „eine allgemeine, implizite wie explizite Durchsetzung kybernetischer Prinzipien in wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen“ versteht (Höhne 2003 a: 34) und in der Folge auch die Systemtheorie darunter subsumiert. Die zentra-le Bedeutung der Mobilisierung immaterieller, subjektiver Ressourcen im Diskurs um die Wissensgesellschaft beruhe wesentlich auf der Verknüpfung dieser beiden Diskursstränge:
Selbstorganisation, Lernen, Kommunikation, symbolische Steuerung bilden die den beiden Diskurssträngen zugrunde liegenden konvergenten Prinzipien, die im Kon-zept der Wissensgesellschaft zusammenkommen. Gleich einem Brennglas werden die unterschiedlichen Diskurslinien dabei gebündelt und konzentriert. Mithilfe der Übertragung der Maschinen- und Systemmetapher können unterschiedliche Berei-che bzw. Ebenen homologisiert werden: Subjekte, soziale Gruppen, Wissensbereiche usw. funktionieren grundlegend nach denselben Strukturprinzipien. (Ebd.: 40)
Höhnes These der Kybernetisierung konkurriert nicht mit der Ökonomisierungsthe-se, sondern ergänzt sie. Denn viele Vertreter des Gouvernementalitätsansatzes haben die Beschreibung neoliberaler Gouvernementalität als Generalisierung der ökonomi-schen Form sowie als allseitige Etablierung des Marktprinzips aus der Analyse zeit-genössischer Managementliteratur und der dort propagierten Führungstechniken ge-wonnen – Ulrich Bröckling untersucht beispielsweise die „totale Mobilmachung“ im Qualitäts- und Selbstmanagement (Total Quality Management – Bröckling 2000; 360°-Feedback – Bröckling 2003 a). Höhne spricht von einem Steuerungs- bzw. Re-gulierungsdispositiv, „das sich zuerst in den Wissenschaften und seit den 70er Jahren auch in anderen Bereichen wie Management oder später Verwaltung durchzusetzen begann“ (Höhne 2003 b: 25) und welches nicht nur auf Steuerung ziele, sondern im-mer auch auf eine Optimierung von Leistung (ebd.: 28).
Ohne sich kenntlich auf Foucault (abgesehen von der Verwendung des Begriffs Dis-positiv) oder auf den Gouvernementalitätsansatz zu beziehen, hat der Medienpädago-ge und -forscher Frank Haase den Medienkompetenzbegriff einer kritischen Würdi-gung unterzogen, und zwar genau unter den genannten Gesichtspunkten der Kyber-netisierung und der Pädagogisierung. Er legt damit eine Art Genealogie des von Höhne so genannten Steuerungs- und Regulierungsdispositivs auf dem Feld der Me-dienkompetenz unter dem Motto Zukunft gestalten heißt Vergangenheit begreifen (vgl. Haase 1999: 142) vor:
Zwei grundlegende Entwicklungslinien sind es, die dem Medienkompetenz-Begriff zugrunde liegen und in seiner Ausprägung kurzgeschlossen werden. Die eine stammt aus der reformpädagogischen Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts, die andere aus der Kybernetik und im besonderen aus der Automatentheorie. Mit anderen Worten: Pädagogik und Kybernetik sind die Eltern des Medienkompetenz-Begriffs, zu deren Paten Physiologie und Linguistik gehören. (Haase 2003: 4)
Hier werden zwei Texte Haases kurzgeschlossen: Abschied von der Medienkompe-tenz (2003) und Nicht die Schule, Medien neu denken (in: Haase 1999: 141-165); Haase gründet seine These auf der Analyse folgender Texte bzw. AutorInnen:
- Kurt Laßewitz: Die Fernschule (1902). Hierbei handelt es sich um eine ironi-sche Zukunftsreise in die Schulwelt von 1999 (Haase 1999: 150). Die Fern-schule ist der Traum eines von der „Wiederkehr des Gleichen“ ermatteten Gymnasialprofessors: Die Bücherregale verwandeln sich in Bildschirme, statt der gewohnten face-to-face -Kommunikation standardisierten Frontalunter-richts sehen sich Schüler und Lehrer nur noch als Tele-Visionen (video-con-ferencing), Lernen und Unterrichten sind dezentralisiert und werden zur Heimsache. Klassen gibt es nicht mehr, sondern nur noch Individualitäten, „deren Teleexistenz den heimischen Schoß der Familie nicht mehr zu verlas-sen braucht“ (ebd.: 148). Die Funktion des Lehrers reduziert sich auf die von Überwachung, die Funktion von Schülern „auf die von Gefangenen am hei-mischen Herd, die aufgrund der technischen Möglichkeiten zur überwachten Selbsttätigkeit und Eigenständigkeit verdammt sind“ (ebd.).
Die Fernschule fußt auf der Substitution der traditionellen Verhältnisse durch technische Medien, auf der Instrumentalisierung von technischen Medien und auf dem Prinzip der Selbststeuerung. (Ebd.)
Laßewitz’ Erzählung dient Haase als ironisch-kontrastive Folie zu Ellen Keys von großer Ernsthaftigkeit getragenem Buch Das Jahrhundert des Kindes.
- Ellen Key: Das Jahrhundert des Kindes (1900; dt. Übers. 1902). Ellen Keys Vision einer „Schule der Zukunft“ liegt nach Haase ein Beobachtungs-Para-doxon zugrunde:
Am Kind – so sagte man – artikuliere sich Natur, weshalb man seine Hand-lungen als Zeichen natürlicher Artikulattion lesen sollte. Folglich war es Aufgabe von Müttern und Pädagogen, ihr Beobachten auf diese natürlichen Artikulationen zu richten, um naturgemäß pädagogisch handeln zu können. (Hasse 2003: 4)
Diese Handlungsaufforderung sei insofern paradox, als die Mütter und Päda-gogen Zeichen beobachten sollten, deren Code sie nicht kannten, gleichzeitig sollten sie aber Zeichen erkennen, „von denen sie tatsächlich nicht wissen konnten, ob es überhaupt Zeichen waren“ (ebd.: 5). Die Richtschnur pädago-gischen Beobachtens aber ist, „die Selbstbeobachtung und Selbstarbeit des Kindes als Erziehungsmittel für das Kind“ zu gebrauchen (Ellen Key im O-Ton, zit. n. Haase 1999: 153). Das heißt, Kinder werden dazu erzogen, „ihr Beobachten zu beobachten, was zur Folge hat, daß sie ihr willkürliches Zei-chenlesen hinsichtlich ihres Zeichenlesens (oder Beobachtens) hinterfragen, um nochmals zu beobachten, was sie beobachtet haben, wenngleich sie nicht wissen können, ob es Zeichen waren oder nicht“ (ebd.: 153). Die verschach-telten Selbstbezüglichkeiten, die Harald Gapski im Diskurs um die Medien-kompetenz anfangs (siehe Kapitel 2.1) verwirrten und mittels einer Beobach-ter-Perspektive zweiter Ordnung entwirren zu können hoffte, sind aus dieser Perspektive somit kein Betriebsunfall, sondern System:
Beobachten und Zeichen lesen – das sind die „zwei großen Ziele“ der Key-schen „Schule der Zukunft“. Zwei Ziele aber, die zur Folge haben, daß in das Medium Kind eine selbstreferentielle wie paradoxe Struktur installiert wird, die zur Folge hat, daß der zeichenproduzierende und zeichenrezipierende Mensch seinen Wert in der Zeichenproduktion selbst findet. Eine Zeichen-produktion aber, die strukturell end- und ziellos ist, weil sinnlos. Ellen Keys „Schule der Zukunft“ ist eine Stätte von Zeichenproduktionsmaschinen, die zum Beobachteten verdammt ihr Beobachten zum Thema machen müssen. (Ebd.: 154)
- Maria Montessori: Das kreative Kind. Der absorbierende Geist (1972). Maria Montessori argumentiert auf der Grundlage der Physiologie des Menschen und seiner Entwicklungspsychologie; die Entwicklung des Neugeborenen erscheint in erster Linie als ein physiologischer Vorgang, in dessen Zentrum die neuronale Vernetzung steht. Pädagogik/Erziehung hat die Aufgabe, den Entwicklungsgang von Natur zu unterstützen und zu fördern:
Auch hier hieß die Devise: beobachten. Wie reagiert das Kleinkind auf seine Umwelt? Wie setzt es sich mit ihr auseinander? Mit welcher Intensität er-folgt diese Auseinandersetzung? […] Kann man ein Höchstmaß an Ausein-andersetzungsintensität beobachten, dann ist dies sicheres Anzeichen für ei-nen entscheidenden Entwicklungsschritt. […] Entlang von Frequenz und Amplitude der Auseinandersetzung läßt sich ermessen, was im Inneren des Kindes sich abspielt. Das Kind ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Medium: nämlich ein Messinstrument. (Haase 2003: 5 f)
Nur wenn das Kind in all seinen Enwicklungsphasen die Möglichkeit habe, der Logik seiner Natur gemäß, diese neuronalen Schaltungen als Bedingun-gen der Möglichkeit von Weltbezug schlechthin aufzubauen, könne es zu-künftig selbstbestimmt oder selbstgesteuert bestimmte Fähigkeiten oder Auf-gaben ausführen:
Die Schaltung ist das zentrale, ihr Effekt die Selbststeuerung. Einen solchen neuronal gegründeten Selbststeuerungsmechanismus kann man auch Men-talität nennen. Das heißt: Der späterhin erwachsene Mensch verfügt über ei-ne mentale Neuronen-Struktur, die ihn ermächtigt, unbewußt Fähigkeiten auszuüben, und die es ihm zugleich erlaubt, aus diesem seinem ‚Selbst’ her-aus zu agieren. Nichts anderes besagen die in der Reformpädagogik formu-lierten Erziehungsziele: Eigenständigkeit, Selbsttätigkeit und Kreativität […]. Kurzum: Was heutzutage als Zielvorgabe von Medienkompetenz for-muliert wird, sind reformpädagogische Erziehungsziele – und aus dem re-formpädagogischen Denkansatz wird zugleich klar, daß diese Ziele als Steuerungs- und Regelungsmechanismen begriffen werden, deren Materia-lität zu Anfang des 20. Jahrhunderts im Neuronalen gedacht werden. (Ebd.: 6)
- Noam Chomsky: Regeln und Repräsentationen (1980/1981). Noam Chom-skys Generative Transformationsgrammatik hatte das Ziel, die Algorithmen von Sprachhervorbringungen über die Performanz (gesprochene Sprache) zu rekonstruieren – im Unterschied zur Kompetenz, verstanden als eine Struktur, die sich als Koppelung von Spracherwerb und neuronalen Schaltungen des Gehirns herausbildet, die es jedem Menschen erlaubt, Sprache selbst zu er-zeugen (vgl. Haase 2003: 8):
Kompetenz meint also: die Welt integrierter neuronaler Nerven-Schaltkreise von Natur wie auch die symbolische Welt der Zeichen und Codes von Spra-che, die sich gegenseitig bedingen. (Ebd.)
Während es bei Montessori um Steuerungs signale gehe, gehe es bei Chomsky um die Rekonstruktion des Steuer programmes. Der hier verwendete Pro-gramm begriff und in der Folge auch der Modell begriff differieren auf den ersten Blick von den bereits erörterten (vgl. Kap. 4.2.2); Chomskys Verständ-nis ist ein platonisches, worauf Manfred Geier hinweist:
Eine generative Grammatik ist keine psycholinguistische Abbildung sprach-licher Produktivität, sondern ein künstliches Berechnungssystem, das algo-rithmisch arbeitet.
Die sprachliche Wirklichkeit ist kein theoretisch unvermitteltes Erfahrungs-feld sprachlicher Ereignisse. Sie wird mittels mathematisierter Modelle ge-neriert, denen ein „höherer Realitätsgrad“ als der alltäglichen Welt des Sprachverhaltens zugeschrieben wird. (Geier 1999: 230)
Daraus resultiere eine Phantomisierung der Sprache in ihrer geschichtlichen Dynamik und geographischen Breite (vgl. ebd.: 235). Sprache wird bei Chomsky zum „computitonal system“, dessen „Modell“ dann nicht mehr mimetisch, sondern eben generativ ist.
Seltsamerweise attestiert Haase dem schule bildenden Baackeschen Begriff von Medienkompetenz, dass sich dieser zwar ausdrücklich im Sinne mentaler Strukturen auf Chomsky berufe, um ihn dann wieder auszublenden: Weshalb aber führt er dann Chomsky in seiner Genealogie an?
Haases kritische Einwände gegen den gängigen Begriff von Medienkompetenz gipfeln in der Frage: „Was wäre, wenn der Medienkompetenzbegriff wider besseren Wissens im Kern seiner Handlungsorientierung der Installierung von Steuerungs- und Regelungsmechanismen verpflichtet wäre?“ (Haase 2003: 10); er moniert, dass in den einschlägigen Arbeiten zur Medienkompetenz diesem fundamentalen Kern (Steuern und Regeln) nicht Rechnung getragen werde, so dass der Medienkompe-tenz-Begriff und seine Theoriebildung zwar ihre Aussagen auf der Grundlage dieses semitechnologischen Dispositivs bildeten, sie „haben aber genau dieses zum blinden Fleck ihrer eigenen Theorie“ (ebd.: 9):
Aus der Reformpädagogik wissen wir, dass jene Umwelt, auf die das Messinstru-ment Kind mit höchster Intensität und Artikulation reagiert, just dann jene Sinnes-materialien bereithält, die seiner neuronal-mentalen Entwicklung förderlich sind. An die Stelle von Umwelt treten beim Medienkompetenz-Begriff Medien. Folglich wird Intensität durch Rezeptivität/Mediennutzung und Artikulation durch Produktivi-tät/Mediengestaltung ersetzt. Über diese strukturell begründete Substitution finden wir Montessoris Reformpädagogik in Baackes vierfach ausdifferenziertem Medien-kompetenz-Begriff wieder, ohne dass Chomskys Kompetenz-Begriff von Relevanz wäre: Die „Sinnesmaterialien“ (Montessori) von Medien (das heißt exakt: von tech-nischen Medien) wie Fernseh- und Radiosendungen bewirken bestimmte Intensitäten der Nutzung und der Wahrnehmung. Um deren Steuerung und Regelung geht es im Kern des Medienkompetenz-Begriffs, wobei Nutzung schlichtweg Fernseh/Radio-hördauer bedeutet und Wahrnehmung auf die Exkludierung der zum Standard ge-wordenen Themen Sex, Pornographie, Gewalt und Werbung abzielt […]. (Ebd.: 10)
Die (Medien-)Pädagogik geriere sich so letztlich als Schaltkreistechnik, welche die Einrichtung von Regelkreisen bezwecke, deren Steuerungs- und Regelungsmecha-nismen im Idealfall auf Selbststeuerung beruhten; Inhalte sollen in dieser pseudo-kybernetischen Konstruktion keine Bedeutung mehr haben, sondern werden zu Ma-terialien, an denen die Steuerungs- und Regelungsmechanismen erworben werden. Die Folge: sinnentleerte Produktivität und Rezeptivität als Selbstzweck (vgl. ebd.: 11).
Haase verwendet hier den Medien-Begriff unscharf, was sich in einer Übergenerali-sierung seiner These niederschlägt. Es stimmt zwar, dass in der Kybernetik als Mo-dell- bzw. Strukturwissenschaft Materialität (Inhalt bei Haase) nicht zählt, was aller-erst gänzlich neue Tableaus von Ähnlichkeit ermöglicht, welche etwa „Curricula und Spaghetti, Kochtöpfe und Raketen, Chemorezeptoren und Kreiselkompasse in der gleichen Objektklasse erscheinen lassen“ (Pias 2003 a: 25):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tabelle nach Pias 2003 a: 25; die kursiv gesetzte Spalte Medienpädagogik stellt den Versuch dar, Haases kritische Würdigung von Medienkompetenz in das kybernetische Analogiedenken zu integrieren)
In der diagrammatischen Modellierung von Regelkreisen, die scheinbar unbegrenzt über Sachverhalte gelegt werden kann, zeichnet sich […] eine neue Ordnung der Dinge ab, die zugleich Erklärbarkeit postuliert und sogar auf eine wissenschaftliche Universalsprache ausblicken und (wieder einmal) hoffen läßt. (Ebd.)
Die kybernetische Epistemologie ist nach Pias nur dann „arbeitsfähig“, wenn Men-schen und Maschinen „gleichermaßen auf digitaler Basis arbeiten, wenn das Wissen vom Menschen und das Wissen von Computern kompatibel gemacht werden kön-nen“ (ebd.: 14). Die von ihm apostrophierte kybernetische Ordnung der Dinge beruht allerdings auf unscharfen Analogieschlüssen; ohne hier auf die inzwischen erkaltete Diskussion um analog versus digital näher eingehen zu wollen, sei hier an einen Aufsatz namens „Ob man ohne Körper denken kann“ von Jean Francois Lyotard erinnert:
[…] Operationen wie ‚ebenso wie…’ oder ‚da …, also’ oder auch ‚da p zu q, also auch r zu s ’ dominieren über digitale Operationen des Typs ‚wenn … dann’ oder ‚ p ist nicht nicht- p ’. Jene Operationen sind die paradoxalen Operationen, welche die Körpererfahrung konstituieren, die Erfahrungen genau des Körpers, den man in der Raum-Zeitlichkeit des Empfindens und der Wahrnehmung den ‚eigenen’ nennt. (Lyotard 1988: 821)
Die diagrammatischen Modellierungen von Regelkreisen sind in diesem Sinne die Korrelate zur Raum-Zeitlichkeit des Empfindens und des Wahrnehmens.
Die Darstellung von Haases Interpretation des Medienkompetenzbegriffs war hier eigentlich als thematisches Exempel der von Höhne postulierten Tendenz zur Kyber-netisierung bzw. zur Konvergenz von Pädagogisierung und Kybernetisierung ge-dacht; prima vista war Haases Ansatz denn auch eine Art Durchführung des gouver-nementalistischen Ansatzes auf dem Feld der Medienkompetenz, also eine bereits ge-tätigte, wenn auch nicht entsprechend gerahmte Vorleistung. Ein augenscheinliches Defizit war zwar – ähnlich wie bei Gapski – eine Synchronisierung von Diagnose (Sinn- und Inhaltsleere) und Therapie (Inhalte!) einerseits, die situative Dehnung und Stauchung des Medienbegriffs nach dem jeweiligen Argumentationszusammenhang andererseits. Haase postuliert, etwas zu sehen, was in keiner der „einschlägigen Ar-beiten zur Medienkompetenz“ (Haase 2003: 9) gesehen werde. Aus der tabellari-schen Integration von Haases Sichtweise wird (visuell-analogisch, was innerhalb des kybernetischen Diskurses eine legitime, bewusst unscharfe Form der Argumentation darstellt; siehe oben) allerdings ersichtlich, dass Haases vermeintliche Diagnose der Kybernetisierung der (Medien-) Pädagogik zuallererst seine eigene Wissenschafts-poetik umschreibt: Haase dezimiert die Baacksche Medienkompetenz aus kyberneti-scher Perspektive auf das, was aus dieser Perspektive von der Medienkompetenz üb-rig bleibt, um sie dann zirkulär als kybernetisch zu genealogisieren und zu denun-zieren.
Dabei reduziert Haase den Medienbegriff auf die nicht-papierenen Massenmedien Radio und Fernsehen sowie Mediennutzung auf ihre Dauer; und das Substitut für die Artikulation wird zur Ausklammerung von Sex, Pornographie, Gewalt und Werbung. Haase karikiert damit eine bewahrpädagogische Haltung, die Baackes Ansatz und der neueren Medienpädagogik in keiner Weise gerecht wird. Selbst der unterstellte kybernetische Regelkreis, den die Medienpädagogik via Medienkompetenz zu in-stallieren trachte, funktioniert in diesem Zerrbild nicht: wenn Haase vom Idealfall der Selbststeuerung spricht, dann wäre das nur eine Internalisierung bewahrpäda-gogischer Normen, welche in bestimmten, inhaltlich wie zeitlich restringierten Me-dienselektionen resultiert. Um seine letztlich behaviouristische These (da das kyber-netische Vorgehen nun einmal „grundlegend funktional und behaviouristisch“ ist; Ashby 1974: 15) halten zu können, konstruiert Haase also eine Medienumwelt und eine Kybernetik, in der/denen eben seine These zutreffen soll und kann. Innerhalb dieser argumentativen Konstruktion ist Haase gezwungen, der gegenwärtigen Me-dienpädagogik einen völlig antiquierten Medienkompetenzbegriff zu unterstellen, um seine eigene Konstruktion zu retten.
Das heißt nun aber nicht, dass damit die These der Kybernetisierung zu verwerfen ist. Haases genealogische Herleitung der Medienkompetenz als Instrument von Steuerung und Kontrolle ist durchaus etwas abzugewinnen. Wenn Franz Josef Röll etwa zur Medienkompetenz aus konstruktivistischer Sicht schreibt
Unter konstruktivistischer Perspektive änderte sich die Rolle des Pädagogen. Seine Aufgabe liegt vor allem in der Schaffung einer Lernumgebung, die das Erleben der sachverständigen Lösung von Problemen und das Erleben der eigenen Wirksamkeit begünstigt. Medienkompetenz bedeutet in diesem Sinne die Förderung der Selbst-kompetenz. […] Der Pädagoge agiert als Navigator, der verantwortlich ist für das Bereitstellen das Lernverhalten begünstigender Arrangements. […] Er kann dafür sorgen, dass das Lernen Spass macht und dass das Lernen somit eigentlich zum Spiel wird. (Röll 2002: 76),
so sind die Anklänge an Montessori bzw. die Kybernetik (als Kunst des Lotsens; Ashby 1974: 15) unüberhörbar. Nebenbei ist Rölls Bild schief: Eine NavigatorIn sorgt nicht dafür, dass eine Schiffsreise lustig ist, sondern dass das Schiff samt Be-satzung, Frachtgut und Passagieren sicher im Zielhafen ankommt – der/die Navi-gatorIn erschafft aber nicht den/die See, den Fluss als Spaß- und Spielumgebung; diese Aufgabe bleibt den AnimateurInnen vorbehalten, die auch aus einem realen Schiffsuntergang ein gruppenästhetisches Erlebnis (Selbstwirksamkeitserfahrung inklusive) gestalten können. In einem solchen simulativen Zusammenhang zitiere ich gerne (lange vor Baudrillard, nämlich 1952) Ernst Kris:
Der Kapitän einer Marineeinheit auf einer der pazifischen Inseln vernahm von einem der Vorposten her Stimmengewirr. Eine Gruppe von Männern erregte, obwohl der Kapitän den Feind in sicherer Entfernung wußte, seine Aufmerksamkeit. Er ging auf die Stelle zu und fand einen seiner Leute mit einem Radioapparat; er hatte einen amerikanischen Kurzwellensender eingeschaltet. Der Kapitän berichtete, daß er kaum Zeit hatte, sich zu fragen, ob das Radiohören auf Außenposten erlaubt sei oder nicht, so schnell hatte ihn die Geschichte gefangengenommen – sie handelte vom Außenposten einer Marinetruppe, die auf einer Insel im Pazifik einen japanischen Angriff erwartete. (Kris 1977: 47)
Seltsamerweise klammert Haase in seiner Kritik des Medienkompetenzbegriffs ge-rade diesen Aspekt der Schaffung und Bereitstellung von Lernumgebungen aus, nachdem er ihn mit der Analyse von Kurt Laßewitz’ Fernschule heraufbeschworen hat. In der – theoretisch sehr ambitionierten – „kybernetischen Pädagogik“ erfuhr Laßewitz’ ironisches Zukunftsszenario „sehr bescheidene technische Realisierun-gen“:
Zu den Grundannahmen der „Lehrmaschinen“ gehört dabei, daß diese sich den Nei-gungen und Geschwindigkeiten des Einzelnen anpassen und jeden, wenngleich auf wechselvollen Wegen, einmal zum Ziel führen werden. Forcierte Individualität ist damit nicht mehr Hemmnis, sondern wird zur Grundbedingung einer Strategie der Effektivierung. Jeder wird, durch und als Teil einer Maschine, die selbst ununter-brochen lernt, am Ende auf seine Weise gelernt haben. Eigensinn und Abweichung, früher Störfaktoren, werden hier produktiv, denn sie dienen dazu, immer neue, uner-wartete Anpassungsherausforderungen und Lernerfolge herzustellen. Und dieser Zu-sammenhang war – zumal in Zeiten des Kalten Krieges – allemal politisch konno-tiert: Die freie Entscheidung der Lernenden, die Wahl im weitesten Sinn, galt als Signum einer „pluralistisch[en]“ Gesellschaft, deren Angehörige allesamt „Kapi-täne“ ihres eigenen Wegs sein und dadurch „kreativer, intelligenter [und] spieler-ischer“ werden durften. (Pias 2003 a: 29; Pias zitiert hier aus Felix von Cubes Tech-niken des Lebendigen. Sinn und Zukunft der Kybernetik. Stuttgart 1970)
Nachdem die Kybernetik als Universalwissenschaft, in der „logische und mathema-tische Operationen zum tertium comparationis zwischen Gehirn und Computern“ gemacht wurden (ebd.: 10), Mitte der 70er Jahre an öffentlicher Attraktivität und Aufmerksamkeit verloren hatte, kehrte sie – allerdings mit „C“ geschrieben – seit Mitte der 80er wieder. Gegenwärtig feiern sich Lernprogramme und virtuelle Lern-plattformen und -umgebungen selbst, wie ehedem.
Der Medienpädagoge Thorsten Lorenz nun steigt in den Strudel der Mythen der Me-dienkompetenz hinab (Lorenz 2000: 2) und komplettiert Haases kaum nachvollzieh-bare Ausblendung, indem er den folgenden Mythos als einen der angeblich am schwierigsten aufzulösenden, weil gebündelten Mythos aufdeckt: „Neue Medien be-glücken uns mit erfolgreicheren Lernumgebungen. Die Reformpädagogik hat durch die neuen Technologien endlich ihre technische Wunscherfüllung gefunden“ (Ebd.: 6). So schwierig scheint dieses Bündel denn wieder auch nicht aufzulösen zu sein, denn Lorenz identifiziert ganze zwei Teilmythen. Der erste Teilmythos lautet dem-nach:
Perspektivische, lineare Denkstrukturen sollen abgelöst werden durch mehrperspek-tivische, beurteilungsoffene Umgebungen. Weil dies, um es einmal paradox zu for-mulieren, mehr der Blackbox unseres Lernvorgangs entspricht. Und dabei sollen selbststeuernde, interaktive, dem Lerner anpassungsfähige, multimediale Programme helfen. Hier wird subkutan eine Analogie verkauft: Die Analogie von Netzstruktur und Denkstruktur, von elektronischen Netzstrukturen und kognitiver Verarbeitung. (Ebd.)
Zur illustrativen Begründung steigt Lorenz in die Metapherngeschichte des Men-schen hinab, um das Pathos, „die neuen Informationstechnologien seien jetzt endlich dem Menschen homolog“ (ebd.: 7), zum Schwinden zu bringen: Im Gutenberg-Zeit-alter wäre der Mensch ein wandelndes Buch gewesen, im 18. Jahrhundert eine Ma-schine, im 19. Jahrhundert ein elektrischer Telegraph, Anfang des 20. Jahrhunderts eine Art Lebens-Kinematograph und heute ein „elektro-neurales Algorithmen-Netz-werk“ (ebd.). Der zweite Teilmythos bestehe im Argument des Lebenslangen Ler-nens: „Der Mensch ist nicht mehr frei, er gerinnt nicht zum Subjekt, sondern zum permanenten Lerninterface“ (ebd.). Ebenso wie Haase plädiert Lorenz für „Mut zu Contents, Riskieren inhaltlicher Verbindlichkeiten“:
Selektion heißt: Viele Inhalte nicht wahrnehmen, ausschließen oder vergessen. Wer glaubt, Alternativen offen halten zu können, irrt. Eine Stunde Klavier spielen schließt anderes aus. (Ebd.)
Lorenz’ Kritik an der Medienpädagogik gipfelt darin, dass er den Medienpädagogen zwar konzediert, „hervorragend in der Praxis“ zu arbeiten, aber „unendlich banal in der Theorie“ zu sein:
Pädagogik ist schon lange keine Leitdisziplin mehr, sondern ein Amalgam. Dabei haben wir wirklich sehr seriöse, aufwendig erstellte und vorsichtige Ergebnisse aus der Soziologie, der Psychologie, den Kognitionswissenschaften, der Neurologie und auch der Philosophie. Aber die pädagogischen Universal-Theorien, bestehend aus einer Zitat-Melange dieser Disziplinen, hinken der Praxis hinterher, sie sind nicht auf der Theoriehöhe der Zeit. (Ebd.)
Lorenz reklamiert hier eine Beobachterposition für den Medienkompetenz-Diskurs, ohne sich irgendwie positionieren zu können. „Unendlich flach“ erscheint ihm die medienpädagogische Theoriebildung, weil er selbst darin watet. Haase plausibilisiert zumindest seine Thesen durch den Versuch einer genealogischen Herleitung. Lorenz hingegen versinkt im hic et nunc:
Also hinein in das Spiel der Medien, dem wir nicht entrinnen können. Und nicht mit der Attitüde des Immer-schon-besser-gewußt-Habens. Man kann von der Bildzeitung das intelligente Servicegeschäft, die Aufbereitung von komplizierten Themen lernen – Lehrtexte, exemplarisches Erklären par excellence. Nur tritt dieser Gedanke nicht als Irritation in die Pädagogik ein. Und von Pastor Fliege am Nachmittag kann jeder professionelle Fragetechniken, Gesprächsführung und Zeitdramaturgien lernen undundund… (Ebd.: 6)
Halten wir vorläufig zusammenfassend fest: Aus gouvernementaler Perspektive wird eine diskursive Überlappung von Kybernetisierungs-, Pädagogisierungs- und Ökonomisierungsprozessen konstatiert; die Konvergenz von verschiedenen ökono-mischen und pädagogischen Diskursen wird dabei als Effekt einer diese beiden Diskurse erfassenden Kybernetisierung gedeutet:
Die Rationalität der Führung, Steuerung und Anleitung sowohl von individuellen (Selbst-)Bildungsprozessen, kollektiven Organisationsentwicklungen, als auch von unternehmerischen Investitionen ist nicht voneinander zu trennen. Kurz: die Ratio-nalität des Regierens in diesem umfassenden Sinne ist in den verschiedenen Berei-chen identisch. Der Stil, Charakter und die „Seele“ dieser Regierungsrationalität, in einem Wort: die Gouvernementalität – welche man über die Schüler, die Lehrer, die Schuladministratoren und –entwicklungsforscher, die Arbeitnehmer und Manager ausübt, welche diese über die anderen ausüben und welche insbesondere integraler Bestandteil ihres Verhältnisses zu sich selbst ist – diese Gouvernementalität belebt den individuellen Lernprozess ebenso wie die Organisation einer Volkswirtschaft; sie ist gleichermaßen individuell und total. Im Zentrum […] steht das Leitbild der Selbstverwirklichung verstanden als ein Unternehmen seiner selbst. Die allumfas-sende Klammer bildet das Modell und die Technologie der Selbstbestimmung und Selbstregulation: das Selbstmanagement. Es schaltet die Vorstellung einer einzig-artigen emanzipatorischen Selbstverwirklichung einerseits mit definierten – einer einheitlichen Verantwortung verpflichteten – Zielvereinbarungen und einer – zwar variabel festgelegten, aber aus einer jeweils als allgemein akzeptierten gesellschaft-lichen Wirklichkeit und den notwendigen Mitteln ihrer Bemeisterung abgeleiteten – Handlungs- und Verhaltensnorm andererseits zusammen. Es vermag somit kritische Pädagogen ebenso zu begeistern wie die Apologeten des Neoliberalismus. (Münte-Goussar 2001: 72)
5.5 Das kompetente Subjekt technischer Medien
[…] agency does not spring from some inhe-rent or essential source within the individual or the collective; agency here is a socially and discursively mobilized construction, al-beit a construction that is never fully pre-dictable.
(Austin 2005: Abs. 14)
In diesem Abschnitt werden zwei Studien kurz dargestellt und aufeinander bezogen: Einerseits die Studie ‚Making Voices’: New Media Technologies, Disabilities, and Articulation von Moser und Law (2003), andererseits Markus Stauffs Dissertation ‚Das Neue Fernsehen’ – Machteffekte einer heterogenen Kulturtechnologie (2004). Stauffs Arbeit ist eine explizite Anwendung der analytischen Perspektive der Gou-vernementalität auf das neue Fernsehen, während die erste zwar auch auf Foucault aufbaut, aber als spezifischen theoretischen Bezugsrahmen den ebensfalls interdis-ziplinären Ansatz von science, technology and society (STS) nennt (Moser/Law 2003: 2).
5.5.1 Rolltalk
(Rolltalk: New Modell 2004 – Communication and
environmental Control; www.rolltalk.com)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
‚Making Voices’ handelt von Rolltalk:
It is a computer system mounted on an electric wheelchair. The box which holds the computer itself is on the back, behind the seat. In front, where the user can see it, there is a flat screen. It’s a red box, which is about the size of A4 sheet of paper, and perhaps five centimeters deep. When the Rolltalk is powered up three coloured icons appear on the screen. This is the first level, so to speak ‘welcome’ screen. On the left, we see the profile of a head with an open mouth and a series of semicircels spreading out from the mouth. We understand straight away that this has something to do with speech, with being heard, with speaking. The second icon, in the middle, shows various objects in the immediate environment – for instance a door. We learn that this has to do with ‘environmental control’, that is the control of various aspects of the user’s living environment. The third icon, on the right, shows a wheelchair. This has to do with moving and steering – that is with mobility. (Ebd.: 3)
Hier wird die Benutzeroberfläche (die gleichzeitig immer auch eine Lernumgebung ist) einer assistive technology for disabeled persons beschrieben; medial prominen-tester Benutzer eines solchen Systems ist wahrscheinlich der Physiker Stephen Haw-kin, der tatsächlich nur mehr digital, also per Zeigefinger kommunizieren kann: to enable disabled people is a good (ebd.: 11). Aber nicht alle disabeled persons sind wie Hawkin, der sich gleichsam als reine Geistigkeit zu verkaufen weiß.
Moser und Law verstehen Rolltalk als eine Art „Doppelexperiment“: an attempt to enable disabeled people; and an exploration of the character of competence, person-hood and subjectivity (ebd.). Sie verrücken damit die Perspektive hin zu gesellschaft-lichen „Abjekten“, für die Medienkompetenz wirklich zur basalen Kompetenz wird, damit sie sich überhaupt als Subjekte artikulieren können, wobei hier die neuen Infor-mations- und Kommunikationstechnologien tatsächlich die Matrix abgeben, die sol-ches in spezifischer Weise ermöglichen, gleichzeitig Anderes aber nicht ermöglichen bzw. verunmöglichen (im Sinne eines Un/Möglichkeitsraumes).
Moser und Law erzählen Szenen und Sequenzen vom Umgang verschiedener User mit Rolltalk und kommentieren sie theoretisch; ein signifikantes Beispiel, in wel-chem Eikels Bestimmung von Medienkompetenz als spezifizierte Zuständigkeit für das Warten auf einen Apparat (Kap. 5.3) in paradoxer Weise zutrifft:
[Knut] is clicking on the communication shilouette in the ‘welcome’ menu. A new menu pops up. Choosing the icon for drink, he opens a third menu. Here there are three choices: water, tee and coffee. As it happens, Knut never drinks tea. He almost always drinks coffee. But when the drink menu appears, tea is framed and highligh-ted first. We sit while the Rolltalk counts away its seconds. It moves to water. Again we wait. Finally, the frame jumps again and highlights the icon coffee. He knocks the joystick with his head and a voice says ‘I am thirsty’ Could I have some coffee, please?’ (Ebd.: 6)
Was die AutorInnen als Warten empfinden, wurde von Knuts Mutter bewusst so pro-grammiert bzw. eingerichtet, um Knut zu aktivieren und ihn im Gebrauch von Roll-talk zu trainieren, zumal einige von Knuts BetreuerInnen mit dem Gedanken spielen, ihm das Gerät wegzunehmen, da es für ihn auf Grund seiner kognitiven Beeinträchti-gung nicht notwendig und lohnend sei, sich mit den Komplexitäten von Rolltalk he-rumzuschlagen: „In short, Knut’s system is relative simple. Slow and simple“ (ebd.: 7; die AutorInnen fallen hier augenscheinlich selbst in eine System -Falle…).
Rolltalk verspricht communicational and environmental control – aber wem? Es geht in diesem Beispiel gerade um die Janusköpfigkeit von Kontrolle und Subjektivität, von Unterwerfung und Ermächtigung bzw. Befähigung, welche in einem solchen familial-therapeutischen Setting von enable the disable via Rolltalk als Medium pastoraler Macht greifbar und in welchem der bedauernswerte Knut zum diszipli-nierten Objekt des von seiner Mutter begehrten Geräts wird.
Moser und Law sind jedoch weniger an solchen Beziehungssystemen als an Verall-gemeinerbarkeit interessiert, weniger an der „individuellen“ Einrichtung der Be-nutzeroberfläche/Schnittstelle als an den nicht- optionalen Vorgaben von Rolltalk; aus dem gegebenen Beispiel extrapolieren sie, dass kompetente Subjekte active agents sein müssen/sollen: „To be passive is not, or so it seems, an acceptable op-tion“ (ebd.). Da hier nicht die ganze Arbeit referiert werden kann, sei nur die Zu-sammenfassung wiedergegeben:
1. Rolltalk tends to perform subjectivities in specific ways. This is in part because of the technical features of the system – for instance its structure of menus – but also certain (centred, autonomous and disretionary) subjectivities are considered to be particulary important for disabled people, or for people tout court.
2. Rolltalk sets limits. For instance in some of its simpler versions it cannot directly articulate certain kinds of subject-positions and or movements between subject-positions – for instance relatively fluid displacements between unprepared but verbally articulated subject positions.
3. However, the relations between fixed subject-positions or articulations and those that are fluid are also more complex than this suggests. This means that fixed and discrete subject positions do not necessariliy exclude those that are more fluid, and that the requirement of active agency built into the system does not necessarily preclude – indeed it may help to create – contrasting and passive forms of agency an subjectivity.
4. The process of designing and adapting Rolltalk may be imagined as a double experiment. Each individual system is tested and adapted for particular users. But more generally over time, IGEL [die norwegische Herstellerfirma von Rolltalk; T.H.] can also be seen as building a more general model of disabled users togethter with assumptions about the nature of competent agency and subjectivity.
5. Finally, we have considered then issue of ’giving voice’. Rolltalk enables severly disabled people to speak or act for themselves in ways that would otherwise be impossible. But the term ‘giving voice’ is not quite right. First, it implies that a person has a voice that is simply waiting to be expressed – which is not alwys right. ‘Voices’ or, as we would prefer to say, ‘articualtions’ are created in an emergent and cyborg-like logic. Second, to talk of ‘giving voice’ also implies a troubling commitment to logocentrism. Talk is a mode of articulation, but only one. Our data suggest that there are many other ways of acting, signifying, arti-culation or resisting. (Ebd: 11)
Die AutorInnen schwanken zwischen der Generalisierung ihrer Beobachtungen und Analysen und deren Selbstrelativierung – einmal hypostasieren sie das von Rolltalk insinuierte Subjekt zum modernen Subjekt schlechthin, dann geben sie sich wieder vermeintlich bescheiden als ungefragte ExpertInnen, welche die Defizite des von ihnen analysierten Programms aufdecken und konstruktiv an dessen Verbesserung mitwirken wollen. Der interdisziplinäre Ansatz von science, technology and society (STS), auf den sie sich berufen, erscheint damit methodisch in der Frage der Verall-gemeinerbarkeit seiner Ergebnisse ebenso wie in der forschungspraktischen/-ethi-schen Reflexion dringend supervisions -bedürftig.
Das Forschungsfeld jedoch, das die SoziologInnen Moser und Law damit eröffnen, ist überaus spannend; es Programmierern und ihren Normalitäts- und Normalisie-rungsthesen bzw. daraus abgeleiteten und mit der Eigenlogik der Programmierung amalgamierten Produkten als unreflektierte Praxis zu überantworten, fällt gewiss schwer (jedenfalls ist dieses Feld auch eines, zu dessen Erhellung die Medienpäda-gogik wertvolle Beiträge liefern könnte).
Für unseren Kontext ist relevant, dass Medienkompetenz nicht nur im medienpägago-gischen Diskurs zwischenzeitlich zu einer ähnlich basalen Grundkompetenz für Nor-malbürger hochstilisiert wird, wie sie es für mehrfach Behinderte im Umgang mit Systemen wie Rolltalk ist.
Offenbar (zumindest für Rolltalk) aber verfügen mehrfach Behinderte über Medien-kompetenz, selbst wenn sie nicht sprechen/schreiben können bzw. wenn ihnen unter-stellt wird, es selbst dann nicht zu können, wäre ihre Sprach- und Feinmotorik (noch) intakt. Medienkompetenz in diesem Sinne wäre dann basal, ikonisch und – um es pointiert auszudrücken – höheren Affen, Delphinen und Analphabeten gleicherma-ßen zuzusprechen.
Springt ein mehrfach Behinderter nicht auf die kommunikativen Aktivierung sversu-che an, was dann? Ist dann sein System simpel und langsam ? Moser/Laws Unterstel-lung, ein System wie Rolltalk lasse Verweigerung und Widerstand zu – und zwar in dem Sinne, dass dessen Gebrauch zeitweise oder gar überhaupt verweigert wird – könnte einmal als Unfähigkeit/Inkompetenz interpretiert werden, ein anderes Mal als indirekte Willensbezeugung; in beiden Fällen aber würde das System/Gerät auf Grund ökonomischer Diktate von dem/der Betroffenen abgezogen, worauf hin er/sie ein amtlich ausgesteuertes Topfpflanzendasein fristen dürfte.
Die Gouvernementalität solcher Systeme besteht in der Subjektanrufung, die wahr-zunehmen ist; es geht nicht nur um das kompetente Subjekt, sondern um den Sub-jektstatus überhaupt, denn ein Subjekt ist eo ipso kompetent bzw. hat sich kompetent zu verhalten, was auf dem untersten Level auch die aktive Artikulation von Wider-stand bedeuten kann.
5.5.2 ‚Das neue Fernsehen
Auch in diesem Abschnitt geht es um Benutzeroberflächen in Form von TV- Menüs, welche eine Optimierung des Zugriffs auf die Apparate und Programme (Stauff 2004: 257) versprechen. Im Sinne des Gouvernementalitätsansatzes betrachtet Stauff „die penetrante Aufforderung, die nahezu alle gegenwärtigen medialen Neuerungen [im Bereich TV; T.H.] begleitet, die Mediennutzung ganz nach den ‚eigenen Wün-schen’ zu gestalten, als subtile und machtvolle Form eines ‚Führens der Führun-gen’“; das „Dispositiv Fernsehen“ stelle somit ein Feld dar, „in dem den Individuen systematisch selbst die Aufgabe überantwortet wird, ihre Unterhaltung, ihre Infor-mation, ihre Bildung und mit diesen ihre ganz eigene Individualität zu optimieren“ (ebd.: 222).
Unter den Oberbegriffen Optimierung, Zugriff, Individualisierung und Ökonomisie-rung/Intensivierung skizziert Stauff das gegenwärtige Fernsehen als Selbst- und Re-gierungstechnologie im Sinne einer Intensivierung der Verkoppelung von Apparaten, Programmen und Praktiken der ‚ZuschauerInnen’.
- Optimierung der Medien
Das gegenwärtige Fernsehen, insbesondere das Digitale Fernsehen, ist nach Stauff auffallend oft vom Versprechen eines „besseren Fernsehens“ begleitet, wobei neben den sinnlichen Aspekten (Bilder und Töne) vor allem die flexible Nutzung und Ge-staltung zur Diskussion stehen (vgl. ebd.: 258):
Das Problem, das mit dem Medium bearbeitet werden soll, ist in erster Linie das Medium selbst. Mediale Defizite sollen überwunden, Funktionen des Mediums ge-steigert und überboten werden; die Bedienung des Fernsehens soll nicht erleichtert werden, um etwas Bestimmtes mit dem Fernsehen erreichen zu können, sondern alleine, um ‚besser fernzusehen’. (Ebd.: 259)
Solche Optimierungsdiskurse begleiten medientechnische Innovationen seit jeher, neu ist für Stauff im Sinne des Gouvernementalitätsansatzes, dass nunmehr auch die Individuen aufgerufen sind, „in ihren Koppelungen an die Medien keineswegs nur ‚Unterhaltung’ oder ‚Information’, sondern eben auch das mediale Funktionieren selbst zu optimieren“, so dass sie den Stellenwert eines „optimierenden (und zu opti-mierenden) Mechanismus’“ einnähmen, welcher beispielsweise „reibungslos zwi-schen Fernsehen und Internet vermitteln soll“ (ebd.: 263).
- Zugriff auf Apparat und Programm
Im Mittelpunkt der gegenwärtigen Optimierungsstrategien stehen für Stauff die Ver-fügbarkeit, die Auswahl und die zeitliche Planbarkeit des Fersehangebots, was dazu führe, dass die „Zuschauerinnen und Zuschauer […] kaum noch als ‚schauende’ und sehr viel mehr als auswählende Subjekte“ fungieren (ebd: 264): „Der Fernsehbild-schirm wird in Verbindung mit der Fernbedienung (oder eher: vielen Fernbedienun-gen) zu einem Kontrollturm, der die Steuerung von Geräten wie von inhaltlichen Angeboten erlaubt“ (ebd.).
Die Problematik des Zugriffs realisiert sich für Stauff beispielhaft in der „Koppelung von Fernbedienung und Menüstruktur, die auf der einen Seite sicherstellt, dass ‚mit einem Knopfdruck’ mehr oder weniger eindeutige Optionen ausgeführt […], und auf der anderen Seite die Anlässe und Wirkungen des jeweiligen Knopfdrucks ‚unend-lich’ vervielfältigt“ (ebd.: 272) werden können. Grundlage dafür sind mehrfach ge-staffelte Menüs, die Hierarchien, Semantiken und Auswahlmöglichkeiten zur Verfü-gung stellen; Stauff spricht hier in Analogie zum Internet von „Navigieren“:
Die Zuschauerinnen und Zuschauer vollziehen immer von neuem Unterscheidungs- und Entscheidungsprozesse und manipulieren so ihr eigenes Verhältnis zu Apparat und Programm; sie sind Subjekte des Fernsehens (und Subjekte ihrer eigenen Fern-sehnutzung) genau insoweit, als sie ihre Individualität an und mit diesen Zugriffs-techniken artikulieren. […]
Die ‚Inhalte’ spielen zwar als Anreiz- und Ordnungsfaktoren für die Zugriffsstrate-gien weiterhin eine bedeutende Rolle; dennoch wird man davon ausgehen können, dass die Macht- und Subjekteffekte, die mit der Einbindung von Praktiken in die te-levisuellen Mechanismen einhergehen, in erheblichem Maße von den Zugriffsfor-men geprägt werden – auf welche Inhalte auch immer zugegriffen wird. (Ebd.: 273 ff)
- Individualisierung
Fernsehen ist in diesem Sinne eine Selbsttechnologie, eine „Technologie, die Sub-jekte nicht nur hervorbringt, sondern diese zur Regierung des eigenen Selbst nötigt und befähigt“ (ebd.: 282): „Die Praktiken von Zuschauerinnen und Zuschauern wer-den […] gerade dadurch (und in der Form) für die Regierungstechnologie Fernsehen produktiv (und in sie einbezogen), dass sie als souveräne Individualität Apparat und Programm gegenübergestellt werden“ (ebd.).
- Intensivierung / Ökonomisierung
Erst auf der Grundlage einer solchen Modellierung der Subjekte als souveränes ‚Ge-genüber’ von Apparat und Programm „können sie in ein heterogenes Geflecht von Apparaten und Texten einbezogen werden, deren Lücken sie füllen und deren Quer-verweise sie nachvollziehen“ (ebd.: 284). Dieses „Lückenfüllen“ bedeutet Intensi-vierung der Koppelung von Apparat(en), Progammen und Subjekten in den ver-schiedensten Formen von ‚Interaktivität’ in einem heterogenen Medienmix (Fern-sehen, Handy, Internet…):
Das durch die mediale Konstellation gestützte Begehren, immer neue Koppelungen an Apparate und Programme zu realisieren, zielt auf eine flexible Differenzierung, die zwar entlang einer medialen Anleitung (einem „Führen der Führungen“) erfolgt, zugleich aber (durch medienkulturelle Mechanismen) in ein ‚Außen’ der Medien verlagert wird, um es dann abfragen und in den Medien repräsentieren zu können. (Ebd.: 286)
Eine solche Intensivierung ist freilich ökonomisch motiviert, indem dadurch andere und mehr Verdienstquellen erschlossen werden sollen; darüber hinaus wird das Fern-sehen aber auch in dem Sinne ökonomisiert, „dass die individuellen Praktiken einer ökonomischen Rationalität folgen, die sich nicht auf das Geldverdienen beschränkt“:
Vielmehr hat das Fernsehen Anteil an einer neoliberalen Selbstregulierung von Sub-jekten, die – und vor allem darin besteht die Ökonomisierung – ‚ihr’ Fernsehen ei-genverantwortlich und effizient gestalten sollen: Wenn sie nun – wie häufig be-schworen wird – ihre eigenen Programmdirektoren sind, dann müssen sie sich auch als Manager und/oder Unternehmer ‚ihres’ Fernsehens verstehen. (Ebd.: 287 f)
Die flexiblen Koppelungen von Praktiken an Apparate und Programme scheinen demnach eine „eigenverantwortliche, rational kalkulierende und risikobereite Sub-jektivität gleichermaßen vorauszusetzen wie hervorzubringen“, und insofern das ‚neue’ Fernsehen insbesondere auf eine „ökonomisch angeleitete Eigenaktivität der Individuen“ ziele, interpretiert Stauff es als „Teil des neoliberalistischen Projekts“ (ebd.: 291). Den ZuschauerInnen werde „in aller Deutlichkeit“ vor Augen geführt, „dass sie nicht mehr das schauen, was gerade läuft, sondern das, was sie sich aus-gewählt haben“ (ebd.: 293). So gesehen, verdoppele die Forderung Medienkompe-tenz das, was ohnehin „gerade läuft“, zumal das aktuelle Programm gerade in der intensiven Koppelung von medialen Praktiken, Apparaten und Programmen bestehe.
Kennzeichend für die neoliberale televisuelle Subjektivität ist demnach, dass weni-ger Werte verinnerlicht werden, als vielmehr in Auseinandersetzung mit fortlaufen-den neuen äußerlichen Reizen souveräne und zugleich risikobereite Entscheidungen getroffen werden. Die Aufgabe besteht in der dauerhaften kulturtechnologischen Be-arbeitung der ‚eigenen’ Individualität. In kaum einem anderen Bereich lassen sich derart häufig und technisch präzise (‚auf Knopfdruck’) Entscheidungen treffen, die zum einen die ganz ‚eigenen’ Wünsche und Interessen repräsentieren und realisieren sollen, deren Resultate zum anderen ‚sofort’ aber zugleich wieder revidierbar oder zumindest optimierbar auf dem Bildschirm zugänglich sind. Fernsehen wird eine Übung im Selbstmanagement; jede Kontrolle, die wir über Apparat und Programm erlangen, ist vor allem eine Kontrolle über uns selbst […]. Das passive Dasein eines couch potatoe erhält demgegenüber fast schon den Anschein der Subversion. (Ebd.: 294)
Kontrastieren wir einige Kernaussagen der zwei skizzierten Studien tabellarisch:
Rolltalk
‚Neues Fernsehen’
Prosthetic Articulation: The Rolltalk system is a hierarchy, a tree. An implication of this is that the user has a clear idea of the nature of his own wishes; it also implies that those wishes are indeed clear, and may be well articulated.
Die souveräne Individualität, die ‘ihre’ Wünsche durch selbst gewählte Zugriffe auf Apparat und Programm realisiert, gewinnt sowohl ihre Souveränität als auch ihre Individualität erst aus dieser kulturtechnologischen Konstellation.
Articulating Discreteness: The making of discrete classes presupposes and helps to produce a certain kind of person – one who can distinguish instantaneously between possibilities.
Die Menüstruktur erstellt eine Ordnung der Vielfalt, indem sie auswählt, klassifi-ziert, zusammenstellt und hierarchisiert.
Rolltalk
‚Neues Fernsehen’
Centred Articulation: Rolltalk displays create new relations by juxtaposing objects, bringing them together, arrying them at the same time and the same place. They operate by making a centre – a mini-panopticon, a subject-singularity from which all the various possibilities may be seen.
Der Fernsehbildschirm wird in Verbindung mit der Fernbedienung zum Kontrollmoni-tor. Die Reg(ul)ierung des Fernsehens und die Selbstreg(ul)ierung der mit ihm gekop-pelten Praktiken finden ihre Rationalität in der Frage des effizienten, individuellen Zu-griffs auf ein möglichst breites und zugleich wohlgeordnetes Programmangebot.
Articulating Agency: To be passive is not, or so it seems, an acceptable option (siehe oben).
Bezeichnend für die Dominanz des Zu-griffsmodus scheint, dass die Form der Koppelung an Apparat und Programm selbst optionalisiert werden soll. Wer will, kann wie bisher auch ganz passiv genießen (wobei diese Einstellung aktiv gewählt werden muss, also auch selbst verantwortet ist).
Articulating Resistance: Rolltalk works to make people with discretionary power and autonomy. It enables them to act, in specific circumstances, as independent subjects and agents. Active resistance is being performed – and it becomes being performed via the machine and within hierarchical series of options and choices. In some sense, then, this is resistance which is socially acceptable. It is preconfigured, it is anticipated, it is accepted.
Entweder ‘interaktive’ Artikulation von Widerstand, also Intensivierung der Koppelung, oder vermeintlich subersive couch potatoe- Existenz.
Beide Menüs zielen augenscheinlich auf medien -kompetente (durch Medien für Me-dien kompetente) Subjekte ab. Im ersten Fall werden die Medien als prothetische Re-medien (im Sinne von Heilmitteln) für nicht artikulationsfähige, aber prinzipiell unterstellte souveräne Subjektivität propagiert; im zweiten Fall werden Re -Medien (im Sinne von Kontrollmasken) propagiert, welche Medienkompetenz meta-program-matisch als Aktivierung der durch die Programmvielfalt überforderten User inszenie-ren und sich den AnwenderInnen als Werkzeug zur Wieder erlangung eines souverä-nen Subjektstatus’ anbieten.
Ist Passivität also inzwischen keine akzeptable Option mehr und ist die Existenz als couch potatoe bereits subversiv ? Ein passives Genießen wie bisher wird es, wenn es nach dem Medientheoretiker und -künstler Peter Weibel geht, beim neuen Fernsehen nicht mehr geben:
Die Zukunft des Fernsehens liegt in der Wahl zwischen zwei Optionen: technische Innovation oder nicht. Das Fernsehen der Zukunft, wie wir es bisher gekannt haben, das heißt ohne technische Innovation, wird sich an ein Publikum wenden, das von der Konstruktion der Wirklichkeit mehr oder minder ausgeschlossen ist. Die Mehr-heit dieser Fernsehzuschauer wird von jenen Mitgliedern der Gesellschaft gebildet werden, die vom produktiven Leben ausgeschlossen sind, also Pensionisten, Arbeits-losen etc. […]
Die Menschen, die noch voll im Produktionsprozess stehen, werden zum einen nicht die Zeit haben, sich den TV-Trash anzusehen, weil er sie im beruflichen Leben nicht weiterbringt und auch keinen rekreativen Freizeitwert bietet. Zum anderen wollen sie mit dem Fernsehen nicht ihre Lebenszeit töten. […]
Wer fernsieht, wird in Zukunft als stigmatisiert gelten. (Weibel 2005: 84)
Die andere Option – aus der Sicht der Medien macher, die Weibel hier einnimmt – besteht in der Konvergenz von Computer, Fernsehen und Netz (vgl. oben). „Man kann also davon ausgehen“, schreibt Weibel in Bezug auf das noch aktuelle Fern-sehen, „dass das Fernsehen die gegenwärtigen Klassengegensätze verschärft, indem für die aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligten Menschen nichts mehr produ-ziert wird und nur mehr für die passiv am gesellschaftlich Leben teilnehmenden Menschen Programme erstellt werden“ (ebd.).
Christan Swertz skizziert in Kapitel 3.1 in didaktischer Absicht ein wirklich graus-liches „Abjekt“ von Medienkompetenz, welches zwar dumm, immerhin aber medien-kompetent wie höhere Affen und Delphine ist, jedoch nicht mehr aktiv an der Gesell-schaft teilnimmt. Eine etwas freundlichere Variante der inneren Emigration ange-sichts der grenzenlosen/globalisierten Individualitätszumutungen macht Rudolf Ma-resch unter Rekurs auf Herman Melvilles „Bartleby“ aus – als eine „listige Gegen-figur zu den ‚Arbeitstieren’ der New Economy, die rund um die Uhr wie Tatort-Kommissare nonstop oder standby-Bereitschaft signalisieren und mit ihrer aktiven Teilnahme, Kreativität und positiven Einstellung alle anderen mitreißen“ (Maresch 2005: 7) und welche die InterviewpartnerInnen im bereits genannten Roman wir schlafen nicht von Kathrin Röggla abgeben:
Nimmt man die Umfragen der Wirtschaft ernst, so sind diese Männer und Frauen im Zunehmen begriffen. Wie die sprichwörtliche Made im Speck machen sie in Unter-nehmen oder Behörden Dienst nach Vorschrift. Sie vermeiden es durch unbedachte Äußerungen, Stellungnahmen oder Kommentare unangenehm aufzufallen. Entweder halten sie den Kopf unten und geben keine Widerworte, oder sie stimmen mit der Mehrheit und verrichten ihre Arbeit dem äußeren Anschein nach zufriedenstellend. […] Eifer entwickeln sie nur, wenn der Chef im Großraumbüro auftaucht oder sie den Atem des Chefs im Genick spüren. (Ebd.: 8)
Was hat das aber mit Medienkompetenz zu tun? Kade und Seitter führen am Beispiel des „lebenslangen Lernens“, für das die unabschließbare Aufgabe der Medienkom-petenz ein Paradebeispiel ist, aus, dass Aktivität bzw. Passivität von ihrer Kontext-ierung abhängig sind:
Gegenwartsbezogene Mischformen des Lernens können […] als sanfte Verweigerun-gen von vor allem ökonomisch, aber auch kulturell verursachten Systemzwängen innerhalb des Systems angesehen werden. Die Relativierung des Lernens in institu-tionellen Kontexten durch die Orientierung an freizeit- und alltagsbezogenen Krite-rien wie Vergnügen, soziale Zugehörigkeit und Fortsetzung des Lebens kann daher als eine – weniger radikale, dafür umso effektivere – Variante der Umsetzung des Rechts auf Nicht-Lernen interpretiert werden. Sie setzt das Prinzip des lebenslangen Lernens zwar nicht außer Kraft, bindet es jedoch an Kriterien, die – jenseits von De-fizitannahmen oder Veränderungsnotwendigkeiten auf eine unvorhersehbare Zukunft hin – der gegenwärtigen Gestaltung und Fortsetzung des eigenen Lebens dienen. (Kade/Seitter 1998: 8)
Kade und Seitter machen damit genau jenes Moment der Gegenwartsbezogenheit, der Genussfähigkeit, der lebensweltlichen Rekontextierung geltend, welches auch in den neueren Ansätzen zur Medienkompetenz über Baackes Grund- und Baustein-legung hinausgehend lanciert wird: (Medien-)Konsum als (vermeintliche) Erholung und Bereicherung – eine Art kleine Pensions- Insel im Ich-UnternehmerInnen -Stress. Maresch situiert seine intelligenten Verweigerer allerdings auf der Ebene von Mikro-Sklaven, Angestellten und Beamten (Maresch 2005: 7), meint also Arbeitssubjekte, die ihre „Leistung“ insofern erbracht haben, als sie ihren sozialen Abstieg akzeptiert haben und auf soziale Aufwärtsmobilität verzichten (vgl. 4.3.1), gleichzeitig aber – aus neoliberaler Perspektive – als museale Figuren nicht- ich-unternehmerischer Be-schäftigungsformen ausgestellt werden und die primären Adressaten von Lebens-langem Lernen oder Medienkompetenz-Anrufungen sind, welchen sie passiv teilneh-mend nachkommen, zumal sie ja von der Konstruktion der Wirklichkeit mehr oder minder ausgeschlossen (Weibel) sind/werden/werden sollen. Kade und Seitter haben wohl ein ähnliches Personal im Sinn. Swertz, Maresch, Kade und Seitter stellen sich damit selbst in das Museum für moderne kritische Intellektuelle (vgl. 2.4.), ebenso wie Roland Reichenbach, Pädagogik-Professor in Münster, der, zwischen einer päda-gogischen Lebenskunst -Lesart Foucaults und gouvernementalen Interpretamenten hin und her changierend (vgl. 4.1), eine erziehungsphilosophische Legitimation für eine solche pädagogische Provinz der Gegenwart ewiger Kinder er findet:
Die Zukunft, diese letzte moderne Legitimationsbastion, hat moralisch ausgedient, sie ist jetzt vielmehr der Ort des aufdringlich-partikularistischen Globalisierungs-denkens, welches dem homo politicus einreden will, er wohne einem großartigen Naturschauspiel bei. Wenn es je einen ausgereiften Vulgärmaterialismus gegeben hat, dann ist es wohl dieser. […]
[…] es wäre zu überlegen, ob man nicht einen pädagogischen Imperativ stark ma-chen könnte, der sentimentalistisch etwa so zu formulieren wäre: „Werdet wie die ateleologischen Kinder am Morgen“. Damit würden Bildungsprozesse als Trans-formationsprozesse mit unbekanntem Verlauf verstanden und die Idee der Schlüssel-kompetenzen, mit welcher sich der Vervollkommnungsgedanke noch heimlich am Leben erhält, eine Weile ad acta gelegt. (Reichenbach 1999: 17 f)
Im Kontext des Gouvernementalitätsansatzes entblößen sich solche Äußerungen auf erschreckende Weise selbst: Der kritische Impetus, der vorgeblich Zusammenhänge aus einer Art Vogelperspektive emanzipierend aufzudecken verspricht, stiftet sie in-zwischen maßgeblich mit (vgl. 2.2). Aktive Teilnahme wird hier durchgehend mit passiver Teilnahme kontrastiert und letztere als negativ konnotiert. Der binäre gesell-schaftliche Raum (vgl. Wrana) wird vorausgesetzt, Aktivität oder Passivitiät der un-gefragt Teilnehmenden werden als maßgebendes Kriterium festgeschrieben, wobei ‚Aktivität’ mit unternehmerischem Agieren und unternehmerischer Selbstformierung gleichgesetzt wird. Ausschluss wird als passive Teilnahme euphemistisch umschrie-ben, und wenn Weibel in seinem Essay auf „Klassenzugehörigkeit“ rekurriert, meint er damit keine soziologische oder gesellschaftskritische Kategorie mehr, sondern ar-beitet anscheindend der Trennung zwischen von der aktiven Teilnahme an der Ge-sellschaft Ausgeschlossenen (Auszuschließenden?) – nämlich Pensionisten, Arbeits-lose etc. (et cetera? Frauen, Kinder, Wahnsinnige, AusländerInnen, Beamte, Ange-stellte?), also mindestens zwei Drittel der Bevölkerung werden zu „Abjekten“ erklärt – und aktiven TeilnehmerInnen zu. Ob das gegenwärtige Fernsehen an diesen Aus-schlussmechanismen maßgeblich Anteil hat, ist fraglich, fraglicher noch aber ist, ob ein ‚neues’, interaktives, konvergierendes Fernsehen daran etwas ändern würde, dass die so genannten Arbeitstiere und 24-7 -Typen der New Economy ihr Genießen in-terpassiv an die passiven TeilnehmerInnen delegieren, um diese dann als Parasiten zu verunglimpfen (vgl. Pfaller 2003; Wilson 2004).
Das von Maresch skizzierte Modell intelligenter Verweigerung ebenso wie die le-bensweltliche Umkodierung der Lernzwänge bei Kade und Seitter sind, um eine Analogie zum Fernsehen herzustellen, an couch potatoe -Beschäftigungsverhältnisse gebunden, die eine lebensweltliche Rekontextierung oder gar Rekolonialisierung zu-lassen und somit Auslaufmodelle sind.
Die andere Option ist im Sinne Stauffs seine interaktive Artikulation von Widerstand, die zugleich Intensivierung der Koppelung bedeuten soll – mit anderen Worten aus dem Kontext gouvernementaler Analyse postfordistischer Unternehmen: taktische Widerstände vollziehen „Quergänge, welche die Elemente der Strategie benutzen“ (Opitz 2004: 165), sind aber „nicht per se unschuldig“:
Stattdessen bergen sie durch ihre Bindung an die gouvernementale Strategie die Gefahr, die Unterwerfung fortzusetzen oder sie sogar zu intensivieren. Allerdings muss der Widerstand diese Gefahr in Kauf nehmen, wenn er nicht resignieren will. Ihm steht keine universelle Option des Dafür oder Dagegen zur Verfügung, er muss vielmehr lokale Entscheidungen treffen und aushandeln. (Ebd.: 168)
‚Taktische Widerstände’ sind denn auch Opitz zu wenig, weshalb er den „konfor-mistischen Techiken des unternehmerischen Selbst als Kontrapunkt die immer ris-kanten Techniken der Desubjektivierung “ (ebd.: 194) gegenüber stellt (vgl. 5.6.3).
5.6 Kreativität
5.6.1 Der kreative Imperativ
Children and young people will have to do more than routine tasks, they will now be expected to be creative. Even if they don’t go on to earn a living in the cultural sector thinking creatively is now at the heart of the knowledge economy.
(McRobbie 2002: 8)
Die Kreativität bildet sowohl den „funktionalen“ Kern des neoliberal-gouvernemen-talen Selbst (vgl. Höhne 2003 b: 54) als auch den des pädagogischen Medienkompe-tenz -Diskurses.
Eines der vier Module von Medienkompetenz im Sinne Dieter Baackes ist die Me-diengestaltung, welche er weiter differenziert in Innovation (Weiterentwickeln des Mediensystems innerhalb der angelegten Logik) und Kreativität (ästhetische Vari-anten, Routinen sprengend). In Kapitel 3.2.1 wurde festgestellt, dass die sprachge-nerative Regel des Suffixoids - kompetenz auch jene von Kreativität ist, so dass man anstelle von Medienkompetenz auch Medienkreativität sagen könnte, ohne dass sich diese Substitution sinnentstellend auswirken würde.
Baackes Medienkreativität im engeren Sinne ist so etwas wie die Kür der Medien-kompetenz, während Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und innovative Mediengestaltung gleichsam deren Pflichtprogramme darstellen – zumal Medien-kompetenz bei Baacke ja letzlich den Charakter eines Instruments im Dienste der utopischen Umgestaltung der Gesellschaft besitzt.
Die genannten Pflichtprogramme mögen bestenfalls Virtuosität im Umgang, in der Nutzung und in der Gestaltung mit den Medien vermitteln, was ja nicht wenig ist. Medienkreativität hingegen zielt auf die kreative Umgestaltung der Medien (der Ge-sellschaft) in den Medien mittels Medien, wobei das avantgardistische Motiv des Über-die-Grenzen-Gehens samt dem Pathos der Überschreitung mitschwingt.
Im Gouvernementalitätsansatz nun wird Kreativität im Sinne der Biomacht Focaults bzw. der busno-power Marshalls interpretiert:
Die vermenschlichte Bio-Macht setzt die Individuen frei, um ihnen um so treff-sicherer das zu entreißen, auf was sie zielt: das sprudelnde Leben, die Kreativität, die Spontaneität, die soziale Kompetenz, eine realistische Vernunft und ein Drängen nach Innovation, mit einem Wort: lebenslang wandelbare Schlüsselqualifikationen als Grundverhalten von Beruflichkeit, sozialem Engagement und Lebensführung. (Münte-Goussar 2001: 181)
Dabei verdecke das wohlklingende Vokabular des Kompetenzdiskurses das Rationali-sierungs- und Disziplinierungspotential, „weil es produktiv ausgerichtet ist: Es geht um die individuelle Entfaltung, Kreativität und Kräftesteigerung und nicht um Selbstrepression und Subordination unter ein normatives System im Sinne einer Moral oder Ethik“ (Höhne 2003 a: 101)
Kreativität wird ebenso wie die Fähigkeit zum Selbstmanagement als Voraussetzung für das „Bestehen in den Arbeits-, Aufmerksamkeits- und Beziehungsmärkten über-haupt“ (Osten 2002: 2) analysiert, wobei der ‚kreative Imperativ’ – entgegen Höhne für Osborne dennoch a kind of moral imperative (Osborne 2003: 508) – die „Auto-nomieparolen der 60er und 70er Jahre“ (Osten 2002: 4) im bereits dargelegten Sinn einer Umcodierung und Funktionalisierung emanzipatorischer Ziele absorbiere.
Das kreative Arbeitssubjekt ist aufgefordert, genau diejenigen Fähigkeiten in den Arbeitsprozess einzubringen, die – vormals Forderungen von seiten linker Gesell-schaftskritik – als Refugien gegen Ökonomisierung und Verwertungslogik galten: Kreativität, Intellektualität, Kritik, Kommunikation als zentrale Momente künstleri-scher, intellektueller und affektiver Arbeit. Dem „Kreativitätsimperativ“ folgend entfalten Menschen heute als FreiberuflerInnen, Selbstbeschäftigte und Ich-AGs, aber auch auf den prekär werdenden Angestellten-Posten ausgereifte Selbsttechno-logien, um marktgerechte Subjektivitäten mit der Durchsetzung eigener Interessen und Bedürfnisse zu verbinden. (Engel 2003: 2)
Die Anforderungsprofile postfordistischer Arbeitsverhältnisse hören sich dabei an wie ein „Echo auf Kriterien, die bislang vorrangig künstlerischer Praxis und den an sie geknüpften Erwartungen vorbehalten waren, zählen doch im Umfeld von Selbst-verwirklichung, Selbstbestimmung und Freiheit angesiedelte Techniken der Selbstor-ganisation und -verwaltung ebenso dazu wie etwa die Fähigkeit, Paradoxalitäten pro-duktiv zu machen“, wodurch KünstlerInnen entsprechende Vorbildfunktion zuge-sprochen werde (Bismarck 2004: 1). Allerdings richtet sich die aktuelle Kreativitäts-semantik nicht mehr an ein emphatisches Konzept des Ausnahmeindividuums, son-dern an alle BürgerInnen und LohnarbeiterInnen der westlichen Industriegesellschaft – gleichsam als „demokratische Variante der Genialität“ (Osten 2002: 2 f) bzw. als „Pseudogenialität fürs Volk“ (Lenk 2000: 64).
Freilich ist diese Kreativitätszumutung selbst paradox: „Die Aufforderung ‚Be crea-tive!’ ist […] nicht weniger paradox als das legendäre ‚Sei spontan!’. Gefordert ist die serielle Einzigartigkeit, Differenz von der Stange“ (Bröckling 2004: 143). Diese Differenz von der Stange, wie sie von Bröckling gouvernemental als Kontrollmecha-nismus analysiert wird, wiederum trifft, sofern sie kommuniziert wird, auf das Para-doxon der Sprache als „Institutionalisierung von Subjektivität“ (Barthes 1969: 53).
Kreativität ist also einerseits eine „ökonomische Ressource, die der Markt gleicher-maßen mobilisiert wie verbraucht“ (Bröckling 2004: 141), andererseits aber – etwa im Sinne von Baackes Medienkreativität – auch eine revolutionäre/utopische Res-source (deren Innovationen aber in immer kürzeren Intervallen ökonomisch absor-biert und beispielsweise zu Medienrevolutionen hochstilisiert werden…).
5.6.2 Die Vor-läufigkeit der Technik(W. Sesink)
[…] to say that the ethos of creativity simply answers to structural needs would be to ig-nore the fact that the creativity explosion is also a product of human agency and the ma-chinations of experts and – loosely speaking – of workers of the intellect. It is, then, as much a matter of our governmentality as of ideology.
(Osborne 2003: 508)
Werner Sesink, Professor für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik an der TU Darmstadt, untersucht die Auswirkungen der sich immer rasanter entwickelnden In-formations- und Kommunikationstechnologien in ihrer Funktion als Steuerungstech-nologien auf den Stellenwert von Bildung, ohne allerdings jenem „Technikdetermi-nismus“ (vgl. Schönberger 2000) zu verfallen, der Technikeuphorie wie Technik-kritik zugrunde liegt (ähnlich argumentiert Flusser 1997: 22 ff):
In dem Maße, in dem die gesellschaftliche Entwicklung einer unkontrollierten Dy-namik folgt, in dem Maße also, in dem auf gesellschaftlicher Ebene die subjektive Geltungsmacht verloren geht, wird sie dem individuellen Subjekt in Hinsicht seiner Selbstgestaltung, seiner Bildung umso dringlicher abverlangt. Das neue Mündig-keitspostulat ist in einem gewissen Sinne sogar radikaler als das traditionelle. Ja man könnte von dem Verlangen totaler Mündigkeit sprechen, weil die Fähigkeit zur Selbstgestaltung durch keinerlei Festhalten an vorher Gelerntem, Gewußtem, Ge-konntem behindert wird, aber auch auf keinerlei positive Voraussetzungen sich stützen darf. Das Subjekt soll gleichsam sich selbst ausstreichen, um auch davon, als was es sich vorfindet, noch frei zu sein, hinsichtlich dessen, was es aus sich macht. (Sesink 2000: 17 f)
Somit verlöre das Selbst alle Substanz, würde zur Hülle wechselnder Qualifikations-fassaden, die ihrerseits nichts als Spiegelflächen verselbständigter technologischer Entwicklungsprozesse wären: „Eben die Instanz, welcher die ausschließliche Verant-wortung für die nötigen Anpassungsleistungen zugemutet wird, löst sich auf in eine leere Potentialität“ (ebd.: 19). Mit diesem Szenario skizziert Sesink, kritisch poin-tiert, das „Selbstkonzept der Informationstechnologie im Zusammenhang einer Öko-nomie der abstrakten Arbeit“ (ebd.) und kommt damit zu einem ähnlichen Ergebnis wie Eikels, der die Kreativität, auf den sich der Kompetenzbegriff bezieht, als syste-matische Auslagerung von Inkompetenzen versteht: „Am Zielpunkt einer solchen Auslagerung steht ein Augenblick, der selbst praktisch ‚leer’, aber als leere Aktuali-tät nachweislich von allen Zweifeln bezüglich der Durchführbarkeit einer Handlung gereinigt ist, die dann unterbleiben kann oder nicht“ (Eikels 2003: 4).
Sesinks Argumentationsgang unterbrechend und zugleich fortschreibend kann hier festgehalten werden, dass die fiktiv eingelöste Forderung nach Kompetenz – die In-Inkompetenz – anscheinend so etwas wie einen Zen-Zustand generiert. Eine notwen-dige tabula rasa nach der Schumpeterschen „schöpferischen Zerstörung“, welche in diesem Fall von den neuen Kommunikations- und Informationstechnologien geleistet wird („Technik ist Destruktion“; Sesink 2002: 15) und die überhaupt nur mehr krea-tives Handeln als Durchsetzung neuer Kombinationen (vgl. Bröckling 2004: 141) zu-lässt: Folglich wird jede/r gezwungenermaßen zur UnternehmerIn, weil er/sie gar nicht mehr anders kann, als kreativ (oder aber gar nicht) zu sein.
Dieser Augenblick reiner Potentialität allerdings kann und muss – gerade, wenn es um den Medienkompetenz -Diskurs geht (Der von Ingrid Hamm 2001 herausgegebene Sammelband Medienkompetenz. Wirtschaft-Wissen-Wandel ist ein beredtes Exempel hierfür, wobei die übliche verlegerische Verspätung dieses euphorische new econo-my -Elaborat zu Makulatur machte.) – historisch situiert werden. Franco Berardi Bifo, Philosoph und legendärer Medienaktivist (Radio Alice in Bologna), spricht konse-quenterweise von einer „Allianz zwischen dem rekombinanten Kapital und der kog-nitiven Arbeit“ (Bifo 2003: 4) während der Periode der so genannten Dotcom-Mania:
Wegen der Massenbeteiligung am Zyklus der Finanz-Investitionen in den 90ern kam ein breiter Prozess der Selbstorganisierung von kognitiven ArbeiterInnen in Gang. Kognitive ArbeiterInnen investierten ihre Expertise, ihr Wissen und ihre Kreativität und fanden am Aktienmarkt Mittel, um Unternehmen zu gründen. Für einige Jahre wurde die Unternehmensform der Punkt, an dem sich Finanzkapital und hochpro-duktive kreative Arbeit trafen. Die libertäre und liberale Ideologie, die die (ameri-kanische) Cyberkultur der 90er dominierte, idealisierte den Markt, indem sie ihn als bloße Umwelt darstellte. In dieser Umwelt, die so natürlich war wie der Kampf um das Überleben der Stärksten, der die Evolution möglich macht, würde die Arbeit die nötigen Mittel dazu finden, um an Wert zu gewinnen und ein Unternehmen zu wer-den. (Ebd.)
Diese Allianz war faustisch (vgl. Binswanger 1997): Während in Goethes Faust II der Kaiser sich auf Fausts Ratschlag hin seiner Schulden mit der Ausgabe von Pa-piergeld entledigte, indem er dieses mit seiner Unterschrift legitimierte und durch noch nicht gehobene Goldschätze im Boden deckte, vollzog der aktuelle Pakt seine virtuellen Finanztransaktionen auf der Grundlage von Kreativitätsversprechen (die auf der Seite der kognitiven ArbeiterInnen durchaus die Form von Kompetenzbe-hauptungen im Sinne Eikels hatten), also von Verheißungen ungeahnter Möglich-keiten, absolut neuer Ideen, von grenzüberschreitenden Innovationen usw. – bis die Blase, begleitet von neo-chiliastischen Hysterien, endlich platzte.
Greifen wir Sesinks Argumentation wieder auf. Eine bildungstheoretisch begründete Pädagogik diskutiere die Frage, was Bildung unter den skizzierten Bedingungen in-formationstechnischen Fortschritts noch heißen könne, gern unter der Alternative von Anpassung oder Widerstand, wobei es als unerheblich einzustufen sei, „ob die Anpassung ‚kreativ’ oder unkreativ erfolgt, außer vielleicht, daß man feststellen muß, daß kreative Anpassung eher eine noch größere Sauerei ist, weil sie den An-passungs-Charakter verschleiert“ (Sesink 2000: 19). Trotz des derzeitigen Kreativi-tätsgeredes entdeckt Sesink in der Bildung eine widerständige Kraft, indem sie „ein Moment behauptet, das sich in der technischen Tendenz nicht aufheben läßt: das kreative, nicht-maschinelle Moment der menschlichen Existenz“ (ebd.: 20); indem Bildung in der kritischen Reflexion des technischen Fortschritts dieses kreative Mo-ment zur Geltung bringe, werde sie nicht zu einer dem technischen Fortschritt äußer-lichen Position des Einspruchs, sondern zur Quelle, aus dem sich dieser Fortschritt speise:
Techniker, Ingenieure, Informatiker sind in unserem Namen und Auftrag im Begrif-fe, die Welt in eine gigantische Maschine zu verwandeln. Sie können dies, weil sie selbst keine Maschinen sind, auch wenn sie sich selbst oft dafür halten. Denn die Verwandlung der Welt in eine Maschine ist eine schöpferische Tätigkeit; sie kann daher niemals das Werk von Maschinen sein. (Ebd.)
Sesink hat hier eine technische Elite im Auge, welche als oberste Regelungsebene maschineller Systeme fungiert (vgl. Holling/Kempin 1989: 79; ähnlich wie Sesink argumentiert Winkler 2004: 250). Aber auch für Nicht-Angehörige des Kognitariats (Bifo) eröffnet Sesink Perspektiven unter Rekurs auf die Lebenswelt bzw. dem Bruch zwischen dieser und der technischen Welt, welcher beständig von Entwicklern wie Anwendern überbrückt werde:
Die Anwendung informatorischer Systeme ist eben niemals nur Bedienung des Sy-stems. Sie findet immer in Kontexten menschlicher Lebensgestaltung statt. Und das heißt, daß sie niemals nur eine definierte Funktion erfüllen, wie es das instrumentel-le, aber auch das systemisch-konstruktivistische Technikverständnis unterstellen, sondern zugleich auch immer neue Möglichkeiten der Gestaltung, „Möglichkeits-räume“ […] eröffnen. (Sesink 2000: 21)
Diese Gestaltungsräume aber „ können nicht nur, sie müssen wahrgenommen werden – andernfalls droht der Ausschluß“ (ebd.: 23). Sesink führt exemplarisch die Aktu-alität des Gouvernementalitätsansatzes auf informationspädagogischer Ebene vor. Angeordnete Freiheit ist eben keine, sie ist „funktional dringend benötigt und gefor-dert“ (ebd.: 22); Sesink bezieht das zwar auf die Pädagogik, welche er im gouverne-mentalen Rennen halten will: Die Zuständigkeit (= auch Kompetenz) für die Vermitt-lungssphäre zwischen technischer und Lebenswelt liege nämlich bei der (Informa-tions-, Medien-)Pädagogik. Technik könne nicht aus eigener Kraft konkret werden, ihre Materialisierung zweiter Instanz (die erste Instanz bezieht sich auf die von der Lebenswelt abgekoppelte Konstruktion der Technik) setze „entweder ihre Durch-setzung aufgrund sozialer Macht voraus oder ihre Akzeptanz bei den Anwendern“ (Sesink 2002: 12).
Keineswegs also entmündigt Informationstechnik die Menschen. Jedenfalls nicht, wenn wir sie als Vermittlungssphäre verstehen und nicht als Modell, nach dem die Welt sich richten soll. Vielmehr fordert sie Mündigkeit, die Selbstverantwortung, die eigene Sinngebung. Ganz nah also ist die Informatik plötzlich der Pädagogik. Beide sind Kinder der Aufklärung. (Ebd.: 16)
Sesink spielt hier ein gouvernementales (Macht-)Spiel – ähnlich wie das Symposium „ Bildet Regierungen! “ (Engel 2003):
Ich behaupte also die Zuständigkeit der Pädagogik für die Regierung im Felde der Neuen Lernmedien. (Sesink 2002: 4; Hervorhebung T.H.)
Sesink behauptet diese Zuständigkeit der Pädagogik gegenüber der Psychologie („Ja, die Psychologie ist der Brückenkopf des informatorischen Feindes auf pädagogi-schem Gebiet. Auf ihr Konto geht die Verbreitung von Lernbegriffen, die kompatibel sind zu informatorischem Denken. Sie liefert Modelle vom lernenden Menschen, die informatorisch verwertet werden können.“ Ebd.: 3) und hält damit alte Animositäten zwischen Pädagogik und Psychologie am Kochen (wie etwa auch Reichenbach/Oser 2002), welche hier nicht weiter geschürt werden sollen. Sesink jedenfalls verweist die Psychologie in die erste Instanz als Wasserträgerin der Technik durch Bereit-stellung kybernetisch-konstruktivistischer Lernbegriffe unter Laborbedingungen, während die Pädagogik, ebenso Wasserträgerin, Spezialistin der lebensweltlichen Vermittlungssphäre (der Gouvernementalität) sei und folglich bereits in der Entwick-lung der ersten Instanz befragt werden müsste, damit nicht – uneffiziente – Nachbes-serungen nötig werden. Abgesehen davon:
Ich behaupte also die Zuständigkeit der Pädagogik für die Regierung im Felde der Neuen Lernmedien.
Diese Äußerung, dieses Aussageereignis (Keller 2004: 64) – das mir nicht zu Beginn dieser Arbeit, sondern erst zu Beginn dieses Abschnittes aufgrund kontinuierlicher Nachrecherchen bekannt wurde – ist eine Trouvaille, die zwar die Grundthese dieser Arbeit nicht belegt, ihr aber zumindest eine gewisse Plausibilität verleiht. Freilich wird diese Äußerung durch ihre Kontextualisierung im Gouvernementalitätsansatz semantisch derart aufgeladen, dass Sesink sie nicht als eigene Worte wiedererken-nen würde – aber was sind schon eigene Worte ? Jedenfalls bündeln sich darin offen-sichtlich viele Momente des bisher Referierten, ohne dass sie hier noch einmal eigens angeführt werden müssten.
Sesink eröffnet zwar eine Perspektive, die sowohl der Pädagogik wie den Subjekten (der Pädagogik) einen gewissen Stellenwert an der Peripherie des Maschinensystems (vgl. Holling /Kempin 1989) sichert.
Was Technikern, Ingenieuren, Informatikern einfällt, leitet sich nicht einfach ab aus den Daten, die man ihnen gibt. Wäre es so, könnte man das Erfinden und Entwickeln den Computern überlassen. Was ihnen einfällt, fällt ihnen als Menschen ein. Ihre Kreativität entfaltet sich in einem humanen Sinnhorizont, dem die geschichtliche Dimension nicht zu nehmen ist, ohne ihm seinen humanen Sinn zu rauben. Subjektiv geht es um eine Verbesserung der Welt. Das ist nicht nur Legitimation; das ist die tiefe, humane Motivation der Technik. (Sesink 2000: 24)
Sesink verwischt hier Mensch versus Maschine mit human versus inhuman. Subjektiv ging es Hitler wahrscheinlich auch um die Verbesserung der Welt – und seine Tech-niker und Ingenieure verbesserten die Welt, indem sie das Abschlachten (freilich human motiviert, weil sie eben Menschen und nicht Untermenschen waren) – indu-striell perfektionierten? „Was ihnen einfällt, fällt ihnen als Menschen ein“, ist ange-sichts der beschworenen, aber nicht eingelösten historischen Dimensionierung, blanker Zynismus.
Wir beobachten immer deutlicher, wie das Verhalten des einzelnen und der Ge-sellschaft von verschiedenen Apparaten programmiert wird. Und wir beobachten immer häufiger, wie „intelligente Werkzeuge“ sich programmiert verhalten. Wir können nicht umhin, unser eigenes Verhalten darin wiederzuerkennen. Kurz, wir beobachten, daß das programmatische Weltbild nicht nur „theoretisch“ ist, sondern auch angewandt wird. Wenn wir bei der Analyse dieser Lage versuchen, die „Moti-ve“ aufzudecken, die hinter den Apparaten „verborgen“ sind, wenn wir finalistisch denken, dann verfallen wir den Programmen. Denn eben das ist ja im Programm ent-halten: daß wir angesichts der Apparate „Kulturkritik“ treiben. Zwar sind die „Moti-ve“ eine gute genetische Erklärung, sind doch die Apparate absichtlich hergestellt worden, aber eine solche Erklärung geht an der Sache vorbei: Die Apparate funktio-nieren immer unabhängiger von den „Motiven“ und immer mehr in Funktion ihrer Programme. Diese Programme werden immer öfter von zum Programmieren pro-grammierten Apparaten entworfen. Die Programme werden von Motiven immer au-tonomer. Die menschlichen Programmatoren sind immer häufiger selbst program-miert worden, um selbst zu programmieren. Zwar mögen sie sich subjektiv für die Besitzer der Apparate halten, aber funktionell sind sie Funktionäre ihrer eigenen Pro-gramme, ebenso wie die „Kulturkritiker“ Funktionäre sind, nur in anderen Abteilun-gen der Apparate. Beide, Programmatoren und Kritiker, haben nicht gelernt, pro-grammatisch zu denken.
Es ist ratsam, die Apparate weder zu objektivieren noch zu anthropomorphisieren, sondern sie in ihrem absurden, zufällig notwendigen Funktionieren zu fassen. Nur so können wir hoffen, sie in die Hand zu bekommen, um dann mit ihnen spielen und sie einem Meta-Programm einverleiben zu können. (Flusser 1997: 26 f).
5.6.3 Kreativitäts - und andere Selbst techniken
Weil der Postfordismus ein in seiner Spon-taneität und Kreativität reiches Subjekt be-nötigt, steigen die Chancen einer Hand-lungsfähigkeit, die über ihre Entstehungs-bedingungen hinausreicht.
(Opitz 2004: 188 f)
Seltsamerweise befassen sich die Gouvernementalitätsstudien nur ansatzweise mit der Kreativität als „Kern“ der neoliberalen Gouvernementalität bzw. Subjekti-vierung. Ulrich Bröckling nimmt sie zwar in das Glossar der Gegenwart auf:
Programme zur Kreativitätsförderung standardisieren den Bruch mit Standardlösun-gen. Sie normieren die Normabweichung und lehren, sich nicht auf Gelerntes zu ver-lassen. Die Wege zum je Besonderen sollen für alle gleich sein. Deshalb sind sie denkbar allgemein: Irritation von eingeschliffenen Denk- und Handlungsmustern, Ausschaltung innerer wie äußerer Zensurinstanzen und anderer „Kreativitätskiller“, künstliche Assoziationssprünge und Analogiebildungen, systematische Exploration und Erfassung möglicher Lösungen. (Bröckling 2004: 143)
Kreativität, darin ist sich Bröckling mit Sesink (bzw. mit dessen auf Kreativität ge-gründetem Bildung sbegriff) einig, braucht Muße, braucht Zeit. Bleibt zu ergänzen: wahre Kreativität, die aber nur angerufen wird. Bröckling windet sich elegant aus dem aus der gouvernementalen Beobachterebene erschlossenen „kreativen Im-perativ“, indem er diesen nicht als Beobachtungsleistung, sondern als „Realität“ ausgibt, von der er sich nun unverbindlich verabschieden kann: “Nicht die Losung ‚Don’t be creative!’ wäre die Negation der allgegenwärtigen Kreativitätsanfor-derungen, sondern die Abkehr vom Sprechen im Imperativ“ (ebd.: 144).
Eine detaillierte Untersuchung der aktuellen Kreativitätstechniken aber unterbleibt, wobei gerade eine solche aus gouvernementaler Perspektive relevant wäre: „Die Steuerungsregime wechseln, was bleibt, sind die Anstrengungen, Kreativität in Regie zu nehmen“ (ebd.: 140) – eigentlich wollte man/frau, wenn schon von einem Glossar der Gegenwart die Rede ist, wissen, wie das gegenwärtige Steuerungsregime be-schaffen ist. „Kreativitätsförderung ist Kontextsteuerung; sie schafft nichts, sie er-möglicht“ (ebd.: 143), erfahren wir, schafft also Möglichkeits- und Gestaltungs-räume, welche unternehmerisch-kreativ zu behausen sind, ansonsten droht der gesell-schaftliche Ausschluss – dies ist der gemeinsame Fluchtpunkt der Analysen im Glos-sar. So begnügen sich gouvernementalistische bzw. gouvernemental inspirierte Stu-dien zumeist mit dem Aufzeigen der Konvergenz der Anforderungen an Arbeitskraft-UnternehmerInnen und künstlerische Existenzweisen (für das Theater etwa Eikhof/ Haunschmid 2004), so dass KünstlerInnen nun nicht mehr als Leitbilder erscheinen, sondern „nur noch [als] ein bestimmtes Kreativitätssegment innerhalb eines effektiv verallgemeinerten Kreativitätsregimes“ (Marchart 2001: 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mind Machine Zen Master (www.visiosonic.de)
„Der Begriff des Selbst ist die engste und letzte
Spielform der Zirkularität“ (Foerster/Pörksen 1999: 68)
„Kreativität“ wird zum zeitgenössischen „Mehrwertgenerator“ schlechthin stilisiert, folglich ist es unter anderem eine, wenn nicht die wichtigste Aufgabe der Pädagogik, diese zu wecken und zu fördern, damit die Kinder sich nicht wie triviale Maschinen verhalten, die auf einen bestimmten Input immer ein und denselben Output erzeugen (vgl. 5.2):
Da unser Erziehungssystem darauf ausgelegt ist, berechenbare Staatsbürger zu er-zeugen, besteht sein Zweck darin, jene inneren Zustände auszuschalten, die Unbe-rechenbarkeit und Kreativität ermöglichen. […] Und wenn die Trivialisierung schon erfolgt ist, dann heißt die Aufgabe für die Pädagogik: Enttrivialisierung, auf andere Antworten aufmerksam machen, zu einer Vielfalt der Lösungen und Sichtweisen anregen. (Foerster/Pörksen 1999: 46 f)
Auch Heinz von Foerster verfällt jenem „impliziten Rousseauismus“ der Kreativi-tätsprogramme (Bröckling 2004: 142), selbst wenn Menschen bei ihm ursprünglich „nicht-triviale Maschinen“ sind, die im Prozess kultureller Formierung „trivialisiert“ werden und daher ihrer (alternativ-)pädagogischen „Ent-Trivialisierung“ harren.
Werfen wir kurz einen Blick auf die (klassisch-avantgardistischen) künstlerischen Selbsttechniken zur Kreativitätsförderungen (vgl. Heel 1991 und 1999) als Wege kritischer Desubjektivierung (vgl. 5.5.2) Diese sind oft ruinös (Drogen, Alkohol…), zumal es ja darum geht, etwas (kulturelle Routinen, „Mauern“, „Grenzen“…) zu „sprengen“, zu „überschreiten“, um in Form eines kontrollierten, experimentellen Abtauchens oder Überschreitens (denn es wird zumindest in irgend einer medialen Form protokolliert) „Neuland“ zu betreten oder den – exemplarisch – Anschluss an den bzw. Einfluss auf den „materiellen Prozeß der Sinngebung“ (Kristeva 1978: 111) herzustellen bzw. zu erlangen, wobei oft intellektuelle Konstrukte (z.B. die Topolo-gie der Psychoanalyse) metaphorisch in „Betrieb“ genommen werden: „Der Text produzierende Prozeß partizipiert nicht an irgendeiner gefestigten Gesellschaft, son-dern an der gesellschaftlichen Umwandlung, die von der triebhaften und sprachlichen nicht zu trennen ist“ (ebd.: 113).
Michel Foucault, creative designer auf dem Feld des Denkens, hat diese permanente Transformation und schöpferische Überschreitung „mit den Mitteln extremer Grenz-erfahrungen verfolgt – mit Drogen und sadomasochistischem Sex, aber es [das Er-kunden der Grenzen und ihrer Überschreitung] kam auch in einer radikalen Politik zum Ausdruck“ (Shusterman 2001: 37), weil er „das ‚private’ Selbst als wesentlichen Ort und als Kampffeld des Politischen ansah“ (ebd.: 80); jedoch, räumt Fabian Heu-bel ein, der von einem Dispositiv der Kreativität bei Foucault selbst spricht:
[…] es entsteht der Eindruck, sein [Foucaults] Lob des kreativen Selbst der Selbst-bemeisterung und Selbsterfindung, der Selbstüberschreitung und Selbsttransforma-tion füge sich nahtlos in die ästhetische Ökonomie des fortgeschrittenen Kapitalis-mus und das ihm zugehörige Ideal des kreativen Selbst-Unternehmers. (Heubel 2002: 229)
Heubels Eindruck täuscht nicht. Er ist einerseits ein Effekt der bereits genannten Umcodierung ehemals widerständiger Praktiken in vorgebliche Systemnotwendig-keiten. Andererseits ist dieses „private Selbst“ tatsächlich der wesentliche Ort und das Kampffeld des Politischen, nämlich insofern, als es gegenwärtig nur mehr als Grenze fungiert, die es zu überschreiten gilt. Von Außen, das heißt globalisiert öko-nomisch, kommt permanenter Transformations- und Kreativitätsdruck. Innen, gefan-gen gehalten durch pädagogische und gesellschaftliche Trivialisierung, west der noch nicht gehobene Schatz der Kreativität:
Die neue Welt macht Geld aus Wissen und Information, aus Kreativität und Neugier. Das Kapital steckt in den Köpfen. Doch wie kommt es auf Ihr Konto? […] der Wan-del ist eine Tür, die sich nur von innen öffnen läßt. (Berger 2005)
Lutz Berger von „Creativ Concept“ (Deutschlands erstem und einzigen Fachversand zum Themenbereich KREATIVität) führt als Beispiele von „innovativen Modellen und Techologien“ zur Förderung von Kreativität an: „NLP, Neuro-Feedback, der Einsatz von Musik und speziellen Frequenzen, Mind Machines, computergestützte Selbstprogrammierungs- und Vorstellungstechniken, ethno-schamanistische Techni-ken und Methoden“ (ebd.). Berger spricht bezeichnenderweise von „cerebraler Soft-ware“, andernorts ist von Mindmachines die Rede, welche „das mentale Betriebssy-stem in Schwung bringen“ (N.N. 2005 b: 1), also cognitive enhancement bewirken sollen (vgl. Schaefer 2004).
Während bei Heinz von Foerster noch vorausgesetzt werden kann, dass, selbst wenn er von Kindern als „nicht-trivialen Maschinen“ spricht, es sich dabei um kyberneti-sches Analogisieren und Metaphorisieren handelt, welches eben strikt behaviouris-tisch ist und von Materialität absieht, so indizieren die beiden letzten Beispiele, dass die Kybernetisierung gegenwärtig naturalisiert wird. Foerster weist der Pädagogik immerhin die traditionelle, wenn auch schwierig zu bewerkstelligende Aufgabe zu: einerseits soll sie Verantwortung dafür zu tragen, dass die Kinder berechenbare StaatsbürgerInnen werden, andererseits aber dafür sorgen, dass sie offen und kreativ bleiben. Im zweiten Fall braucht es kein Pädagogik mehr: In der Kreativitäts gesell-schaft hat die ambivalente pädagogische Subjektivität ausgedient, sie ist vielmehr ein Hemmnis, welches den Anschluss an das kapitalisierbare humane Kreativitätspoten-tial verschließt oder zumindest erschwert; dahinter steht die naturalisierte Vorstel-lung gesellschaftlicher Formierung – There is no such thing like society; M. Thatcher –, dass die Maximierung des Eigennutzes das Wohl aller befördere. Das sich selbst ökonomisch maximierende Subjekt bedarf nicht der/ einer Pädagogik über das Ver-mitteln von basalen Kulturtechniken hinaus, sondern einer Art von standardisierter Selbstbenutzeroberfläche: „Es gibt kein mentales Äquivalent zu Microsoft“ (Berger 2005). Die augenblicklich geforderte oder erwünschte Selbsttransformation soll (ähnlich dem mood management mittels Medien) durch direkte biochemische oder neurologische Manipulation erreicht werden, ohne einen langen pägogischen Ent-wicklungsroman zu durchlaufen: “Some worry that we will soon be able to alter our moods, emotions, desires and intellectual capacities at will trough the use of smart drugs, without the hard work of self on itself that is currently required” (Rose 2005: 14). „Smart Drugs“ (vgl. Hall 2003) wie Prozac oder mental enhancers wie Ritalin sollen hier stellvertretend für andere Produkte kosmetischer Pharmakologie (vgl. Rose 2005: 15) genannt werden. Im Kontext der Schlafforschung (Stichwort Moda-finil als Eugeroikum, „guter Wachmacher“ – im Unterschied etwa zu Amphetaminen, welche im militärischen Bereich zum Alltag gehören mit dem Zweck der Schaffung eines „metabolisch dominanten“ Soldaten) stellen allerdings die Neurowissenschaft-lerInnen Foster und Wulff bereits selbstkritische Fragen (vgl. Rögglas Roman wir schlafen nicht):
Wir könnten die Entwicklung der 24-Stunden-Gesellschaft weiter vorantreiben und Medikamente bei Bedarf nutzen, um die unerwünschten biologischen Effekte des Rund-um-die-Uhr-Arbeitens zu kompensieren. Oder wir könnten uns diesem Trend entgegenstemmen und unsere Kenntnisse über die innere Uhr nutzen, um Schlaf und biologische Zeit uns zu Eigen zu machen – und so die Vorteile von Abermillionen Jahren Evolution einstreichen.
Doch sind wir vielleicht schon zu weit gegangen? Haben wir eigentlich noch die Wahl? „Wir können die Uhren nicht zurückdrehen“ und „der 24/7-Geist wird nicht in seine Flasche zurückkehren“ sind Standardformeln der modernen Gesellschaft, und daher sind viele Menschen überzeugt, wir hätten keine andere Chance, als der Nacht den totalen Krieg anzusagen. Wie es scheint, wird die Technologie uns wahr-scheinlich helfen, ein 24/7-Leben zu bewältigen. Doch bedeutet, „mit so etwas fertig zu werden“, wirklich zu leben? Vielleicht spielt diese Frage dann schon keine große Rolle mehr, weil viele von uns schon so abgestumpft sind, dass sie den Unterschied zwischen Vegetieren und Leben nicht mehr wahrnehmen können. (Foster/Wulff 2005: 99)
Michael Schaefer, Fellow am National Institute of Health in Bethesda (USA), stellt in diesem Zusammenhang ebenfalls eine gute (und zugleich die gouvernementale) Frage: „Und wenn wir unser Selbst korrigieren können und sollen, geraten wir da nicht in einen Widerspruch, da das Selbst hier Objekt und Subjekt gleichzeitig ist?“ (Schaefer 2004: 3). Laut Nikolas Rose, einem der Vordenker des Gouvernementali-tätsansatzes, hat sich die Zahl ärztlicher Verschreibungen von Antidepressiva im Zeitraum 1993-2002 in Europa verdoppelt, jene von SSRI (das „Schwestermedika-ment“ von Prozac) verzehnfacht:
Yet we do not seem to have witnessed a general increase in geniality, well being, conviviality or any of the rest of it. In fact, these drugs do not allow individuals to manipulate their moods at will – they do so less reliably than the older and rather un-smart drugs such as alcohol and marijuana. Indeed they are not sold on this promise but another, more familiar one – not to make yourself something new, but ‘feel like yourself again’, get your life back, become the author in your own narrative. It is not the novel ethic of enhancement but the familiar ethic of authenticy – familiar from so many of our existing psychotherapies – that is engaged here. (Rose 2005: 15)
Rose versteht die präventive Abgabe von Psychopharmaka an SchülerInnen im US-Bundesstaat Texas, die aufgrund eines psychiatrischen screenings als potentiell ge-fährded (to be ‚at risk’) erachtet wurden – woraufhin die New Freedom Comission on Menthal Health ein Programm für ein generelles screening der Bevölkerung, ange-fangen mit den 52 Millionen Schülerinnen und StudentInnen und den sechs Milli-onen Lehrkräften, anregte – unter dem Askpekt der Kontrolle und des Risiko -Mana-gements (vgl. ebd.: 17), wobei die Verweigerung (Widerstand) eines solchen Scree-nings wahrscheinlich als pathogener Faktor gewertet wird / werden würde.
Was hat dies aber nun mit Medienkompetenz zu tun? Genau so viel, wie die Biotech-nologie und -medizin (vgl. Focualts Biomacht) mit der Wissensgesellschaft zu tun haben: Wenn der britische Premier Tony Blair auf der European Bioscience Confe-rence im November 2004 Biotechnologie als „the next wave of the knowledge eco-nomy“ ankündet (zit. n. Rose 2005: 2), so verbinde sich damit die Hoffnung auf eine „virtuous alliance of state, science and commerce in the pursuit of health and wealth“ (ebd.). Ein Zusammenhang zwischen Medienkompetenz mit dem Konstrukt der In-formationsgesellschaft ist insofern leicht herzustellen, als die Medienkompetenz in einer durch Informations- und Kommunikationstechnologien mitgeprägten Welt einerseits die notwendigen Kenntnisse vermitteln will/soll, um mit diesen Geräten bzw. den daraus gebildeten Netzen umgehen und sie mitgestalten zu können, ande-rerseits die Fähigkeit entwickeln will/soll, aus den dort verfügbaren Informationen für Individuen (Unternehmen/Instituionen/Gesellschaften) handlungs- und entschei-dungsrelevantes Wissen zu extrahieren (vgl. Höhne 2003 a: 56 ff).
Das Wissen der von Blair beschworenen knowledge economy / society freilich ist anderer Art: Es ist ein Wissen, das in abgeschotteten Labors angeblich entwickelt wird, zum größten Teil aber aus Versprechungen und Ankündigungen neuer Bio-technologien besteht: „Each day seems to bring news of research that promises to increase our ability to modify, manipulate, transform our living bodily processes at will or secular desires“ (Rose 2005: 2). Es ist ein Wissen, für das, noch ehe es das Labor verlässt, bereits Zuständigkeit in Form der Ausschüttung von Forschungsgel-dern reklamiert wird (Blair: „…and I want Britain to become its European hub“), das aber, verlässt es das Labor wirklich einmal, sogleich Patent und Produkt bzw. Pro-duktinformation und Werbung ist. Beide genannten Formen der Kompetenzbehaup-tung sind uns inzwischen hinreichend bekannt. Das Wissen der Wissensgesellschaft ist demnach ein Wissen, das noch nicht gewusst wird, ein Wissensversprechen, das an der Börse notiert und dessen Grundlage forscherische Kreativität ist; die Mauern um die Labors hüten nicht Wissen – „Das aussprechbare Geheimnis ist nur das Ge-heimgehaltene“ (Böhme 1997: 3) –, sondern ein Geheimnis, nämlich jenes, an dessen Auflösung darin aufschiebend gearbeitet wird, indem es infinitesimal ins Mikrosko-pische und Makroskopische verlagert wird, zugleich aber als extramurale (Re-)Or-ganisationgrundlage für den globalisiert-gesellschaftlichen Mesokosmos instrumen-talisiert wird:
Nichts scheint falscher zu sein, als die Webersche These von der Entzauberung der Welt. Die Entzauberung im Namen der Rationalität hat zu einem gewaltigen, kaum kontrollierbaren, doch wirkungsvollen Schub der Wiederverzauberung geführt. Die Renaissance des Geheimnisses liegt bereits hinter uns, doch haben wir ihren Zusam-menhang mit der Verwissenschaftlichung und der Technisierung aller Lebensbe-reiche nicht verstanden. Vereinfacht gesprochen, geht es darum, daß Kult- und Ge-heimnisformen (aller Art) die Bildung von ‚Gemeinschaftskörpern’ erlauben; genau dazu sind die aufgeklärten und demokratischen Vergesellschaftungsformen kaum in der Lage. Es sind diese ‚Gemeinschaftskörper’, welche für Menschen Plausibilität erzeugen, hier und jetzt in dieser Gesellschaft leben zu wollen und zu können. (Ebd.: 4; wobei ein solcher „Gemeinschaftsköper“ auch binär codiert werden kann - vgl. 4.3.1)
Wenn die Biotechnologie die „next wave“ der knowledge economy sein soll, dürften die IuK-Technologien wohl die noch aktuelle „Welle“ sein, und wenn wir uns gegen-wärtig angeblich am Übergang von der Informations- zur Wissensgesellschaft befin-den (eine der aktuell populärsten Zeitdiagnosen; Höhne 2003 b: 9) – wobei der Über-gang von Information zu Wissen positiv konnotiert, als fände damit eine Art Rück-kehr zu einer gewissen Sicherheit der Werte, des Wissenswerten statt – dann wird, heruntergbrochen auf den Kontext des Medienkompetenz -Konstrukts, dessen Kür im Sinne der Medienkreativität zur Pflicht. Der kompetente Umgang mit dem öffentli-chen Netz als Schaufenster disperser Informationen impliziert Medienkritik, Medien-kunde, Mediennutzung und innovative Mediengestaltung; Wissen im Sinne der know-ledge economy aber ist darin nicht zu finden, allenfalls Gewusstes, Verwusstes, Abge-wusstes, Zerwusstes. Was zwar Recycling und kreative Bricolage zulässt oder das Netz zu einer Basis für kulturwissenschaftliche Untersuchungen und Reflexionen werden lässt, aber auch zu Irritationen bei manchen (Schul-)PädagogInnen führen kann, sofern sie sich als WissensvermittlerInnen und damit als pädagogische Medien eindeutiger Botschaften verstehen; Wissen in der knowledge economy jedoch ist an das abgeschottete Labor als Arkanum gekoppelt, wo die wirkliche Arbeit stattfinden und sich der Gral eines ungbrochenen „Fortschrittsglaubens“ befinden soll.
Den Subjekten der knowledge economy nun wird via Kreativität als Innerstes ein solches Labor unterstellt, wo – in Analogie zum Es der Psychoanalyse – unentwegt gearbeitet, symbolisiert, transfomiert usw. (vgl. Kristeva 1977) wird. War aber ehe-dem das Es eine imaginäre Instanz, deren polymorphe Asozialität per Über-Ich zum Medium Ich zu zähmen war, so ist nun das Ich die sozial und pädagogisch konstru-ierte Grenz-Figur, die als letztes Hemmnis der Ankunft des verabsolutierten Mehr -Himmels auf Erden erscheint, welche die Vermählung von permanent transformativ-kreativem Es und permanent kreative Transformation forderndem Über-Ich zu ver-hindern droht.
Nikolas Roses Anregung, Smart Drugs und Cognitive Enhancers – und nicht nur die Gentechnologie – unter gouvernementalistischen Gesichtspunkten zu betrachten, ist hier doppelt bedeutsam: Einerseits für mich persönlich, da ich bereits 1991 in meiner germanistischen Diplomarbeit in Hinblick auf sogenannte „Wach-Schlaf-Präparate“, mit deren Hilfe den immer zeitdynamischer werdenden gesellschaftlichen, ökonomi-schen und betrieblichen Strukturen zeitplastische Individuen zur Verfügung gestellt werden sollten, für eine qualitative Extension des Medienbegriffs plädiert habe:
In einem dezenten Wink will ich die um einen empirisch-naturwissenschaftlichen Status […] ringende „Kommunikationswissenschaft“ auf einen „Gegenstand“ auf-merksam machen, der als Un-Gegenstand die aus einer Analyse der Massenmedien zaghaft gewonnene These der Impolsion sozialer/semiotischer Räume und Zeiten alltäglich und für eine ständig steigende Zahl von Menschen (der „ersten Welt“…) „verkörpert“ – im denkbar hintergründigsten Sinne: ich meine die „Pillen“. Sie nicht zu schlucken, um akademischen Trott auszuhalten, sondern denkerisch aufzulösen als das Paradebeispiel „verdinglichter“ Kommunikation, als Massen-Medium, als geronnene zweckdienliche ideologisch-wissenschaftliche Begrifflichkeit usw., das ist meine Anregung. (Heel 1991: 48)
Damit erweist sich, zweitens, der Gouvernementalitätsansatz zumindest für mich als eine Perspektive, die auch den Medienwissenschaften und der Medienpädagogik an-ders und Anderes zu sehen erlaubt, was bislang durch traditionelle Scheuklappen (Technikfixierung) verborgen geblieben ist (wiewohl Baudrillard 1992: 139 von einer mentalen Modellierung durch Psychopharmaka und Drogen spricht). Die Sub-jektzentrierung, welche Harald Gapski der Medienpädagogik vorwirft (vgl. 3.3.1), während Hans-Dieter Kübler diese gerade als spezifische Leistung der Medienpäda-gogik im (inter-)disziplinären Diskurs der Medien hervorkehrt (vgl. 1.3.2), wäre demnach in Subjektivierung zu transformieren, also zu prozessualisieren, temporali-sieren und probelmatisieren, wobei die Medienpädagogik ihre spezifisch pädagogi-sche Gouvernementalität zu reflektieren hätte.
6. Eine gouvernementalistischeMedienpädagogik?
6.1 Die Allianz von Cultural Studies und Critical Pedagogy
als Kontrastfolie
Wenn denn überhaupt eine vom Gouvernementalitätsansatz (mit-)inspirierte Medien-pädagogik angedacht werden sollte, so ließe sich deren Eigenart am besten vor der diskursiv minimal-kontrastiven Folie der Cultural Studies, welche ja auch maßgeb-lich auf Foucault fußen, illustrieren. Ohne einer theoriegeschichtlichen Verästelung zu folgen (um Gapskis Wendung zu bemühen), sei hier Oliver Marcharts nicht gera-de überkomplexe Grafik in Form eines „magischen Dreiecks“ als Succus der Cultural Studies nachgezeichnet:
Kultur
Identität Macht
(Marchart 2003: 10; ergänzt um Cultural Studies)
„Cultural Studies sind jene intellektuelle Praxis, die untersucht, wie soziale und poli-tische Identität qua Macht im Feld der Kultur (re-)produziert wird“ (ebd.), lautet Marcharts Versuch einer kurzen Definition der Cultural Studies; ergänzend führt er, bestimmte Vereinseitungen dieses Ansatzes, welche zu seiner akademischen Desa-vouierung beigetragen haben, ausgrenzend, weiter aus:
Eine Cultural Studies-Analyse zeichnet sich dadurch aus, dass die Kategorie Kultur nur eingesetzt werden kann, wenn zugleich die Kategorie der identitätsproduzieren-den Macht aufgerufen wird – denn sonst handelt es sich [...] um Pop-Feuilleton. Ge-nauso wenig kann von kultureller Identität die Rede sein, ohne dass von ihrer macht-basierten Durchsetzung – ihrer Artikulation in Dominanz- und Subordinationsver-hältnissen – zu sprechen ist. Und eine Analyse von Macht selbst (im Unterschied zu reinem Zwang und blosser Gewalt) muss immer auch Kultur als das eigentliche Me-dium der Macht berücksichtigen, das heisst als das Terrain, auf dem Identität kon-struiert wird. (Ebd.).
Marchart ergänzt darüber hinaus, dass es sich beim skizzierten Dreieck nicht um eine Topographie des Sozialen handele, sondern um einen analytischen Raster, was er je-doch in den etwas unglücklichen Kurzschluss „Identität (und damit Kultur) ist Macht“ (ebd.) überführt. Die Cultural Studies selbst seien dabei mitten in diesem Dreieck positioniert, sie wiesen die „Vorstellung der wissenschaftlichen Vogelper-spektive“ zurück, insofern sie selber eine kulturelle Praxis und damit machtbasiert seien: „Die Wissensproduktion der Cultural Studies dient der bewussten Interven-tion“ (ebd.). Medien sind in der Folge nicht Mittel zur Übertragung von Botschaften, sondern „Institutionen der Erzeugung und Artikulation von konsensualer Bedeutung im Rahmen hegemonialer Auseinandersetzungen“ (ebd.: 13).
Diesen interventionistischen Anspruch teilt die Medienpädagogik mit den Cultural Studies; während bei letzteren die Realisierung dieses Anspruches zugunsten intel-lektueller Glasperlenspielerei in Frage gestellt wird, wird der Medienpädagogik bis-weilen blinder Aktionismus ohne theoretischen Tiefgang vorgeworfen (vgl. 5.4).
Christian Swertz kritisiert an medienpädagogischen Adaptionsversuchen der Cultural Studies (z.B. Hipfl 2002, 2004; Winter 2004; Moser 2004), dass diese den „Über-gang von der Kritik zur Intervention, also von der theoretischen Analyse zu einer pädagogischen Praxis“ zu wenig oder gar nicht reflektierten (Swertz 2004: 3), wie-wohl die Cultural Studies ja ursprünglich in einem (erwachsenen-)pädagogischen Kontext entstanden sind (vgl. Marchart 2003: 8) und in den neunziger Jahren sehr wohl Brücken zur Critical Pedagogy geschlagen und damit die Bedingungen und Möglichkeiten ihres Praktisch-Werdens bedacht haben (vgl. etwa die Sammelbände Giroux/McLaren 1994; Giroux u.a. 1996 und Giroux/Shannon 1997).
Stellvetretend dafür soll hier kurz Rhonda Hammers und Peter McLarens Konzeption einer „media literacy as counter-hegemonic practice“ (Hammer/McLaren 1996: 101 ff) durch einige Kernzitate angerissen werden:
- A critical media literacy recognizes that we inhabit a photocentric, aural, and televisual culture, in which the proliferation of photographic and electronically produced images and sounds serves as a form of media catechism – perpetual pedagogy – through which individuals ritually encode and evaluate the engage-ments they make in various discursive contexts of everyday life […]. This form of literacy understands media representations – wheter photographs, television, print, film or others – as productive not merely of knowledge, but also of sub-jectivity. (Ebd.: 106)
- […] the critical media literacy that we envision seeks to create communities of resistance, counterpublic spheres, and oppositional pedagogies that can resist dominant forms of meaning by offering new channels of communication, cir-cuits of semiotic production, codifications of experience, and perspectives of reception that unmask the political linkage between images, their means of pro-duction and reception, and the social pratices they legitimate. (Ebd.: 108)
- Needed is a counterhegemonic media literacy in which subjectivities may be lived and analyzed outside the dominate regime of official print culture – a culture that is informed by a technophobic retreat from emerging technoae-sthetic cultures of photographs, film, and electronically mediated messages. (Ebd.: 109)
- Critical media literacy helps us to identify and answer the question: How do essentially arbitrarily organized cultural codes, products of historical struggle among not only regimes of signs but also regimes of material production, come to present “real”, the “natural”, and the “necessary”. (Ebd.: 112)
- A critical perspective of the media also enables teachers and students to under-stand the dangers considering literacy to be private or individual competency – or set of competencies – rather than a complex circulation of economic, politi-cal, and ideological practices that inform daily life […]. (Ebd.)
Das ist wirklich ein ambitioniertes Programm, das auf den ersten Blick mit den Grundannahmen des Gouvernementalitätsansatzes trefflich zu harmonieren scheint. Eine aktualisierte (2004), aber auch ein wenig verwässerte und konsenstaugliche Form einer solchen kritischen Medienkompetenz liefert Douglas Kellner, der auf-grund der technologischen Tranformation eine Re-Vision der Erziehung fordert:
The project of transforming education will take different forms in different contexts. In the overdeveloped countries, individuals should be empowered to work and to act in a high-tech information economy, and should learn skills of media and computer literacy to survive in the new social environement. Traditional skills of knowledge and critique should also be enhanced, so that individuals can name the system, de-scribe and grasp the changes occuring and defining features of the new global order, and can learn to engage in critical and oppositional practice in the interests of demo-cratization and progressive transformation. This process challenges us to gain a vi-sion of how life can be, of alternatives to the present order, and of the necessity of struggle and organization to realize progressive goals. Languages of knowledge and critique must be supplemented by the discourse of hope and practice. (Kellner 2004: 29)
Kellners Zitat ist bereits ein Zeugnis des Scheiterns bzw. des Verlusts des Glaubens an die Realisierbarkeit der beschworenen Perspektiven. Medienkompetenz ist hier zur individualisierten Kompetenz geworden, die sich man/frau aneignen muss, um überhaupt in einer ‚naturalisierten’ neuen sozialen Umwelt überleben zu können. ‚Kritik’ und (traditionelles) ‚Wissen’ werden als historische Vertiefungsfächer be-trachtet; sich noch alternative Existenzformen in der neuen sozialen Umwelt vorzu-stellen, wird zur Herausforderung (zumal alles in der neuen sozialen Umwelt eine solche ist); sofern noch Visionen diesbezüglich bzw. dies veränderlich bestehen soll-ten, hätten sie dem Prinzip Hoffnung verpflichtet zu sein, welches dann auch irgend-wann irgendwo irgendwie zu irgendeiner (ergo utopischen) Praxis führen könnte. Kellner führt hier, im selben argumentativen und theoretischen Cultural Studies/ Critical Pedagogy -Kontext, einen beispielhaften Krebsgang zu Hammer/McLaren vor.
Wenn es denn eine Aufgabe für eine Pädagogik, über die Vermittlung arbeitsmarkt-mäßiger Fitness hinaus, in derart interpretierten Zeiten geben sollte, dann besteht sie nach Angela McRobbie, Professorin für Communiactions an der Universität London (McRobbie kommt aus dem Cultural Studies-Umfeld, wird aber auch im gouverne-mentalistischen Kontext angeführt), für „intellectuals or perhaps an ‚older genera-tion’“ (McRobbie 2002: 10) in der Vermittlung von Nostalgie:
We have to confront the embeddedness of business studies and enterprise culture in a population who have not grown up as subjects of ‚welfare regime’, ‚public minded-ness’ and public sector employment. If the categories no longer exist then neither do the subjects (this is the logic of Foucault). (Ebd.)
Eine solche ‚Argumentation’ ist nur mehr als Hohn zu bewerten. This is not the logic of Foucault – wie man ihn auch drehen und wenden mag. Eine dozierende laudatio temporis acti ist die beamtete Inkorporation des Prinzips Hoffnungslosigkeit.
Heinz Moser rät der deutschsprachigen Medienpädagogik dennoch, die Ergebnisse der Cultural Studies „30 Jahre nach ihren Anfängen in Birmingham intensiver zu re-zipieren“ (Moser 2004: 18). Auch er moniert, dass sich in den Cultural Studies die anfänglich dezidiert pädagogische Intention in Richtung hochkomplexer, teils herme-tischer Analytik verschoben habe, weshalb es medienpädagogisch schwierig sei, „solche Konzepte Schüler/innen und Jugendlichen als Orientierungsrahmen zu ver-mitteln“ (edb.: 14). Offenbar misstraut Moser der Vermittlungskompetenz seiner ei-genen Disziplin, denn er empfiehlt für den Brückenschlag zwischen den Medien-Analysen der Cultural Studies zur sozialen Praxis nicht die praxiserprobte Medien-pädagogik, sondern die Ansätze der soziokulturellen Animation:
Wesentlich ist dabei, wie Menschen angeleitet werden können, kulturell schöpferisch zu werden – und dabei im Sinne der Pleasures der Cultural Studies auch Spaß und Vergnügen finden. [..]
Das ist m.E. auch jenes Element, das Dieter Baacke gegenüber einer aufklärerischen Medienpädagogik als Aspekt der Mediengestaltung stets betont hat […]. (Ebd.: 15 f)
Moser bestätigt damit einerseits eine der Kernaussagen dieser Arbeit in Bezug auf den Stellenwert der Kreativität (vgl. 5.6.1), andererseits aber indiziert die vorge-schlagene Lösung (Theorie - Praxis) gerade die Dringlichkeit einer gouvernementa-listischen Reflexion des pädagogischen Theorie-Praxis-Nexus bzw. einer solchen (medien-)pädagogischen Programmatik. Soziokulturelle Animation setze – im Unter-schied zu „belehrenden pädagogischen Konzepten“ (ebd.: 15) – auf Empowerment und Partizipation, also auf Programme aus dem Glossar der Gegenwart. Pointiert (nach-)gesagt: Mosers Therapie ist die Krankheit, die sie heilen will…
Christian Swertz weicht, anders als Moser, angesichts der selbst aufgeworfenen Fra-ge der Nicht-Einlösung des interventionalistischen Anspruchs der Cultural Studies nicht auf theoretisch-praktisches Culture-Crossing aus, welches Synergie -Effekte verspricht, sondern er mobilisiert die paradox-ambivalente Grundstruktur moderner Subjektivität, welche „innerhalb der Pädagogik in einem spezifischen Disziplinwis-sen kultiviert“ (Höhne 2003 a: 243) ist, für den gegebenen Kontext der Vermittlung so:
Für die hier aufgeworfene Frage nach der Möglichkeit eines interventionalistischen Charakters der Cultural Studies ergibt sich […]: […] die kritische Analyse [kann] praktisch gewendet werden, z.B. indem […] die Forschungslogik für eine entspre-chende (!) Unterrichtspraxis umgesetzt wird. Dabei darf das Ziel jedoch nicht sein, damit die „richtige“ Analyse vorzuführen oder die Ergebnisse als finale Wahrheit hinzustellen. Das Ziel bleibt offen; es wird den Lernenden eine Denkmöglichkeit aufgezeigt, d.h. ein Bildungsanlass geschaffen – und ob die Lernenden diese Mög-lichkeit annehmen oder nicht, muss ihnen überlassen bleiben, und auch andere For-men der Analyse müssen offen gehalten und nicht von vornherein abgelehnt werden; d.h. die Cultural Studies müssen die Anwendung der eigenen Macht in der pädagogi-schen Praxis als Geltungsanspruch realisieren und sich zugleich der Anwendung der Macht enthalten. (Swertz 2004: 6 f)
Macht als Geltungsanspruch realisieren und sich zugleich ihrer Anwendnung enthal-ten, indem die zu be/ermächtigenden Subjekte dazu gebracht werden, sich – Angebo-te werden geliefert – selbstverantwortlich ihrer selbst zu bemächtigen oder auch nicht, meint letztlich: Selber schuld (also Aufklärung pur). Aber: Analyse muss sein… In der Tat.
6.2 Prolegomena zu einer gouvernemental reflektierten
Medienkompetenz
Einen interventionistischen Anspruch, den die Cultural Studies offenbar nicht (mehr) einlösen, erheben die Gouvernementalitätsstudien erst gar nicht. Hier geht zuerst um das Eröffnen neuer Beobachtungsperspektiven (zweiter Ordnung) und die Schaffung eines analytischen Rahmens. Vergegenwärtigen wir uns Harald Gapskis Versuch, die Luhmannsche Systemtheorie auf den Medienkomeptenzdiskurs herunterzubrechen, wobei er in eine diskursive Isolation geraten ist – ähnlich würde voraussichtlich der Versuch eines gouvernementalistischen Medienkompetenz-Konzeptes enden.
6.2.1 Eine Relativierung des Gouvernementalitätsansatzes
Der digitale Himmel über mir, die virtu-elle Lebenskunst in mir…
(Schmid 1998: 134)
Die analytische Kompetenz (sit venia verbo) des Gouvernementalitätsansatzes liegt in der Untersuchung von Subjektivierungsprogrammen. Deshalb wäre es auch vermes-sen, von ihm ein Praktisch-Werden im Sinne eines Tranfers in ein medienpädagogi-sches Bildungsprogramm oder in mediendidaktische Projekte zu erhoffen. Aber auch Anleitungen zur ‚Widerständigkeit’ und wertende ‚Kritik’ sind von ihm nicht zu er-warten:
Die Schreib-Maschine der Analytik der Gouvernementalität kann von einem „bes-ser“ und „schlechter“ nur schwer sprechen, weil derartige Urteile von epistemischen fundierten Bedingungen abhängen, die sie selbst archäologisch abtastet. Statt dem „besser“ oder „schlechter“ widmet sie sich bevorzugt den Ausprägungen des „an-ders“. Wollte man daraus eine praktisch-politische Haltung ableiten, gründete sie auf der Ansicht, dass die Verhältnisse niemals „böse“, sondern immer gefährlich sind. (Opitz 2004: 190)
Dennoch wird der Gouvernementalitätsansatz primär in kritisch und widerständig ausgerichteten Zirkeln als Auffrischungsquelle rezipiert; dass er außerhalb solcher Kreise durchaus als affirmativ erscheinen kann, verwundert deshalb wenig (vgl. 4.2.2). Die Gouvernementalitätsstudien gründen auf der Analyse (neo)liberaler Ge-sellschaften und teilen mit ihnen die Auffassung, dass Macht das Element für Frei-heit sei, teilen also eine wesentliche (Selbst-)beschreibung mit dem Untersuchungs-gegenstand, um dann aber (etwas) anders frei sein zu können:
Indem sie [die gouvernementale Analytik] die Kontingenz einer historisch situierten Regierungsweise darlegt, eröffnet sie den Möglichkeitsraum einer Freiheit, die darin bestünde, sich die Gegenwart anders vorzustellen, als sie ist. […] Sie [die vorliegen-de Abeit] lässt keinen Zweifel daran, dass eine Freiheit als Effekt der Befreiung von sozialen Zwängen nicht dasselbe ist wie eine Freiheit, der ein dezidierter Auffor-derungscharakter innewohnt. Eine an solchen Erkenntnissen orientierte kritische Pra-xis würde deshalb versuchen, Freiheiten der zweiten Art in Freiheiten der ersten Art zu transformieren. Um so zu einer Freiheit zu gelangen, die von Vorgaben entbunden ist, wie diese Freiheit eingesetzt werden kann. (Ebd.: 194)
Dies ist der Abschluss von Opitz’ Arbeit zur Gouvernementalität im Postfordismus: Opitz dementiert die in Aussicht gestellte Freiheit derade dadurch, dass er seine Theoriebildung, seine kontrafaktische ‚Wahrheit’ aufgibt, „um sie durch Viabilität zu ersetzen“, womit er in ein ungewolltes Bündnis mit jener gesellschaftlichen Tendenz gerät, „die jede symbolische Operation ohnehin auf Praxisrelevanz verpflichten will“ (Winkler 2004: 230). Am Schluss also tappt Opitz genau in jene Falle, die er aus-führlich analysiert hat: Es ist augenscheinlich – um Foucaults Formel für Kritik zu bemühen – wirklich eine Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden.
Die argumentative Aussparung allgemeiner Prinzipien und universeller Freiheit (Opitz 2004: 194), mit deren Hilfe sich alles und nichts begründen lässt, ist nach-vollziehbar; spätestens aber, wenn Opitz die „Konturen eines neuen Regimes der Ak-zeptabilität“ (ebd.: 89) über die Trennungslinien zwischen Ökonomischem, Juridi-schem, der Wissenschaft und der Politik hinweg sich abzeichnen sieht – was sich nicht zuletzt am Beispiel der „Medienkompetenz“ exemplifizieren lässt –, müssten, zumindest wenn von der historischen Situiertheit von Regierungsweisen die Rede ist (gerade in Deutschland), bei ihm historische Alarmglocken läuten. Opitz zielt, wenn er meint, eine praktische Relevanz des Gouvernementalitätsansatzes in Aussicht stel-len zu müssen, indem Freiheiten der zweiten Art in Freiheiten der ersten Art zu transformieren wären, gerade auf die Überbrückung jenes Risses in der Foucault-Re-zeption, von der Brieler spricht: ein liberales Foucaultchen für die Lebenskunst einerseits, andererseits ein Funke, an dem sich die Kritik der Gegenwart entzündet (Brieler 2004).
Eine Ausformulierung einer solchen Lebenskunst-Konzeption im Anschluss an Fou-cault liefert Wilhelm Schmid (1998), der gewiss über profunde Foucault-Kenntnisse verfügt, dessen „Extremismus als Artikulation einer objektiven Unversöhnlichkeit“ jedoch eine „quasi-kantianische Wende“ gibt und ihn in eine „Position zwischen Liberalismus und Kommunitarismus“ umarbeitet (Heubel 2002: 232), wobei er die freie Wahl fetischiert (vgl. 4.3.2), was am Beispiel der gelassenen Führung im kyber-netischen Raum exemplifiziert sei:
Das Subjekt der Lebenskunst macht es zu einer Frage der Wahl, ob überhaupt und welche Technologien es gebraucht, wann und wann nicht, auf welche Weise, bis zu welchem Punkt, für welchen Zweck, um deren Möglichkeiten zu nutzen, ohne sich ihnen gänzlich zu unterwerfen. Die Wahrung einer Reserve, die Aufrechterhaltung einer skeptischen Distanz ist nötig, um einem Totalitätsanspruch der Medien zu ent-gehen und sich andere Möglichkeiten der Lebensgestaltung offen zu halten. Gelas-senheit kann jedoch auch bedeuten, die Führung seiner selbst im kybernetischen Raum auf gezielte Weise sein zu lassen, um sich der leidenschaftlichen Erfahrung des neuen Raums ganz zu überlassen. Das Heraufkommen einer neuen, alte Formen sprengenden Leidenschaft ist ein faszinierendes, singuläres Ereignis in der Geschich-te; um den Umgang mit ihr einzuüben, muss sie erst nach allen Seiten hin erfahren werden; das Selbst, das durch diese Erfahrung gestellt wird, muss sich auf neue Wei-se erst finden. Gelassenheit meint ferner, das System arbeiten zu lassen und dadurch den Freiraum zu gewinnen, in dem die Kreativität des Selbst sich entfalten kann, ent-lastet von den Aufgaben der Aufbewahrung von Datenmaterial und der Informa-tionsbearbeitung, die, soweit möglich, aus dem Denken des Selbst „ausgelagert“ werden. (Schmid 1998: 137 f)
Und so weiter. Schmid brabbelt ‚Gouvernementalität’ und nennt das dann Lebens-kunst. Es gibt also offensichtlich ein Desiderat in der deutschsprachigen Rezeption des Gouvernementalitätsansatzes: Wie sieht die Gouvernementalität totalitärer Syste-me aus, wie verhält sich liberale zu totalitärer Gouvernementalität, gibt es so etwas wie einen „qualitativen Umschlag“ – oder einfacher: Was kann der Gouvernemen-talitätsansatz mit Giorgio Agambens Foucault-Lesart des homo sacer (2002), die der hier favorisierten abjektiven Perspektive, wenngleich ähnlich abgehoben wie der Gouvernementalitätsansatz, ungleich näher liegt, anfangen?
Dennoch wird hier dem Gouvernermentalitätsansatz aufgrund seiner Situiertheit in linken, (globalisierungs-) kritischen und nach neuen Formen von Widerständigkeit suchenden intellektuellen Zirkeln unterstellt, dass seine VetreterInnen beispielsweise Adornos negativen pädagogischen kategorischer Imperativ („Die Forderung, daß Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung“; Adorno 1969: 85) gewiss unterschrieben, der dann gleichsam als minimale normative Grundlage eines angedachten Transfers gouvernementaler Perspektiven in einen pädagogischen Kon-text fungieren könnte – wiewohl Adornos Forderung wohl überlegt ist und eine ge-wisse paradoxe Gouvernementalität in sich birgt. Kersten Reich, Professor für Allge-meine Pädagogik in Köln und pädagogischer interaktionistischer Konstruktivist, bestätigt – im Kontext einer Rede 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, in welcher Adornos Forderung als ein dekonstruktivistisches Erziehungsziel erscheint – mein persönliches Misstrauen gegenüber Theorien „zweiter Ordnung“ (wozu sich der Gouvernementalitätsansatz auch stilisiert), wenn er meint, dass Auschwitz die Kon-struktivisten nicht vor die Möglichkeit unzähliger Erfindungen stelle, sondern klare normative Aussagen verlange (vgl. Reich 1995: 1); der Konstruktivismus als relati-vierende Wahrheitstheorie enthalte eine Schwachstelle, nämlich die, dass „man sich aus dieser relativierenden Position schnell zurückziehen und die Welt- und Alltags-probleme von einer höheren, bloß noch verstehenden Warte aus betrachten“ könne (ebd.):
Wir haben, wo immer es geht, wann immer es uns begegnet, wie auch immer es erscheint, jeglicher Macht und jeglichem Eingriff gegen die Menschenrechte zu begegenen, bevor wir in einem System von Tätern und Opfern gefangengesetzt sind, das uns jegliche Dekonstruktion verbietet. Auschwitz ist uns dafür ein Mahnmal, das für viele andere steht. (Ebd.: 25)
Vorausgesetzt, dass der Abstieg des Gouvernementalitätsansatzes aus der zweiten Ordnung in die erste Ordnung des Theoretisierens nicht ähnliche Entgleisungen ge-nerieren möge, gilt die abschließende Frage, welche Impulse sich aus der diskursiven Kontrastierung von Gouvernementalitätsansatz und pädaogogischem Medienkompe-tenz-Diskurs für letzteren ergeben könnten.
6.2.2 Vom Nutzen des Gouvernementalitätsansatzes für die Medienpädagogik
„Ziel allen medienpädagogischen Strebens ist demnach die Ich-AG“ (Maresch 2004: 1) – so oder so ähnlich könnte das Fazit lauten, wäre Medienkompetenz ein Eintrag im gouvernementalistischen Glossar der Gegenwart, und man/frau könnte mit Frank Haase (2003) den Abschied von der Medienkompetenz feiern.
Wurde in Kapiel 3.2.1 der Effekt der Suffixoidisierung per -kompetenz als seman-tische Perturbation charakterisiert, so ist der Fokus und gleichzeitg das prädizierbare Ergebnis gouvernementaler Analytik das unternehmerische Selbst. Insofern ist die gouvernementale Deutung im Sinne der Kybernetik (mega-)trivial. Ähnlich wie das Suffixoid ist sie auf Diskurse und Leitbegriffe der ersten Ordnung angewiesen, um sie dann auf der zweiten Ebene der Beobachtung zu ver ein deutigen. Dies wiederum ist ein Effekt jener Verschärfung, welche die jüngeren Arbeiten der governmentality studies Foucaults Methode zumuten, wie Opitz unter dem Titel „Blindheit und Ein-sicht“ treffend bemerkt:
Foucault nimmt in seinen Arbeiten den Umweg über die Vergangenheit, um die Frage zu beantworten, was das Heute ist. […] Während Foucault eine Schicht des Diskursiven und Nicht-Diskursiven isolieren konnte, fällt eine solche Distanznahme in den meisten Arbeiten der governmentality studies weg. Konfrontierte Foucault seine Leser mit einer systematischen Fremdheit, so ist die Kontingenz jeder Gouver-nementalität der Gegenwart eine sich immer erst noch erweisen werdende. (Opitz 2004: 192 f)
Das programmatische Desinteresse der Gouvernementalitätsstudien an einer empi-rischen Überprüfung ihrer theoretischen Analysen (Wie verhalten sich die analysier-ten Formen von Subjektivierung zu den empirischen Individuen? Vgl. Bührmann 2005 und 4.2.2) sowie die mangelnde Reflexion ihrer eigenen historischen Situiert-heit (die ja auch als „kontrastiver Diskurs“ fungieren kann) bewirkt eine systemati-sche Bekanntheit (im Unterschied zur systematischen Fremdheit bei Foucault), aus der heraus alle möglichen Diskurse expansiv-analytisch (aber eben auch zeitgeistig) bearbeitet werden können. Damit liefert der Gouvernementalitätsansatz eine besten-falls als subversiv oder karnevalesk (vgl. 2.4) zu interpretierende Karikatur von Theorien zweiter Ordnung (Systemtheorie, Konstruktivismus). Wie diese ist er auf User angewiesen, welche gouvernementalistische Interpretamente in verschiedene Disziplinen hineintragen, wo sie Unruhe stiften und die Routinen etablierter Be-triebssysteme stören, zu welchen Systemtheorie und Konstruktivimus inzwischen bereits überhöht worden sind. Bezeichenderweise evoziert die Bezugnahme auf den Gouvernementalitätsansatz im erziehungswissenschaftlichen Kontext scharfe Resen-timents gegen Konstruktivismus und Systemtheorie (vgl. 2.2).
Insofern, nämlich sofern diese Auslegung nicht allzu überzogen sein sollte, wären Konstruktivismus und Systemtheorie nicht als kontrastive, sondern als sozialwissen-schaftlich hegemoniale Diskurse zu betrachten, welchen sich der Gouvernementali-tätsansatz in Beschränkung und Beschränktheit bei gleichzeitig maßlosem Anspruch chamäleonhaft anzugleichen versucht, um transformative und aufklärerische Effekte zu provozieren (der Gouvernementalitätsansatz als akademischer Trojaner ?).
So gesehen, und es sind ja keine Dummköpfe, die da am Werk sind, könnte der Gou-vernementalitätsansatz durchaus als kreative pädagogische In(ter)vention im ter-tiären Bildungsbereich gewertet werden: nämlich als Versuch, dort aufklärerisch wirksam zu werden, wo Modelle von Wirksamkeit und zukünftigen Wirkens her-gestellt werden (was im Einklang mit der Fokussierung auf Programme stünde).
Zugegeben, hier wird in einer Schlangenlinie gedacht, was aber durchaus im Sinne der dialogischen, reflexiv-kritischen Positionierung des Aussagesubjekts der hier favorisierten Position einer ideologiekritischen Diskursanlayse ist (vgl. 2.3).
Abschließend will ich hier kurz eine „Pädagogik der Medien“ anreißen, in welcher die Subjektzentrierung des pädagogischen Medienkompetenz-Diskurses (vgl. 2.1 und 3.3.1) und die Fokussierung des Gouvernementalitätsansatzes auf Subjektivierungs-prozesse produktiv kurzgeschlossen werden könnten. Allerdings gibt es bereits ein bereits seit Anfang der 90er Jahre laufendes Forschungsprojekt gleichen Namens von Jochen Kade an der Universität Frankfurt, welches die vielfältigen Interdependenz-verhältnisse von Wissens- und Mediengesellschaften zu Erziehungs- und Bildungs-prozessen zum Thema hat und in Fallanalysen von Massenmedien (insbesondere des Fernsehens) die pädagogische Strukturierung der Massenmedien untersucht – „jen-seits medienpädagogischer Fragen“ ( Kade 2005: 1). Hier geht es also um das Iso-lieren und Beschreiben „medialer pädagogischer Kommunikation“ (Kade 2004: 229 f) etwa in (politischen) Talkshows zur Primtime (Kade 2003) – also um mediale For-mate, denen von vornherein ein aufklärerisches und implizit pädagogisches Moment anhaftet; die Normativität der medialen Form (Leschke 2001: 219 ff) dagegen ist mit einer solch engen Version pädagogischer Kommunikation, die von der Unterrichts-situation als Modell ausgeht, nicht zu erfassen.
Die hier anvisierte „Pädagogik der Medien“ kann zwar insofern an Kades Projekt anschließen, als die Pädagogik eine der gouvernementalen Künste der Moderne par exzellence gelten soll (vgl. Wrana 2003: 108); Kades Interesse ist aus dieser Sicht-weise auf besondere Arrangements pädagogischer Gouvernementalität im Fern-sehen gerichtet, das Fernshen als pädagogische/gouvernementale (und durchaus auch moralische) Apparatur (vgl. den Ansatz von Stauff – 5.5.2) übersteigt jedoch Kades analytischen Rahmen. Die Anschließbarkeit der hier imaginierten „Pädagogik der Medien“ an Kades Ansatz wäre also nur über die Formel „Gouvernementalität der Medien“ gegeben.
Meine Vorstellung hingegen geht in die Richtung einer qualitativen Expansion der Medien zu Medien der Subjektivierung aus der Sicht der Sub/Objekte gouvernemen-taler Programme (im Sinne von „Regierung“als Technologie der Regulation von Be-völkerungen und Transformation der Subjektivitäten von Individuen – Wrana 2003: 108). Die beispielsweise in 5.6.3 genannten Medikamente sind aus dieser Perspektive auch individualisierte/-ende „Massenmedien“; ebenso wie (Innen-)Architektur, Raumplanung und spezifische Erlebnis environements (Malls, funktionale öffentliche Räume usw. – vgl. ISIP o.J, Legnaro 2000, Augé 1994), die Folterkammern der kör-perlichen und die Operationssäle der optischen und die Labors genetischer Fitness, die Börsen, die Medien als Fabrik und Oberfläche, aber auch Schulen, Universitäten, Asylanten-, Altenheime und so weiter: Das wären Beispiele für die realiter aufzu-suchenden und möglichst lange auszuhaltenden, im traditionell-pädagogischen Sinne fokussierten (mit einer „Aufgabe“ und gemeinsamer „Reflexion“) Stätten einer „Pä-dagogik der Medien“ im Sinne von Medien der Subjektivierung und –anrufung. Bil-dungsziel könnte in einer solchen Vorstellung Bild sein, ein Körperschema, in das all die Individualitätszumutungen, die verbal oder nicht-verbal zugemutet werden, über die Jahre hinweg ein- und aufgetragen, überschrieben und wieder gestrichen werden. Und so weiter.
In einer solchen „Pädagogik der Medien“ klingt Adornos Forderung weiter, der Un-terricht müsse sich in Soziologie verwandeln, „also über das gesellschaftliche Kräfte-spiel belehren, das hinter der Oberfläche der politischen Formen seinen Ort hat“ (Adorno 1969: 101). Dass ein Rekurs auf Theodor Adorno im Kontext des Gouver-nementalitätsansatzes keinen Rückfall in einen ideologiekritischen Atavismus bedeu-ten muss, belegt Adornos Beschreibung des manipulativen Charakters, die der zen-tralen Figur des Unternehmer-Ichs im Gouvernementalitätsansatz bedenklich nahe kommt (ebenso wie Vilém Flussers Operator; vgl. 1.3.2):
Der manipulative Charakter […] zeichnet sich aus durch Organsisationswut, durch Unfähigkeit, überhaupt unmittelbare menschliche Erfahrungen zu machen, durch eine gewisse Art von Emotionslosigkeit, durch überwertigen Realismus. Er will um jeden Preis angebliche, wenn auch wahnhafte Realpolitik betreiben. Er denkt oder wünscht nicht eine Sekunde lang die Welt anders, als sie ist, besessen vom Willen of doing things, Dinge zu tun, gleichgültig gegen den Inhalt solchen Tuns. Er macht aus der Tätigkeit, der Aktivität, der sogenannten efficiency als solcher einen Kultus, der in der Reklame für den aktiven Menschen anklingt. […] Was damals nur einige Nazimonstren exemplifizierten, wird man heute feststellen können an sehr zahlrei-chen Menschen […]. (Ebd.: 94)
7. Bibliografie
Adorno, Theodor W. (1969): Erziehung nach Auschwitz. In: Ders.: Stichworte. Kritische Modelle 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1969: 85-101.
Adorno, Theodor W. / Horkheimer, Max (1985): Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt am Main: Fischer 1985.
Agamben, Giorgio (2002): Homo sacer. Die souveräne Macht und das absolute Leben. Frankfurt am Main. Suhrkamp 2002.
Ang, Iin (1999): Kultur und Kommunikation. Auf dem Weg zu einer ethnographischen Kritik des Medienkonsums im transnationalen Mediensystem. In: Bromley, Roger u.a. (1999): Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung. Lüneburg: zu Klampfen 1999: 317-340.
Ashby, W. Ross (1974): Einführung in die Kybernetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974.
Assheuer, Thomas (2003): Leben auf eigene Rechnung. In: Die Zeit 52/2003: 39.
Aufenanger, Stefan (1998): Was versteht man unter Kompetenz (soziologisch-medienpäda-gogischer Aspekt)? Vortrag auf dem Bundeskongress des Deutschen Kinderhilfs-werks in Minden am 15.5.1998. URL: http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/ Personal/ Aufenanger/auf_sub/veroeff.htm [15 Seiten; Zugriff: 18.11.2003].
Aufenanger, Stefan (2002): Medienerziehung und Medienkompetenz. In: Was bieten Me-dien? Was braucht die Gesellschaft. Chancen und Risiken moderner Kommuni-kation. München: Bayerischer Rundfunk 2002: 119-123.
Aufenanger, Stefan (2003 a): Medienkompetenz und Medienbildung. Vortrag zur ajs [=Aktion Jugendschutz]-Tagung „Medienkompetenz in der Erziehungshilfe und Jugendsozialarbeit“ am 12. 11.2002 in Stuttgart. Printversion in: ajs-Informationen 1/2003. URL: http://www.ajs-bw.de/media/files/ajs-info/aufenanger.pdf [8 Seiten; Zugriff: 23.10.2003].
Aufenanger, Stefan (2003 b): Situation und Perspektiven der Medienpädagogik. Theorie-defizite und verbandspolitische Neuorientierung. In: medien praktisch 2/2003: 11-13.
Augé, Marc (1994): Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Ein-samkeit. Frankfurt am Main: Fischer 1994.
Austin, Joe (2005): Youth, Neoliberalism, Ethics: Some Questions. In: rhizomes [Online-Zeitschrift], Issue 10, Spring 2005: Neo-Liberal Governmentality: Technologies of the Self & Governmental Conduct. URL: http://www.rhizomes.net/issue10/ austin.htm [30 Absätze; Zugriff: 8.6.2005].
Baacke, Dieter (1995): Die Medien. In: Lenzen, Dieter (Hrsg.): Erziehungswissenschaft. Ein Grundkurs. 2., verb. Aufl.; Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1995: 313-339.
Baacke, Dieter (1996 a): Medienkompetenz als Netzwerk. Reichweite und Fokussierung eines Begriffs, der Konjunktur hat. In: medien praktisch 2/1996: 4-10.
Baacke, Dieter (1996 b): Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In: Rein, Antje von (Hrsg.): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn: Klink-hardt 1996: 112-124.
Baacke, Dieter (1997): Medienpädagogik. Tübingen: Niemeyer 1997.
Baacke, Dieter (1998 a): Medienkompetenz im Spannungsfeld von Handlungskompetenz und Wahrnehmungskompetenz. Vortrag an der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-burg am 8.12.1998. URL: http://ph-ludwigsburg.de/ medien1/Baacke.pdf [8 Seiten; Zugriff: 17.10.2003].
Baacke, Dieter (1998 b): Zum Konzept und zur Operationalisierung von Medienkompetenz. URL: http://www-uni-bielefeld.de/paedagogik/agn/ag9/ MedienKomp.htm [4 Seiten; Zugriff: 9.11.2003].
Baacke, Dieter (1999 a): Projekte als Formen der Medienarbeit. In: Baacke, Dieter u.a. (Hrsg.): Medienkompetenz – Modelle und Projekte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 1999: 86-93.
Baacke, Dieter (1999 b): Vom Vorlesen bis zum Internet. Die Medienwelten der kleinen Kinder. In: Medienimpulse / März 1999: 5-12.
Bachmair, Ben (2001): Auf der Suche nach einem Bewertungsrahmen für die Medienent-wicklung. Skizzen zu einer Hermeneutik der Beziehung von Mensch und Medien. In: Medienimpulse / Dezember 2001: 33-41.
Balzer, Nicole (2004): Von den Schwierigkeiten, nicht oppositional zu denken. Linien der Foucaultrezeption in der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft. In: Ricken, Norbert / Rieger-Ladich, Markus (Hrsg:): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004: 15-35.
Barsch, Achim (2002): Medienerziehung. In: Rusch, Gebhardt (Hrsg.): Einführung in die Medienwissenschaft. Konzeptionen, Theorien, Methoden, Anwendungen. Wies-baden: Westdeutscher Verlag 2002: 314-328.
Barsch, Achim / Erlinger, Hans Dieter (2002): Medienpädagogik. Eine Einführung. Stutt-gart: Klett-Cotta 2002.
Barthes, Roland (1969): Literatur oder Geschichte. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1969.
Baudrillard, Jean (1989 a): Paradoxe Kommunikation. Bern: Benteli 1989.
Baudrillard, Jean (1989 b): Videowelt und fraktales Subjekt. In: Ars Electronica (Hrsg.): Philosophien der neuen Technologie. Berlin: Merve 1989: 113-131.
Baudrillard, Jean (1992): Transparenz des Bösen. Ein Essay über extreme Phänomene. Berlin: Merve 1992.
Bauer, Thomas (1997): Neue Medien und Neue Pädagogik – Die Interoperation von Medien und Pädagogik. Zur Transformation der Medienpädagogik. In: Medienimpulse / September 1997: 4-10.
Bauer, Thomas (2002): Zweitwissenschaft oder Erschließungsperspektive? Zur Relevanz pädagogischer Intervention in der Kommunikationswissenschaft. In: Pauss-Haase, Ingrid u.a. (Hrsg.): Medienpädagogik in der Kommunikationswissenschaft. Posi-tionen, Perspektiven, Potenziale. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2002: 21-33.
Bauer, Thomas (2003): Medienpädagogik als Mediationsfigur zwischen Medienökonomie und Medienkultur. Printversion in: Altmeppen, Klaus-Dieter / Karamasin, Matthias (Hrsg.): Medien und Ökonomie. Band 1/2: Grundlagen der Medienökonomie. Wies-baden: Westdeutscher Verlag 2003. URL: http://gerda.univie.ac.at/ thomasbauer/ tab/ media/pdf/artikel/Medien Paedagogik_Medienokonom.pdf [29 Seiten; Zugriff: 13.3.2004].
Bauer, Thomas (2004): Medienbildung in der Mediengesellschaft. Ein Kompetenzpro-gramm: Medien für Bildung – Bildung für Medien. URL: http://www.treffpunkt-ethik.de/download/Bauer_Medienbildung.pdf [14 Seiten; Zugriff: 23.10.2004].
Baumann, Zygmunt (1995): Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Frank-furt am Main: Fischer 1995.
Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986.
Benner, Dietrich u.a. (2003): Kritik in der Pädagogik. Versuche über das Kritische in Er-ziehung und Erziehungswissenschaft. Zeitschrift für Pädagogik, 46. Beiheft. Wein-heim, Basel, Berlin: Beltz 2003.
Berger, Lutz (2005): Mind & Brain, Die neurostarken Neunziger. URL: http://www.creativity.de/vorshop.htm [Zugriff: 5.8.2005].
Berger, Peter L. / Luckmann, Thomas (2004): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirk-lichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Fischer 2004.
Bickelmann, Karin / Sosalla, Werner (2002): Medienkompetenz. Voraussetzungen, För-derung, Handlungsschritte. Berlin: Vistas 2002.
Bierbaum, Harald (2004): Kritische Theorien des Subjekts (und) der Bildung. Foucault/ Butler und Heydorn/Koneffke zwischen Differenz und Annäherung. In: Massche-lein, Jan u.a. (Hrsg.) (2004): Kritik der Pädagogik – Pädagogik als Kritik. Opladen: Leske und Budrich 2004: 180-199.
Bifo, Franco Berardi (2003): Was heißt Autonomie heute? Rekombinantes Kapital und das Kognitariat. URL: http://republicart.net/disc/realpublicspaces/berardi01_de.pdf [ 6 Seiten; Zugriff: 10.5.2005]
Binswanger, Hans Christoph (1997): Geld und Magie. Deutung und Kritik der modernen Wirtschaft anhand von Goethes Faust. Stuttgart: Weinbrecht 31997.
Bischoff, Sandra / Schiefers, Anette (2002): Medienkompetenz. Eine Aufgabe nimmt Gestalt an. München: KoPäd-Verlag 2002.
Bismarck, Beatrice von (2004): Modellversuch Projektarbeit. Instituionalisierter Widerstand oder emanzipatorisches Experiment? URL: http://igklutur.at/igkultur/kulturrisse/ 1076864118/1076866736 [5 Seiten; Zugriff: 14.12.2004].
Blömeke, Sigrid (2001): Analyse von Konzepten zum Erwerb medienpädagogischer Kompe-tenz. Folgerungen aus den Ansätzen von Dieter Baacke und Gerhard Tulodziecki. In: Bachmair, Ben u.a. (Hrsg.): Jahrbuch Medienpädagogik 2. Opladen: Leske und Budrich 2001: 27-47.
Bodensohn, Rainer Michael (2002): Die inflationäre Anwendung des Kompetenzbegriffs fordert die bildungstheoretische Reflexion heraus. URL: http://www.uni-landau.de/ ~schulpra/Kompetenzen_ bildungstheoretisch.pdf [10 Seiten; Zugriff: 11.12.2003].
Böhme, Hartmut (1997): Das Geheimnis. Printversion in: Neue Zürcher Zeitung vom 20./21.12.1997: 65-66. URL: http://www.culture.hu-berlin.de/HB/volltexte/ texte/geheimnis.html [5 Seiten; Zugriff: 5.7.2005].
Bolz, Norbert (1999): Die Konformisten des Andersseins. Ende der Kritik. München: Fink 1999.
Borelli, Michele (2003): Utopisierung von Kritik. Pädagogik im Spannungsverhältnis von utopischem Begriff und kontingenter Faktizität. In: Benner, Dietrich u.a. (Hrsg.): Kritik in der Pädagogik. Versuche über das Kritische in Erziehung und Erziehungs-wissenschaft. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz 2003 (= Zeitschrift für Pädagogik, 46. Beiheft): 142-154.
Brennan, Marie / Popkewitz, Thomas S. (1998): Restructuring of Social and Political Theory in Education. Foucault and a Social Epistemology of School Practices. In: Brennan, Marie / Popkewitz, Thomas S. (Hrsg.): Foucault’s Challenge. Discourse, Know-ledge, and Power in Education. New York, London: Teachers College Press 1998: 3-35.
Bricmont, Jean / Sokal, Alan (1999): Eleganter Unsinn. Wie die Denker der Postmoderne die Wissenschaften mißbrauchen. München: Beck 1999.
Brieler, Ulrich (2004): Der Riss in der Rezeption. In: taz vom 25.6.2004: 15.
Bröckling, Ulrich (2000): Totale Mobilmachung. Menschenführung im Qualitäts- und Selbstmanagement. In: Bröckling, Ulrich u.a. (Hrsg.): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000: 131-167.
Bröckling, Ulrich (2002 a): Das unternehmerische Selbst in der Zivilgesellschaft. Vortrag auf dem Workshop „Zivilgesellschaft. Historische Forschungsperspektiven“ am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin, 7./7.12.2002. URL: http://www.k3000.ch/becreative/texts/text_12.html. [6 Seiten; Zufriff: 4.1.2004].
Bröckling, Ulrich (2002 b): Jeder könnte, aber nicht alle können. Konturen des unterneh-merischen Selbst. URL: http://www.eurozine.com/article/2002-10-02-broeckling-de.html#imprint [11 Seiten; Zugriff: 8.2.2004].
Bröckling, Ulrich (2003 a): Das demokratisierte Panopticon. Subjektivierung und Kontrolle im 360°-Feedback. In: Honneth, Axel / Saar, Martin (Hrsg.): Michel Foucault. Zwi-schenbilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003: 77-93.
Bröckling, Ulrich (2003 b): Menschenökonomie, Humankapital. In: Mittelweg 36, 1/2003: 3-22.
Bröckling, Ulrich (2004): Kreativität. In: Bröckling, Ulrich u.a.(Hrsg.): Glossar der Gegen-wart. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004: 139-144.
Bröckling, Ulrich u.a. (2000): Gouvernementalität, Neoliberalismus und Selbsttechnologien. Eine Einleitung. In: Bröckling, Ulrich u.a. (Hrsg.): Gouvernementalität der Gegen-wart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000: 7-40.
Bröckling, Ulrich u.a. (2004): Einleitung. In: Bröckling, Ulrich u.a.(Hrsg.): Glossar der Gegenwart. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004: 9-16.
Brunnett, Regina / Gräfe, Stefanie (2003): Gouvernemnetalität und Anti-Terror-Gesetze. Kritische Fragen an ein analytisches Konzept. In: Pieper, Marianne / Rodriguez, Encarnatión Guitiérrez (Hrsg.): Gouvernementalität. Ein sozialwissenschaftliches Konzept in Anschluss an Foucault. Frankfurt am Main, New York: Campus 2003: 50-67.
Bührmann, Andrea D. (2005): Das Auftauchen des unternehmerischen Selbst und seine gegenwärtige Hegemonität. Einige grundlegende Anmerkungen zur Analyse des (Trans-) Formierungsgeschehens moderner Subjektivierungsweisen. Forum Quali-tative Sozialforschung (Online-Zeitschrift) 6/1, Artikel 16. URL: http://www-qualitative-research.net/fqs-texte/1-05/o5-1-12-d.htm [49 Absätze; Zugriff: 30.1.2005].
Burkhardt, Wolfgang (2001): Förderung kindlicher Medienkompetenz durch die Eltern. Grundlagen, Konzepte und Zukunftsmodelle. Opladen: Leske und Budrich 2001.
Bußmann, Hadumod (1983): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner 1983.
Charim, Isolde (2003): Das (selbst)angetriebene Ich. Interview mit Martin Birkner in: Progress (ÖH-Magazin), 6/2003. URL: http//:oeh.ac.at/oeh/progress/ 106510248789/106510554943/106510668773 [4 Seiten; Zugriff: 4.4.2004].
Charlton, Michael / Sutter, Tilmann (2002): Medienkompetenz – einige Anmerkungen zum Kompetenzbegriff. In: Groeben, Norbert / Hurrelmann, Bettina (Hrsg.): Medienkom-petenz. Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim, München: Juventa 2002: 129-147.
Council of Europe / Parliarmentary Assembly (2000): Recommendation 1466 – Media Education. Assembly Debate on 27 June 2000. URL: http://assembly.coe.int/ Documents/ AdoptedTest/ta00/EREC1466.htm [4 Seiten; Zugriff: 23.9..2003]
Deleuze, Gilles (1992): Foucault. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1992.
Deleuze, Gilles (1993): Unterhandlungen 1972-1990. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993.
Deventer, Karsten / Schmitz-Gümbel, Eva (2005): Das Gedächtnis wird massiv gestört. Ge-fahr durch exzessiven Medienkonsum. Vollständiger Abdruck des Sendemanusktipts des ZDF-Beitrages im politischen Magazin „Fraontal 21“ vom 30.11.2004. URL: http://www.zeit-fragen.ch/ARCHIVE/ZF_124d/T07.HTM [3 Seiten; Zugriff: 11.2.2005].
Dewe, Bernd / Sander, Uwe (1996): Medienkompetenz und Erwachsenenbildung. In: Rein, Antje von (Hrsg.): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn: Klink-hardt 1996: 125- 155.
Dorer, Johanna (1999): Das Internet und die Genealogie des Kommunikationsdispositivs: Ein medientheoretischer Ansatz nach Foucault. In: Hepp, Andreas / Winter, Rainer (Hrsg.): Kultur – Medien – Macht. Cultural Studies und Medienanalyse. Opladen: Westdeutscher Verlag 21999:295-305.
Dreyfus, Hubert L / Rabinow, Paul: Michel Foucualt. Jenseits von Strukturalismus und Her-meneutik. Frankfurt am Main: Athenäum 1987.
Dzierzbicka, Agnieszka / Sattler, Elisabeth (2004): Entlassung in die ‚Autonomie’ – Spiel-arten des Selbstmanagements. In: Pongratz, Ludwig A. u.a. (Hrsg.): Nach Foucault. Diskurs- und machtanalytische Perspektiven der Pädagogik. Wiesbaden: VS Verlag 2004: 114- 133.
Egbringhoff, Julia u.a. (2003): Subjektivierung von Bildung. Bildungspolitische und bil-dungspraktische Konsequenzen der Subjektivierung von Arbeit. Arbeitsbericht. Stuttgart: Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg 2003.
Eikels, Kai van (2003): Kompetenz – Ein Essay über die Zeitdisziplinierung. URL: http//:www.t-rich.org/kompetenz.pdf [29 Seiten; Zugriff: 4.2.2005].
Eikhof, Doris / Haunschild, Axel (2004): Die Arbeitskraft-Unternehmer. Ein Forschungsbe-richt. Printversion in: Theater heute 2/2004. URL: http://theaterheute.de/archiv/03-04/foyer.html [14 Seiten; Zugriff: 23.4.2005].
Engel, Antke (2003): Konzept zum Symposion Bildet Regierungen! Gouvernementalität jenseits von Ökonomisierung und Verwertungslogik. 30./31.1.2004, Universität Lüneburg. URL: http//:dieregierung.uni-lueneburg.de/bildetregierungen.php [3 Seiten: Zugriff: 15.1.2004].
Engelmann, Jan (1999): Aktenzeichen „Foucault“. In: Foucault, Michel: Botschaften der Macht: Der Foucault-Reader, Diskurs und Medien. Hrsg. von Jan Engelmann. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1999: 215-226.
Eppensteiner, Barbara (2000): Auf dem Weg zur Medienkompetenz? URL: http//:www.aufdraht.org/texte/f_texte_medienkompetenz.htm [11 Seiten; Zugriff: 13.5.2004].
Erlass des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, GZ 48.233/14-Präs.10/01, Rundschreiben Nr.64/01 (Grundsatzerlass 2001). URL: http://www. mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/medienerziehung/ grundsatzerlass/ grundsatzerlass.htm [5 Seiten; Zugriff: 8.10.2003].
Euler, Peter (2004): Kritik in der Pädagogik. Zum Wandel eines konstitutiven Verhältnisses in der Pädagogik. In: Masschelein, Jan u.a. (Hrsg.) (2004): Kritik der Pädagogik – Pädagogik als Kritik. Opladen: Leske und Budrich 2004: 9-28.
Fairclough, Norman (2001): Globaler Kapitalismus und kritisches Diskursbewußtsein. In: Keller, Reiner u.a. (Hrsg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Band 1: Theorien und Methoden. Opladen: Leske und Budrich 2001: 335-351.
Faulstich, Werner (2002): Einführung in die Medienwissenschaft. München: Fink 2002.
Fischbach, Rainer (1998): Kompetenz aus der Dose. Printversion in: HLZ – Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hessen; H.6/ 998: 16 ff. URL: http://www.uni-kassel.de/gew/hlz69816.htm [4 Seiten; Zugriff: 22.12.2003].
Faulstich, Werner (2002): Einführung in die Medienwissenschaft. München: Fink 2002.
Fink-Eitel, Heinrich (1992): Foucault zur Einführung. Hamburg: Junius 21992.
Fitzsimons, Patrick (2002): Neoliberalism and Education: the Autonomous Chooser. In: Radical Pedagogy, Volume 4, Issue 2, Summer 2002. URL: http://radicalpedagogy. iaap.org/ content/issue4_2/04_fitzsimons.html [7 Seiten; Zugriff: 18.3.2004].
Flusser, Vilém (1997): Nachgeschichte. Eine korrigierte Geschichtsschreibung. Frankfurt am Main: Fischer 1997.
Flusser, Vilém (1998): Kommunikologie. Herausgegeben von Stefan Bollmann und Edith Flusser. Frankfurt am Main: Fischer 1998.
Foerster, Heinz von / Pörksen, Bernhard (1999): Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Gespräche für Skeptiker. Heidelberg: Auer 31999.
Forneck, Hermann J. (1999): Selbstorganisiertes Lernen und Modernisierungsimperative in der Erwachsenen- und Weiterbildung. URL: http://www-user.tuchemnitz.de/ ~koring/quellen/paed01/forneck.eb-antritt-vl/forneck-antritt-vorles.htm [12 Seiten; Zugriff: 5.1..2003].
Foster, Russel G. / Wulff, Katharina (2005): Unser Schlaf-Wach-Rhythmus. In: Spektrum der Wissenschaften, August 2005: 92-99.
Foucault, Michel (1985): Freiheit und Selbstsorge. Interview 1984 und Vorlesung 1982. Hrsg. v. Helmut Becker u.a. Frankfurt am Main: Materialis 1985.
Foucault, Michel (1987 a): Das Subjekt und die Macht. In: Dreyfus, Hubert L. / Rabinow, Paul (Hrsg.): Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Frankfurt am Main: Athenäum 1987: 243-261.
Foucault, Michel (1987 b): Von der Subversion des Wissens. Hrsg. von Walter Seitter. Frankfurt am Main: Fischer 1987.
Foucault, Michel (1989 a): Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989.
Foucault, Michel (1989 b): Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit 3. Frankfurt am Main:Suhrkamp 1989.
Foucault, Michel (1989 c): Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 81989.
Foucault, Michel (1992): Was ist Kritik? Berlin: Merve 1992.
Foucault, Michel (1993): Technologien des Selbst. In: Martin, Luther H. u.a. (Hrsg.): Technologien des Selbst. Frankfurt am Main: Fischer 1993: 24-63.
Foucault, Michel (1999): Botschaften der Macht: Der Foucault-Reader, Diskurs und Medien. Hrsg. von Jan Engelmann. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1999.
Foucault, Michel (o.J.): Von der Freundschaft als Lebensweise. Michel Foucault im Ge-spräch. Berlin, Merve o.J.
Fraser, Nancy (2003): Von der Disziplin zur Flexibilisierung? Foucault im Spiegel der Glo-balisierung. In: Honneth, Axel / Saar, Martin (Hrsg.): Michel Foucault. Zwischen-bilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003: 239-258.
Fuchs, Max (2000): Neue Medien als Herausforderung der kulturellen Jugendbildung. URL: http://www.akademieremscheid.de/ars/publikationen/aufsaetze/ fuchsneuemedien.pdf [13 Seiten; Zugriff: 12.4.2004].
Fuchs, Max (2003): Wissen und Bildung in der “Wissensgesellschaft“ – gezeigt an Homer Simpson. URL: http://www.akademieremscheid.de/ ars/publikationen/aufsaetze/ fuchs_wissensghsimpson.pdf [10 Seiten; Zugriff: 13.4.2004].
Gapski, Harald (1996): Über „Medienkompetenz“, „Media Literacy“ und die neuen Heraus-forderungen durch digitale Netzmedien. URL: http://gapski.de/ publications/ netzmedien_1996.html [4 Seiten; Zugriff: 24.11.2003].
Gapski, Harald (2001 a): Media Competence as a Key Concept in the information Society. Vortrag beim Media Literacy Workshop der EU am 3.4.2001 in Brüssel. URL: http://www.fr.eun.org/vs/media/comp/harald.html [7 Seiten; Zugriff: 27.11.2003].
Gapski, Harald (2001 b): Medienkompetenz. Eine Bestandsaufnahme und Vorüberlegungen zu einem systemtheoretischen Rahmenkonzept. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2001.
Gapski, Harald (2001 c): Was ist Medienkompetenz? Vortrag auf der Fachtagung „Medien-kritik und Medienkompetenz“ am 25. September 2001 in Dortmund. URL: http://www.ecmc.de/fachtagung-medienkompetenz-2001/doku/gapski.html [4 Seiten; Zugriff: 17.11.2003].
Gapski, Harald (2002): Medienkompetenz anders denken – ein Plädoyer für die Soziologi-sierung eines Begriffs. In: Koziol, Klaus / Hunold, Gerfied W. (Hrsg.): Medien-kompetenz. Kritik einer populären Universalkonzeption. München: KoPäd-Verl. 2002: 29-39.
Gapski, Harald (2003): De-pädagogisiert Medienkompetenz – Nutzt interdisziplinäre Schnittstellen! In: tv diskurs - Verantwortung in audiovisuellen Medien, Heft 23/2003: 68-69.
Geier, Manfred (1999): FAKE. Leben in künstlichen Welten. Mythos – Literatur – Wissen-schaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1999.
Giroux, Henry A. / McLaren, Peter (Hrsg.; 1994): Between Borders. Pedagogy and the Politics of Cultural Studies. New York, London: Routledge 1994.
Giroux, Henry A. u.a.. (Hrsg; 1996): Counternarratives. Cultural Studies and Critical Pedagogies in Postmodern Spaces. New York, London: Routledge 1996.
Giroux, Henry A. / Shannon, Patrick (Hrsg.; 1997): Education and Cultural Studies. Towards a Performative Practice. New York, London: Routledge 1997.
Glotz, Peter (2001): Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation. In: Hamm, Ingrid (Hrsg.): Medienkompetenz. Wirtschaft – Wissen –Wandel. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung 2001: 16-37.
Gräsel, Cornelia (2002): “Fachübergreifende Schlüsselqualifikationen“ – Versprechungen. In: Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Zukunft gestalten – Kompetenzen erwerben. Was muss wie in der Schule gelernt werden? Veranstal-tungsdokumentation (Brücken in die Zukunft; 6. Gespräch über Bildung). Berlin: 2002: 26-32.
Greco, Monica (2000): Homo Vacuus. Alexithymie und das neoliberale Gebot des Selbst-seins. In: Bröckling, Ulrich u.a. (Hrsg.): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000: 265-285.
Green, Bill (1998): Born-Again Teaching? Governmentality, „Grammar“ and Public Schoo-ling. In: Brennan, Marie / Popkewitz, Thomas S. (Hrsg.): Foucault’s Challenge. Discourse, Knowledge, and Power in Education. New York, London: Teachers College Press 1998: 173-204.
Groeben, Norbert (2002 a): Anforderungen an die theoretische Konzeptualisierung von Medienkompetenz. In: Groeben, Norbert / Hurrelmann, Bettina (Hrsg.): Medien-kompetenz. Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim, München: Juventa 2002: 11-22.
Groeben, Norbert (2002 b): Dimensionen der Medienkompetenz: Deskriptive und normative Aspekte. In: Groeben, Norbert / Hurrelmann, Bettina (Hrsg.): Medienkompetenz. Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim, München: Juventa 2002: 160-197.
Grossberg, Lawrence (1994): Bringin’ It All Back Home – Pedagogy and Cultural Studies. In: Giroux, Henry A. / McLaren, Peter (Hrsg): Between Borders. Pedagogy and the Politics of Cultural Studies. New York, London: Routledge 1994: 1-25.
Grossberg, Lawrence (1996): Fluchtwege. Versperrte Ausgänge. Interview mit Christian Höller. In: Widerstände. Kunst – Cultural Studies – Neue Medien. Interviews und Aufsätze aus der Zeitschrift springerin. Wien, Bozen: Folio 1999: 165-172.
Haase, Frank (1999): Medien – Codes – Menschmaschinen. Medientheoretische Studien zum 19. und 20. Jahrhundert. Opladen, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 1999.
Haase, Frank (2003): Abschied von der Medienkompetenz – oder: Sprache und Medien an-gesichts der Konvergenz der Medien. Sendung vom 8.1.2003. URL: http://3sat.de/ ard/pdf/F_12/hasse.pdf [18 Seiten; Zugriff: 26.12.2003].
Hall, Stephen S. (2003): The Quest for A Smart Pill. In: Scientific American, September 2003: 55-65.
Halmer, Elisabeth (2003): Warum integrative Medienerziehung in der AHS? – Eine Er-klärung anhand von Beispielen. In: Tell&Call 3/2003: 20-27.
Hamm, Ingrid (2001): Schule im Netz. In: Hamm, Ingrid (Hrsg.): Medienkompetenz. Wirtschaft – Wissen –Wandel. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung 2001: 146-193.
Hammer, Ronda / McLaren, Peter (1997): Media Knowledge, Warrior Citizenry, and Post-modern Literacies. In: Giroux, Henry A. u.a.. (Hrsg;): Counternarratives. Cultural Studies and Critical Pedagogies in Postmodern Spaces. New York, London: Routledge 1996: 81-115.
Haupert, Bernhard (2000): Gegenrede. Wider die neoliberale Invasion der Sozialen Arbeit. URL: http://www.qualitative-sozialforschung.de/haupert.htm#_ftn1 [27 Seiten; Zugriff: 13.2.2004].
Heel, Thomas (1991): Poetische Sprache und postmoderne Subjektivität. Diplomarbeit / „Deutsche Philologie“, Universität Wien. Unveröffentlicht.
Heel, Thomas (1999): Von der Unfreiheit der freien Improvisation. Abschlussarbeit zum Weiterbildenden Studium „Kulturmanagement“ an der Universität Hagen. Unveröffentlicht.
Heubel, Fabian (2002): Das Dispositiv der Kreativität. Darmstadt: Wissenschaftliche Buch-gesellschaft 2002.
Hepp, Andreas (2004): Cultural Studies und Medienanalyse. Eine Einführung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 22004.
Hipfl, Brigitte (2002): Zur Politik von Bedeutung: Medienpädagogik aus der Perspektive der Cultural Studies. In: Pauss-Haase, Ingrid u.a. (Hrsg.): Medienpädagogik in der Kom-munikationswissenschaft. Positionen, Perspektiven, Potenziale. Wiesbaden: West-deutscher Verlag 2002: 34-48.
Hipfl, Brigitte (2004): Medien –Macht –Pädagogik. URL: http://www.medienpaed.com/03-02/hipfl03-2.pdf [22 Seiten; Zugriff: 10.1.2004].
Hirseland, Andreas / Schneider, Werner (2001): Wahrheit, Ideologie und Diskurse. Zum Verhältnis von Diskursanalyse und Ideologiekritik. In: Keller, Reiner u.a. (Hrsg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Band 1: Theorien und Methoden. Opladen: Leske und Budrich 2001: 373-402.
Höhne, Thomas (2003 a): Pädagogik der Wissensgesellschaft. Bielefeld: transcript 2003.
Höhne, Thomas (2003 b): Regieren oder Kontrollieren in der Wissensgesellschaft? Über den Zusammenhang von Wissen, Medien und Macht. In: www.copyriot.com/ gouverne-mentalitaet (Hrsg.): „führe mich sanft“. Gouvernementalität. – Anschlüsse an Michel Foucault. Gesammelte Veröffentlichungen zur gleichnamigen studentischen Tagung am 1. und 2. 11. 2002 in Frankfurt am Main. E-book: URL: http//:www.copyriot. com/gouvernementaliaet/pdf/fms-ebook.pdf; Seiten 21-34 [Zugriff: 3.5.2004].
Höhne, Thomas (2004): Pädagogik und das Wissen der Gesellschaft. Erziehungswissen-schaftliche Perspektiven auf Wissen. Publikationen der eb.Giessen; Giessener Elektronische Bibliothek. URL: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2004/1830 [138 Seiten; Zugriff: 8.5.2005].
Höhne, Thomas (2005): Evaluation als Wissens- und Machtform. Publikationen der eb.Giessen; Giessener Elektronische Bibliothek. URL: http://geb.uni-giessen.de/ geb/volltexte/2005/2105 [41 Seiten; Zugriff: 6.7.2005].
Holling, Eggert / Kempin, Peter (1989): Identität, Geist, Maschine. Auf dem Weg zur technischen Zivilisation. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1989.
Honneth, Axel (2003): Foucault und die Humanwissenschaften. Zwischenbilanz einer Re-zeption. In: Honneth, Axel / Saar, Martin (Hrsg.): Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001. Frankfurt am Main: Suhr-kamp 2003: 15-26.
Hug, Theo (1998 a): Lesarten des „Instant Knowledge“. In: Hug, Theo (Hrsg.): Techno-logiekritik und Medienpädagogik. Zur Theorie und Praxis kritisch-reflexiver Me-dienkommunikation. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 1998: 180-188.
Hug, Theo (1998 b): Technologiekritik und Medienpädagogik – Zur Einleitung. In: Hug, Theo (Hrsg.): Technologiekritik und Medienpädagogik. Zur Theorie und Praxis kritisch-reflexiver Medienkommunikation. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 1998: 1-6.
Hug, Theo (1999): Dialogische Pädagogik im Zeitalter der neuen Informations- und Kom-munikationstechnologien. In: Toleranz-Minderheiten-Dialog.Teil 2. Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst. Wien: 1999: 18-26.
Hug, Theo (2001 a): Aufwachsen im Medienzeitalter. Überlegungen zu den veränderten Aufgabenbereichen und Zuständigkeiten der Medienpädagogik. Printversion in: Siegfried J. Schmidt (Hsg.): Lernen in Zeiten des Internets. Grundlagen, Probleme, Perspektiven. Bozen: Pädagogisches Institut für die Deutsche Sprachgruppe 2001: 139-155. URL: http://homepage.uibk.ac.at/~c60357/texte/brix2000.pdf [13 Seiten; Zugriff: 17.10.2003].
Hug, Theo (2001 b): Neue Medien – alte Pädagogik? Anmerkungen zur Frage des Lernens mit „platten Formen“ in Zeiten des Internet. In: Erziehung heute, H. 2/2001: 30-33.
Hug, Theo (2002): Medienpädagogik. In: Rusch, Gebhardt (Hrsg.): Einführung in die Me-dienwissenschaft. Konzeptionen, Theorien, Methoden, Anwendungen. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2002: 189-207.
Hurrelmann, Bettina (2002 a): Medienkompetenz: Geschichtliche Entwicklung, dimensio-nale Struktur, gesellschaftliche Einbettung. In: Groeben, Norbert / Hurrelmann, Bet-tina (Hrsg.): Medienkompetenz. Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen. Wein-heim, München: Juventa 2002: 301-314.
Hurrelmann, Bettina (2002 b): Zur historischen und kulturellen Relativität des ‚gesellschaft-lich handlungsfähigen Subjekts’ als normativer Rahmenidee für Medienkompetenz. In: Groeben, Norbert / Hurrelmann, Bettina (Hrsg.): Medienkompetenz. Voraus-setzungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim, München: Juventa 2002: 111-126.
Hurrelmann, Bettina (2003): Von der Integration schriftsprachlicher Fähigkeiten in den Er-werb der Medienkompetenz. Vortrag an der Tagung „Lesen und Schreiben im Kon-text neuer Medien“, Pädagog. Hochschule Zürich, 6.6.2003. URL: http://www.literalitaet.ch/ tagung03/Hurrelmann.pdf [14 Seiten; Zugriff: 23.1..2004].
Institut für Sicherheits- und Präventionsforschung (ISIP, o.J.): Die Ordnung der Nicht-Orte – Inszenierungen von Raum. Gestaltungen von Erleben und die Herstellung sozialer Ordnung. Abschlußbericht. URL: http://www-rrz-uni-hamburg.de/isip/Orte.html [16 Seiten; Zugriff: 20.3.2004]. Vgl. Legnaro 2000.
Kade, Jochen (2003): Zugemutete Angebote, angebotene Zumutungen – (Politische) Auf-klärung unter den Bedingungen von Ungewissheit. Printversion in: Helsper, Werner u.a. (Hrsg.): Ungewissheit. Pädagogische Felder im Modernisierungsprozess. Weilerwist: Velbrück 2003: 364-389. URL: http://www.velbrueck-wissenschaft.de/pdfs/jochenkade.pdf [22 Seiten; Zugriff: 27.8.2005].
Kade, Jochen (2004): Erziehung als pädagogische Kommunikation. In: Lenzen, Dieter (Hrsg.): Irritationen des Erziehungssystems. Pädagogische Resonanzen auf Niklas Luhmann. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004: 199-232.
Kade, Jochen (2005): Forschungsprojekt „Pädagogik der Medien“. URL: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/forschung/medienpaed.html [2 Seiten; Zugriff: 26.8.2005].
Kade, Jochen / Seitter, Wolfgang (1998): Bildung – Risiko – Genuß. Dimensionen und Ambivalenzen lebenslangen Lernens in der Moderne. Beitrag für die virtuelle Konferenz „Lernen und Bildung in der Wissensgesellschaft“, 11/1998. URL: http://www.wissensgesellschaft.org/themen/bildung/ bildungrisiko.pdf [12 Seiten; Zugriff: 9.10.2004].
Kade, Jochen / Seitter, Wolfgang (2001): Uneindeutige Verhältnisse. Bildung – Umgang mit Wissen – pädagogische Wissensordnungen. Theoretischer Zugang und empirische Fälle. Erste Befunde. Impulspapier zum Kolloquium „Wissensordnungen. Zum Umgang mit Wissen in unterschiedlichen (pädagogischen / pädagogiknahen / pädagogikfernen) Kontexten“ (22.-24.6.2001, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main). URL: http://uni-frankfurt.de/fb/fb04/download/Umwiss.pdf [Zugriff: 18.3.2005; 94 Seiten].
Keller, Reiner (1999): Diskursbegriff und interpretatives Paradigma. Referat zum Workshop „Perspektiven der Diskursanalyse“ vom 11.-12. März 1999 in Augsburg. URL: http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/Personal/Lohmann/Lehre/Wint3-4/pe/keller.html [6 Seiten; Zugriff: 19.5.2004 ].
Keller, Reiner (2001): Wissenssoziologische Diskursanalyse. In: Keller, Reiner u.a. (Hrsg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Band 1: Theorien und Methoden. Opladen: Leske und Budrich 2001: 113-143.
Keller, Reiner (2004): Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen. Opladen: Leske und Budrich 2004.
Kellner, Douglas (1999): Medien- und Kommunikationsforschung vs. Cultural Studies. Wider ihre Trennung. In: Bromley, Roger u.a. (1999): Cultural Studies. Grundlagen-texte zur Einführung. Lüneburg: zu Klampfen 1999: 341-363.
Kellner, Douglas (2004): Technological Transformation, Multiple Literacies, and the Re-visioning of Education. In: E-Learning, Vol. 1, Nr. 1/2004: 9-37.
Kerres, Michael u.a. (2003): Die Rolle der Medienpädagog/innen bei der Gestaltung der Medien- und Wissensgesellschaft. Printversion in: Neuss, Norbert (Hrsg.): Beruf Medienpädagoge. Selbstverständnis – Aufgaben – Arbeitsfelder. München: KoPaed Verlag 2003. URL: http//:online-campus.net/edumedia/publications/ ke4neuss2.doc [11 Seiten; Zugriff: 18.3.2005].
Keupp, Heiner u.a. (1999): Identitätskonstruktionen. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1999.
Kirschenmann, Johannes (2001): Irritationsästhetik in der Medienbildung. In: Kunst und Unterricht 257/2001:38-43.
Klammer, Irmgard C. (2000): Medienkompetenz und Bildungspolitik. URL: http://www.netzstilus.at/ media/medienkompetenz.htm [4 Seiten; Zugriff: 2.4.:2003].
Knipphals, Dirk (2004): Erkenne die diskursive Lage! In: taz vom 6.10.2004: 15.
Knobloch, Hubert (2001): Diskurs, Kommunikation und Wissenssoziologie. In: Keller, Reiner u.a. (Hrsg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Band 1: Theorien und Methoden. Opladen: Leske und Budrich 2001: 207-223.
Kögler, Hans-Herbert (1994): Michel Foucault. Stuttgart, Weimar: Metzler 1994.
Kögler, Hans-Herbert (1999): Kritische Hermeneutik des Subjekts. Cultural Studies als Erbe Kritischer Theorie. In: Hörning, Karl H. / Winter, Rainer (Hrsg.): Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999: 196-237.
Koller, Hans-Christoph / Lüders, Jenny (2005): Möglichkeiten und Grenzen der Foucault-schen Diskursanalyse. In: Ricken, Norbert / Rieger-Ladich, Markus (Hrsg:): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004: 57-76.
Koziol, Klaus / Hunold, Gerfied W. (Hrsg.; 2002): Medienkompetenz. Kritik einer populären Universalkonzeption. München: KoPäd-Verl. 2002
Krasmann, Susanne (2000): Gouvernementalität der Oberfläche. Aggressivität (ab)trainieren beispielsweise. In: Bröckling, Ulrich u.a. (Hrsg.): Gouvernementalität der Gegen-wart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000: 194-226.
Krasmann, Susanne (2003): Kriminelle Elemente regieren – und produzieren. In: Honneth, Axel / Saar, Martin (Hrsg.): Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003: 94-114.
Krasmann, Susanne (2004): Monitoring. In: Bröckling, Ulrich u.a.(Hrsg.): Glossar der Gegenwart. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004: 167-173.
Kreisky, Eva (2001): Ver- und Neuformungen des politischen und kulturellen Systems. Zur maskulinen Ethik des Neoliberalismus. Printversion in: Kurswechsel 4/2001: 38-50. URL: http://evakreisky.at/onlinetexte/neoliberalismus-kreisky.pdf [9 Seiten; Zu-griff: 12.3.2004].
Kris, Ernst (1977): Die ästhetische Illusion. Phänomene der Kunst in der Sicht der Psycho-analyse. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977.
Kristeva, Julia (1978): Die Revolution der poetischen Sprache. Frankfurt am Main: Suhr-kamp 1978.
Kübler, Hans-Dieter (1996): Kompetenz der Kompetenz der Kompetenz... Anmerkungen zur Lieblingsmetapher der Medienpädagogik. In: medien praktisch, 2/1996: 11-15.
Kübler, Hans-Dieter (1999): Medienkompetenz – Dimensionen eines Schlagwortes. In: Schell, Friedrich u.a. (Hrsg.): Medienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. München: KoPäd-Verlag 1999: 25-47.
Kübler, Hans-Dieter (2002 a): Die technologische Implosion des Medienpolitischen oder Warum sich multimediale Öffentlichkeit nicht mehr politisiert. In: Felsmann, Klaus-Dieter (Hrsg.): Medienkompetenz zwischen Bildung, Markt und Technik. 5. Buckower Mediengespräche. München: KoPäd.-Verl. 2002: 9-21.
Kübler, Hans-Dieter (2002 b): Medienpädagogik in der „Informationsgesellschaft“. Theo-retische und empirische Sondierungen. In: Pauss-Haase, Ingrid u.a. (Hrsg.): Medien-pädagogik in der Kommunikationswissenschaft. Positionen, Perspektiven, Potenzia-le. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2002: 169-191.
Kübler, Hans-Dieter (2002 c): Modalitäten von Medienkompetenz. Von der Mediener-ziehung zum Wissensmanagement? In: Koziol, Klaus / Hunold, Gerfied W. (Hrsg.): Medienkompetenz. Kritik einer populären Universalkonzeption. München: KoPäd-Verlag 2002: 18-28.
Kübler, Hans-Dieter (2003 a): Medienpädagogik wohin? Ein prospektiver Nachruf auf medien praktisch. Printversion in: medien praktisch 2/2003: 4-8. URL: http:// www.mediaculture-online.de/fileadmin/Kuebler_nachruf/Kuebler_nachruf.pdf [11 Seiten; Zugriff: 8.9.2004].
Kübler, Hans-Dieter (2003 b): Multimedia - Zwischen Kommerzialisierung des Lernens und der Herausforderung für eine ganzheitliche Bildung. In: Felsmann, Klaus-Dieter (Hrsg.): Das Politische im Diskurs zur Medienkompetenz. 6. Buckower Medien-gespräche. München: KoPäd.-Verlag 2003: 65-80.
Kübler, Hans-Dieter (2004): Medienbildung zwischen „Medienverwahrlosung“ und Infor-mationsdidaktik (information literacy). Vortrag an der Medienpädagogischen Mati-nee am 5.3.2004 im Literaturhaus Stuttgart. URL: http://www.mediaculture-online.de/fileadmin/bilder/Kuebler_medienver.pdf [27 Seiten; Zugriff: 28.4.2004].
Langemeyer, Ines (2003): Zur Kritik des Gouvernementalitätsansatzes. Leicht überarbeitete Fassung des Artikels: Subjektivierung als Schauplatz neoliberaler Macht (In: Zeit-schrift für Politische Psychologie, H. 3+4/2002: 361-375). URL: http//:www.Kritischepsychologie.de/archiv/material/031116_IL-KritikGouvernement.pdf [21 Seiten; Zugriff: 23.4.2004].
Larner, Wendy (2000): Neo-Liberalism: Policy, Ideology, Governmentality. Printversion in: Studies in Political Economy 2000/63: 5-25. URL: http://www.newcastle.edu.au/ centre/curs/downloads/2003/spe%20_revised_.pdf [26 Seiten; Zugriff: 23.3.2004].
Legnaro, Aldo (2000): Subjektivität im Zeitalter ihrer simulativen Reproduzierbarkeit: Das Beispiel des Disney-Kontinents. In: Bröckling, Ulrich u.a. (Hrsg.): Gouvernemen-talität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000: 286-314. Vgl. ISIP o.J.
Lehmann-Rommel, Roswitha (2004): Partizipation, Selbstreflexion und Rückmeldung: gouvernementale Regierungspraktiken im Feld Schulentwicklung. In: Ricken, Norbert / Rieger-Ladich, Markus (Hrsg:): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004: 261-283.
Lehrplan der Volksschule (2000). Wien: Österreichischer Bundesverlag 92000.
Lemke, Thomas (2001): Thomas Lemke im Interview mit Pro-qm (eine Buchhandlung in Berlin). URL: http://www.pro-qm.de/ArsViva/lemkeframe.html [2 Seiten; Zugriff: 16.10.2004].
Lemke, Thomas (2002 a): Foucault, Governmentality, and Critique. Printversion in: Rethinking Marxism, 14. Jg., Nr. 3/2002: 49-64. URL: http://www.thomaslemkeweb.de/publikationen/Foucault,%20Governmentality, %20and%20Critique%20IV-2.pdf [17 Seiten; Zugriff: 30.7.2004].
Lemke, Thomas (2002 b): Gouvernementalität. In: Kleiner, Marcus (Hrsg.): Michel Fou-cault. Eine Einführung in sein Denken. Frankfurt am Main: Campus 2001: 108-122.
Lemke, Thomas (2003): Andere Affirmationen. Gesellschaftsanalyse und Kritik im Post-fordismus. In: Honneth, Axel / Saar, Martin (Hrsg.): Michel Foucault. Zwischen-bilanz einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003: 259-274.
Lenk, Hans (2000): Kreative Aufstiege. Zur Philosophie und Psychologie der Kreativität. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000.
Leschke, Rainer (2001): Einführung in die Medienethik. München: Fink 2001.
Leschke, Rainer (2003): Einführung in die Medientheorie. München: Fink: 2003.
Lessenich, Stephan (2003): Soziale Subjektivität. Die neue Regierung der Gesellschaft. In: Mittelweg 36, 4/2003: 80-93.
Liesner, Andrea (2004): Von kleinen Herren und großen Knechten. Gouvernementali-tätstheoretische Anmerkungen zum Selbständigkeitskult in Politik und Pädagogik. In: Ricken, Norbert / Rieger-Ladich, Markus (Hrsg:): Michel Foucault: Päda-gogische Lektüren. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004: 285-300.
Lohmann, Ingrid (2002): Bildungspläne der Marktideologen. Ein Zwischenbericht. Vortrag am 18. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft ( 24.-27.3 2002). URL: http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/Personal/ Lohmann/Publik/ 18DgfE-SY.htm [13 Seiten; Zugriff: 24.2.2004].
Lohmann, Ingrid (2004): Tektonische Verschiebungen. Neue Weltmarktordnungen, Glo-balisierungspolitik und die Folgen für die nationalen Bildungs- und Sozialsysteme. Überarb. und erg. Fassung des Vortrags auf dem Kongress „Bildung über die Le-benszeit“ an der Universität Zürich, 21.-24.3.2004. URL: http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/Personal/Lohmann/Publik/zuerich-sy-19.doc [11 Seiten; Zugriff: 9.3.2005].
Lorenz, Thorsten (2000): Das Chaos der Medienpädagogik. Vom Mythos einer universellen Medienkompetenz. Vortrag Dezentrales Medienkolleg, Edutain 2000 in Karlsruhe. URL: http://ph-heidelberg.de/wp/lorenz/ChaosderMedienkom-petenz1.pdf [11 Sei-ten; Zugriff: 23.11.2004].
Ludwig, Joachim (2003): Kompetenzentwicklung als reflexiver Selbstverständigungspro-zess. Printversion in: Bolder, A. u.a. (Hrsg.): Heimliche Kompetenzen. Jahrbuch Arbeit und Bildung 2003. URL: http://projekt-be-online.de/ veroeffentlichungen/ pdf/KompetenzentwicklungSelbt.pdf [13 Seiten; Zugriff: 8.4.2004].
Lüders, Jenny (2004): Bildung im Diskurs. Diskurstheoretische Anschlüsse an Michel Foucault. In: Pongratz, Ludwig A. u.a. (Hrsg.): Nach Foucault. Diskurs- und machtanalytische Perspektiven der Pädagogik. Wiesbaden: VS Verlag 2004: 50-69.
Lutter, Christina / Reisenleitner, Markus (1998): Cultural Studies. Eine Einführung. Wien: Turia und Kant 1999.
Lyotard, Jean-Francois (1988): Ob man ohne Körper denken kann. In: Gumbrecht, Hans Ulrich / Pfeiffer, K. Ludwig (Hrsg.): Materialität der Kommunikation. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988: 813-829.
Marchart, Oliver (2001): Welcome to the Revolution. Printversion in: springerin 4/01. URL: http://springerin.ail.at/dyn/heft_text.php?textid=721&lang=de [Zugriff: 24.5.2004; 3 Seiten].
Marchart, Oliver (2003): Warum Cultural Studies vieles sind, aber nicht alles. Zum Kultur- und Medienbegriff der Cultural Studies. In: Medienheft Dossier 19 / 27.6. 2003: 7-14.
Maresch, Rudolf (2004): Gespenster-Pädagogik. Warum Medien-Pädagogen kleinere Bröt-chen backen sollten. Printversion in: merz (Medien und Erziehung) 1/2004: 46-51. URL: http://www.rudolf-maresch.de/texte/67.pdf [9 Seiten; Zugriff: 17.4.2004].
Maresch, Rudolf (2005): Individualitätszumutungen. (Über)Leben in der vernetzten Weltgesellschaft. URL: http://www.telepolis/de/r4/artikel/19/19182/1.html [8 Seiten; Zugriff: 15.2.2005].
Marshall, James D. (1995): Foucault and Neo-Liberalism: Biopower and Busno-Power. URL: http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/ 95_docs/marshall.html. [8 Seiten; Zugriff: 19.3.2004].
Marshall, James D. (1996): Education in the Mode of Information: Some Philosophical Considerations. URL: http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/ 96_docs/ marshall.html. [8 Seiten; Zugriff: 28.4.2004].
Marshall, James D. (1998): Michel Foucault: Philosophy, Education, and Freedom as an Exercise upon the Self. In: Peters, Michael (Hrsg.): Naming the Multiple. Poststruc-turalism and Education. Westport, London: Bergin & Garrey 1998: 65-83.
Marotzki, Winfried (2003): Medienbildung und digitale Kultur. In: Magdeburger Wissen-schaftsjournal 1-2/2003: 3-8.
Masschelein, Jan (2002): Die Erosion des pädagogischen Denkens als ein Vergessen der Kindheit. In: Reichenbach, Roland / Oser Fritz (Hrsg.): Die Psychologisierung der Pädagogik. Übel, Notwendigkeit oder Fehldiagnose. Weinheim, München: Juventa 2002; S. 189-208.
Masschelein, Jan (2003): Trivialisierung von Kritik. Kritische Erziehungswissenschaft weiterdenken. In: Benner, Dietrich u.a. (Hrsg.): Kritik in der Pädagogik. Versuche über das Kritische in Erziehung und Erziehungswissenschaft. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz 2003 (= Zeitschrift für Pädagogik, 46. Beiheft): 124-141.
Masschelein, Jan / Quaghebeur, Kerlijn (2003): Participation making a Differnece? Critical analysis of the participatory Claims of Change, Reversal an Empowerment [Prelimi-nary Version]. Prepared for the Conferne “Participation: From Tyranny to Transfor-mation? Exploring New Approaches to Participation in Development”; 27-28. Februar 2003, University of Manchester. URL: http://idpm.man.ac.uk/rsc/ events/participation03/Quaghebeur.doc [21 Seiten; Zugriff: 12.9.2004].
Masschelein, Jan u.a. (2004 a): Das Ethos kritischer Forschung. In: Pongratz, Ludwig A. u.a. (Hrsg.): Nach Foucault. Diskurs- und machtanalytische Perspektiven der Pädagogik. Wiesbaden: VS Verlag 2004: 9-29.
Masschelein, Jan u.a. (Hrsg.; 2004 b): Kritik der Pädagogik – Pädagogik als Kritik. Opla-den: Leske und Budrich 2004.
McRobbie, Angela (2002): ‚Everyone is Creative’. Artists as Pioneers of the New Economy. URL: http://www.k3000.ch/becreative/texts/text_5.html [12 Seiten; Zugriff: 28.10. 2004]. Eine frühere deutsche ist erschienen in: Interventionen 11/2000: 37-60.
Merkens, Andreas (2002): Ideologie, Kritik und Bildung. Entwicklungen, Widersprüche und Krisen ideologiekritischer Theoriebildung – Ein Überblick mit Schwerpunkt. Print-version in: Das Argument 246. URL: http//:www.linksnet.de/ drucksicht.php?id=802. [8 Seiten; Zugriff: 21.5.2004].
Merkens, Hans (2003): Immunisierung gegen Kritik durch Methodisierungn der Kritik. In: Benner, Dietrich u.a. (Hrsg): Kritik in der Pädagogik. Versuche über das Kritische in Erziehung und Erziehungswissenschaft. Zeitschrift für Pädagogik, 46. Beiheft. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz 2003: 33-53.
Meyer-Drawe, Käte (1996): Versuch einer Archäologie des pädagogischen Blicks. In: Zeitschrift für Pädagogik, H. 5/1996: 655-664.
Mikos, Lothar (2000): Ästhetische Erfahrung und visuelle Kompetenz: Zur Erweiterung der diskursiven Medienkompetenz um präsentative Elemente. In: Medienpädagogik 1/2000. URL: http://medienpaed.com/00-1/mikos1.pdf [16 Seiten; Zugriff: 3.4.2004].
Mikos, Lothar (2001): Cultural Studies, Medienanalyse und Rezeptionsästhetik. In: Göttlich, Udo u.a. (Hrsg.): Die Werkzeugkiste der Cultural Studies. Perspektiven, Anschlüsse und Interventionen. Bielefeld: transcript 2001: 323-342.
Miller, Peter / Rose, Nikolas (1991): Political Power Beyond the State. Problematics of Government. Printversion: British Journal of Sociology 43-2/1992: 177-205. URL: http://is.lse.ac.uk/events/ESRCseminars/Political_power_beyond_the_state.pdf [53 Seiten; Zugriff: 8.4.2004].
Moritz, Peter (1999): Kritische Kompetenz. Qualitative Inhalts- und Diskursanalyse als mediales Curriculum. In: Medienimpulse / März 1999: 61-65.
Moritz, Thomas (2001): Bildung und Medienpädagogik im Zeitalter der digitalen Medien. Probleme, Herausforderungen und Perspektiven für Pädagogik, Bildung und Schule in Zeiten von Internet und Telekommunikation. In: Medienimpulse / Sept. 2001: 51-60.
Moser, Heinz (1999): Einführung in die Medienpädagogik. Aufwachsen im Medienzeitalter. Opladen: Leske und Budrich 21999.
Moser, Heinz (2004): Bedürfnisse, soziale Texte und die Cultural Studies. URL: http//: medienoaed.com/03-2/moser03-2.pdf [21 Seiten; Zugriff: 11.2.2005].
Moser, Ingunn / Law, John (2003): „Making Voices“: New Media Technologies, Disabili-ties, and Articulation. Published by the Departement of Sociology and the Centre for Science Studies, Lancaster University, Lancaster LA1 4YN, UK at URL: http://www.comp.lans.ac.uk/sociology/Moser-LAW-Making-Voices.pdf [16 Seiten; Zugriff: 4.3.2004].
Mourad, Roger Jr. (2001): Education after Foucault: The Question of Cicility. In: Teachers College Record, Volume 103, Nummer 5, Oktober 2001: 739-759.
Münte-Goussar, Stephan (2001): Selbst-Sein. Zur Gouvernementalität der humanen und autonomen Schule. Pädagogische Diplomarbeit, Universität Hamburg 2001.
N.N. (2005 a): Aufklärung gegen die Medienverwahrlosung. Printversion in: Zeit-Fragen 1/2005 (3.1.2005). URL: http://www.zeit-fragen.ch/ARCHIVE/ZF_124d/T07.HTM [2 Seiten; Zugriff: 11.2.2005].
N.N. (2005 b): Mit dem Fragen nicht aufhören. In: Maschinenmarkt 19/2005. URL: http://www.maschinenmarkt.de/fachartikel/mm_fachartikel_fachgruppe_1913955.html [2 Seiten; Zugriff: 1.7.2005].
Naumann, Thilo (2001): Das umkämpfte Subjekt. Überarbeitete und ergänzte Fassung des Einführungsvortrages der „Tagung zu Subjektkonstitution und Ideologieproduktion“, 9.-11.2. 2001 an der Universität Frankfurt. URL: http//:www.copyriot.com/ unefarce/no5/subjekt.html [14 Seiten; Zugriff: 9.11.2003].
Nassehi, Armin (2004): Wasser auf dem Mars, Leben auf der Erde. Warum die Sozial-wissenschaften nützlicher sind, als ihre Kritiker ahnen. In: Die Zeit, Nr. 20, 6. 5. 2004: 38.
Neuss, Norbert (2000): Operationalisierung von Medienkompetenz – Ansätze, Probleme und Perspektiven. URL: http://www.medienpaed.com/00-1/neuss1.pdf [14 Seiten; Zugriff: 17.3.2004].
Odih, Pamela / Knights, David: ‚Discipline needs Time“: Education for Citizenship and the Finanacially Self Disciplined Subject. In: The School Field, Vol. 10 (1999), Nr. 3/4: 127-152.
Opitz, Sven (2004): Gouvernementalität im Postfordismus. Macht, Wissen und Techniken des Selbst im Feld unternehmerischer Rationalität. Hamburg: Argument Verlag 2004.
Osborne, Thomas (2003): Against ‚creativity’: a philisitine rant. In: Economy and Society, Vol. 32, Nr. 4/2003: 507-525.
Osten, Marion von (2002): Anleitung. In: Museum für Gestaltung Zürich (Hrsg.): Be Creative! Der kreative Imperativ. Begleitpublikation zur gleichnamingen Ausstel-lung (30.11.2002 – 16.2.2003): Zürich: Edition Musum für Gestaltung 2002: 1-4.
Orthey, Frank Michael (2002): Der Trend zur Kompetenz. Begriffsentwicklung und Perspektiven. Printversion in: Supervision 1/2002: S. 7-14. URL: http://www.ortheys.de/Veroeffentlichungen/ Trend_zur_Kompetenz.pdf [19 Seiten; Zugriff: 8.5.2004].
Owen, David (2003): Kritik und Gefangenschaft. Genealogie und Kritische Theorie. In: Honneth, Axel / Saar, Martin (Hrsg.): Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Re-zeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003: 122-144.
Oy, Gottfried (2000): Wir müssen reden. Kommunikation und Macht - ein gar nicht so ungleiches Paar. In: kommunikation@gesellschaft, Jg. 1, 2000, Beitrag 4. URL: http//:www.rz.uni-frankfurt.de/fb03/K.G/B4_2000_Oy.pdf [11 Seiten; Zugriff: 28.4.2004].
Parton, Nigel (1999): Reconfiguring Child Welfare Practices: Risk, Advanced Liberalism, and the Government of Freedom. In: Chambon, Adrienne S. u.a. (Hrsg.): Reading Foucault for Social Work. New York: Columbia University Press 1999: 101-130.
Peters, Michael (2001): Education, Enterprise Culture and the Enterpreneurial Self: A Foucauldian Perspective. In: Journal of Educational Enquiry 2/2001: 58-71.
Peters, Michael (2004):Why Foucault? New Directions in Anglo-American Educational Research. In: Pongratz, Ludwig A. u.a. (Hrsg.): Nach Foucault. Diskurs- und machtanalytische Perspektiven der Pädagogik. Wiesbaden: VS Verlag 2004: 195-219.
Pfaller, Robert (2003): Interpassivity and the Theory of Ritual. Printversion in: JEP (Journal of Europeyn Psychoanalysis), Nr. 16, Winter-Spring 2003. URL: http://www.psychomedia.it/jep/number16/pfaller.htm [8 Seiten; Zugriff: 24.5.2005].
Pfeiffer, Christian (2003): Bunt flimmert das Verderben. Printversion in: Die ZEIT 39/19.9. 2003. URL: http://zeus.zeit.de/text/2003/39/Essay_Pfeiffer_neu [4 Seiten; Zugriff: 23.10.2004].
Pias, Claus (2003 a): Zeit der Kybernetik – eine Einstimmung. In: Pias, Claus (Hrsg.): Cybernetics/Kybernetik. Die Macy-Konferenzen 1946-1953. 2 Bde. Berlin: Diaphenes 2003: 9-41.
Pias, Claus (2003 b): Die kybernetische Utopie. URL: http//:www.verbundkolleg-berlin.de/Veranstaltungenandere/Kollegiatentag03/Kollegiatentag%20Pias%Stand%2008_07_03.pdf [12 Seiten; Zugriff: 18.3.2005].
Pieper, Marianne (2003): Regierung der Armut oder Regierung von Armut. In: Pieper, Marianne / Rodriguez, Encarnatión Guitiérrez (Hrsg.): Gouvernementalität. Ein sozialwissenschaftliches Konzept in Anschluss an Foucault. Frankfurt am Main, New York: Campus 2003: 136-160.
Pieper, Marianne / Rodriguez, Encarnatión Guitiérrez (2003): Einleitung. In: Pieper, Marianne / Rodriguez, Encarnatión Guitiérrez (Hrsg.): Gouvernementalität. Ein sozialwissenschaftliches Konzept in Anschluss an Foucault. Frankfurt am Main, New York: Campus 2003: 7-21.
Pörksen, Uwe (1988): Plastikwörter. Die Sprache einer internationalen Diktatur. Stuttgart: Klett-Cotta 1988.
Pongratz, Ludwig A. (2001): Pädagogik und Disziplinargesellschaft. In: Hug, Theo (Hrsg.): Einführung in die Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung (= Wie kommt Wissenschaft zu Wissen? Band 4). Baltmannweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2001: 312-320.
Pongratz, Ludwig A. (2004 a): Freiwillige Selbstkontrolle. Schule zwischen Disziplinar- und Kontrollgesellschaft. In: Ricken, Norbert / Rieger-Ladich, Markus (Hrsg:): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004: 243-259.
Pongratz, Ludwig A. (2004 b): Konstruktivistische Pädagogik als Zauberkunststück: Vom Verschwindenlassen und Wiederauftauchen des Allgemeinen. In: Masschelein, Jan u.a. (Hrsg.) (2004): Kritik der Pädagogik – Pädagogik als Kritik. Opladen: Leske und Budrich 2004: 108-133.
Pongratz, Ludwig A. u.a. (Hrsg.) (2004): Nach Foucault. Diskurs- und machtanalytische Perspektiven der Pädagogik. Wiesbaden: VS Verlag 2004.
Portfolio Medienkompetenz für Schülerinnen und Schüler (2005): learnline.de-nordrhein-westfälischer Bildungsserver des Landesinstituts für Schule; betreut durch Annemarie Hauf-Tulodziecki. URL: http://www.learn-line.nrw.de/angebote/ portfoliomk/medio/portfolio/konzept_layer.htm [Zugriff: 12.4.2005].
Radtke, Frank-Olaf (2003): Die Erziehungswissenschaft der OECD – Aussichten auf die neue Performanz-Kultur. In: Erziehungswissenschaft, Mitteilungsheft der DGfE; 14. Jg. 2003 / H. 27: 109-136.
Reckwitz, Andreas (2004): Die Politik der Moderne aus kulturtheoretischer Perspektive: Vorpolitische Sinnhorizonte des Politischen, symbolische Antagonismen und das Regime der Gouvernementalität. In: Schwelling, Birgit (Hrsg.): Politikwissenschaft als Kulturwissenschaft. Thorien – Methoden – Forschungsperspektiven. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004: 33-56.
Reetz, Lothar (1999): Zum Zusammenhang von Schlüsselqualifikation-Kompetenzen-Bildung. In: Tramm, Tade (Hrsg.): Professionalisierung kaufmännischer Bildung: Beiträge zur Öffnung der Wirtschaftspädagogik für die Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Lang 1999: 32-51.
Reich, Kersten (1995): „…daß nie wieder Auschwitz sei!“ Gedanken über ein dekonstrukti-vistisches Erziehungsziel. URL: http://www.uni-koeln.de/ew-fak/konstrukt/texte/download/ auschwitz.pdf [36 Seiten; Zugriff: 23.10.2003]
Reich, Kersten (2001): Konstruktivistische Ansätze in den Sozial- und Kulturwissenschaften. In: Hug, Theo (Hrsg.): Einführung in die Wissenschaftstheorie und Wissenschafts-forschung (= Wie kommt Wissenschaft zu Wissen? Band 4). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren 2001: 356- 376.
Reichenbach, Roland (1999): Aufklärungseschatologische Insuffizienzen. Ein Plädoyer für die Pädagogische Provinz der Gegenwart. Referat an der Halbjahrestagung der Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, Eichstätt, Bayern, 1.10.1999. URL: http://www.unifr.ch/ pedg/archiv/Eichstaett-99.pdf [23 Seiten; Zugriff: 14.10.2003]
Reichenbach, Roland / Oser Fritz (Hrsg.; 2002): Die Psychologisierung der Pädagogik. Übel, Notwendigkeit oder Fehldiagnose. Weinheim, München: Juventa 2002.
Reichert, Ramón (2001): Agonale Selbstregierung – Marktmodelle als Bedingung für Subjektivität in agonalen Demokratietheorien. In: sinnhaft, Febraur 2001. URL: http://sinn-haft#.at/nr9_stoerfaelle/print_nr9_reichert_agonal.html [9 Seiten; Zugriff: 19.4.2004].
Reichert, Ramón (2002): Anthropologie der Arbeit im Postfordismus. In: Marburger Forum, Jg. 3 (2002), H.1. http//:philosophia-online.de/mafo/heft2002-01/Anthropologie_der_Arbeit.htm [21 Seiten].
Rein, Antje von (1996): Medienkompetenz – Schlüsselbegriff für die Informationsgesell-schaft. In: Rein, Antje von (Hrsg.): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1996: 11-23.
Ribolits, Erich (1997): Die Arbeit hoch? Berufspädagogische Streitschrift wider die Total-verzweckung des Menschen im Post-Fordismus. 2., durchges.u.erg.Aufl. München, Wien: Profil 1997.
Ribolits, Erich (2004): Pädagogisierung – Oder: “Wollt ihr die totale Erziehung“? Print-version in: Schulheft 116/2004. Innsbruck u.a.: Studienverlag 2004. URL: http://www.streifzuege.org/str_05-33_ribolits_paedagogisierung.html [6 Seiten; Zugriff: 21.4.2005].
Ricken, Norbert / Rieger-Ladich, Markus (2004): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Eine Einleitung. In: Dies.(Hrsg.): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Wies-baden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004: 7-13.
Röll, Franz Josef (2002): Medienkompetenz ist machbar. Thesen aus konstruktivistischer Sicht. In: Koziol, Klaus / Hunold, Gerfied W. (Hrsg.): Medienkompetenz. Kritik einer populären Universalkonzeption. München: KoPäd-Verl. 2002: 73-76.
Rose, Nikolas (2000): Tod des Sozialen? Eine Neubestimmung der Grenzen des Regierens. In: Bröckling, Ulrich u.a. (Hrsg.): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000: 72-109.
Rose, Nikolas (2005): Will Biomedicine Transform Societiy? The Political, Economic, Social and Personal Impact of Medical Advances in the Twenty First Century. Clifford Barclay Lecture, 2.2.2005, Hong Kong Theatre, London School of Economics. URL: http://www.lse.ac.uk/collections/LSEPublicLecturesAnd Events/pdf/20050202-WillBiomedicine-NikRose.pdf [21 Seiten; Zugriff: 7.7.2005].
Röggla, Kathrin (2004 a): wir schlafen nicht. Frankfurt am Main: Fischer 2004.
Röggla, Kathrin (2004 b): Interview in „Navigationen. Siegener Beiträge zur Medien- und Kulturwissenschaft“. URL: http://kathrin-roeggla.de/text/schlafen_interview.htm [12 Seiten, Zugriff: 14.3.2005].
Rößer, Barbara (2000): Über die Qualität des Wollens – Erzieherische Ableitungen aus Michel Foucaults Subjektbegriff. URL: http://www.gradnet.de/ pomo2.archives/pomo2.papers/roesser00.htm [8 Seiten; Zugriff: 30.5.2004].
Rößer, Barbara (2001): Wohin führt die „Sorge um sich“? URL: http://www.gradnet.de/ papers/pomo2.archives/pomo01.paper/Roesser01.htm [7 Seiten; Zugriff: 2.6.2004].
Rosebrock, Cornelia / Zitzelsberger, Olga (2002): Der Begriff Medienkompetenz als Zielperspektive im Diskurs der Pädagogik und Didaktik. In: Groeben, Norbert / Hurrelmann, Bettina (Hrsg.): Medienkompetenz. Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen. Weinheim, München: Juventa 2002: 148-159.
Ruhloff, Jörg (2003): Problematisierung von Kritik in der Pädagogik. In: Benner, Dietrich u.a. (Hrsg.): Kritik in der Pädagogik. Versuche über das Kritische in Erziehung und Erziehungswissenschaft. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz 2003 (= Zeitschrift für Pädagogik, 46. Beiheft): 111-123.
Sandbothe, Mike (2003): Vorwort zu Schmidt, Siegfried J.: Geschichten & Diskurse. Abschied vom Konstruktivismus. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2003: 7-22.
Sanders, Olaf (2004): Deleuzes Foucault – Bildung in Kontrollgesellschaft und populärer Kultur. In: Pongratz, Ludwig A. u.a. (Hrsg.) (2004 ): Nach Foucault. Diskurs- und machtanalytische Perspektiven der Pädagogik. Wiesbaden: VS Verlag 2004: 134- 157.
Schaefer, Michael (2004): Sorge dich nicht, schlucke. Cognitive Enhancement. Print-Version in: Freitag 19/20.4.2004. URL: http://www.freitag.de/2004/19/04191801.php [3 Seiten; Zugriff: 30.6.2005].
Schiersmann, Christiane u.a. (2002): Medienkompetenz – Kompetenz für Neue Medien. Studie im Auftrag des Forum Bildung. Bonn: Forum Bildung 2002.
Schmid, Wilhelm (1998): Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1998.
Schmid, Wilhelm (2000): Auf der Suche nach einer neuen Lebenskunst. Die Frage nach dem Grund und die Neubegründung der Ethik bei Foucault. Frankfurt am Main: Suhr-kamp 2000.
Schmidt, Siegfried J. (2000): Kalte Faszination. Medien, Kultur, Wissenschaft in der Mediengesellschaft. Weilerwirst: Velbrück Wissenschaft 2000.
Schmidt, Siegfried J. (2003): Geschichten & Diskurse. Abschied vom Konstruktivismus. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2003.
Schönberger, Klaus (2000): Der Mensch als Maschine. In: Das Argument 3/2000: 812-823.
Schönherr-Mann, Hans-Martin (1998): Zwischen Wertezerfall und Ästhetisierung. Ethik in der Informationsgesellschaft. In: Hug, Theo (Hrsg.): Technologiekritik und Medien-pädagogik. Zur Theorie und Praxis kritisch-reflexiver Medienkommunikation. Hohengehren: Schneider-Verlag 1998: 36-49.
Schorb, Bernd (1999): Vermittlung von Medienkompetenz als gesellschaftspolitischer Auf-trag. Referat bei der Fachtagung „Aktive Medienarbeit mit Kindern und Jugendli-chen – Offene Kanäle als Partner“ am 11./12.11 1999 in Wittstock an der Dosse. URL: http://www.bok.de/referat2.html [5 Seiten; Zugriff: 13.1.2004].
Schorb, Bernd (2001): Medien oder Kommunikation – wofür soll sich Kompetenz entfalten? In: Medien-Impulse Nr.36, Juni 2001: 12-16.
Schorb, Bernd (2002): Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft. Eine not-wendige und problematische Verbindung. In: Pauss-Haase, Ingrid u.a. (Hrsg.): Medienpädagogik in der Kommunikationswissenschaft. Positionen, Perspektiven, Potenziale. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2002: 206-217.
Schreiber, Manfred (o.J): PowerPoint – die „Kompetenzdroge des kleinen Mannes“? Kurze Abhandlung über Möglichkeiten und Missbräuche eines Computerprogrammes in Korrelation zu einem erziehungswissenschaftlich orientierten „Medienkompetenz-begriff“. URL: http://www.medienkiosk.de/ schrift/droge_PowerPoint.doc [5 Sei-ten; Zugriff: 29.12.2004].
Schröter, Jens (o.J.): Der König ist tot, es lebe der König. Zum Phantasma eines techno-logischen Subjekts der Geschichte. URL: http://www.theorie-der-medien.de/text_druck.php?nr=9 [10 Seiten; Zugriff: 7.7.2004].
Seiverth, Andreas (2005): „Entgrenzung“ in der reflexiven Moderne. Meditation über einen Schlüsselbegriff. Printversion in: Die Zeitschrift für Erwachsenenbildung 30-32//2005/1. URL: http//:www.diezeitschrift.de/12005/seiverth04_01.htm [4 Seiten; Zugriff: 18.6.2005].
Serres, Michel (1987): Der Parasit. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987.
Sesink, Werner (2000): Inverse Imitation – Über die Vor-läufigkeit der Technik. Vortrag vor der Kommision Erziehungs- und Bildungsphilosophie der DGfE am 26.3.2000 in Siegen. URL: http://www.sesink.de [26 Seiten; Zugriff 24.3.2004].
Sesink, Werner (2002): Informationspädagogik. Transdisziplinäres Forschen und Lehren im Schnittfeld von Pädagogik und Informatik.Vortrag an der Technischen Universität Berlin am 5.12.2002. URL: http://www.sesink.de [16 Seiten; Zugriff: 10.5.2005].
Siebert, Horst (2005): Sozialkonstruktivismus: Gesellschaft als Konstruktion. URL: http://sowi-onlinejournal.de/2004-2/sozialkonstruktivismus_siebert.htm [8 Seiten, Zugriff: 4.3.2005].
Shusterman, Richard (2001): Philosophie als Lebenspraxis. Wege in den Pragmatismus. Berlin: Akademie Verlag 2001.
Simola, Hannu u.a. (1998): A Catalog of Possibilities: Foucaultian History of Truth and Education Research. In: Brennan, Marie / Popkewitz, Thomas S. (Hrsg.): Foucault’s Challenge. Discourse, Knowledge, and Power in Education. New York, London: Teachers College Press 1998: 64-90.
Simons, Maarten (2004): Lernen, Leben und Investieren. Anmerkungen zur Biopolitik. In: Ricken, Norbert / Rieger-Ladich, Markus (Hrsg:): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004: 165-185.
Spanhel, Dieter (2002 a): Bedeutung der Medienpädagogik aus der Sicht der Erziehungs-wissenschaft. In: Pauss-Haase, Ingrid u.a. (Hrasg.): Medienpädagogik in der Kom-munikationswissenschaft. Positionen, Perspektiven, Potenziale. Wiesbaden: West-deutscher Verlag 2002: 59-74..
Spanhel, Dieter (2002 b): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff der Medienpädagogik? In: Koziol, Klaus / Hunold, Gerfied W. (Hrsg.): Medienkompetenz. Kritik einer popu-lären Universalkonzeption. München: KoPäd-Verl. 2002: 48-53.
Stang, Richard (1996): Wahrnehmungsbildung als Zukunftsaufgabe. In: Rein, Antje von (Hrsg.): Medienkompetenz als Schlüsselbergiff. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1996: 143-155.
Stauff, Markus (2004): ‚Das neue Fernsehen’. Machteffekte einer heterogenen Kulturtech-nologie. Phil. Dissertation. Bochum: Ruhr-Universität 2004.
Steinbach, Silke (1996): Medienkompetenz – eine aktuelle Bestandsaufnahme medienpä-dagogischer Theorie und Praxis. In: Rein, Antje von (Hrsg.): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1996: 156-166.
Steinwidder, Patrick (2004): „In and outside the academy…“. URL: http://www.medienpaed.com/03-2/steinwidder03-2.pdf [19 Seiten; Zugriff: 5.11.2004].
Stenzel, Gudrun (2001): Kulturpädagogik und Medienkompetenz. Vortrag am ORF-Sym-posion 2001 und überarbeitete Fassung des Artikels „Medienkompetenz – Schlag-wort ohne Zielrichtung?“. Printversion in: Stenzel, Gudrun (Hrsg.): Vom Papiertiger zum Computer. Alte und Neue Medien in Theorie und Praxis. Weinheim 2000 (Bei-heft 11 der Beiträge Jugendliteratur und Medien). URL: http://www.jugendliteratur.net/download/stenzel-pdf [15 Seiten; Zugriff: 24.11.2003].
Süss, Daniel u.a. (2003): Medienkompetenz in der Informationsgesellschaft. Selbstein-schätzung und Ansprüche von Kindern, Eltern und Lehrpersonen im Vergleich. Zürich: Hochschule für angewandte Psychologie 2003.
Swertz, Chrsitian (2004): Medienbildung. Skeptische Anmerkungen zum Beitrag der Cultural Studies. URL: http://lerndorf.uni-bielefeld.de/cswertz/texte.html [8 Seiten; Zugriff: 19.12.2004].
Thompson, Christiane (2004): Diesseits von Authentizität und Emanzipation. Verschie-bungen kritischer Erziehungswissenschaft zu einer „kritischen Ontologie der Gegen-wart“. In: Ricken, Norbert / Rieger-Ladich, Markus (Hrsg:): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004: 39-56.
Treusch-Dieter, Gerburg (2003): Das Arbeitsmannequin. Von der Produktion zum Dienst. Printversion in: Meschnig, Alexander / Stuhr, Mathias (Hrsg.): Arbeit als Lebensstil. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003. URL: http://www.treusch-dieter.de/ tarbeit/mannequin01[02/03/04].html [27 Seiten; Zugriff: 18.12.2004].
Tuldoziecki, Gerhard (2001): Medienkompetenz als Aufgabe von Unterricht und Schule. URL: http//:www.fwu.de/semik/publikationen/downloads/zulo_vortrag.pdf [15 Seiten; Zugriff: 18.3.2004].
Tuldoziecki, Gerhard (2002): Lesen als Mediennutzung – medienpädagogische Überlegun-gen zum Verhältnis von Lesekompetenz und Medienkompetenz. Vortrag beim 14. Symposion Deutschdidaktik in Jena, 15.9.2002. URL: http://www.personal.uni-jena.de/~x9krmi/ SDD2002/sonst/vortrtul.htm [18 Seiten; Zugriff: 25.11.2004].
Vollbrecht, Ralf (2001): Einführung in die Medienpädagogik. Weinheim und Basel: Beltz 2001.
Vollbrecht, Ralf / Mägdefrau, Jutta (1999): Medienkompetenz als Ziel schulischer Medien-pädagogik. In: Medien praktisch 1/1999: 54-57.
Weber, Stefan (2001): Vom Fremdwort „Medienkritik“. Warum (nicht nur) die Kommuni-kationswissenschaft immer affirmativer wird. In: Teleopolis, URL: http//:www. heise.de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.cgi?artikelnr=4715&mode=print [4 Seiten; Zugriff: 27.12.2004].
Weber, Stefan (2002): Was heißt „Medien konstruieren Wirklichkeit“? Von einem onto-logischen zu einem empirischen Verständnis von Konstruktion. In: Medienimpulse / Juni 2002: 11-15.
Weibel, Peter (2005): Stigma-TV. In: Profil 31/2005: 84-85.
Weiland, Dieter (2001): Ökonomisierung der Pädagogik. Prinversion in: Die deutsche Schule, H. 4/2001. URL: http://gew-duisburg.net/s_s_site/oekonomisierung.html [3 Seiten; Zugriff: 18.11.2004]
Wilson, Laetitia (2004): Interactivity or Interpassivity: a Question of Agency in Digital Play. URL: http://hypertext.rmit.edu.au/dac/papaers/Wilson.pdf [4 Seiten; Zugriff: 16.6.2005].
Wrana, Daniel (2003): Lernen lebenslänglich… Die Karriere lebenslangen Lernens. Eine gouvernementalitätstheoretische Studie zum Weiterbildungssystem. In: www.copyriot.com/gouvernementalitaet (Hrsg.): „führe mich sanft“. Gouvernemen-talität. – Anschlüsse an Michel Foucault. Gesammelte Veröffentlichungen zur gleichnamigen studentischen Tagung am 1. und 2. 11. 2002 in Frankfurt am Main. E-book, URL: http//:www.copyriot.com/ gouvernementaliaet/pdf/fms-ebook.pdf: 103-143 [Zugriff: 14.2.2004].
Wiedemann, Dieter (2000): Medienpädagogik als „Wunderwaffe“ im Mediendschungel? Printversion in: Stanpunkt: Sozial, 3/2000. URL: http//:www.haw-hamburg.de/sp/standpunkt/heft0300/Wiedemann300.htm [7 Seiten; Zugriff: 14.3.2004].
Wieser, Bernhard (2002): Auf den Schultern des Riesen. Eine Nachlese zur Frankfurter Foucault-Konferenz. URL: http://sinn-haft.action.at/nr_12/nr_12wieser.html [6 Seiten; Zugriff: 2.9.2004].
Winkler, Hartmut (2004): Diskursökonomie. Versuch über die innere Ökonomie der Medien. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004.
Winter, Rainer (2004): Cultural Studies und kritische Pädagogik. URL: http//:medienpaed.com/03-2/winter03-2.pdf [16 Seiten; Zugriff: 18.1.2004]
Zizek, Slavoj (2001): Ein Plädoyer für die Intoleranz. 2., überarb. Aufl. Wien: Passagen 2001.
Zizek, Slavoj (2002): Die Revolution steht bevor. Dreizehn Versuche über Lenin. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2002.
Zizek, Slavoj (2003): Ideologie heute. Anhang zu: Ders.: Die Puppe und der Zwerg. Das Christentum zwischen Perversion und Subversion. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003: 146-190.
[...]
[1] Einen ganz eigentümlichen Begriff von Ökonomisierung entwickelt Jochen Kade (vgl. auch 6.2.2 ) in einem systemtheoretischen Kontext, welcher deshalb nicht unerwähnt bleiben soll, weil Kade die (metaphorische) Ökonomisierung der pädagogischen Kommunikation aus de-ren Medialisierung herleitet, was für unseren Kontext, zumindest diskurs- kontrastiv und illu-strativ für die systemtheoretische Schließung in puncto Verständlichkeit und systematische Aussparung von Subjektivität relevant ist (und weil Kade hinter all diesen intellektuellen Fil-tern eine Art Grundsatz- Kritik übt, die jedoch in den intellektuellen Filtern stecken bleibt – als bliese ich den Rauch meiner Zigarette in dieselbe zurück: gleichsam eine innerweltliche Theologie und ein innerweltlicher Schamanismus zugleich…) – weshalb dieser Konstruktion (die wesentlich selbst eine Passage mit Überhang des Fußnoten-Textes gegenüber dem Fließtext ist, was ja ein Signum hegemonialer, quasi-religiöser Diskurse ist) die einzige Fuß-note dieser Arbeit gewidmet sei:
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptinhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es analysiert das Thema Medienkompetenz aus einer akademischen Perspektive, wobei insbesondere der Gouvernementalitätsansatz von Michel Foucault berücksichtigt wird.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Themen wie: Vorwort, Einleitung (Medienkompetenz als Plastikwort, Foucaults Medienkompetenz, Inkompetenz der Medienpädagogik), Kritik als Methode, der pädagogische Medienkompetenz-Diskurs (Medienverwahrlosung, Kompetenz-Theorem, Bedeutungsfelder und Dimensionen), der Gouvernementalitätsansatz (Rezeption Foucaults, liberaler Code, Beispiele pädagogischer Rezeption), pädagogische Medienkompetenz im Lichte des Gouvernementalitätsansatzes (Pädagogisierung, homo competens, Kompetenz-Dispositiv, Kybernetisierung, Rolltalk, Kreativität) und eine gouvernementalistische Medienpädagogik.
Was sind die Schlüsselthemen, die in der Arbeit behandelt werden?
Zu den Schlüsselthemen gehören: Medienkompetenz als vieldeutiger Begriff, Kritik als Methode, Pädagogisierung und Ökonomisierung, der Gouvernementalitätsansatz, Subjektivität, Regierungstechniken und die Rolle der Medienpädagogik.
Wer sind die zentralen Denker, auf die sich die Arbeit bezieht?
Die Arbeit bezieht sich auf Denker wie Michel Foucault, Harald Gapski, Gilles Deleuze, Jürgen Habermas, Uwe Pörksen, Ulrich Bröckling, Nikolas Rose, und Dieter Baacke.
Was ist das "Plastikwort" im Kontext von Medienkompetenz?
Der Begriff "Plastikwort" bezieht sich auf den inflationären und oft inhaltsleeren Gebrauch des Begriffs Medienkompetenz, der von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen für spezifische Interessen instrumentalisiert wird.
Was ist der Gouvernementalitätsansatz und wie wird er in Bezug auf Medienkompetenz angewendet?
Der Gouvernementalitätsansatz, basierend auf den Ideen von Michel Foucault, betrachtet Regierung als Führung durch Selbstführung. In Bezug auf Medienkompetenz wird analysiert, wie Medienkompetenz zur Formung von Subjekten und zur Durchsetzung neoliberaler Regierungstechniken beiträgt.
Was bedeutet der Begriff "Homo Competens"?
Der "Homo Competens" beschreibt das Ideal eines kompetenten Individuums im neoliberalen Kontext, das fähig ist, sich selbst zu führen und sich den Anforderungen der Wissensgesellschaft anzupassen.
Was ist die Kritik am pädagogischen Medienkompetenz-Diskurs?
Die Kritik umfasst die Vorwürfe der Inkompetenz, der Kausalitätsmythen, der Instrumentalisierung des Begriffs Medienkompetenz und die Vernachlässigung der ethischen und gesellschaftlichen Aspekte.
Was ist der Zusammenhang zwischen Pädagogisierung und Ökonomisierung?
Die Arbeit argumentiert, dass Pädagogisierung, also die Durchsetzung einer spezifischen pädagogischen Form, eine komplementäre Bewegung zur Ökonomisierung des Sozialen darstellt, wie sie im Gouvernementalitätsansatz beschrieben wird.
Welche Rolle spielt die Kreativität im Medienkompetenz-Diskurs?
Kreativität wird sowohl als funktionaler Kern des neoliberalen Selbst als auch als revolutionäre Ressource betrachtet. Es wird untersucht, wie der kreative Imperativ zur Selbstoptimierung und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit genutzt wird.
Was ist eine gouvernemental reflektierte Medienkompetenz?
Eine gouvernemental reflektierte Medienkompetenz bedeutet, die Mechanismen und Machtstrukturen zu erkennen, die durch Medien und ihre Nutzung entstehen und gefördert werden, sowie Strategien zu entwickeln, um sich diesen Einflüssen bewusst und kritisch zu stellen.
- Quote paper
- MMag.phil. Thomas Heel (Author), 2006, Die Subjekte der Medienkompetenz - Der pädagogische Medienkompetenzdiskurs im Lichte des Gouvernementalitätsansatzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110414