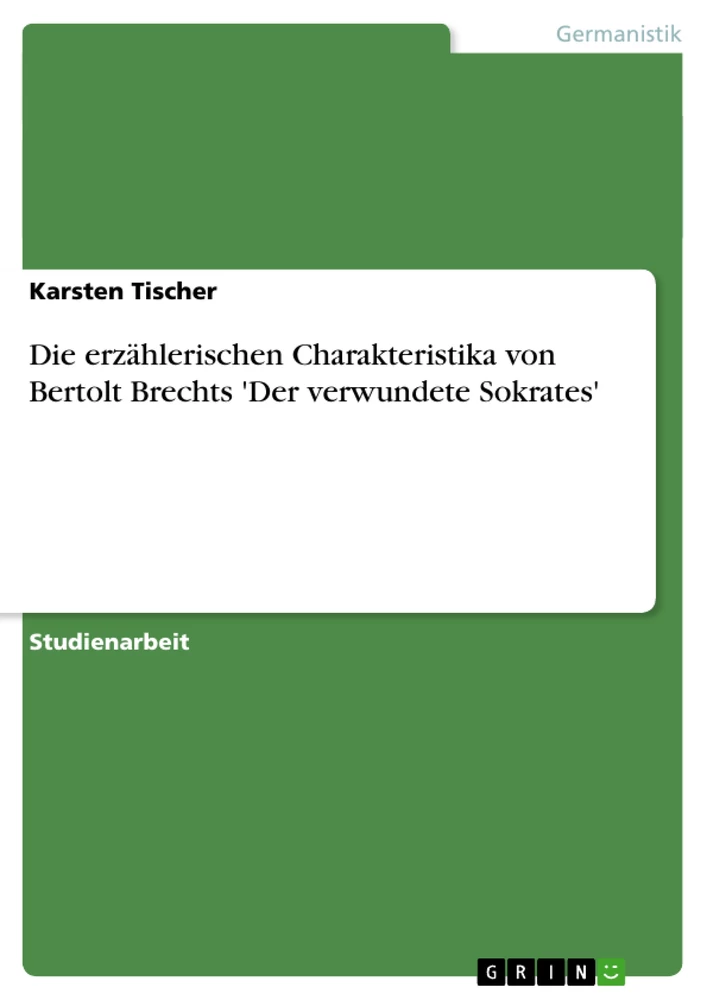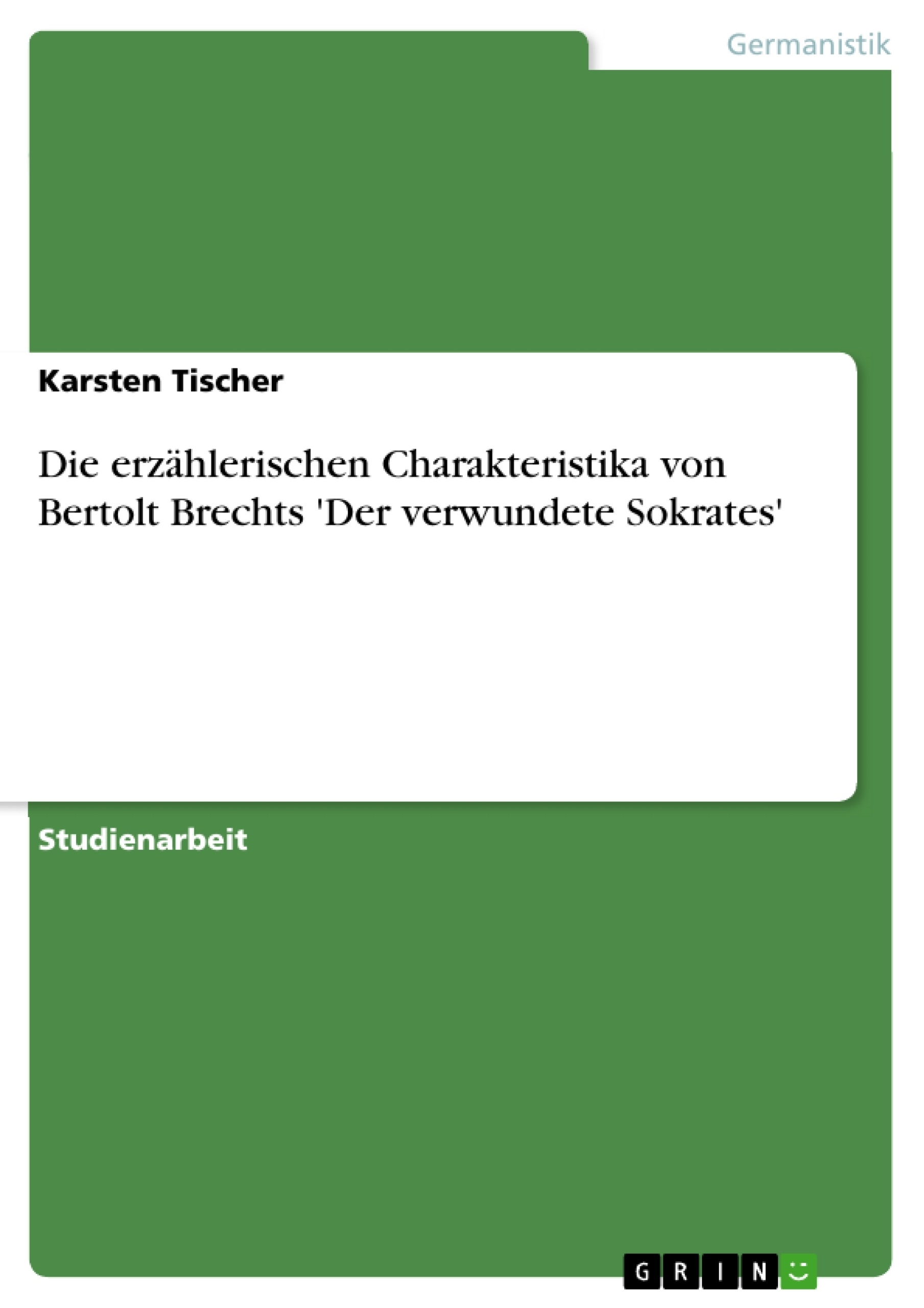„Ich habe einige Erzählungen geschrieben,
in denen ich, nicht ohne Heiterkeit, auf weises Verhalten hinwies.“
Bertolt Brecht
1 Einleitung
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“2, hieß der Grundsatz des griechischen Philosophen Sokrates. Auf diesem basierte sein gesamtes Lehren. Durch geschicktes Nachfragen versuchte er die scheinbare Wahrheit des anderen zu hinterfragen und damit seinen Gegenüber selbst zur Einsicht zu bringen, diese zu korrigieren. Für diese diplomatische Kunst wird er heute noch bewundert.
Anscheinend auch von Bertolt Brecht, der dem Griechen einen Platz in einer seiner Kalendergeschichten verschaffte. Und getreu Sokrates’ Motto verfährt Brecht ähnlich, indem er dem Leser hilft, selbst die Wahrheit zu entdecken. Es ist kein Zufall, dass er gerade den griechischen Philosophen als Hauptfigur wählte. Brecht schrieb die Geschichte 1939.
Der Zweite Weltkrieg war spürbar nahe. Das merkte auch der Augsburger Brecht. Somit war Sokrates, der schon seit über 2300 Jahren tot war, aktueller denn je. Vielleicht hoffte er, die Menschen, wie damals Sokrates, zum Nachdenken zu bewegen, doch leider erschien ‚Der verwundete Sokrates’ erst nach dem Krieg. Zu spät für Millionen von Menschen.
Trotzdem soll nun versucht werden, die erzähltechnischen Finessen, die Brecht verwandte, herauszufiltern und ihre Bedeutung und Wirkung auf den Leser zu ermitteln. In diese Analyse soll eine Betrachtung der Gattung ‚Kalendergeschichte’ mit einfließen, um zu klären, warum Brecht gerade diese für die Geschichte wählte.
Inhalt
1 Einleitung
2 Geschichten zur Geschichte
3 Der verwundete Sokrates
3.1 Erfundene Geschichte
3.2 Lehrreiches für das Volk
3.2.1 Krieg und Klassenkampf
3.2.2 Wahre Tapferkeit
4 Schluss
5 Bibliographie
„Ich habe einige Erzählungen geschrieben,
in denen ich, nicht ohne Heiterkeit, auf weises Verhalten hinwies.“1
Bertolt Brecht
1 Einleitung
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“2, hieß der Grundsatz des griechischen Philosophen Sokrates. Auf diesem basierte sein gesamtes Lehren. Durch geschicktes Nachfragen versuchte er die scheinbare Wahrheit des anderen zu hinterfragen und damit seinen Gegenüber selbst zur Einsicht zu bringen, diese zu korrigieren. Für diese diplomatische Kunst wird er heute noch bewundert.3
Anscheinend auch von Bertolt Brecht, der dem Griechen einen Platz in einer seiner Kalendergeschichten verschaffte. Und getreu Sokrates’ Motto verfährt Brecht ähnlich, indem er dem Leser hilft, selbst die Wahrheit zu entdecken. Es ist kein Zufall, dass er gerade den griechischen Philosophen als Hauptfigur wählte. Brecht schrieb die Geschichte 1939.
Der Zweite Weltkrieg war spürbar nahe. Das merkte auch der Augsburger Brecht. Somit war Sokrates, der schon seit über 2300 Jahren tot war, aktueller denn je. Vielleicht hoffte er, die Menschen, wie damals Sokrates, zum Nachdenken zu bewegen, doch leider erschien ‚Der verwundete Sokrates’ erst nach dem Krieg. Zu spät für Millionen von Menschen.
Trotzdem soll nun versucht werden, die erzähltechnischen Finessen, die Brecht verwandte, herauszufiltern und ihre Bedeutung und Wirkung auf den Leser zu ermitteln. In diese Analyse soll eine Betrachtung der Gattung ‚Kalendergeschichte’ mit einfließen, um zu klären, warum Brecht gerade diese für die Geschichte wählte.
2 Geschichten zur Geschichte
Jan Knopf beschrieb die Kalendergeschichten einmal als „Geschichten zur Geschichte“4, in denen es „zu einem unmittelbaren Einbeziehen von geschichtlicher Erfahrung“5 kommt, welche den Leser dazu herausfordert, sich ein Urteil zu bilden.6 Knopf schreibt weiterhin, dass Erfahrungen der Vergangenheit von den nachwachsenden Generationen aufgenommen werden, um Lehren daraus zu ziehen, damit Selbiges nicht noch einmal passiert. Und gerade die Fehler, die seit 1933 in Deutschland passierten, sind auf eine besonders schlimme Weise belehrend.7 Allerdings war es Brecht, um seines eigenen Lebens willen, natürlich nicht möglich, das NS- Regime direkt in seiner Geschichte zu durchleuchten. Dafür nahm er die Geschichte des Sokrates, der in einen Krieg zieht, den er nicht versteht, und somit deutliche Parallelen zum aktuellen Geschehen der damaligen Zeit hatte.
Die Geschichte soll also belehren. Das ist typisch für den volksnahen Kalender, der aufgrund des Platzmangels bei den Geschichten auf allzu weit Ausschweifendes, Kompliziertes und Abstraktes verzichtet, da dies nur einen höheren Grad an Bildung erfordern würde.8 Weiterhin bietet sich der Kalender, als „das Medium [,das] ‚Zeit zählt’ und ‚ordnet’“9, an für Historisches. Und als ständig benutztes Utensil im Haushalt ist er für die „Aufnahme von praktischen Hinweisen geradezu prädestiniert.“10
Diese „volkstümliche“11 Gattung war demnach ideal für Brecht, um den Durchschnittsleser zu erreichen und ihn zum Nachdenken zu zwingen, was auch dringend nötig war, wenn man folgender Ausschnitt aus einem Brief Brechts an Slatan Dudow liest: „Das ist das Volk, das dieses Regime in einen der größten und schwierigsten Kriege aller Zeiten hineintreiben will.“12
Dieser allgemein belehrende Charakter der Sokrates-Geschichte führte dann wohl auch dazu, dass sie später als Einzelausgabe für Kinder veröffentlicht wurde13, da sie nicht abstrakte Lehrsätze predigt, sondern Geschichte erlebbar macht.14
[...]
1 Jan Knopf: Brecht-Handbuch. Lyrik, Prosa, Schriften. Eine Ästhetik der Widersprüche. Stuttgart: Metzler 1986. S. 294-295.
2 Gebhard Kurz: Stvdivm Latinvm. Latein für Universitätskurse. Teil 1. Texte, Übungen, Vokabeln. 3. Auflage. Bamberg: Buchner 2005. S. 129.
3 Vgl. Otfried Höffe: Kleine Geschichte der Philosophie. München: Beck 2005 (=beck’sche reihe). S. 36.
4 Jan Knopf: Die deutsche Kalendergeschichte. FaM: suhrkamp 1983. S. 17.
5 Ebd. S. 269.
6 Vgl. Ebd.
7 Vgl. Ebd. S. 270.
8 Vgl. Ebd. S. 19.
9 Ebd. S. 22.
10 Ebd. S. 24.
11 Ebd.
12 Bertolt Brecht. Briefe. Hrsg. von Günter Glaeser. FaM: suhrkamp 1981. S. 362.
13 Vgl. Frank D. Wagner: Der verwundete Sokrates. In: Brecht-Handbuch. Bd. 3: Prosa, Filme, Drehbücher. Hrsg. von Jan Knopf. Stuttgart: Metzler 2002. S. 313.
Häufig gestellte Fragen zu "Der verwundete Sokrates"
Was ist das Thema des Textes "Der verwundete Sokrates"?
Der Text analysiert Bertolt Brechts "Der verwundete Sokrates" im Kontext der Kalendergeschichte und untersucht Brechts erzähltechnische Mittel sowie deren Wirkung auf den Leser. Er beleuchtet die Parallelen zwischen Sokrates' Situation in einem sinnlosen Krieg und der politischen Lage im Deutschland des Jahres 1939.
Was ist eine Kalendergeschichte und warum hat Brecht diese Gattung gewählt?
Kalendergeschichten sind, laut Jan Knopf, "Geschichten zur Geschichte", die historische Erfahrungen vermitteln und den Leser zur Urteilsbildung anregen. Brecht wählte diese Gattung, um ein breites Publikum zu erreichen und zum Nachdenken anzuregen, da der Kalender ein weit verbreitetes und volksnahes Medium ist, das sich für historische und belehrende Inhalte eignet.
Welche Rolle spielt Sokrates in Brechts Geschichte?
Sokrates dient als Hauptfigur, dessen Geschichte als Parallele zur politischen Situation der Zeit dient. Brecht nutzt Sokrates' Weisheit und seine Methode des Hinterfragens, um den Leser dazu zu bringen, selbst die Wahrheit zu erkennen und zu überdenken.
Was sind die Hauptaussagen des Textes in Bezug auf Brechts Absichten?
Der Text argumentiert, dass Brecht mit seiner Geschichte beabsichtigte, die Menschen zum Nachdenken anzuregen und Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, um zu verhindern, dass sich die Fehler der NS-Zeit wiederholen. Die Geschichte soll belehren und Geschichte erlebbar machen, wodurch sie auch für Kinder geeignet ist.
Welche Textstellen werden zitiert und welche Bedeutung haben sie?
Zitiert werden unter anderem Aussagen von Bertolt Brecht und Jan Knopf. Die Zitate von Knopf definieren und erklären die Gattung Kalendergeschichte und ihre Bedeutung. Brechts Zitate verdeutlichen seine Absichten und seine Einschätzung der politischen Lage.
Worum geht es in Kapitel 3, "Der verwundete Sokrates"?
Kapitel 3 analysiert die Geschichte selbst, inklusive der erfundenen Geschichte und den lehrreichen Aspekten für das Volk. Es thematisiert Krieg, Klassenkampf und wahre Tapferkeit.
Was sind die Stichworte des Textes?
Die Stichworte sind unter anderem: Einleitung, Geschichten zur Geschichte, Der verwundete Sokrates, Erfundene Geschichte, Lehrreiches für das Volk, Krieg und Klassenkampf, Wahre Tapferkeit, Schluss, Bibliographie.
- Quote paper
- Karsten Tischer (Author), 2006, Die erzählerischen Charakteristika von Bertolt Brechts 'Der verwundete Sokrates', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110433