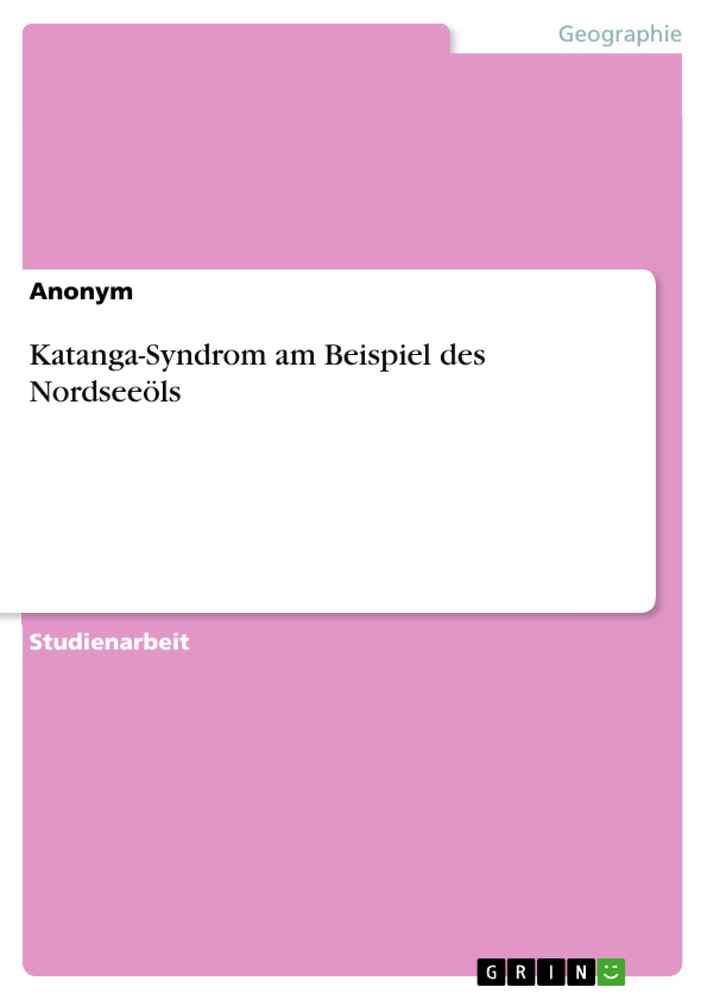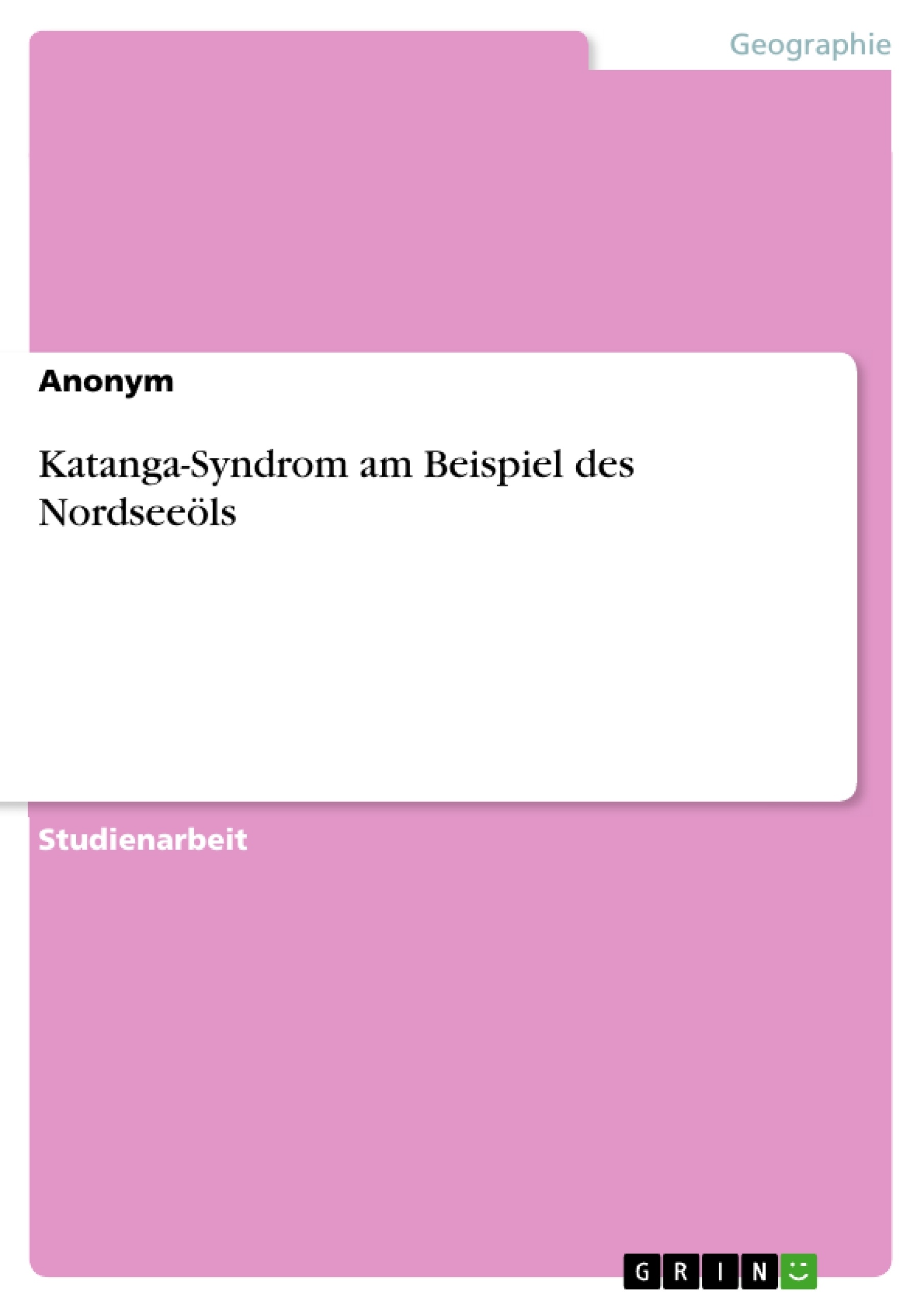Diese Facharbeit beschäftigt sich mit dem Katanga-Syndrom des globalen Wandels. Das Katanga-Syndrom beschreibt einen Abbau nicht-erneuerbarer Ressourcen, welcher zur Umweltdegradation in Form von Ökosystemschädigung oder -zerstörung, welche zu temporären, aber auch irreversiblen Schäden an der Umwelt führt. Dieses wird auf die Nordsee bzw. die Förderung der nicht-erneuerbaren Ressourcen Erdöl und- gas in derselben, welche gemein unter dem Begriff „Nordseeöl“ zusammengefasst werden, angewandt. Im Hauptteil wird die Region zunächst verortet und geschichtliche Gegebenheiten werden zusammengefasst. Anschließend wird der anthropogene Einfluss auf verschiedene Sphären analysiert und eingeordnet. Anschließend werden diese Einflüsse im Fazit zusammengefasst und Lösungsansätze formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Verortung und Geschichte
- Wirtschaft
- Gesellschaftliche Organisation
- Hydrosphäre
- Biosphäre
- Bevölkerung
- Atmosphäre
- Technik/Wissenschaft
- Fazit/Lösungsansätze
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Katanga-Syndrom am Beispiel der Nordseeölförderung. Ziel ist es, den anthropogenen Einfluss auf die Umwelt durch den Abbau nicht-erneuerbarer Ressourcen zu analysieren und mögliche Lösungsansätze zu formulieren. Die Arbeit verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit der Realität der Nordseeölgewinnung.
- Der Einfluss der Nordseeölförderung auf verschiedene Sphären (Hydrosphäre, Biosphäre, Atmosphäre).
- Die wirtschaftliche Bedeutung der Nordseeölförderung und deren globale Einordnung.
- Die historische Entwicklung der Nordseeölförderung und die politische Dimension des Ressourcenabbaus.
- Das Katanga-Syndrom als Modell zur Beschreibung der Umweltzerstörung durch Ressourcenabbau.
- Mögliche Lösungsansätze zur Minimierung der negativen Folgen der Nordseeölförderung.
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die Motivation der Autorin, sich mit dem Thema Nordseeöl und dem Katanga-Syndrom auseinanderzusetzen. Der Bezug zu Frank Schätzings Roman „Der Schwarm“ wird hergestellt, um die Aktualität und Relevanz der Thematik hervorzuheben. Das Interesse an Umwelt- und Klimaschutz wird als treibende Kraft für die Arbeit genannt.
Einleitung: Die Einleitung definiert den Begriff „Nordseeöl“ und beschreibt die beteiligten Anrainerstaaten. Der globale Anteil der Nordseeölförderung an der Gesamtproduktion wird beziffert. Das Katanga-Syndrom wird als analytisches Modell eingeführt und seine Kernelemente – Umweltdegradation durch Ressourcenabbau, Einsatz veralteter Technologien, fehlende Umweltstandards und Politikversagen – werden erklärt. Der Bezug zum Kongo und die globale Verbreitung des Syndroms werden hervorgehoben.
Verortung und Geschichte: Dieses Kapitel beschreibt die geographische Lage der Nordsee und ihre Ausdehnung. Die Entdeckung der ersten Erdgasfelder und die darauf folgende Aufteilung des Meeresbodens unter den Anrainerstaaten werden chronologisch dargestellt. Der Zusammenhang zwischen steigenden Ölpreisen und der verstärkten Förderung von Nordseeöl wird erläutert, ebenso wie der Ausbau der Förderinfrastruktur bis zur heutigen Situation.
Wirtschaft: Obwohl der Anteil der Nordseeölförderung an der globalen Erdölproduktion relativ gering ist, wird die wirtschaftliche Bedeutung des Nordseeöls für die Europäische Union betont. Die Exporte fossiler Brennstoffe und deren Anteil am Gesamt-Exportvolumen der EU werden quantifiziert, um die wirtschaftliche Relevanz zu unterstreichen.
Schlüsselwörter
Katanga-Syndrom, Nordseeöl, nicht-erneuerbare Ressourcen, Umweltdegradation, Ökosystemzerstörung, Erdölförderung, anthropogener Einfluss, Ressourcenabbau, nachhaltige Entwicklung, Umweltstandards, Politikversagen, globale Erwärmung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Das Katanga-Syndrom am Beispiel der Nordseeölförderung
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Katanga-Syndrom anhand der Nordseeölförderung. Sie analysiert den anthropogenen Einfluss des Abbaus nicht-erneuerbarer Ressourcen auf die Umwelt und entwickelt mögliche Lösungsansätze. Die Arbeit verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit der Realität der Nordseeölgewinnung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss der Nordseeölförderung auf die Hydrosphäre, Biosphäre und Atmosphäre, die wirtschaftliche Bedeutung der Förderung, die historische Entwicklung und die politische Dimension des Ressourcenabbaus, das Katanga-Syndrom als Modell für Umweltzerstörung durch Ressourcenabbau und mögliche Lösungsansätze zur Minimierung negativer Folgen.
Was ist das Katanga-Syndrom?
Das Katanga-Syndrom dient als analytisches Modell, um die Umweltzerstörung durch Ressourcenabbau zu beschreiben. Es umfasst Umweltdegradation durch Ressourcenabbau, den Einsatz veralteter Technologien, fehlende Umweltstandards und Politikversagen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet ein Vorwort, eine Einleitung, Kapitel zu Verortung und Geschichte der Nordseeölförderung, zur Wirtschaftlichkeit, zur gesellschaftlichen Organisation (implizit), zur Hydrosphäre, Biosphäre, Bevölkerung, Atmosphäre und Technik/Wissenschaft, sowie ein Fazit/Lösungsansätze und eine Quellenangabe.
Was wird im Vorwort erläutert?
Das Vorwort beschreibt die Motivation der Autorin, den Bezug zu Frank Schätzings Roman „Der Schwarm“ und das Interesse an Umwelt- und Klimaschutz als treibende Kraft für die Arbeit.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung definiert "Nordseeöl", beschreibt die beteiligten Anrainerstaaten, beziffert den globalen Anteil der Nordseeölförderung und führt das Katanga-Syndrom als analytisches Modell ein, inklusive seiner Kernelemente.
Was wird im Kapitel "Verortung und Geschichte" dargestellt?
Dieses Kapitel beschreibt die geographische Lage der Nordsee, die Entdeckung der ersten Erdgasfelder, die Aufteilung des Meeresbodens und den Zusammenhang zwischen steigenden Ölpreisen und der verstärkten Förderung.
Welche wirtschaftliche Bedeutung hat die Nordseeölförderung?
Obwohl der Anteil der Nordseeölförderung an der globalen Erdölproduktion relativ gering ist, wird die wirtschaftliche Bedeutung für die Europäische Union betont, inklusive der Quantifizierung der Exporte fossiler Brennstoffe.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Katanga-Syndrom, Nordseeöl, nicht-erneuerbare Ressourcen, Umweltdegradation, Ökosystemzerstörung, Erdölförderung, anthropogener Einfluss, Ressourcenabbau, nachhaltige Entwicklung, Umweltstandards, Politikversagen und globale Erwärmung.
Welche Lösungsansätze werden in der Arbeit formuliert?
Die Arbeit beschreibt mögliche Lösungsansätze zur Minimierung der negativen Folgen der Nordseeölförderung (genaue Lösungsansätze werden im Fazit/Lösungsansätze Kapitel detailliert).
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Katanga-Syndrom am Beispiel des Nordseeöls, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1104376