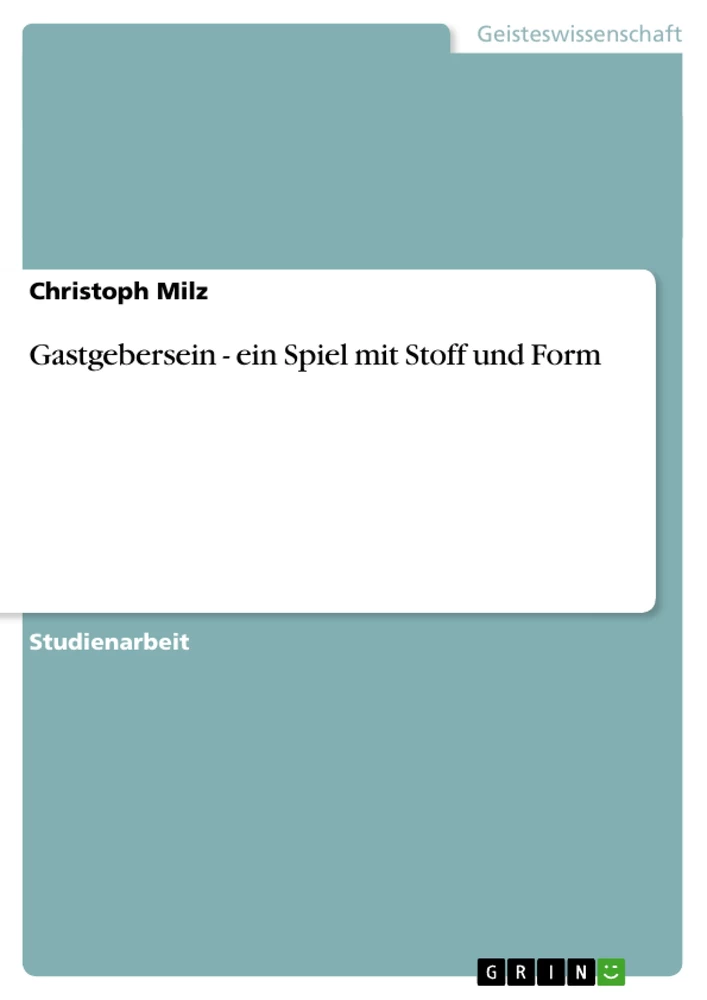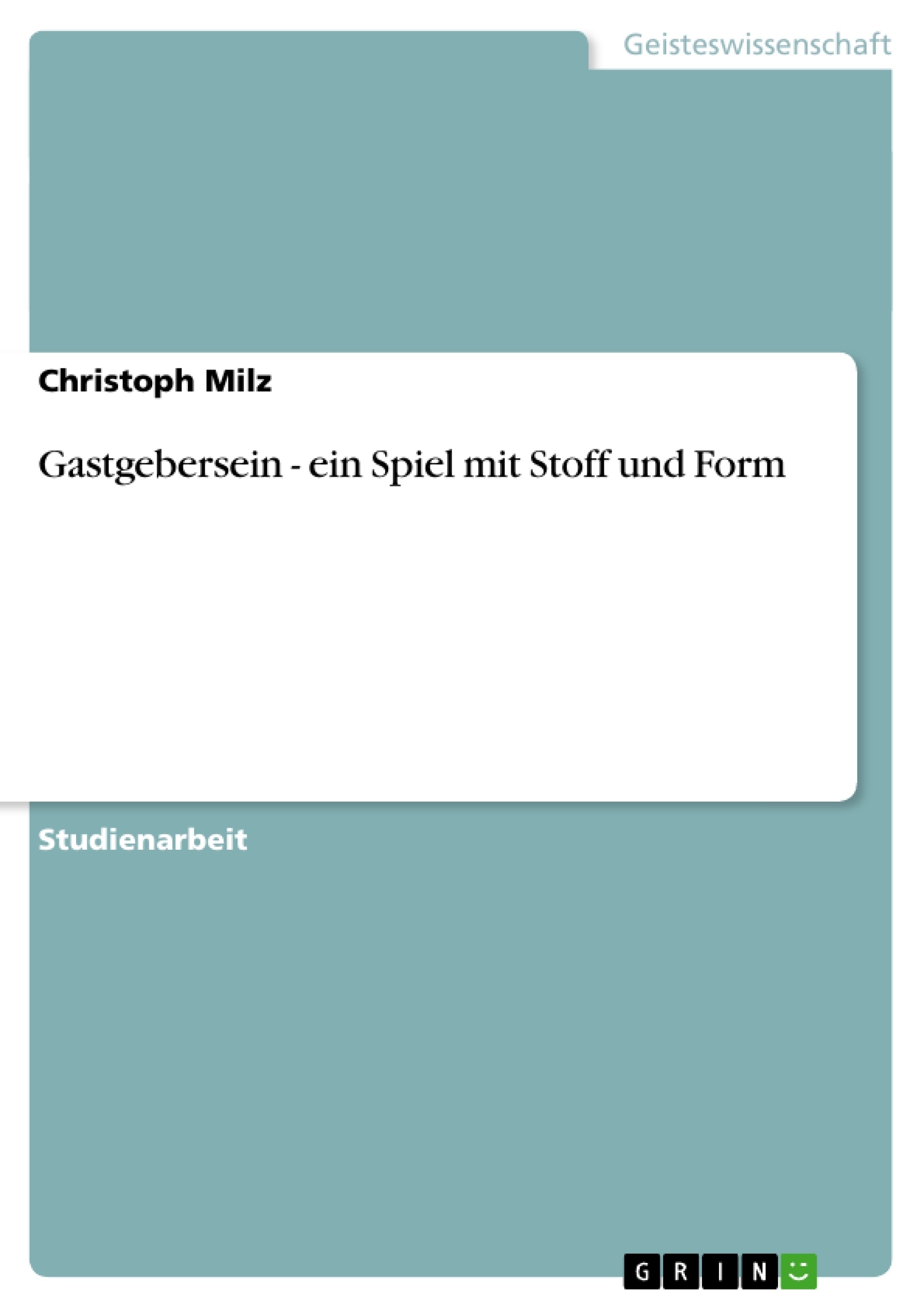Gastgeben ist eine eigenartige Aktivität. Sucht man nach einer Definition, dann entdeckt man, dass ein Gastgeber in der ursprünglichen Bedeutung jemand ist, der einem Gast Unterkunft und Verpflegung gibt.
Heute ist der Begriff auch auf Personen erweitert, die etwas veranstalten oder zu etwas einladen. Letzterer enthält die Bedeutung eines gestalterischen Prozesses – eines sozialen Gestaltungsprozesses. Hier könnte der Begriff der sozialen Skulptur hilfreich sein. Allerdings denken dann die meisten: Das ist doch von Beuys! Und leider bin ich an dieser Stelle mir nicht ganz darüber im Klaren, ob der Beuyssche Begriff auf das Gastgebens übertragbar ist. Dennoch, unabhängig von Beuys, lässt sich der Vorgang des Gastgebens im ersten Moment mit dem Bild des Gestalters einer sozialen Skulptur beschreiben. Damit könnte man dem Gastgeben in gewisser Weise eine künstlerische Note zuweisen. Doch würde dadurch nicht wieder Unklarheit entstehen?
Ist es vielleicht sogar nicht etwas zu viel gesagt, wenn eine Einladung als künstlerischer Akt bezeichnet wird? Wie lässt sich denn beim Gastgeben feststellen, ob ein künstlerischer Moment entstanden ist? Gastgeben besteht doch ausschließlich aus vergänglichen Momenten und subjektiver Empfindung. Um sie zu erleben muss man ein Teil des Ganzen sein.
Gastgeben im gestalterischen Sinne liefert einen Moment des Erfüllt seins, einen Moment der Balance zwischen sinnlichem und geistigem. Und irgendwie haben wir alle diese Momente schon erlebt. Irgendwie haben wir auch alle schon einmal erfahren, dass diese Balance nicht eingetroffen ist. Und durch die Erfahrung dieses Unterschieds zwischen Ausgeglichenheit und Unausgeglichenheit haben wir eine gewisse Idee davon entwickelt, wie sich dieser Moment schaffen lässt. Aber diese Erfahrung hilft nicht unbedingt, da die Zusammenstellung der Umstände sich meist unterscheidet. Was in der einen Situation geholfen hat, hilft nicht unbedingt in einer neuen Situation. Erfahrene Gastgeber verweisen vielmehr auf ihr Gefühl und die Fähigkeit spontan nach dem Gefühl und mit Improvisation zu handeln. Ein Rezept für den erfolgreichen Gastgeber gibt es also nicht. Eine Antwort auf die Frage was genau den Moment des Gastgebens ausmacht, sprich wie der Moment der Balance aus sinnlichem und geistigen zustande kommt, ist hiermit nicht gefunden.
Gliederung
Einleitung
Moment der Schönheit
Das Spiel mit den Trieben
Das in sich gegründete Sein und die Zeit als Bedingung
Empfänglichkeit und Welt ergreifend
Konklusion
„Der Mensch spielt nur,
wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“
Friedrich von Schiller (15. Brief)
Einleitung
Gastgeben ist eine eigenartige Aktivität. Sucht man nach einer Definition, dann entdeckt man, dass ein Gastgeber in der ursprünglichen Bedeutung jemand ist, der einem Gast Unterkunft und Verpflegung gibt.
Heute ist der Begriff auch auf Personen erweitert, die etwas veranstalten oder zu etwas einladen. Letzterer enthält die Bedeutung eines gestalterischen Prozesses - eines sozialen Gestaltungsprozesses. Hier könnte der Begriff der sozialen Skulptur hilfreich sein. Allerdings denken dann die meisten: Das ist doch von Beuys! Und leider bin ich an dieser Stelle mir nicht ganz darüber im Klaren, ob der Beuyssche Begriff auf das Gastgebens übertragbar ist. Dennoch, unabhängig von Beuys, lässt sich der Vorgang des Gastgebens im ersten Moment mit dem Bild des Gestalters einer sozialen Skulptur beschreiben. Damit könnte man dem Gastgeben in gewisser Weise eine künstlerische Note zuweisen. Doch würde dadurch nicht wieder Unklarheit entstehen?
Ist es vielleicht sogar nicht etwas zu viel gesagt, wenn eine Einladung als künstlerischer Akt bezeichnet wird? Wie lässt sich denn beim Gastgeben feststellen, ob ein künstlerischer Moment entstanden ist? Gastgeben besteht doch ausschließlich aus vergänglichen Momenten und subjektiver Empfindung. Um sie zu erleben muss man ein Teil des Ganzen sein.
Gastgeben im gestalterischen Sinne liefert einen Moment des Erfüllt seins, einen Moment der Balance zwischen sinnlichem und geistigem. Und irgendwie haben wir alle diese Momente schon erlebt. Irgendwie haben wir auch alle schon einmal erfahren, dass diese Balance nicht eingetroffen ist. Und durch die Erfahrung dieses Unterschieds zwischen Ausgeglichenheit und Unausgeglichenheit haben wir eine gewisse Idee davon entwickelt, wie sich dieser Moment schaffen lässt. Aber diese Erfahrung hilft nicht unbedingt, da die Zusammenstellung der Umstände sich meist unterscheidet. Was in der einen Situation geholfen hat, hilft nicht unbedingt in einer neuen Situation. Erfahrene Gastgeber verweisen vielmehr auf ihr Gefühl und die Fähigkeit spontan nach dem Gefühl und mit Improvisation zu handeln. Ein Rezept für den erfolgreichen Gastgeber gibt es also nicht. Eine Antwort auf die Frage was genau den Moment des Gastgebens ausmacht, sprich wie der Moment der Balance aus sinnlichem und geistigen zustande kommt, ist hiermit nicht gefunden.
Das Gerüst für eine Antwort lässt sich allerdings in Schillers Briefen zur ästhetischen Erziehung eines Menschen finden. Schillers Briefe behandeln eigentlich das Thema eines ästhetischen Staates, in dem der "schöne Umgang" und der "schöne Ton" als kommunikative Voraussetzung gelebt werden. In solch einer Umwelt geht Schillers Idee zufolge der moralische Staat auf, weil das Individuum motiviert ist, moralisch zu handeln, und das Allgemeinwohl zu seinem inneren Bedürfnis geworden ist. Die Schillersche politische Utopie seiner Briefe, hat in der Frage zum Begriff des Gastgebens keine Bedeutung. Jedoch soll in diesem Aufsatz anhand des Schillerschen Gedankengebäudes ein Versuch unternommen werden das Phänomen des Gastgebens zu erklären. Schillers Beschreibung, wie der Moment der Schönheit und der Ästhetik zustande kommt und wie er auf den Menschen wirkt, erwecken dabei wertvolle Assoziationen.
Es soll gezeigt werden aus welchen Elementen sich ein Moment der Schönheit zusammensetzt, wie sich das Schillersche Gedankengebäude der Triebe auf das Gastgeben anwenden lassen und wie das Gastgebersein als ein freies Spiel zwischen dem sinnlichen und der Form verstanden werden kann. Weiter gedacht in der Schillerschen Idee, stellt die Zeit und die Existenz eines „in sich gegründeten seins“ als Voraussetzung für die Entwicklung einer Persönlichkeit, die in der Lage zum freien gastgeberischen Spiel mit Form und Inhalt ist, dar.
„Lassen Sie es sich gefallen, mir einige Schritte zu folgen, so wird ein freyerer Gesichtskreis sich aufthun, und eine muntre Aussicht die Mühe des Weges vielleicht belohnen.“ (15. Brief)
Moment der Schönheit
Der Moment der Schönheit bedeutet bei Schiller ein Zustand, in dem der Mensch in Einheit mit seiner Natur und ein „vollendetes Ganzes“ ist. Dieser Moment schafft Freiheit und Lebendigkeit. Ein Moment, „in dem [die] angespannten Menschen die Harmonie, in dem [die] abgespannten die Energie wieder herstellt, und auf diese Art, ihrer Natur gemäß, den eingeschränkten Zustand auf einen absoluten zurückführt, und den Menschen zu einem in sich selbst vollendeten Ganzen macht“ (17. Brief). Viele Menschen, nicht nur zu Schillers Zeit sondern auch heute, erreichen nie diesen Zustand eines in sich selbst vollendeten Ganzen. Es mangelt ihnen entweder an "Harmonie" oder an "Energie". Der ästhetische Zustand liegt genau dazwischen und verschmilzt "Leiden und "Tätigkeit", "Empfinden" und "Denken". Das Werkzeug zur freien Entfaltung und um diesen Zustand zu erreichen, beschreibt Schiller als die Kunst. Denn die Kunst ist ungebunden an einen Zweck und erlaubt damit die freie Entfaltung.
Ein gelungener gastgeberischer Moment kann genau diesen Moment der freien Entfaltung für Gastgeber und Gäste kreieren. Wie in der Kunst, findet der Mensch im Gastgeben eine prädestinierte Form, in dem er sich gestalterisch entfalten kann und damit Freiheit und Lebendigkeit schafft. Gastgeben lässt sich daher nicht in Form oder Inhalt dingfest machen. Gastgeben ist vielmehr ein Moment, der wie von Schiller beschrieben, durch eine besondere Humanität gekennzeichnet ist. Gastgeben ist in Form und Inhalt völlig frei. Es kann eine pompöse Einladung zu einer Familienfeier sein, eine kleine kulinarische Geste in der Kaffeepause gegenüber den Kollegen. Gastgeben kann auch völlig ohne ein materielles Element auskommen und aus einer rein geistigen Aufmerksamkeit bestehen. Das Gastgeben schafft aber nicht nur beim Gastgeber Harmonie und Energie. Wir laden zum Beispiel die Familie oder Freunde ein, um in großer Gemeinsamkeit eine harmonische Stimmung zu genießen, um die Sorgen des Alltags zu vergessen.
Dieser Moment des Schönen entsteht gerade dadurch, dass er zweckungebunden in freier Entfaltung ausgeführt wird. Stellt man den Zweck in den Vordergrund, verliert es den freien Charakter und die Entfaltung wird durch äußere Zwänge eingegrenzt. Genauer betrachtet könnte man daher zu der Behauptung kommen, dass wir für Einladungen in der Regel zwar einen „Grund“ angeben, dass aber leicht ein gemeinsamer Nenner, unabhängig vom Einladungsgrund gefunden werden kann: es ist der Moment des vollendeten Ganzen - der Moment des Schönen, wie Schiller es nennt.
Betrachtet man wie Schillers Moment des Schönen entsteht, ist es keine Überraschung, dass sich dafür kein Rezept finden lässt. Jede Situation ist eine Komposition der richtigen Elemente. Die bloße Erfahrung führt uns in diesem Zusammenhang nicht unbedingt zum Erfolg. Aber manche Menschen sind exzellent in ihrem Gespür, welche Komposition zum Moment des Schönen führt.
Sie stechen als Gastgeber hervor, weil sie besonders frei und in sich gegründet mit dem kompositorischen Spiel umgehen. Um den Moment des Schönen entstehen zu lassen und zu erleben bedarf es der Fähigkeit mit den Elementen zu spielen und sie auszubalancieren. Um zu verstehen, wie sich der vollkommene gastgeberische Moment zusammensetzen kann, und wie man zu diese Souveränität erlangt, die Freiheit dieses spielerischen Umgangs zu nutzen, lohnt ein Blick in Schillers Ausführungen zum Formtrieb und sinnlichen Trieb.
Das Spiel mit den Trieben
Nach Schillers Auffassung ist der Mensch mit zwei Grundtrieben ausgestattet: Affektionalität und Rationalität. Schiller sieht jeden Menschen im Zwiespalt zwischen den Trieben und Gefühlen. Einem Zwiespalt zwischen dem Formtrieb, der nach Logik und dem Verstand strebt, und dem sinnlichen Trieb, der der Materie verhaftet ist. Die mit Inhalt gefüllte Zeit "heißt Empfindung". Schiller nennt den sinnlichen Trieb ein "erfülltes Moment der Zeit". Es gibt keine schöpferische neue Idee ohne den "sinnlichen Trieb". Der "Formtrieb" strebt nach Freiheit vom Körper, Aufheben von Zeit, nach Harmonie und Beständigkeit in der Veränderung, damit der Mensch sich bzw. die Materie sich bei aller äußeren Veränderung behaupten und Identität behalten kann. Dies geschieht, indem der "Formtrieb" der Empfindung Gesetzmäßigkeit ("Wahrheit" und "Recht") verleiht. Er ist das, womit der Mensch seinen Ideen wirklich Gestalt und Ausdruck verleiht. Vergleichbar mit der Arbeit eines Komponisten an einer großen Komposition, welche innere Einheit bei größtmöglicher Freiheit der Entwicklung verlangt. "So streng wie frei", nannte Beethoven dieses Gestaltungsprinzip.1
Dieser Gegensatz scheint fast unüberwindlich. Während der Stofftrieb ein unendlicher Lebensdrang ist, der ins Weite strebt, ist der Formtrieb ein Streben, sich selbst durch Sittlichkeit und Pflicht einzugrenzen. Entweder beherrschen das
Gefühl und die Triebe unser Leben, dann sind wir Wilde, oder wir unterwerfen uns dem Diktat des Verstandes, dann sind wir gefühlsarme Sklaven der Kultur. Die Aufgabe des Menschen ist es nun, Stofftrieb und Formtrieb zum Spieltrieb werden zu lassen, um ein Mensch von innerer Harmonie zu werden und die „Freiheit in der Erscheinung“ zu verwirklichen. Schiller schreibt: Der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt - d. h. wo er Stoff- und Formtrieb zur Deckung bringt. Dazu verhilft ihm die Kunst, denn Schönheit ist ja nichts anderes als die Harmonie von Stoff und Form im klassischen Kunstwerk.
Was ist es also, was unserem Verstand erlaubt die Triebe zu beherrschen, ohne sie zu vergewaltigen. Was liefert uns den Maßstab? Schillers Antwort darauf ist einfach: Während der sinnliche Trieb Leben und der Formtrieb Gestalt verleiht, gibt es noch eine dritte Ebene des Denkens. Wie Schiller im 15. Brief darlegt, ist diese Ebene das, was die schöpferische Spannung erzeugt und eine höhere Ordnung des Geistes darstellt.
"Der Gegenstand des sinnlichen Triebes, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Leben in weitester Bedeutung; ein Begriff, der alles materiale Sein und alle unmittelbare Gegenwart in den Sinnen bedeutet. Der Gegenstand des „Formtriebs, in einem allgemeinen Begriff ausgedrückt, heißt Gestalt, sowohl in uneigentlicher als eigentlicher Bedeutung; ein Begriff, der alle formalen Beschaffenheiten der Dinge und alle Beziehungen derselben auf die Denkkräfte unter sich fasst. Der Gegenstand des Spieltriebes, wird also lebende Gestalt heißen können; ein Begriff, der allen ästhetischen Beschaffenheiten der Erscheinungen und mit einem Worte dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt, zur Bezeichnung dient." (15. Brief)
"Der Mensch (soll) mit der Schönheit nur spielen, und er soll nur mit der Schönheit spielen. Denn um es endlich auf einmal zu herauszusagen. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt." (15. Brief)
Der Spieltrieb ermöglicht also die Berücksichtigung der Gefühle und Triebe und erlaubt zugleich die Bestimmung als Person. Durch den Spieltrieb erhält der Mensch sein Dasein. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass schöpferisches Gestalten spielerisches Denken voraussetzt. Dieses spielerische Denken, klammert sich nicht ängstlich an vorgefasste Meinungen und Axiome, sondern dringt kühn in das "Unbekannte" vor und erhebt gesetzmäßige Veränderung zum Leitfaden schöpferischen Gestaltens. Der Mensch ist somit in der Lage, die Grenzen der sinnlichen und formalen Notwendigkeit zu durchbrechen und neue Gesetze, neue Freiheitsgrade zu entdecken. Nur durch das Spielen mit der Schönheit - dem geistigen Nachvollziehen der Ideen großer Kunst wird der Mensch befähigt, "Freiheit zu geben durch Freiheit".2
I In der Kunst findet die Synthese von Gefühl und Wille statt, in der Kunst findet der Mensch sich wieder, und zwar bei der Hervorbringung einer schöpferischen Idee. Für Schiller ist der Moment der schöpferischen Hervorbringung der Schönheit im Kunstwerk etwas, was sich nicht konkret in Worte fassen lässt. Vage andeutend spricht er im 19. Brief davon, dass es sich dabei um etwas "Dazwischen", ein "Aktual Unendliches" handelt: "Dadurch aber, dass wir die Bestandteile anzugeben wissen, die in ihrer Vereinigung die Schönheit hervorbringen, ist die Genesis derselben auf keine Weise noch erklärt; denn dazu würde erfordert, dass man jene Vereinigung selbst begriffe, die uns, wie überhaupt alle ,Wechselwirkung zwischen dem Endlichen und Unendlichen' unerforschlich bleibt."
Für den Gastgeber beruht der Moment der Schönheit ebenso auf der Grundlage des schöpferischen Prinzips. Genauso wie es die großen klassischen Komponisten Bach, Haydn, Mozart, Beethoven und Brahms beispielsweise getan haben, wird eine in Keimform empfundene gastgeberische Idee im Gesamten der Komposition durchkomponiert, verändert und zu einer höheren Hypothese verdichtet. Was für den Komponisten ein Motiv ist und spielerisch zu einem Thema verarbeitet wird, kann für den Gastgeber eine Idee sein, die er in seiner Einladung thematisch mit einarbeitet. Dieses Spiel vermittelt dem Gast ein Werk. Kein formaler Zwang und keine Willkür, sondern höchste Gesetzmäßigkeit bei größtmöglichster Freiheit - das vermittelt den besonderen Moment.
Im Brief 22 schreibt Schiller über das Zusammenspiel von Form und Inhalt in einem Kunstwerk.
„In einem wahrhaft schönen Kunstwerk soll der Inhalt nichts, die Form aber alles tun; denn durch die Form allein wird auf das Ganze des Menschen, durch den Inhalt hingegen nur auf einzelne Kräfte gewirkt. Der Inhalt, wie erhaben und weit umfassend er auch sei, wirkt also jederzeit einschränkend auf den Geist und nur von der Form ist wahre ästhetische Freiheit zu erwarten. Darin also besteht das eigentliche Kunstgeheimnis des Meisters, dass er den Stoff durch die Form vertilgt; und je imposanter, anmaßender, verführerischer der Stoff an sich selbst ist, je eigenmächtiger derselbe mit seiner Wirkung sich vordrängt, oder je mehr der Betrachter geneigt ist, sich unmittelbar mit dem Stoff einzulassen, desto triumphierender ist die Kunst, welche jenen zurückzwingt und über diesen die Herrschaft behauptet. Das Gemüt des Zuschauers und Zuhörers muss völlig frei und unverletzt bleiben, es muss aus dem Zauberkreis des Künstlers rein und vollkommen wie aus den Händen des Schöpfers gehen.“ (22. Brief)
Die Frage was konkret das Gastgeben ausmacht, wird also hier von Schiller genau erläutert: Im kreativen Spiel bildet der Gastgeber die Idee oder das Motiv der Einladung. Anhand der Form schafft er eine Umwelt, in der die Gäste diese
Idee zum Leben bringen. Das meisterliche Geheimnis liegt darin, dass die Form nicht das Gemüt der Gäste bestimmt, sondern nur eine Grundlage zur Entfaltung bietet und sie gewissermaßen leitet. In anderen Worten und auf den Künstler bezogen hat dies Prof. M. Bockemühl formuliert: „Der Künstler stellt bereit - der Betrachter verwirklicht“3 Wie der Künstler, hat auch der Gastgeber die Freiheit, mit Form und Materie zu spielen. Die Elemente, welche die Idee konstituieren und die Form bestimmen sollen lassen sich beliebig weit definieren. Für den engeren Begriff des Gastgebers sind es Überlegungen zur Tischform, der Anzahl der Gäste, ob Buffet oder Menu, zu welcher Stunde, welche kulinarische Komposition… Für den Gastgeber im Sinne eines Schöpfers von sozialen Skulpturen ist das Spektrum der Elemente unendlich weit. Das Geben wird ein geistiges Geben und drückt sich aus in Denken und Haltung.
In einer Reihe von Einladungen über die vergangenen Monate, habe ich mir zum Ziel gesetzt, genau dieses Spiel mit den Elementen zu betreiben. Meine Erfahrung zeigte, dass die Schönheit des gastgeberischen Moments zu allererst auf die geistige Haltung aufbaut. Die geistige Gabe spendet die Idee, auf die der formale Teil aufbaut. Die Form der Einladung konnte nicht selbst die Idee der Einladung schaffen, sondern die Idee der geistigen Gabe musste immer der Form voraus gehen. Dies zeigte sich dadurch, dass Schillers Moment der Schönheit - das Lebendige und der Moment des Erfüllt seins - das volle Daseins des Gastgebers fordert.
Das in sich gegründete Sein und die Zeit als Bedingung
Der Gastgeber ist verwirklicht sich im Zustand und der Bestimmung. Die Person dahinter lässt sich nur über die Zeit betrachten. Dennoch können beide nicht voneinander getrennt betrachtet werden.
„Person und Zustand - das Selbst und seine Bestimmungen - die wir uns in dem notwendigen Wesen als ein und dasselbe denken, sind ewig zwei in dem endlichen.“ (11. Brief)
Die Bestimmung kann nicht unabhängig von der Person erwachsen und die Person nicht unabhängig von der momentanen Bestimmung. Das in sich gegründete Dasein ist die wichtigste Grundlage des Gastgeberseins.
„Nicht weil wir denken, wollen, empfinden, sind wir; nicht weil wir sind, denken, wollen, empfinden wir. Wir sind, weil wir sind; wir empfinden, denken und wollen, weil außer uns noch etwas anderes ist. (11. Brief)
„Die Person also muss ihr eigener Grund sein, denn das Bleibende kann nicht aus der Veränderung fließen: Und so haben wir denn fürs erste die Idee des absoluten, in sich selbst gegründeten Seins, d.i. die Freiheit.“ (11. Brief)
Dies lässt sich besonders für den Gastgeber als auch die Gäste erfahren, da der gastgeberische Moment einzigartig ist und sich erst in der Verwirklichung vollendet. Das volle Dasein ist die Bedingung für den Moment des Schönen. Es lässt sich sofort erspüren, wenn ein Gastgeber nicht selbst das Spiel bestimmt, sondern durch einen formalen Rahmen bestimmt wird. Dieser Gastgeber hat keine Bestimmung, kreative Idee, und ist nicht in der Lage sie im Zusammenspiel zu dirigieren.
Neben dem in sich gegründeten Seins beschreibt Schiller die Zeit die zweite Bedingung für alles abhängige Sein und Werden.
„Der Zustand muss einen Grund haben; er muss, da er nicht durch die Person, also nicht absolut ist, erfolgen: Und so hätten wir fürs zweite die Bedingung alles abhängigen Seins oder Werdens, die Zeit. Die Zeit ist die Bedingung alles Werdens, ist ein identischer Satz, denn er sagt nichts anders, als: Die Folge ist die Bedingung, dass etwas erfolgt.“ (11. Brief)
Empfänglichkeit und Welt ergreifend
Schiller beschreibt es als die Aufgabe der Kultur, durch Ausbildung des "Gefühlsvermögens" und ebenso des "Vernunftvermögens" den Mensch im sinnlichen Trieb und Formtrieb zu schulen. Dies muss möglichst vielfältig geschehen, damit die Person einerseits größtmögliche Selbstständigkeit und ebenso Freiheit erhält.
„Da die Person das Bestehende in der Veränderung ist, so wird die Vollkommenheit desjenigen Vermögens, welches sich dem Wechsel entgegensetzen soll, größtmöglichste Selbständigkeit und Intensität sein müssen. Je vielseitiger sich die Empfänglichkeit ausbildet, je beweglicher dieselbe ist, und je mehr Fläche sie den Erscheinungen darbietet, desto mehr Welt ergreift der Mensch, desto mehr Anlagen entwickelt er in sich; je mehr Kraft und Tiefe die Persönlichkeit, je mehr Freiheit die Vernunft gewinnt, desto mehr Welt begreift der Mensch, desto mehr Form schafft er außer sich. Seine Kultur wird also darin bestehen, erstens: Dem empfangenden Vermögen die vielfältigsten Berührungen mit der Welt zu verschaffen und auf Seiten des Gefühls die Passivität aufs Höchste zu treiben; zweitens: Dem bestimmenden Vermögen die höchste Unabhängigkeit von dem empfangenden zu erwerben und auf Seiten der Vernunft die Aktivität aufs Höchste zu treiben. Wo beide Eigenschaften sich vereinigen, da wird der Mensch mit der höchsten Fülle von Dasein die höchste Selbständigkeit und Freiheit verbinden und, anstatt sich an die Welt zu verlieren, diese vielmehr mit der ganzen Unendlichkeit ihrer Erscheinungen in sich ziehen und der Einheit seiner Vernunft unterwerfen.“ (18. Brief)
Für den Gastgeber ist die Empfänglichkeit nicht nur auf dem Wege der Formung seiner Persönlichkeit von Bedeutung, sondern auch im Moment des Gastgebens selbst. Somit ist es gerade eine Kultur der Empfänglichkeit, die ihn auszeichnet. Eine Empfänglichkeit für die Sinne, die Form, und für die Freiheit im Spiel die Form und Materie zu balancieren. Ein sensibler Gastgeber ist der Meister in der Komposition von Anspannung und Entspannung. Er hat die Fähigkeit einem sozialen Zusammenhang von Zwängen aufzulösen und in einen Moment des Ästhetischen und Schönen zu verwandeln.
Konklusion
Somit wurde die von mir ursprünglich gestellte Frage nach dem, was das Gastgeben im höheren Sinne definiert, und wie der Mensch sich zu einem Gastgeber entwickeln kann, mit Hilfe Schillers Gedankengebäude zwar in einer philosophischen Weise beantwortet. Jedoch denke ich, dass diese Erörterung auf dieser Ebene sehr gut beschreibt, was ich selbst in mehreren Jahren und vielen Momenten des Gastgebens erfahren habe. Die Suche nach einer Definition bis dahin sehr unbefriedigend, da ich in allen Definitionen und Beschreibungen über das Gastgeben viel zu sehr den Fokus auf die Form gerichtet empfunden habe. Durch diese Übertragung auf Schillers Ästhetik wird klar, dass dieses Unbehagen darauf beruht, dass Form in Balance zu Materie stehen muss, und dass diese Balance immer wieder neu für jeden Moment in einem Spiel hergestellt werden muss. Dieses Spiel definiert die Einzigartigkeit des Moments und das Erfüllt sein, den "Zustand der höchsten Ruhe und der höchsten Bewegung", das persönliche Glück, - also genau das, was man das man empfindet, wenn man von einem guten Gastgeber empfangen wird.
[...]
1 http://www.solidaritaet.com/ibykus/1998/2/brainin.htm (14. Mai 2006)
2 Für Schiller ist dies das Grundgesetz des ästhetischen Bildungstriebes und der großen klassischen Kunst. Ohne sie gibt es keinen gerechten Staat, kein harmonisches Zusammenleben der Bürger untereinander und keine Begeisterung im Einzelnen, am Bau des Staates mitzuwirken. "Die Schönheit allein kann dem Mensch geselligen Charakter erteilen... Das Schöne allein genießen wir als Individuum und als Gattung zugleich d.h. als Repr ä sentanten der Gattung" (27. Brief).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine Analyse des Gastgebens im Sinne eines gestalterischen Prozesses, inspiriert von Friedrich Schillers Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen. Er untersucht, wie sich der Moment der Schönheit und Ästhetik beim Gastgeben manifestiert.
Was sind die Hauptthemen, die im Text behandelt werden?
Die Hauptthemen umfassen den Moment der Schönheit, das Spiel mit den Trieben (sinnlicher Trieb und Formtrieb), das in sich gegründete Sein und die Bedeutung der Zeit, sowie Empfänglichkeit und Welt ergreifend.
Wie definiert der Text den Begriff "Gastgeben"?
Gastgeben wird als mehr als nur Unterkunft und Verpflegung betrachtet; es ist ein sozialer Gestaltungsprozess, der einen Moment der Erfüllung und Balance zwischen Sinnlichem und Geistigem liefert. Es kann als eine Art "soziale Skulptur" betrachtet werden, wobei der Gastgeber eine künstlerische Note hinzufügt.
Was versteht Schiller unter dem "Moment der Schönheit"?
Schillers Moment der Schönheit ist ein Zustand, in dem der Mensch in Einheit mit seiner Natur und ein "vollendetes Ganzes" ist. Dieser Moment schafft Freiheit und Lebendigkeit, indem er Harmonie und Energie wiederherstellt.
Was sind der sinnliche Trieb und der Formtrieb nach Schiller?
Der sinnliche Trieb (auch Stofftrieb genannt) ist mit der Materie und den Empfindungen verbunden, während der Formtrieb nach Logik, Verstand, Harmonie und Beständigkeit strebt. Beide Triebe stehen in einem Zwiespalt, der idealerweise durch den Spieltrieb überwunden wird.
Was ist der "Spieltrieb" und wie hängt er mit Gastgeben zusammen?
Der Spieltrieb ermöglicht die Berücksichtigung der Gefühle und Triebe und erlaubt zugleich die Bestimmung als Person. Durch den Spieltrieb erhält der Mensch sein Dasein. Beim Gastgeben manifestiert sich der Spieltrieb im kreativen Spiel mit Form und Inhalt, um eine einladende und erfüllende Umgebung zu schaffen.
Welche Rolle spielt die Zeit beim Gastgeben?
Die Zeit ist eine wesentliche Bedingung für alles abhängige Sein und Werden. Der Zustand (z.B. die gastgeberische Erfahrung) muss einen Grund haben und erfolgt in der Zeit. Die Zeit spielt eine Rolle für die Entwicklung der Persönlichkeit des Gastgebers.
Warum ist Empfänglichkeit wichtig für einen Gastgeber?
Empfänglichkeit ermöglicht es dem Gastgeber, die Bedürfnisse und Stimmungen seiner Gäste wahrzunehmen und darauf einzugehen. Sie bezieht sich auf Empfänglichkeit für die Sinne, für die Form und für die Freiheit im Spiel, Form und Materie auszubalancieren.
Was ist das Fazit des Textes?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass das Gastgeben im höheren Sinne durch ein philosophisches Verständnis der Balance zwischen Form und Materie, inspiriert von Schillers Ästhetik, definiert wird. Der Fokus sollte nicht zu sehr auf die Form gerichtet sein, sondern ein Spiel zwischen Form und Materie, das ein erfülltes und einzigartiges Erlebnis ermöglicht.
- Arbeit zitieren
- Christoph Milz (Autor:in), 2006, Gastgebersein - ein Spiel mit Stoff und Form, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110461