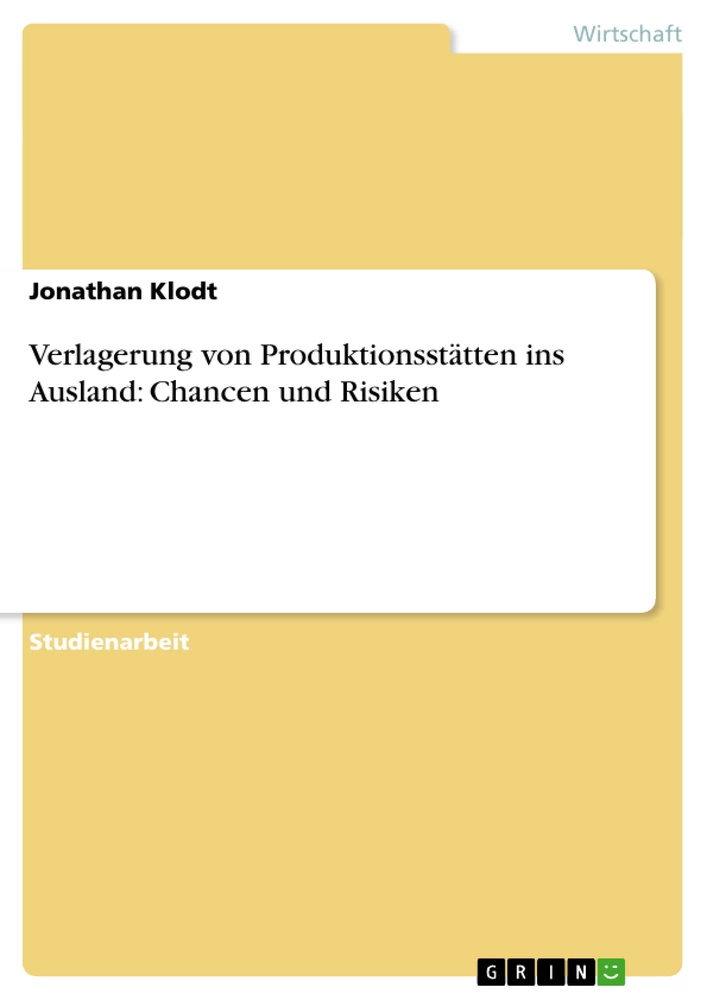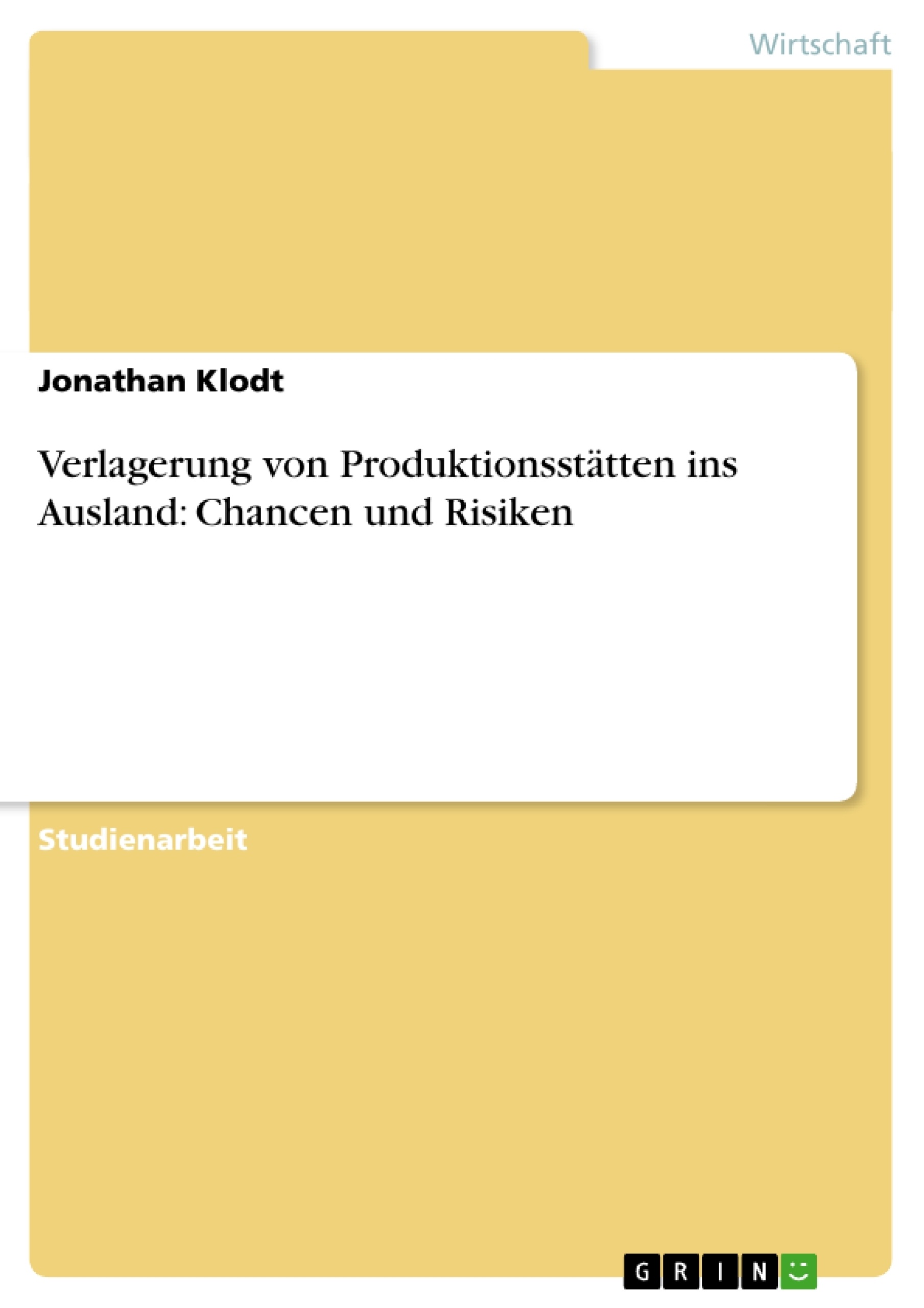Nach einer Umfrage der DIHK planen 24% der befragten Industrieunternehmen eine Verlagerung ihrer Produktionsstätten ins Ausland. Die hierfür notwendigen Voraussetzungen sind im Hinblick auf die EU Osterweiterung von institutioneller Seite besser denn je. Auch die rapide zunehmende internationale Vernetzung und Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationssysteme erleichtern eine Koordinierung internationalen Engagements.
Die besondere Aktualität der Thematik ist, wenn auch nun bereits einige Jahre sowohl in Fachliteratur, als auch öffentlichen Medien vielfach diskutiert, uneingeschränkt. Die folgende Ausarbeitung soll neben einem grundsätzlichen Überblick insbesondere auf die Chancen und Risiken der Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland sowohl für Unternehmen als auch für Volkswirtschaften eingehen.
INHALTSVERZEICHNIS
Abkürzungsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland: Chancen und Risiken
1. Einführung
2. Gründe und Hemmnisse der Verlagerung von Produktionsstätten
2.1 Gründe für Unternehmen
2.1.1 Wettbewerbsanpassungen
2.1.2 Steuern und Abgaben
2.1.3 Sonstige Kosteneinsparungen
2.2 Mögliche Hemmnisse der Standortverlagerungen
3. Folgen von Standortverlagerungen
3.1 gesamtwirtschaftliche Chancen
3.2 gesamtwirtschaftlich Risiken
4. Schlussbetrachtung
Anhang
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Anlage I: Abbildung 1 – Offshore Markt nach Branchen
Anlage II: Abbildung 2 – Hauptmotive für Produktionsverlagerung
Anlage III: Abbildung 3 – Hauptsorgen beim Offshoring
Anlage IV: Tabelle 1 – durchschnittliche Lohnkosten/Stunde 2004 und 2005
Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland: Chancen und Risiken
1. Einführung
Die besondere Aktualität der Thematik ist, wenn auch nun bereits einige Jahre sowohl in Fachliteratur, als auch öffentlichen Medien vielfach diskutiert, uneingeschränkt. Die folgende Ausarbeitung soll neben einem grundsätzlichen Überblick insbesondere auf die Chancen und Risiken der Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland sowohl für Unternehmen, als auch für Volkswirtschaften eingehen.
Der Begriff des Offshorings soll im Folgenden synonym für dieses Phänomen verwendet werden. Weitere, in der Literatur weitgehend bedeutungsgleiche Begriffe sind Offshore-Outsourcing oder internationales Sourcing.[1] Der ursprünglich aus der Finanzökonomie stammende Begriff kann als Verlagerung von Prozessen in andere Staaten, vornehmlich mit niedrigerem Lohnniveau definiert werden.[2]
Die Abgrenzung zum Outsourcing kann als „substituierende Verlagerung oder komplementärer Aufbau im Ausland“[3] gezogen werden.
Neben industrieller Fertigung sind hauptsächlich IT-Dienstleistungen von Auslagerungen betroffen. Dies wird in Abbildung 1, Seite V, veranschaulicht.
Auch wenn sich in letzter Zeit ein Wandel hin zu kapital- und wissensintensiven Aktivitäten vollzieht[4], also neben der Quantitäts- aktuell auch eine Qualitätsdimension hinzukommt, so soll sich diese Arbeit nur auf Produktionsstätten im originären Sinn, also industrielle Fertigungsstätten, beschränken.
Nach einer Umfrage der DIHK planen 24% der befragten Industrieunternehmen eine Verlagerung ihrer Produktionsstätten ins Ausland. Die hierfür notwendigen Voraussetzungen sind im Hinblick auf die EU Osterweiterung von institutioneller Seite besser denn je. Auch die rapide zunehmende internationale Vernetzung und Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationssysteme erleichtern eine Koordinierung internationalen Engagements.
Im Automobilbereich exemplarisch zu beobachten ist eine zunehmende Modularisierung der Fertigung mit der Konsequenz einer abnehmenden Fertigungstiefe und demzufolge ebenfalls erleichterndem Charakter für Produktionsverlagerungen.[5]
Als Hauptziele, im Folgenden auch als Offshore-Länder bezeichnet, sind Asien und Indien, aber insbesondere auch die zehn neuen EU-Mitgliedsstaaten zu nennen, welche streng genommen mit dem Begriff „Nearshoring“[6] verknüpft sind.
2. Gründe und Hemmnisse der Verlagerung von Produktionsstätten
Während für eine Vielzahl von Unternehmen der Schritt ins Ausland aufgrund organisatorischer Gegebenheiten nur eine unrealistische Phantasie darstellt, bedeutet er für andere die letzte Option nach versuchten Rationalisierungs- und Innovationsmaßnahmen.[7]
2.1 Gründe für Unternehmen
Grundlage der Erörterung der Entscheidungsfaktoren für Offshoring soll die mikroökonomische Theorie von Hirschmann darstellen.
Dieses abstrakte Modell sieht auf den Abfall von Leistungen von Anbietern, in diesem Fall dem Staat, zwei Reaktionsmöglichkeiten: Abwanderung (Exit) oder Widerspruch (Voice). Für die zu treffende Entscheidung sind rationale Kostenüberlegungen in Form von Zeitaufwendungen für Widerspruch oder Opportunitätskosten durch Abwanderungsverzicht zu berücksichtigen. Als psychischer Faktor wird die Loyalität zum Anbieter erwähnt.[8]
Hauptaugenmerk soll im Folgenden auf die Kostenaspekte gelegt werden, wobei die Beweggründe aufgeschlüsselt werden in Wettbewerbs-anpassungen, Steuern und Abgaben und sonstige Kosteneinsparungen. Diese Aspekte spiegeln, wie in Abbildung 2, Seite V, zu erkennen, die Hauptmotive für Verlagerungen wider.
2.1.1 Wettbewerbsanpassungen
Die Anpassung an fortschreitende Marktentwicklungen ist in zweierlei Hinsicht entscheidungsrelevant. Zum einen stellt Offshoring eine Möglichkeit dar, den Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten durch Kosten-einsparungen zu erhöhen, oder überhaupt das Fortbestehen am Markt sicherzustellen.[9] Anderseits finden heute viele Verlagerungen hauptsächlich aus dem Aspekt der Erschließung neuer, im Vergleich zu den Ursprungsländern außergewöhnlich dynamischen und attraktiven Wachstumsmärkten statt. Insbesondere erweißt sich dies als vorteilhaft, da häufig Wechselkursunsicherheiten und Exporthemmnisse durch eine Abwanderung ins Zielabsatzland umgangen werden können.[10]
2.1.2 Steuern und Abgaben
Neben den Arbeitskosten stellen die Steuern das Hauptmotiv für Produktionsverlagerungen ins Ausland dar.[11] Die klassischen Offshore-Länder bieten Unternehmen besonders günstige Steuerbedingungen, im Idealfall kombiniert mit entsprechenden zusätzlichen Subventionen.[12] Eine direkte Renditesteigerung ist somit zu erzielen.
Darüber hinaus weisen sie eine im Vergleich zu den Ursprungsländern geringe Regulierungen und Bürokratie auf.[13]
Das Steuersystem in Deutschland wird im Gegensatz dazu als zu unübersichtlich kritisiert und anhaltende Diskussionen über neue Steuern sorgen für Unsicherheit.[14]
2.1.3 Sonstige Kosteneinsparungen
Die in Tabelle 1, Seite VI, erfassten Werte lassen schnell erkennen, dass die Lohnkosten in Deutschland offensichtlich nicht mit osteuropäischen Offshore-Ländern mithalten können. Der durchschnittliche Arbeitslohn in der Slowakei ist beispielsweise nur knapp ein Sechstel der Kosten, die in Deutschland anfallen.
Auch wenn in Billiglohnländern der wirtschaftliche Aufschwung zu steigenden Löhnen führt, so ist die Konkurrenzsituation in naher Zukunft als unverändert zu erwarten. Die IG Metall macht jedoch deutlich, dass diese Lohnvorteilskosten durch hinzuzurechnende Kosten weniger verlockend sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen.[15]
Als weiterer Kostenfaktor finden neben den Lohnkosten zusätzlich niedrige Rohstoffpreise Erwähnung.[16] Dies ist oftmals auf ein gesamtwirtschaftlich niedrigeres Preisniveau zurückzuführen.
2.2 Mögliche Hemmnisse der Standortverlagerungen
Den nun umfassend dargestellten Motivationen einer Standortverlagerung steht allerdings auch eine Vielzahl von Hemmnissen gegenüber. Im Rahmen der mikroökonomischen Theorie von Hirschmann wurde neben den anstehenden Kosten bereits das psychische Hemmnis der Loyalität erwähnt.
Von Bauer/Hardock wird daher treffend differenziert in „ökonomisch-organisatorische“ und „psychisch-soziale Barrieren“.[17]
Eine Verlagerung ist ein komplexes Unterfangen, dass, wenn schlecht geplant, ebenso gut fehlschlagen kann und statt der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit im Gegenteil, dem finanziellen Untergang, insbesondere für kleinere Unternehmen, resultiert.
So kehrt nach Bates jedes dritte Unternehmen nach seiner Verlagerung nach Osteuropa nach Deutschland zurück.[18]
Als Hauptproblem arbeitet er die Schwierigkeit, gute Lieferanten an sich zu binden, heraus.
Grundsätzlich ist für eine Offshoring Maßnahme die Entstehung hoher Initialkosten zu erwarten.[19] Ein gesteigerter Koordinationsaufwand stellt hohe Ansprüche an die Kapazitäten eines Unternehmens.
Zudem kann es zu sinkender Flexibilität in der Abwicklung von Wertschöpfungsprozessen und höheren Durchlaufzeiten kommen, was in sinkender Kundenorientierung münden kann.[20]
In Erfahrungsberichten ist ferner von schlechter Infrastruktur, nicht verlässlichem Justizwesen, komplizierter Bürokratie und anderer Geschäftsmentalität, sowie Logistikproblemen zu lesen.[21]
In einem derartig unbekannten Umfeld kommt als weiterer Risikofaktor der Abfluss oder gar Diebstahl von Know-how hinzu.[22]
Als ebenfalls entscheidungsrelevant ist der Bereich der Corporate Identity anzusehen und hier insbesondere der mögliche Imageverlust, der mit einer Produktionsverlagerung einhergehen kann.
Die bei einer Umfrage der Unternehmensberatung Roland Berger in 2004 erhobenen Daten stellen die Hauptsorgen von Unternehmen übersichtlich in einer Grafik dar (siehe Abbildung 3, Seite V).
[...]
[1] Vgl. Schaaf, 2004, S. 3.
[2] Vgl. ebenda.
[3] Ebenda, S. 7.
[4] Vgl. Nitschke, Wimmers, 2003, S. 4.
[5] Vgl. Nedeß, Barck, 1998, S. 2.
[6] Schaaf, 2004, S. 3.
[7] Vgl. Bauer/Hardock, 2003, S. 266.
[8] Vgl. ebenda.
[9] Vgl. Appel, 2006, S. 17.
[10] Vgl. Bauer/Hardock, 2003, S. 263.
[11] Vgl. Abbildung 1, Seite V.
[12] Vgl. Peitsmeier, 2006, S. 19.
[13] Vgl. Lau, 2005, S. 6.
[14] Vgl. Nitschke, Wimmers, 2003, S. 4.
[15] Vgl. Scheitor u.a., S. 21ff.
[16] Vgl. Appel, 2006, S. 17.
[17] Bauer/Hardock, 2003, S. 268ff.
[18] Vgl. Bates, 2005, S. 300.
[19] Vgl. Huber, 2005, S. 7.
[20] Vgl. Kinkel, 1996, S. 5.
[21] Vgl. Appel, 2006, S. 17.
[22] Vgl. Nedeß, Barck, 1998, S. 1.
- Citation du texte
- Jonathan Klodt (Auteur), 2007, Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland: Chancen und Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110516