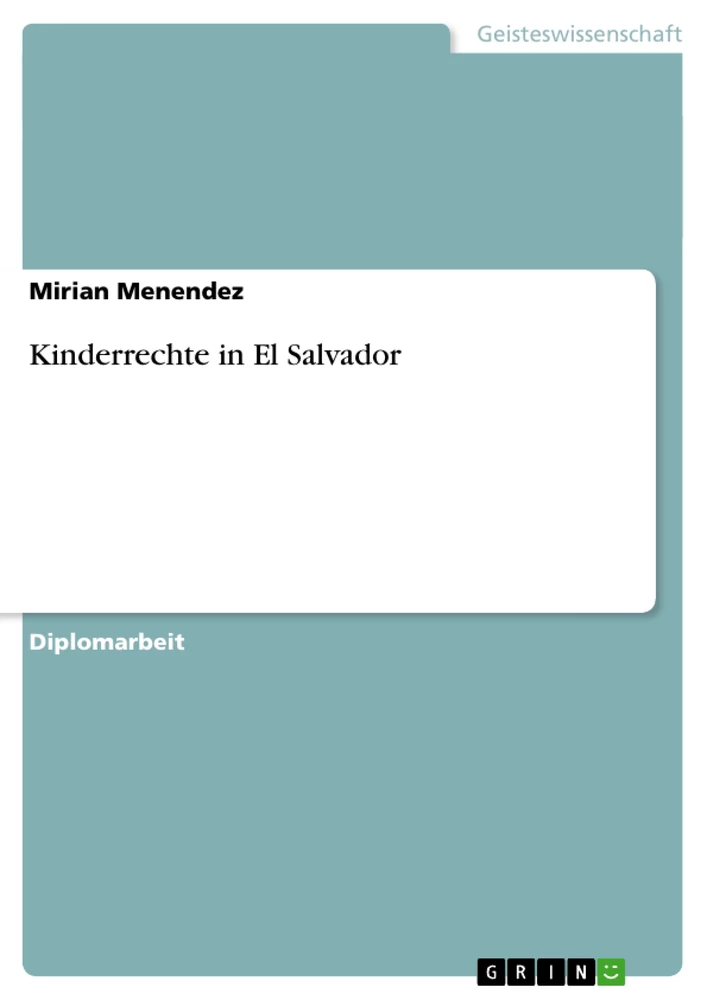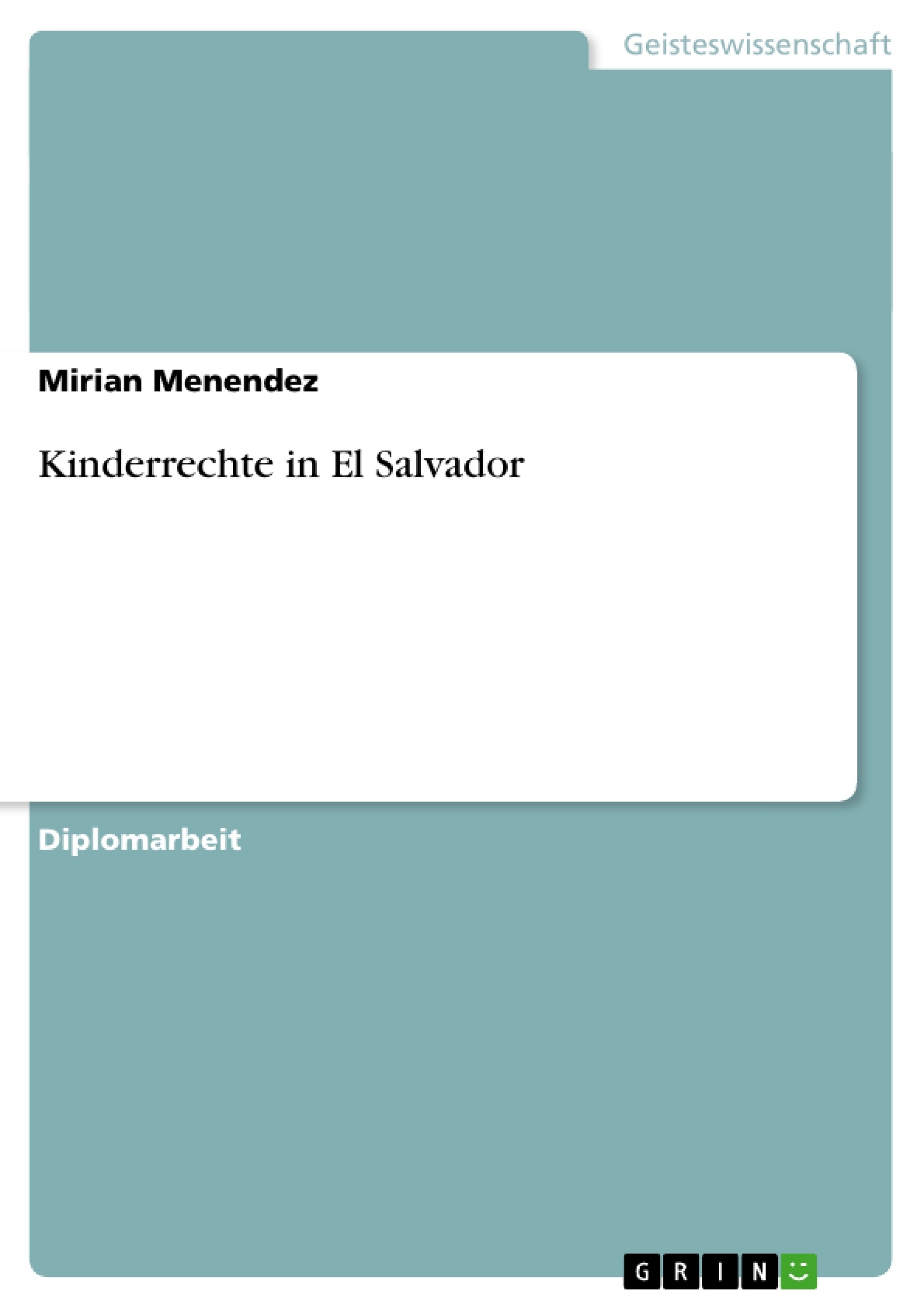„Kinder haben Rechte - das Recht auf Überleben etwa, auf Bildung, auf Beteiligung an wichtigen Entscheidungen, auf Schutz vor Missbrauch und Gewalt. Wer würde dem widersprechen wollen.“
Mit der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) von 1989 liegt zum ersten Mal eine verbindliche Rechtsform vor, in der die Rechte des Kindes festgehalten sind. Sie ist in kürzester Zeit zu dem internationalen Menschenrechtsabkommen mit den meisten Mitgliedern geworden. Alle Staaten bis auf die USA und Somalia haben die KRK ratifiziert.
El Salvador hat die KRK im Jahre 1990 ratifiziert und sich damit verpflichtet, diese im eigenen Staat umzusetzen. Der kleinste Staat Mittelamerikas hat gerade einmal 6,4 Mio. Einwohner. Jährlich sterben hier noch immer rund 231.000 Kinder, bevor sie das fünfte Lebensjahr vollendet haben. Rund 60.000 Kinder müssen arbeiten um zum Familieneinkommen beizutragen und rund 500 leben auf der Strasse und kämpfen dort täglich um ihr Überleben. Kriminalität und Gewalt spiegeln die Realität der Kinder und Jugendlichen in diesem Land wieder.
All das und vieles mehr, hat auch die KRK nicht verhindern können, denn die zugrunde liegenden Ursachen lassen sich durch die Verabschiedung eines internationalen Abkommens natürlich nicht einfach so abschaffen. Die KRK hat den Grundstein für ein kinderfreundlicheres Aufwachsen in El Salvador gelegt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kinderrechte
2.1 Historische Entwicklung der Kinderrechte
2.2 UN-Kinderrechtskonvention
2.2.1 Aufbau der KRK
2.2.2 Die Zusatzprotokolle zur KRK
2.2.3 Verpflichtungen der Vertragsstaaten
2.3 Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes
2.4 Die Rolle der NROen
2.5 Kritik an der KRK
3. Kindheit in El Salvador
3.1 Ratifikation der KRK in El Salvador
3.2 Kindheit in El Salvador
3.3 Armut in El Salvador
3.4 Kriminalität und Gewalt in El Salvador
3.5 Kinderarbeit in El Salvador
3.5.1 Gesetzlich verboten, aber weit verbreitet
3.5.2 Formen und Risiken der Kinderarbeit in El Salvador
3.6 Bildung in El Salvador
3.6.1 Alphabetisierung
3.6.2 Bildung von Mädchen
3.7 Straßenkinder in El Salvador
3.8 Jugendbanden in El Salvador
4. Experteninterviews
4.1 Forschungsdesign
4.1.1 Ausgangspunkt
4.1.2 Erhebungsmethode: Qualitatives Interview
4.1.3 Problemzentriertes Interview nach Witzel
4.1.4 Vorbereitung und Durchführung der Experteninterviews
4.1.5 Auswertungsmodus
4.1.6 Aussagekraft
4.2 Vorstellung der Interviewpartner und der Einrichtungen
4.3 Auswertung der Interviews – Umsetzung von Kinderrechten in El Salvador auf nationaler Ebene
4.3.1 Auswirkungen der Ratifikation der KRK in El Salvador
4.3.2 Die Verantwortung des salvadorianischen Staats bei der Umsetzung von Kinderrechten
4.3.3 Die meistverletzten Kinderrechte in El Salvador
4.3.4 Ursachen für die Missachtung von Kinderrechten in El Salvador auf nationaler Ebene
4.3.5 Ursachen für die Missachtung von Kinderrechten in El Salvador auf familiärer Ebene
4.3.6 Ursachen für die Missachtung der Kinderrechte von Mädchen in El Salvador
4.3.7 Die Armut und ihre Konsequenzen in Bezug auf die Umsetzung von Kinderrechten in El Salvador
4.3.8 Naturkatastrophen und ihre Konsequenzen in Bezug auf die Umsetzung von Kinderrechten in El Salvador
4.3.9 Bildungsarbeit zum Thema Kinderrechte auf gesellschaftlicher Ebene in El Salvador
4.4 Zusammenfassung der Auswertung
5. Die Soziale Arbeit im Einsatz für die Kinderrechte in El Salvador am Beispiel der NRO ANAES
5.1 Beschreibung der NRO
5.2 Zielgruppe
5.3 Gesundheitsprojekte
5.3.1 Klinik
5.3.2 Gesundheitsprojekt in den comunidades[1]
5.3.3 Ernährung der Kinder in den CDIs
5.3.4 Beratung der Eltern zum Thema Gesundheit
5.4 Die Ergebnisse der ärztlichen Untersuchungen in den CDIs
5.5 Elternschulungen in den CDIs
5.5.1 Die Wirkung der Elternschulung in den CDIs nach Meinung der Erzieherinnen
5.5.2 Die Wirkung der Elternschulung in den CDIs nach Meinung der Sozialarbeiterin
5.6 Elternbefragung
5.7 Ergebnisse der Befragung – Wirkung von Elternschulungen in den CDIs von ANAES
5.7.1 Kinderrechte
5.7.2 Recht auf angemessenen Lebensstandard
5.7.3 Recht auf Schutz vor Kinderarbeit
5.7.4 Recht auf gewaltfreie Erziehung
5.7.5 Recht auf Gesundheit
5.7.6 Recht auf Spiel und Freizeit
5.7.7 Recht auf freie Meinungsäußerung
5.7.8 Elternschulungen
5.8 Schlussfolgerung der Elternbefragung
6. Ausblick
Quellenverzeichnis
EIDESTATTLICHE ERKLÄRUNG
ANHANG:
1. Einleitung
„Kinder haben Rechte – das Recht auf Überleben etwa, auf Bildung, auf Beteiligung an wichtigen Entscheidungen, auf Schutz vor Missbrauch und Gewalt. Wer würde dem widersprechen wollen.“ (UNICEF, 2001, S.6)
Mit der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) von 1989 liegt zum ersten Mal eine verbindliche Rechtsform vor, in der die Rechte des Kindes festgehalten sind(vgl. National Coalition, 1996, S.12). Sie ist in kürzester Zeit zu dem internationalen Menschenrechtsabkommen mit den meisten Mitgliedern geworden. Alle Staaten bis auf die USA und Somalia haben die KRK ratifiziert(vgl. UNICEF, 2001, S.6).
El Salvador hat die KRK im Jahre 1990 ratifiziert und sich damit verpflichtet, diese im eigenen Staat umzusetzen(vgl. Save the children, 2001, S.11). Der kleinste Staat Mittelamerikas hat gerade einmal 6,4 Mio. Einwohner. Jährlich sterben hier noch immer rund 231.000 Kinder, bevor sie das fünfte Lebensjahr vollendet haben(vgl. UNICEF, 2004, S. 163). Rund 60.000 Kinder müssen arbeiten um zum Familieneinkommen beizutragen(vgl. IPEC Country Profile: El Salvador, 2004, S.1) und rund 500 leben auf der Strasse und kämpfen dort täglich um ihr Überleben (vgl. CIR, 2002). Kriminalität und Gewalt spiegeln die Realität der Kinder und Jugendlichen in diesem Land wieder(vgl. Terre des Hommes, 2004).
All das und vieles mehr, hat auch die KRK nicht verhindern können, denn die zugrunde liegenden Ursachen lassen sich durch die Verabschiedung eines internationalen Abkommens natürlich nicht einfach so abschaffen(vgl. UNICEF, 2001, S.6). Die KRK hat den Grundstein für ein kinderfreundlicheres Aufwachsen in El Salvador gelegt. Zum einen wurden durch sie viele Verstöße gegen die Grundrechte von Kindern erst als solche bewusst und zum anderen ist es durch die KRK weltweit, so auch in El Salvador, zu einer Bewegung in der Kinder- und Jugendpolitik gekommen(vgl. Terre des Hommes, 2004)
Bereits längere Zeit beschäftigte ich mich theoretisch mit der Situation El Salvadors, ihrer Kultur und Vergangenheit. Mein besonderes Interesse galt dabei der Lebenssituation von Kindern. So entschloss ich mich meine Diplomarbeit über das Thema: Kinderrechte in El Salvador zu schreiben. Im September des vergangenen Jahres ging ich schließlich nach El Salvador, um die notwendigen Recherchen vor Ort durchzuführen. Zuvor hatte ich mich mit der Nichtregierungsorganisation (NRO) Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador[2] (ANAES) in Verbindung gesetzt und darum gebeten, ihre Organisation als Basis für meine Forschung zu verwenden. Vor Ort wurde ich von den Mitarbeitern sehr herzlich aufgenommen und bei meiner Arbeit unterstützt.
Zentrale Fragen in den Anfängen meiner Auseinandersetzung mit dem Thema meiner Diplomarbeit waren: Zum einen, wie es um die Kinderrechte in El Salvador gestellt ist und zum anderen, was die Soziale Arbeit von Nichtregierungsorganisationen (NROen), am Beispiel der NRO ANAES, in Hinblick auf die Umsetzung dieser Rechte, in diesem Land bewirken können. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die KRK in den Blick zu nehmen und eine möglichst genaue Analyse der Umsetzung von Kinderrechten in El Salvador zu entwerfen.
Für die Einfindung in das Thema werden im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit der Historische Hintergrund der Kinderrechte sowie die aktuell gültige KRK beschrieben.
Um zu erfassen, wie es um die Kinderrechte in El Salvador gestellt ist, wird im dritten Kapitel die Kindheit und insbesondere die Situation derer Kinder in El Salvador, die sich in besonderen Problemlagen befinden, dargestellt.
Das darauf folgende Kapitel umfasst einen empirischen Teil mit Experteninterviews. Hier gilt es herauszufinden, was die Experten, zu den Themen, die über die Darstellung der Situation der Kinder hinausgehen, wie Ursachen für die Missachtung von Kinderrechten, die Auswirkung der Ratifikation der KRK in El Salvador u. a., zu sagen haben. Zunächst wird die Vorgehensweise für die Durchführung der Interviews beschrieben. Im Anschluss daran werden die Interviewpartner sowie die Einrichtungen, in denen die vier interviewten Experten tätig sind, vorgestellt. Nach dieser Beschreibung wird die Auswertung der durchgeführten Interviews mittels Kategorien dargestellt.
Im fünften Kapitel wird die Arbeit der NROen am Beispiel der NRO ANAES in El Salvador beschrieben. Hier ist das Ziel, die Wirkung ihrer Arbeit zu analysieren. Zunächst wird die gesamte Arbeit der NRO vorgestellt. Im Anschluss daran wird ein Projekt für die Gesundheit beschrieben und analysiert. Anschließend wird ein Projekt über Elternschulungen genauer unter die Lupe genommen. Eine quantitative Befragung von Eltern soll Aufschluss über die Wirkung von Elternschulungen geben. Es wird zunächst die Vorgehensweise für die Befragung beschrieben und darauf folgend, werden die Ergebnisse in Form von Schaubildern dargelegt und dann erklärt.
Abgeschlossen wird die vorliegende Arbeit mit einem Ausblick. Hier wird Bezug auf die gesamte Arbeit genommen und die Anforderungen an die Soziale Arbeit werden benannt.
Die folgenden Informationsquellen bestehen vorwiegend aus Literatur, Internetquellen sowie Zeitschriften und Berichten der Einrichtung ANAES. Zudem wurde dies durch Interviews mit Experten sowie durch eine Elternbefragung ergänzt. Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, wird bei Internetquellen, im laufenden Text darauf verzichtet, die gesamte Internetadresse anzugeben. Es werden lediglich der Autor und das Jahr der letzten Aktualisierung genannt. Die genaue Adresse ist dann im Quellenverzeichnis aufzufinden.
Abschließend sei angemerkt, dass im Verlauf der vorliegenden Arbeit personelle Bezeichnungen, sofern sie sich ausschließlich auf weibliche Personen beziehen, in der weiblichen Form verwendet werden. Die männliche Form findet Gebrauch, wenn männliche und weibliche Personen einbezogen werden. Wenn von Eltern die Rede ist werden auch andere Erziehungsberechtigten mit eingeschlossen. Dieses macht Sinn um die bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.
2. Kinderrechte
2.1 Historische Entwicklung der Kinderrechte
Im Jahr 1924 wurde die so genannte Genfer Erklärung über die Rechte des Kindes von der damaligen „ International Union for Child Welfare “ entworfen und vom Völkerbund anerkannt. Die Erklärung war das erste Konzept für Rechte von Kindern auf internationaler Ebene(vgl. National Coalition, 1996, S.12). Dieses fünf-Punkte-Programm war jedoch wenig ausdifferenziert und rechtlich unverbindlich (vgl. Fesenfeld, 1997, S. 35). So wurden die Beratungen über Rechte von Kindern 1948 fortgesetzt. Schließlich wurde am 20. November 1959 der in zehn Artikeln überarbeitete und erweiterte Text von der Vollversammlung der Vereinten Nationen als „Deklaration über die Rechte des Kindes“ einstimmig verabschiedet (vgl. National Coalition, 1996, S.12).
Anlässlich des Internationalen Jahres des Kindes 1979, wurde eine Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission bei den Vereinten Nationen beauftragt, eine Konvention über die Rechte des Kindes zu erarbeiten. Die Grundlage hierfür war eine polnische Initiative. Diese sollte völkerrechtlich für die unterzeichnenden Staaten eine größere Verbindlichkeit als die Genfer Deklaration bedeuten. Seit 1983 bemühte sich auch eine Arbeitsgruppe internationaler NROen erfolgreich darum, auf den Fortgang der Verhandlungen Einfluss zu nehmen (vgl. ebd., S. 12).
Im März 1989 wurde die umfangreiche Vorlage von der Menschenrechtskommission verabschiedet. Der Rat für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen stimmte im Mai 1989 dem Entwurf zu. Am 20. November 1989, 30 Jahre nach der Deklaration über die Rechte des Kindes und zehn Jahre nach dem Internationalen Jahr des Kindes, wurde die Konvention über die Rechte des Kindes von der Generalversammlung der Vereinten Nationen schließlich angenommen(vgl. National Coalition, 1996,, S.12). Mittlerweile haben bis auf die Vereinigten Staaten und Somalia alle Staaten die Konvention ratifiziert(vgl. UNICEF, 2003, S.3).
Mit der Konvention über die Rechte des Kindes liegt zum ersten Mal eine für die vertragsschließenden Parteien, verbindliche Rechtsform vor. In dieser werden persönliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von Minderjährigen in einem internationalen Übereinkommen verdeutlicht und zusammengestellt(vgl. National Coalition, 1996, S.12).
2.2 UN-Kinderrechtskonvention
2.2.1 Aufbau der KRK
Die Konvention umfasst 54 Artikel und ist neben der Präambel in drei Teile gegliedert. Teil I stellt mit 41 Artikeln den umfangreichsten dar und behandelt die materiellen Rechte des Kindes. Teil II enthält in seinen Artikeln 42 – 45 Verfahrensvorschriften zur Überprüfung dieser Rechte. Teil III normiert in den Artikeln 46 – 54 die Schlussbestimmungen(vgl. National Coalition, 1996, S.12f).
Die Konvention beinhaltet vier Grundsätze, zu denen die Vertragsstaaten in ihren Berichten Stellung beziehen sollten:
- den Grundsatz der Gleichbehandlung(vgl. KRK, Artikel 2, siehe Anhang: Anlage 1),
- den Grundsatz des besten Interesses(vgl. KRK, Artikel 3, siehe Anhang: Anlage 1),
- das Grundrecht auf Überleben und persönliche Entwicklung(vgl. KRK, Artikel 6, siehe Anhang: Anlage 1) und
- die Achtung vor der Meinung des Kindes (vgl. KRK, Artikel 12, siehe Anhang: Anlage 1).
Thematisch können die Rechte in folgende Gruppen zusammengefasst werden:
- Rechte in der Familie(vgl. KRK, Artikel 5 – 11, siehe Anhang: Anlage 1),
- bürgerlich – politische Grundrechte(vgl. KRK, Artikel 12 – 17, siehe Anhang: Anlage 1),
- wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte(vgl. KRK, Artikel 24 – 26, siehe Anhang: Anlage 1),
- Einzelprobleme (Adoptionskinder, Flüchtlingskinder, Behinderte)(vgl. KRK, Artikel 19ff, siehe Anhang: Anlage 1) und
- Schutz vor der Lebensumwelt / Ausbeutungsparagraphen(vgl. KRK, Artikel 32 – 36, siehe Anhang: Anlage 1).
Zudem können die Rechte in drei Gruppen eingeteilt werden, die gleichberechtigt nebeneinander stehen(vgl. National Coalition, 1996, S.13):
- Versorgungsrechte,
- Schutzrechte und
- Beteiligungsrechte.
2.2.2 Die Zusatzprotokolle zur KRK
Die KRK hat noch Präzisierungen erfahren, weshalb zwei Zusatzprotokolle entstanden sind(vgl. UNICEF, 2003, S. 3). Diese wurden am 25. Mai 2002 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen (vgl. Fespad ediciones, 2002, S.109)
Das Zusatzprotokoll betreffend die Verwicklung von Kindern in bewaffneten Konflikten legt fest, dass Kinder unter 18 Jahren nicht zwangsweise zum Militärdienst eingezogen werden dürfen. Somit wird die Altersbegrenzung von 15 Jahren aus Artikel 38 der Konvention präzisiert. Wer sich freiwillig zum Militärdienst melden will, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Doch auch dann gilt: Niemand unter 18 Jahren darf an Kampfhandlungen teilnehmen (vgl. UNICEF, 2003, S.3).
Das zweite Zusatzprotokoll zur KRK betreffend den Kinderhandel, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie verbietet diese ausdrücklich und fordert die Staaten auf, diese Form der Ausbeutung als Verbrechen zu verfolgen und unter Strafe zu stellen (vgl. ebd., S. 3).
2.2.3 Verpflichtungen der Vertragsstaaten
Mit der Ratifizierung verpflichten sich die Vertragsstaaten dazu, alle in der Konvention aufgeführten Prinzipien und Standards einzuhalten. Sie dürfen allerdings Vorbehalte äußern, welche jedoch nicht im Widerspruch zu Ziel und Zweck der Konvention stehen dürfen(vgl. KRK, Artikel 51,2, siehe Anhang: Anlage 1). Diejenigen Prinzipien und Standards zu denen die Vertragsstaaten Vorbehalte geäußert haben, müssen nicht eingehalten werden. Die Vorbehalte können zurückgenommen werden (vgl. KRK, Artikel 51,3, siehe Anhang: Anlage 1).
Nach Artikel 4 der KRK sind Regierungen dazu verpflichtet, alle rechtlichen, verwaltungsmäßigen und andere Maßnahmen zu ergreifen, um die in der Konvention enthaltenen Rechte umzusetzen. Die Konvention stellt völkerrechtlich, verbindliche Rechtsnormen auf, die dem einfachen nationalen Recht vorgehen und an dieses angepasst werden muss. Die Verfassung des entsprechenden Landes muss dahingehend überprüft werden, inwiefern sie der Konvention entspricht(vgl. National Coalition, 1996, S.14).
Die Vertragsstaaten verpflichten sich zu einer regelmäßigen Berichterstattung über die Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Konvention(vgl. KRK, Artikel 44, siehe Anhang: Anlage 1).
Zudem garantieren die Vertragsstaaten, die Texte der Konvention selbst sowie die Ergebnisse der Beratungen mit dem UN-Ausschuss auf breiter Ebene bekannt zumachen (vgl. KRK, Artikel 42 und Artikel 44,6, siehe Anhang: Anlage 1).
2.3 Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes
Um sicherzustellen, dass die Staaten ihren Verpflichtungen aus der Konvention nachkommen, ist ein Ausschuss für die Rechte des Kindes (vgl. KRK, Artikel 43, siehe Anhang: Anlage 1) eingerichtet worden. Dieser überprüft die staatlichen Fortschritte bei der Erfüllung der Vertragsverpflichtungen.
Die Prüfung der Maßnahmen zur Umsetzung der KRK geschieht zum einen durch die Staatenberichte, die die Regierungen in regelmäßigen Abständen(Erstbericht zwei Jahre nach Ratifizierung, danach alle fünf Jahre) abgeben müssen(vgl. National Coalition, 1996, S.15). Zum anderen hat der Ausschuss die Möglichkeit, einen alternativen Bericht (auch „Schattenbericht“ genannt) von NROen der betreffenden Staaten einzuholen und Vertreter der NROen anzuhören(KRK, Artikel 45 a, siehe Anhang: Anlage 1). Nur so kann sich der Ausschuss ein vollständiges Bild über die Umsetzung der KRK in den jeweiligen Staaten machen(vgl. UNICEF, 2003, S. 4).
In den Staatenberichten ist auf
„bestehende Umstände und Schwierigkeiten hinzuweisen, welche die Vertragsstaaten daran hindern, die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Verpflichtungen voll zu erfüllen. “ (KRK, Artikel 44,2, siehe Anhang: Anlage 1).
Das Komitee kann überdies einzelne Konventionsartikel kommentieren und Anregungen zur besseren Umsetzung der Konvention geben. Daneben kann er säumige Staaten mahnen, ihrer Berichtspflicht nachzukommen. Zur Erleichterung der Ausschussarbeit ist vorgesehen, dass der UNO-Generalsekretär bei Bedarf von der Generalversammlung beauftragt wird, für den Ausschuss Untersuchungen im Zusammenhang mit den Rechten des Kindes durchzuführen(vgl. National Coalition, 1996, S.15).
Das Komitee tagt zweimal im Jahr jeweils drei Wochen lang, um die Länderberichte mit Vertretern der Regierungen zu erörtern. Dabei misst er den Schattenberichten und den Kommentaren der NROen große Bedeutung bei. Nicht zuletzt dadurch werden die Ausschuss-Mitglieder sehr oft auf Themenbereiche aufmerksam gemacht, die in den Regierungsberichten nur unzureichend behandelt werden und die Anregungen für zusätzliche Fragen enthalten. Die Sitzungen sind öffentlich, und das Komitee ermutigt die NROen der jeweiligen Länder, daran teilzunehmen und ihre Expertisen einzubringen(vgl. National Coalition, 1996, S.15).
2.4 Die Rolle der NROen
Bereits im Vorbereitungsprozess zur Entstehung der Konvention hatten verschiedene NROen in Genf einen maßgeblichen Einfluss auf die Formulierung mancher Artikel. Um den Einfluss von NROen im weiteren Prozess zu gewährleisten, wurde in Genf ein Verbindungsbüro zum UN-Komitee eingerichtet. Die Hauptaufgabe des Büros besteht darin, einen guten Informationsfluss zwischen den NROen und dem UN-Ausschuss zu gewährleisten(vgl. National Coalition, 1996, S.15).
In vielen Fällen hat das UN-Komitee die alternativen Berichte und Kommentare der NROen aufgegriffen und von den Regierungsvertretern genauere Auskünfte erbeten. Insofern spielen die NROen eine wichtige Rolle im UN-System, da nur ihre Beteiligung eine ausgewogene Urteilsbildung über den tatsächlichen Stand der Erfüllung der KRK in allen Ländern der Welt sichert(vgl. ebd., S.16).
Bei der Umsetzung der Konvention für die Rechte des Kindes sind alle gesellschaftlichen Kräfte gefordert. Die Hauptverantwortung liegt zwar bei den Regierungen, aber NROen haben oftmals einen direkteren Kontakt zu der Bevölkerung und deshalb im Hinblick auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bessere Umsetzungsmöglichkeiten(vgl. ebd., S.16).
2.5 Kritik an der KRK
Die KRK ist allerdings nicht perfekt. Im Folgenden werden einige Kritikpunkte aufgezeigt(vgl. Fesenfeld, 1997, S. 28f):
- Manche Vorschriften sind unklar: Es wird nicht deutlich, wann die Kindheit endet: Die Konvention nennt 18 Jahre, macht aber die Einschränkung „wenn die Volljährigkeit nicht nach nationalem Recht früher beginnt“.
- Ökologische Kinderrechte sind nicht ausdrücklich verankert, obwohl Kinder massiv von Umweltbelastungen betroffen sind.
- Die besonderen Probleme von Mädchen sind kein Thema in der Konvention, obwohl weltweit Mädchen besonders benachteiligt werden.
- Warum haben gerade die ärmsten Länder der Erde so schnell diese Konvention unterzeichnet – wohl wissend, dass die in ihr enthaltenen Vorgaben in absehbarer Zeit nicht Wirklichkeit werden können? Ist es womöglich „politisch ungefährlich“, eine solche Konvention zu unterschreiben.
- Kritiker bezweifeln die Wirksamkeit der Konvention, wenn selbst längst vorhandene gesetzliche Regelwerke nicht vollständig umgesetzt werden. Da die Vereinten Nationen nur bei Kriegshandlungen direkt eingreifen dürfen, nicht aber bei Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit des Staates gehören, kann die UNO letztlich bei Menschen- und Kinderrechtsverletzungen nur bedingt tätig werden.
Mit der KRK sollte ein für alle Staaten verbindliches Rechtswerk gestaltet werden. Die KRK ist ein Kompromiss, bei dem es galt, die unterschiedlichen Vorstellungen der Staaten einzubinden. Dabei blieben manche Fragen ungeklärt, manche Probleme ungelöst(vgl. Fesenfeld, 1997, S. 29).
„ Reine Paragraphen reichen selbstverständlich nicht aus, um die Situation der Kinder zu verbessern. Die Konvention muss mit Leben gefüllt werden. Sonst ist sie vielleicht nicht mehr als ein Mittel, sich für einen geringen Preis ein gutes Gewissen zu verschaffen“ (ebd., S.29).
3. Kindheit in El Salvador
3.1 Ratifikation der KRK in El Salvador
Im Jahre 1990 hat El Salvador die KRK ratifiziert(vgl. Save the children, 2001, S.11). Zu diesem Zeitpunkt herrschte in El Salvador ein Bürgerkrieg. Dieser hatte im Jahr 1980 begonnen und hielt zwölf Jahre an(vgl. Wikipedia, 2005). Im Jahr 2001 ratifizierte El Salvador das Zusatzprotokoll betreffend der Verwicklung von Kindern und Jugendlichen in bewaffneten Konflikten(vgl. Fespad ediciones, 2002, S.109). Drei Jahre später hat El Salvador zudem das Zusatzprotokoll, betreffend den Kinderhandel ratifiziert(vgl. Comité sobre los derechos del niño, 2004, S.2).
3.2 Kindheit in El Salvador
Der Artikel 1 der KRK besagt, dass jede Person unter 18 Jahren als Kind angesehen wird, wenn nicht nationale Gesetze das Erwachsenenalter früher festlegen. Die Salvadorianische Verfassung, hält im Familiengesetzbuch im Artikel 345 fest, dass alle Personen die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, als Minderjährig gelten(vgl. Fespad ediciones, 2002, S.6).
„Kindheit bezeichnet [jedoch] nicht nur die Zeitspanne zwischen Geburt und Eintritt ins Erwachsenenalter“, so eine Definition von UNICEF(2004), „vielmehr geht es um die Voraussetzungen und die Verhältnisse, unter denen Kinder geboren werden und bis zum 18. Lebensjahr aufwachsen. Kindheit ist ein qualitativer Begriff“ (UNICEF, 2004, S.11)
Ein Kind, das sexuell ausgebeutet wird, ein Kind, das auf den Müllkippen den Müll durchwühlt, Kinder, die in tiefster Armut leben, ohne ausreichende Ernährung, ohne Zugang zu Bildung, sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und einer angemessenen Unterbringung, werden ihrer Kindheit beraubt(vgl. UNICEF, 2004, S.11). Armut raubt Kindern ihre Würde, bedroht ihr Leben und schränkt ihre Fähigkeiten ein. Gewalt und Kriminalität zerstören ihre Familien, verletzen ihr Vertrauen und verraten ihre Hoffnungen(vgl. ebd., S.7). Kindheit ist für diese jungen Menschen nichts weiter als ein leeres Wort und ein gebrochenes Versprechen. Zwischen der Wirklichkeit und dem Konzept einer Kindheit, demzufolge Kinder sich frei entfalten, zur Schule gehen und in einer schützenden Umgebung aufwachsen können, liegen in El Salvador Welten(vgl. ebd., S.11).
3.3 Armut in El Salvador
„Armut hat viele Gesichter. Sie entzieht Kindern die Grundlagen zum Überleben und zur Entwicklung. Sie zementiert und verschärft soziale, wirtschaftliche und geschlechtsspezifische Benachteiligung. Arme Familien sind kaum in der Lage, Kinder gegen Missbrauch, Ausbeutung, Gewalt, Diskriminierung und Stigmatisierung zu schützen (…). Eine Kindheit in Armut ist der Beginn eines Teufelskreises: Arme Kinder wachsen oft zu armen Erwachsenen heran, die ihre eigenen Kinder wiederum in Armut aufziehen (…)“ (UNICEF, 2004, S.27).
In El Salvador, einem Land, dass gerade einmal so groß ist wie das Bundesland Hessen in Deutschland(vgl. Wikipedia, 2005), verfügen 80 Prozent der Familien, laut Untersuchungen des Entwicklungsprogramms der UN und des Welternährungsprogramms, nicht über das Grundeinkommen von 571,43 US Dollar monatlich. Jede vierte Person verdient weniger als einen Dollar pro Tag und lebt damit in extremer Armut. Die Armut veranlasst täglich etwa 200-300 Personen, El Salvador zu verlassen und allein oder mit Hilfe von Schleusern in die USA auszuwandern. Insbesondere Kinder und Frauen werden dabei oft Opfer von Menschenhandel, Prostitution und Missbrauch(vgl. Amnesty International, 2002).
Im Jahre 2001 wurde in El Salvador der US Dollar als Zahlungsmittel eingeführt. Zudem wurden vermehrt Dienstleistungen wie z. B. Telefon- und Stromversorgung privatisiert. Dies führte zu einer deutlichen Verteuerung des Lebensunterhaltes, ohne dass die Höhe der Löhne angepasst worden wäre. Der Mindestlohn in Höhe von 158 US Dollar monatlich reicht nicht aus, um eine Familie zu ernähren(vgl. ebd.).
3.4 Kriminalität und Gewalt in El Salvador
El Salvador ist eines der gefährlichsten Länder Lateinamerikas. Täglich werden in diesem Land sechs bis sieben Morde begangen, 86 Prozent davon sind das Ergebnis sozialer Gewalt. Diese finden ohne Bezug zum organisierten Verbrechen statt. Nach einer Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts der Zentralamerikanischen Universität (UCA) besitzt jeder zehnte Salvadorianer, der mindestens das 13. Lebensjahr vollendet hat, eine Waffe(vgl. Amnesty International, 2002).
Frauen und Kinder werden in El Salvador immer wieder Opfer von innerfamiliärer Gewalt. Jährlich sind es 5.000 Fälle von häuslicher Gewalt, die bekannt werden. Im Jahre 2002 kostete die innerfamiliäre Gewalt 238 Frauen das Leben. Laut Amnesty International, leiden acht von zehn Kindern im Jahre 2001 unter irgendeiner Form von Misshandlung. Auch sexueller Missbrauch und Kinderhandel nehmen an Häufigkeit zu. Drogenkonsum unter Kindern und Jugendlichen ist weit verbreitet(vgl. Amnesty International, 2002).
3.5 Kinderarbeit in El Salvador
3.5.1 Gesetzlich verboten, aber weit verbreitet
Kinderarbeit vor Abschluss der Grundschulerziehung unter 14 Jahren, ist in El Salvador gesetzlich verboten. Sie wird in extremen Fällen, in welchen sie für das Überleben der Familie notwendig ist, geduldet. Allerdings darf auch dann die Arbeit nicht zu Lasten der Schulbildung gehen. Für unter 18 jährige sind Nachtarbeit und gefährliche sowie gesundheitsgefährdende Tätigkeiten verboten. Allerdings werden diese Gesetze in der Praxis von armen Familien und skrupellosen Arbeitgebern weitgehend ignoriert(vgl. IPEC Country Profile: El Salvador, 2004, S.3).
Elf Prozent (etwa 683.000) der Gesamtbevölkerung sind zwischen zehn und 14 Jahren alt. Von dieser Altersgruppe, arbeiten ungefähr 60.000 Kinder, um zum Familieneinkommen beizutragen. Diese Zahlen sind Folgen des jahrelangen Bürgerkrieges und der neoliberalen Wirtschaftspolitik des letzten Jahrzehnts. Durch diese Wirtschaftspolitik wurde die wirtschaftliche und soziale Infrastruktur des Landes teilweise zerstört und besonders in ländlichen Regionen die Armut vergrößert. Im letzten Jahrzehnt hat Kinderarbeit ständig zugenommen. Schätzungen, laut IPEC[3], gehen davon aus, dass etwa 20 Prozent des Einkommens armer Familien aus Kinderarbeit stammt(vgl. IPEC Country Profile: El Salvador, 2004, S.1).
3.5.2 Formen und Risiken der Kinderarbeit in El Salvador
Zwei Drittel der arbeitenden Kinder befinden sich auf dem Land, wo 60 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Kinderarbeit gefährdet nicht nur die Gesundheit dieser Kinder, sondern auch deren Bildung. Sie können in der Regel die Grundschule nicht erfolgreich abschließen und haben somit kaum eine Chance, aus dem Teufelskreis der Armut auszubrechen. Daran ändert auch die Landflucht in die Stadt nichts, wo aufgrund der Arbeitslosigkeit allenfalls der informelle Sektor bleibt(vgl. IPEC Country Profile: El Salvador, 2004, S.1).
Bereits Mädchen ab dem neunten Lebensjahr arbeiten in häuslichen Diensten, oftmals bis zu 12 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche und erhalten dafür ein Lohn zwischen 40 und 100 Dollar monatlich. In einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (OIT) von 2002 gaben 60 Prozent der befragten Mädchen an, Opfer physischer und psychischer Misshandlungen durch ihre Arbeitgeber, geworden zu sein(vgl. El Salvador Solidaritätskomitee, 2005 – Misshandlung und sexuelle Übergriffe).
Viele Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren werden Opfer von Kinderprostitution. Zentrum der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen ist die Hauptstadt San Salvador. Viele der jungen Prostituierten wurden im Milieu drogenabhängig(vgl. ebd., S.5). Nach Angaben des Arbeitsministeriums in El Salvador wurden im Kampf gegen die Kinderprostitution jedoch wichtige Erfolge erzielt. Durch Fortbildungsprogramme und gezielte Überwachung, werden Kinder und ihre Eltern über ihre Rechte aufgeklärt, wobei Polizei, Finanzamt und andere Stellen eng zusammenarbeiten(vgl. El Salvador Solidaritätskomitee, 2005 – Kinderarbeit in El Salvador).
Viele Kinder arbeiten in der Fischerei, hauptsächlich in Kleinst- und Familienbetrieben. Sie sind hohen, oftmals sogar lebensbedrohenden Risiken ausgesetzt. Sie können ertrinken, sich mit Messern oder Sprengstoff verletzen und auch intensive Sonnenbestrahlung und Pilzinfektionen gefährden diese Kinder. Unter ihnen ist der Missbrauch von Amphetaminen oder Tabak (als Schutz gegen die Moskitos) weit verbreitet. Als besonders gefährlich wird die Shrimpsfischerei eingestuft. Der von den Gezeiten bestimmte Arbeitsrhythmus erfordert Nachtarbeit und unregelmäßige Arbeitsstunden, sodass die meisten dieser Kinder früher oder später die Schule aufgeben (müssen)(vgl. IPEC Country Profile: El Salvador, 2004, S.5f.).
IPEC schätzt, dass etwa 2000 Kinder in der extrem gefährlichen Produktion von Feuerwerkskörpern tätig sind. Sie mischen und verpacken Sprengstoff und andere Chemikalien und befestigen die Zündschnüre. Die Risiken sind schwere Verletzungen, Verbrennungen, Verätzungen und immer wieder werden Kinder bei Explosionen getötet(vgl. ebd., S.6).
Auf den Müllkippen El Salvadors, finden sich Kinder beim Sammeln von wieder verwertbarem Müll, wie Glas, Plastikflaschen und Dosen. Die Risiken von Schnittverletzungen, Infektionen aufgrund unhygienischer Bedingungen und tödliche Unfälle mit Baggern und Müllautos sind hoch(vgl. ebd., S.6).
Die Mehrheit der Kinderarbeiter befindet sich auf den Kaffee- und Zuckerrohrplantagen. Die Kinder in der Zuckerrohrindustrie schneiden und schaben das Zuckerrohr. Dabei können sie sich mit den Werkzeugen und dem scharfkantigem Zuckerrohr schwere Schnittwunden und andere Verletzungen zuziehen. Das Tragen schwerer Lasten schädigt die Wirbelsäule. Der Kontakt mit den zahlreichen Chemikalien (Dünger, Insektizide, Fungizide) kann Atemprobleme und Lungenkrankheiten auslösen. Während der langen Arbeitsstunden sind die Kinder hoher Luftfeuchtigkeit sowie den Moskitos und Schlangenbissen ausgesetzt. Die Zuckerrohrernte beginnt im November und dauert fünf Monate. Die ersten drei Monate fallen mit den Ferien zusammen, die beiden letzten Monate überlappen mit dem beginnenden Schuljahr, sodass die Kinder oft den Beginn des Schuljahres versäumen und dann die Schule verlassen (vgl. IPEC Country Profile: El Salvador, 2004, S.6).
3.6 Bildung in El Salvador
3.6.1 Alphabetisierung
„Analphabetismus ist eine Ursache für Armut - nur wer lesen und schreiben kann, hat die Möglichkeit, der Armutsfalle zu entkommen“ (El Salvador Solidaritätskomitee, 2005 - Bildung für alle) , so das Solidaritätskomitee El Salvador.
Vor allem auf dem Land ist in El Salvador die Analphabetenrate noch immer sehr hoch. In den letzten Jahren hat sich hier jedoch einiges zum Positiven verändert(vgl. ebd.). Betrug die Analphabetenrate im nationalen Durchschnitt der über 15 jährigen im Jahr 1993 noch 26,3 Prozent, so konnte diese bis 2002 auf 18,3 Prozent verringert werden. Große Unterschiede gibt es allerdings zwischen städtischen und ländlichen Gebieten: Im Jahr 2002 konnten 30,3 Prozent der ländlichen Bevölkerung weder schreiben noch lesen, in der städtischen Bevölkerung jedoch nur 11,1 Prozent(vgl. CIPED, 2003, S.14).
Viele Kinder können, vor allem in der Erntezeit, nicht regelmäßig am Unterricht teilnehmen. Schulen sind in dieser Zeit oft nur zur Hälfte besucht. Ein anderes Problem ist die Erreichbarkeit: Kinder müssen oft bis zu 30 Minuten zur nächstgelegen Schule gehen und in der Regenzeit mit regelmäßigen Überschwemmungen sind viele Straßen unpassierbar. Naturgewalten ist man in solchen Regionen, vor allem im gebirgigen Norden des Landes, noch immer (fast) hilflos ausgeliefert (vgl. ebd.).
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen(PNUD) zeigt die niedrige Teilnahme in der Schule im Schulpflichtsalter. 75 Prozent der Kinder, die vier Jahre alt sind, nehmen nicht am Vorschulunterricht teil. 50 Prozent der Kinder im Alter von fünf Jahren und 30 Prozent der sechs jährigen sind nicht eingeschrieben. Bei acht bis zwölf jährigen ist die Zahl geringer. Es sind zehn Prozent, die keine Schule besuchen. Ab diesem Alter steigt die Abwesenheit in der Schule jedoch wieder. Am deutlichsten zeigt sich diese Problematik ab dem Alter von 15 Jahren. In dieser Altersklasse sind es 30 Prozent, die keiner Schulbildung nachgehen(vgl. PNUD, 2003, S.85)
Der Artikel 28 der KRK besagt, dass jedes Kind das Recht auf Bildung hat. Es ist dabei die Aufgabe des Staates, den kostenlosen Besuch der Grundschule zur Pflicht zu machen, verschiedene Formen der weiterbildenden Schulen zu entwickeln und Kindern entsprechend ihren Fähigkeiten den Besuch von Hochschulen zu ermöglichen(vgl. KRK, Artikel 28, siehe Anhang: Anlage 1). Die oben aufgeführten Daten zeigen, dass dieses Recht noch immer nicht geachtet wird.
3.6.2 Bildung von Mädchen
Nach Angaben des statistischen Amtes der Regierung El Salvadors (DIGESTYC) waren, im Jahre 2003 auf dem Land 28,9% der Frauen Analphabeten, aber nur 22,7% der Männer. Hieraus geht hervor, dass eine geschlechtsspezifische Ungleichheit in Bezug auf Zugang und Nutzung des Erziehungssystems besteht. Der Frauenanalphabetismus hängt nicht nur mit dem Zugang zum Bildungssystem zusammen, sondern auch mit den Bedingungen, die sie in den Schulen und Bildungseinrichtungen vorfinden. Auch die familiäre Situation entscheidet mit über die Dauer und den Abschluss von formaler Erziehung. Bereits beim Fernbleiben von der Schule in der Altersgruppe der sechs bis 18 jährigen, zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede(vgl. El Salvador Solidaritätskomitee, 2005 - Mehr Bildung für die Mädchen und Frauen). Während Jungen und männliche Jugendliche die Schule nicht besuchen, weil sie aufgrund der wirtschaftlichen Situation arbeiten müssen, werden Mädchen aus wirtschaftlichen Gründen sowie aufgrund der Mithilfe bei der Hausarbeit vom Schulbesuch abgehalten(vgl. ebd.).
3.7 Straßenkinder in El Salvador
Kinder, die den Kontakt mit ihrer Familie abgebrochen haben und auf der Straße leben, stellen ein wachsendes soziales Problem in El Salvador dar. Existierte dieses Phänomen bis vor wenigen Jahren nur in der Hauptstadt San Salvador, so ist es heute auch in mehreren Provinzhauptstädten anzutreffen. Laut der „ Fundación Olof Palme“[4] leben im allein im Stadtzentrum von San Salvador ca. 500 Kinder zwischen fünf und 18 Jahren auf Straßen, Plätzen, in Parks und auf Märkten (vgl. CIR, 2002).
Diese Kinder sind gesellschaftlich marginalisiert und erheblichen Risiken bezüglich ihrer körperlichen und psychischen Integrität ausgesetzt. Eine zentrale Rolle spielen hierbei der Konsum von Drogen, insbesondere Klebstoff und Crack, von denen die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen abhängig ist. Psychologisch sind die Kinder und Jugendlichen durch geringes Selbstbewusstsein, Aggressionen, defizitäre soziale Beziehungen und problematisches Sexualverhalten gekennzeichnet. Sie erhalten keine Schulausbildung und besitzen keine eigene Lebensperspektive jenseits von Straße und Kriminalität (vgl. ebd.).
[...]
[1] Kommunen, Gemeinden, in denen in der Regel arme Familien leben, im Gegensatz zu den colonias, in denen in der Regel reiche Familien leben.
[2] Verein Neuer Tagesanbruch von El Salvador
[3] International Program on the Elimination of Child Labour (Internationales Programm für die Abschaffung von Kinderarbeit)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Der Text behandelt Kinderrechte in El Salvador, insbesondere die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) und die Rolle der Sozialen Arbeit, am Beispiel der NRO ANAES.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis aufgeführt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Hauptpunkte: Einleitung, Kinderrechte (historische Entwicklung, UN-KRK, Rolle der NROen, Kritik), Kindheit in El Salvador (Ratifikation der KRK, Armut, Kriminalität, Kinderarbeit, Bildung, Straßenkinder, Jugendbanden), Experteninterviews (Forschungsdesign, Auswertung zur Umsetzung von Kinderrechten), Soziale Arbeit im Einsatz für Kinderrechte (am Beispiel ANAES), Ausblick.
Welche Aspekte der Kinderrechte werden behandelt?
Der Text behandelt die historische Entwicklung der Kinderrechte, die UN-Kinderrechtskonvention (Aufbau, Zusatzprotokolle, Verpflichtungen der Vertragsstaaten), den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, die Rolle der NROen, sowie Kritik an der KRK.
Wie wird die Situation der Kinder in El Salvador beschrieben?
Die Kindheit in El Salvador wird im Kontext von Armut, Kriminalität, Gewalt, Kinderarbeit, Bildung (Alphabetisierung, Bildung von Mädchen), Straßenkindern und Jugendbanden beschrieben.
Was wird über die Experteninterviews berichtet?
Der Text erläutert das Forschungsdesign der Experteninterviews (Ausgangspunkt, Erhebungsmethode, Auswertungsmodus) und stellt die Interviewpartner sowie ihre Einrichtungen vor. Die Auswertung konzentriert sich auf die Umsetzung von Kinderrechten auf nationaler und familiärer Ebene, Ursachen für die Missachtung, Armut, Naturkatastrophen und Bildungsarbeit.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in El Salvador, insbesondere ANAES?
Die Soziale Arbeit wird am Beispiel der NRO ANAES beleuchtet, mit Schwerpunkt auf Zielgruppe, Gesundheitsprojekten (Klinik, Gemeinden, Ernährung, Elternberatung), Elternschulungen und deren Wirkung. Es werden Ergebnisse von ärztlichen Untersuchungen in den CDIs und Elternbefragungen präsentiert.
Was sind die Hauptprobleme bezüglich Kinderarbeit in El Salvador?
Kinderarbeit ist gesetzlich verboten, aber weit verbreitet. Formen und Risiken umfassen Arbeit in der Landwirtschaft, im Haushalt, in der Fischerei, in der Feuerwerkskörperproduktion und auf Müllkippen. Es wird auf Ausbeutung, Gesundheitsgefahren und fehlende Bildung hingewiesen.
Wie ist die Bildungssituation von Kindern in El Salvador?
Der Text thematisiert Alphabetisierung, Teilnahme am Schulunterricht, Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, und die Bildung von Mädchen. Es wird auf Hindernisse wie Armut, Erntezeiten und Naturkatastrophen eingegangen.
Was sind die Hauptursachen für Armut in El Salvador?
Die Armut ist u.a. auf die Einführung des US-Dollars, Privatisierungen und fehlende Anpassung der Löhne zurückzuführen. Die meisten Familien verfügen nicht über das Grundeinkommen, viele leben in extremer Armut.
Welche Risiken sind mit Straßenkindern in El Salvador verbunden?
Straßenkinder sind gesellschaftlich marginalisiert und erheblichen Risiken bezüglich ihrer körperlichen und psychischen Integrität ausgesetzt, einschließlich Drogenkonsum, geringem Selbstbewusstsein, Aggressionen und Kriminalität.
- Quote paper
- Mirian Menendez (Author), 2005, Kinderrechte in El Salvador, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110543