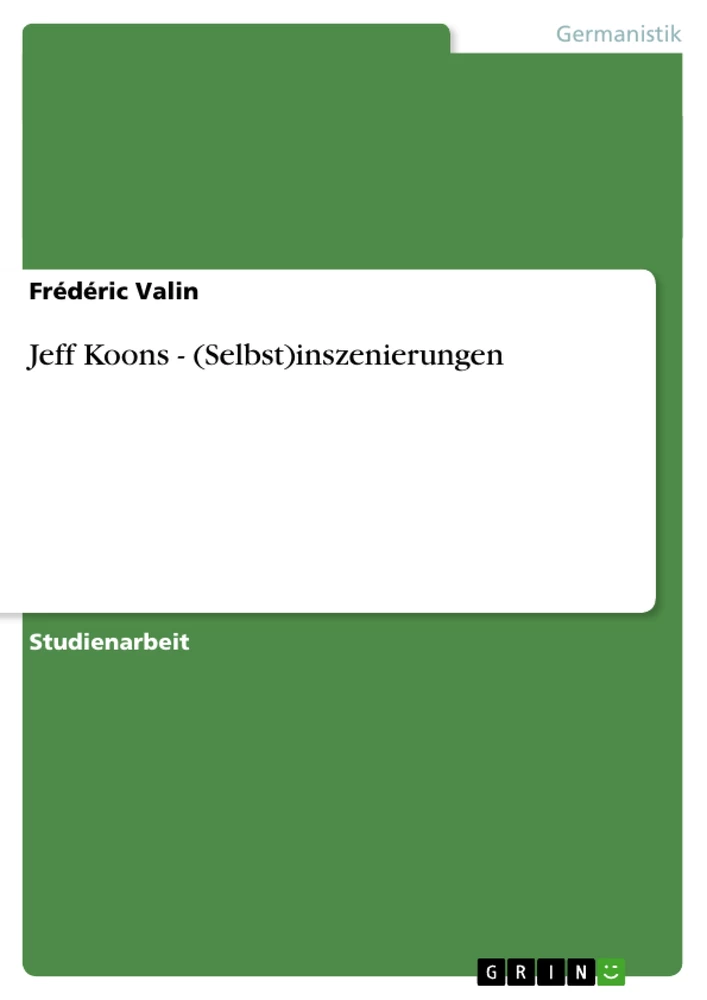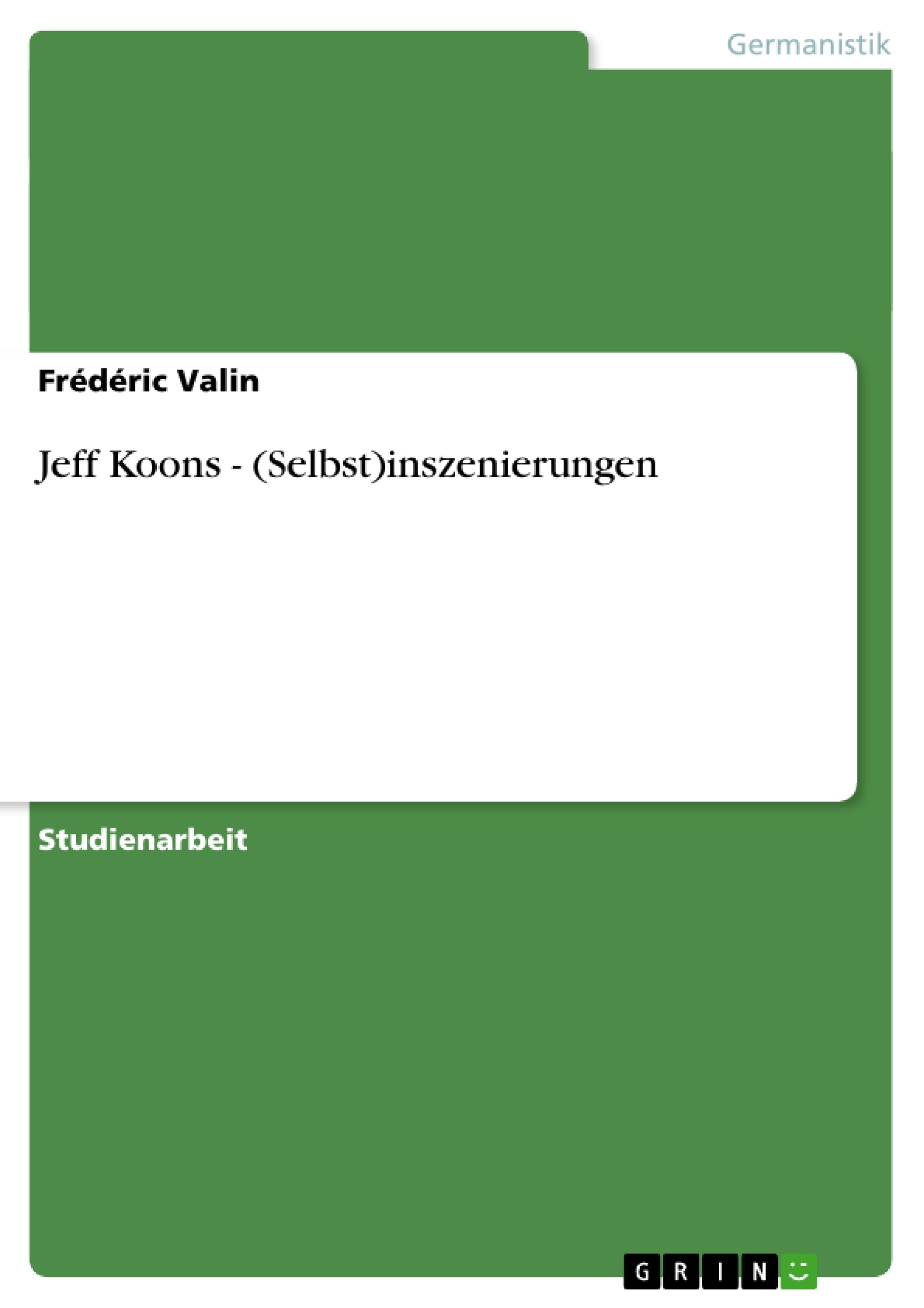Man kann bei Koons drei Arten der Vermarktung feststellen, die er sukzessive durchläuft: Erstens arbeitet er mit Werbematerial, zweitens wirbt er im außermusealen Raum für sich selbst als Künstler, drittens macht er die Eigenwerbung zum Inhalt seiner Kunst. Diese drei Ebenen verlaufen diachron, und tragen bei Koons den Namen Equilibrium bzw. Degradation, in der zweiten Form Banality, und – als endgültigen Höhepunkt – Made in Heaven.
Koons machte zunächst auf sich aufmerksam, als er ab 1981 fabrikneue Hoover-Staubsauger hinter Glasvitrinen präsentierte (1980-1985). Er präsentiert (sehr teure) Staubsauger als Readymades und schneidet damit topoi an, die ihn auch später immer wieder beschäftigen werden: Reinheit/Sauberkeit, Phallus- und Vulvasymbolik.
Später, im Rahmen der Serie Luxury and Degradation (1986), stellte er Werbeplakate für Alkoholika aus. Parallel zur Banality-Serie entstanden die Art Magazine Ads (1988/89), die nicht für die Ausstellung warben, sondern ganz explizit für den Künstler Koons. Sein Ziel ist nicht die Auseinandersetzung des Publikums mit der Kunst, sondern eine Selbstbezeichnung des Künstlers, die, indem sie Bewertungen vorweg nimmt, möglicher, vermuteter und erwarteter Kritik die Grundlage zu entziehen sucht. Es ist – zumindest nach seinen Aussagen in den Interviews – der Versuch, das Publikum zu entmündigen.
Inwieweit die These haltbar ist, dass Koons mit seinen Werken statt dem Kunstbetrachter den Typus des Konsumenten im Auge hat, und ihn nicht nur in seinen Interview-Äußerungen fordert, sondern auch in seiner Kunst, kann hier leider nicht untersucht werden. Einige gedankliche Ansätze werden nochmals in „Koons Kommunikationsbegriff“ auftauchen.
Selbstinszenierung in den Werken:
Kunst als Werbung
Man kann bei Koons drei Arten der Vermarktung feststellen, die er sukzessive durchläuft: Erstens arbeitet er mit Werbematerial, zweitens wirbt er im außermusealen Raum für sich selbst als Künstler, drittens macht er die Eigenwerbung zum Inhalt seiner Kunst. Diese drei Ebenen verlaufen diachron, und tragen bei Koons den Namen Equilibrium bzw. Degradation, in der zweiten Form Banality, und – als endgültigen Höhepunkt – Made in Heaven.
Koons machte zunächst auf sich aufmerksam, als er ab 1981 fabrikneue Hoover-Staubsauger hinter Glasvitrinen präsentierte (1980-1985). Er präsentiert (sehr teure) Staubsauger als Readymades und schneidet damit topoi an, die ihn auch später immer wieder beschäftigen werden: Reinheit/Sauberkeit, Phallus- und Vulvasymbolik.
Später, im Rahmen der Serie Luxury and Degradation (1986), stellte er Werbeplakate für Alkoholika aus. Parallel zur Banality-Serie entstanden die Art Magazine Ads (1988/89), die nicht für die Ausstellung warben, sondern ganz explizit für den Künstler Koons. Sein Ziel ist nicht die Auseinandersetzung des Publikums mit der Kunst, sondern eine Selbstbezeichnung des Künstlers, die, indem sie Bewertungen vorweg nimmt, möglicher, vermuteter und erwarteter Kritik die Grundlage zu entziehen sucht. Es ist – zumindest nach seinen Aussagen in den Interviews – der Versuch, das Publikum zu entmündigen. Inwieweit die These haltbar ist, dass Koons mit seinen Werken statt dem Kunstbetrachter den Typus des Konsumenten im Auge hat, und ihn nicht nur in seinen Interview-Äußerungen fordert, sondern auch in seiner Kunst, kann hier leider nicht untersucht werden. Einige gedankliche Ansätze werden nochmals in „Koons Kommunikationsbegriff“ auftauchen.
Als Höhepunkt der Vermengung von Kunst und Werbung konzipierte Koons die Made in Heaven-Ausstellung (1989-92) als Werbefeldzug innerhalb des Museum für ein Mainstreamprodukt (also den noch nicht veröffentlichten Film). Koons nimmt dabei die Rolle des Marketingexperten, des männlichen Hauptdarstellers und des Regisseurs ein. Die Besetzung der weiblichen Hauptrolle mit einem Pornstar (Ilona Staller alias Cicciolina) kann als bewusst gewählte Provokation des Kulturbetriebes gewertet werden. Die nachfolgende „private“ Liaison zwischen Staller und Koons wirkt wie eine Fortführung der Inszenierung hors de l’oeuvre, die das Skandalpotential dieser – von Koons drastisch überhöht inszenierten – Liebe fortführt. Dass sich das Privatleben Koons als integraler Bestandteil seiner Kunst lesen lässt, dass Koons durchaus als Nonstop-Performance-Künstler interpretierbar ist, dass Koons sein Privatleben nicht nur als Inspirationspunkt nimmt, sondern mithin Kunst und Privates zu einer Einheit verwebt (wären Wortwitze gestattet, könnte man jetzt von einer neuen Form der Kunst sprechen, nämlich von Koonst), wird auch durch die Tatsache gestützt, dass Koons seinen Sohn als „biologische Skulptur“ bezeichnet und ihm dem Namen Kitsch geben wollte.
Die beiden Serien, die 1989/1990 und 1991 entstanden, wurden unter anderem auf der Biennale in Venedig 1990 gezeigt.[1] Der Film wurde nie produziert, und wenn man Koons späteren Äußerungen Glauben schenken darf, war eine Produktion auch nicht geplant. Es blieb bei der impliziten Drohung, den Kunstbetrieb mit der Unterhaltungsindustrie und der Pornografie zu vermengen und die Diskurse in Unordnung zu bringen.
Kunst als Pornografie
Schon in den Werken vor Made in Heaven spielt Sexualität eine beherrschende Rolle, wie Koons zu betonen nicht müde wird. Aber erst mit Made in Heaven bedient er sich explizit bei der pornografischen Bildsprache, gibt den Werken aber einen religiösen Bezugsrahmen. Sich selbst inszeniert Koons dabei als Neuen Adam, als den neuen Menschen schlechthin, der durch den Verlust der Scham – Gott wird. Staller übrigens wird immer Accessoires dargestellt, leicht bekleidet, aber immerhin. Koons/Adam repräsentiert also den Zustand vor dem Sündenfall, Staller/Eva den danach.
Interessanterweise hat sich kaum jemand über den Umstand, dass Koons Pornografie religiös auflädt, mehr als beschreibend geäußert (zumindest bin ich während meiner Recherchen auf keine derartigen Äußerungen gestoßen). Inzwischen handelt es sich bei dieser unholy relation um ein vor allem im Pop und in der Werbung gern eingesetztes Stilmittel. Koons allerdings nutzt hier den religiösen Background, um den etwas profanen Eindruck der reinen Kopulation mit dem häufig und gerne bemühtem Ideal der Reinheit in Einklang zu bringen.
Selbstporträts, reihenweise
Mein Leben und meine Kunst sind absolut eins. Mir steht alles zur Verfügung, und ich mache, was ich machen will. Ich habe meine Plattform. Ich habe die Aufmerksamkeit, und man kann meine Stimme hören. Das ist die Zeit für Jeff Koons.[2]
Koons versucht also den Unterschied zwischen Kunst und Wirklichkeit zu nivellieren: Aus der Person Koons und dem Künstler Koons, der die Person thematisiert, wird, wie er selbst sagt, ein Parameter, oder eben eine Marke.
Konsequenterweise nähert er sich dem Ideal von zwei Seiten an: Einerseits thematisiert er seine Liebe zu und seine Hochzeit mit Ilona Staller in den verschiedenen Made in Heaven-Serien, andererseits versteht er sein Leben als Kunstwerk.
Selbstinszenierung in den Interviews:
Selbstdarstellungen
Koons selbst beschreibt seinen Weg als vorgezeichnet: Als Linkshänder geboren (was in seiner Familie für künstlerische Begabung stand), habe er bereits mit sieben Jahren im Möbelgeschäft seines Vaters Bilder ausgestellt, die auch verkauft wurden. Nach seinem Umzug nach New York 1976 arbeitete er zunächst im MoMA, und habe gleichzeitig für den Förderkreis geworben, der sich dann auch entsprechend verdoppelte. Anschließend arbeitete Koons als Brooker und verbesserte seinen Angaben nach seine Kenntnisse über Leinwände und Baumwolle (sic!). Anfang der 80er konzentrierte er sich vollständig auf seine Kunstkarriere.
Ich bin alles andere als egoman. Meine Grenzen sind mir sehr bewusst. Dennoch muss ich in aller Bescheidenheit sagen: Ich finde, ich bin der stärkste Künstler meiner Generation.[3]
Ich mache einiges der größten Kunst, die zur Zeit entsteht. Die Kunstwelt wird zehn Jahre brauchen, um dahin zu kommen. In diesem Jahrhundert hat es Picasso und Duchamp gegeben. Nun führe ich uns aus dem zwanzigsten Jahrhundert heraus.[4]
Koons Kommunikationsbegriff
Verkäufer sind die großen Kommunikatoren unserer Zeit. Sie stehen im Leben und bringen Autos, Immobilien und Werbung an den Mann.
Ich bin absolut anpassungsfähig. Um zu kommunizieren, passe ich mich jeder Situation an.
Pornographie ist Entfremdung. Mein Werk besitzt absolut kein Vokabular der Entfremdung. Es benutzt Sexualität als Instrument der Kommunikation.[5]
Im Grunde meint Koons mit Kommunikation: ihm zuhören. Sein Kommunikationsmodell kennt nur eine Richtung der Äußerung, und sein Empfänger soll nach seinem Willen nicht zum Sender werden.
Bibliographie:
Anthony d’Offay Gallery London (Herausgeber): Das Jeff Koons Handbuch. München Paris London 1992.
Deutsche Guggenheim Berlin (Herausgeber): Jeff Koons. Easyfun-Ethereal. Katalog zur Ausstellung. New York 2000.
Laura Cottingham: Der maskuline Imperativ. Hochmodern, Postmodern. Siehe http://www.haussite.net/haus.0/SCRIPT/txt1999/09/laura.html (21.01.2007)
Thomas Zaunschirm: Kunst als Sündenfall. Die Tabuverletzungen des Jeff Koons.
Freiburg, 1996.
[...]
[1] Unvollständige Galerien zu den einzelnen Serien finden sich unter http://www.xs4all.nl/~exadega/koons/.
[2] Zit. nach Handbuch, S. 120.
[3] („Umarmt eure Vergangenheit.“ Werkstattgespräch. In: Süddeutsche Zeitung Magazin Nr. 46, 13.11.1992, S. 34. Zitiert nach: Kunst als Sündenfall.)
[4] Handbuch, S. 82.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text über Jeff Koons' Selbstinszenierung?
Der Text analysiert Jeff Koons' Selbstinszenierung in seinen Werken und Interviews, wobei er verschiedene Aspekte wie Kunst als Werbung, Kunst als Pornografie und Koons' Selbstdarstellungen untersucht.
Welche drei Arten der Vermarktung werden bei Koons festgestellt?
Der Text nennt drei Arten der Vermarktung: Erstens die Arbeit mit Werbematerial, zweitens die Werbung im außermusealen Raum für sich selbst als Künstler und drittens die Eigenwerbung als Inhalt seiner Kunst.
Was präsentierte Koons in seiner Serie Equilibrium bzw. Degradation?
Koons präsentierte in dieser Serie fabrikneue Hoover-Staubsauger hinter Glasvitrinen.
Was zeigte Koons im Rahmen der Serie Luxury and Degradation?
Im Rahmen dieser Serie stellte Koons Werbeplakate für Alkoholika aus.
Was sind die Art Magazine Ads und welchen Zweck haben sie?
Die Art Magazine Ads (1988/89) waren Anzeigen, die explizit für den Künstler Koons warben. Ihr Ziel war nicht die Auseinandersetzung des Publikums mit der Kunst, sondern eine Selbstbezeichnung des Künstlers.
Wie konzipierte Koons die Made in Heaven-Ausstellung?
Koons konzipierte die Made in Heaven-Ausstellung (1989-92) als Werbefeldzug innerhalb des Museums für ein Mainstreamprodukt (einen Film, der jedoch nie veröffentlicht wurde).
Welche Rolle nahm Koons bei der Made in Heaven-Ausstellung ein?
Koons nahm die Rolle des Marketingexperten, des männlichen Hauptdarstellers und des Regisseurs ein.
Wer war Ilona Staller und welche Rolle spielte sie bei Made in Heaven?
Ilona Staller, auch bekannt als Cicciolina, war ein Pornostar, der die weibliche Hauptrolle in Koons' Made in Heaven-Ausstellung spielte.
Welchen Bezugsrahmen gibt Koons seinen Werken in Made in Heaven?
Koons bedient sich explizit der pornografischen Bildsprache, gibt den Werken aber einen religiösen Bezugsrahmen.
Wie inszeniert sich Koons in Made in Heaven?
Koons inszeniert sich als Neuen Adam, als den neuen Menschen schlechthin, der durch den Verlust der Scham – Gott wird.
Was ist Koons' Kommunikationsbegriff?
Im Grunde meint Koons mit Kommunikation: ihm zuhören. Sein Kommunikationsmodell kennt nur eine Richtung der Äußerung, und sein Empfänger soll nach seinem Willen nicht zum Sender werden.
Welche Werke von Jeff Koons werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt unter anderem: Hoover Staubsauger hinter Glasvitrinen, Luxury and Degradation, Art Magazine Ads und Made in Heaven.
Welche Personen werden im Text genannt?
Der Text nennt unter anderem: Jeff Koons, Ilona Staller (Cicciolina), Picasso und Duchamp.
- Arbeit zitieren
- Frédéric Valin (Autor:in), 2007, Jeff Koons - (Selbst)inszenierungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110584