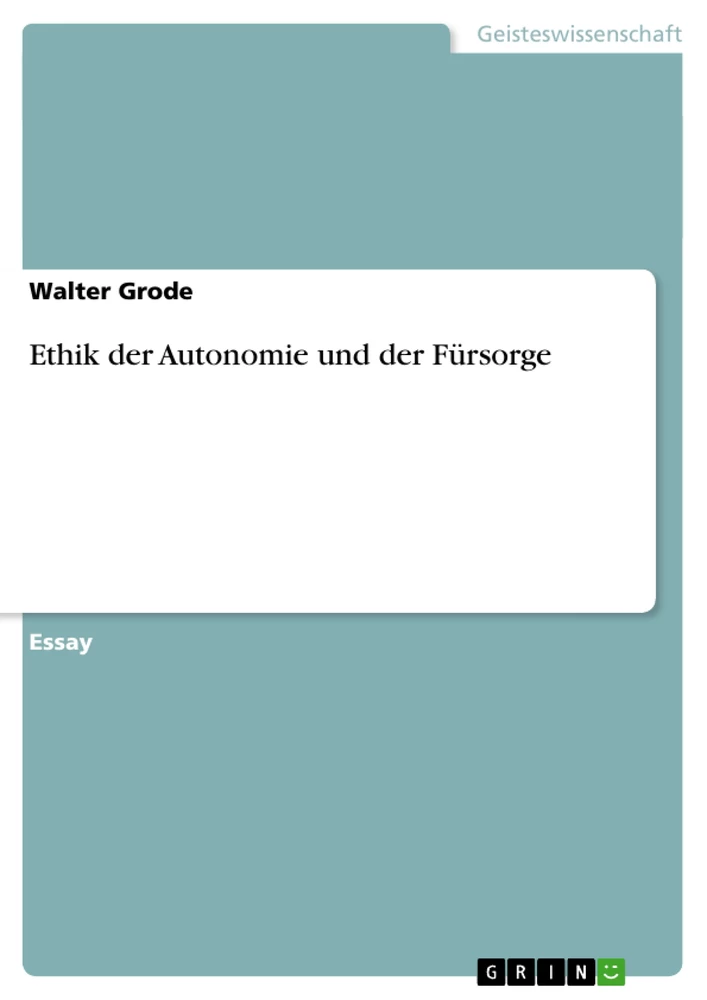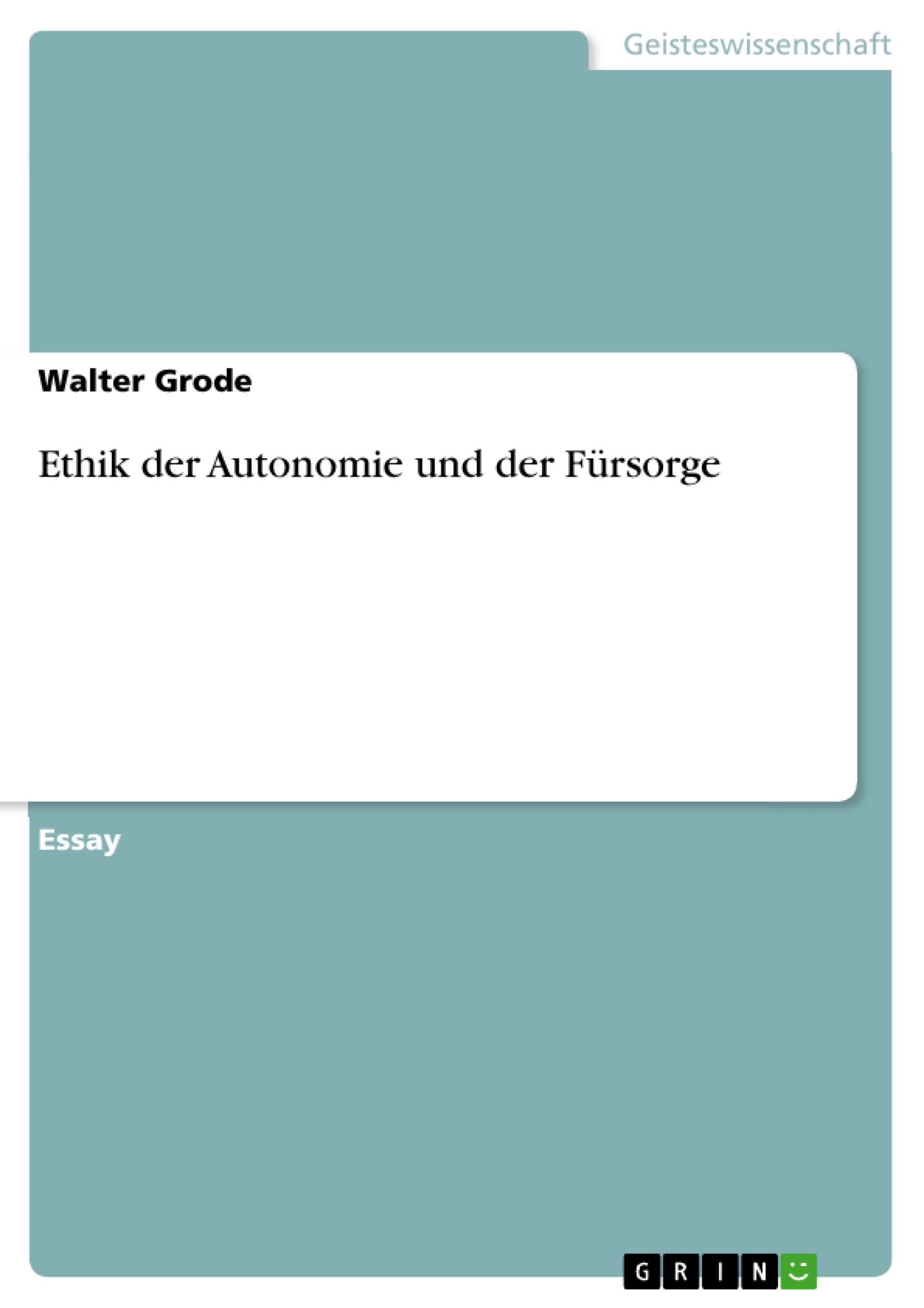Wenn an die demokratische Tugend der Toleranz appeliert wird, so klingt das oft resignativ. Die gegenseitige Duldung bietet den einzigen Ausweg in einem Konflikt, in dem eine Annäherung nicht in Sicht ist. Mehr als mißtrauische, ja mißmutige Koexistenz der Parteien scheint, selbst auf der Basis gemeinsamer christlicher Grundüberzeugungen, nicht zu erreichen zu sein, wenn es um lebenswichtige Fragen wie die Transplantationsmedizin oder die Sterbehilfe geht - vom Schwangerschaftsabbruch gar nicht zu reden. Stets ist da der, auch die eigene Erfahrung prägende Konflikt, allgemein für gültig erachtete ethische Normen mit konkreten individuellen Notwendigkeiten in Übereinstimmung zu bringen. Denn viel zu oft ähnelt (nicht nur) das Leben mit chronischer Erkrankung und Behinderung einem "permanenten Ausnahmezustand", über den man nicht selbst verfügen kann. Dieses Gefühl der "Angst um das bißchen Leben", [wie es Susanne Krähe (LM 1/97) eindrucksvoll beschreibt], scheint in fast allen existentiellen Lebenssituationen aus der Tiefe der Seele emporzukommen. Vermutlich ist dies auch das subjektive Gefühl jeder Frau, die ungewollt schwanger geworden ist.
ETHIK DER AUTONOMIE UND DER FÜRSORGE
[Das folgende Essay erschien 1997 unter dem Titel >An den Rändern des Lebens. Das eigene Sterben läßt sich nicht vollständig programmieren< im Heft 5 der Lutherischen Monats hefte (LM).]
Wenn an die demokratische Tugend der Toleranz appeliert wird, so klingt das oft resignativ. Die gegenseitige Duldung bietet den einzigen Ausweg in einem Konflikt, in dem eine Annäherung nicht in Sicht ist. Mehr als mißtrauische, ja mißmutige Koexistenz der Parteien scheint, selbst auf der Basis gemeinsamer christlicher Grundüberzeugungen, nicht zu erreichen zu sein, wenn es um lebenswichtige Fragen wie die Transplantationsmedizin oder die Sterbehilfe geht - vom Schwangerschaftsabbruch gar nicht zu reden.
Stets ist da der, auch die eigene Erfahrung prägende Konflikt, allgemein für gültig erachtete ethische Normen mit konkreten individuellen Notwendigkeiten in Übereinstimmung zu bringen. Denn viel zu oft ähnelt (nicht nur) das Leben mit chronischer Erkrankung und Behinderung einem "permanenten Ausnahmezustand", über den man nicht selbst verfügen kann. Dieses Gefühl der "Angst um das bißchen Leben", [wie es Susanne Krähe (LM 1/97) eindrucksvoll beschreibt], scheint in fast allen existentiellen Lebenssituationen aus der Tiefe der Seele emporzukommen. Vermutlich ist dies auch das subjektive Gefühl jeder Frau, die ungewollt schwanger geworden ist.
Die Heiligkeit des Lebens als liberaler Wert
Die persönliche Freiheit und die Grenzen des Lebens hat der amerikanische Rechtsphilosoph Ronald Dworkin in einer Studie über Abtreibung und Euthanasie mit ungewöhnlichem Ergebnis auszuloten versucht.
Sein Ehrgeiz besteht darin, die (amerikanischen) Gegner im Streit über Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe so weit über sich selbst aufzuklären, daß sich die Militanz ihrer Haltungen verflüchtigt. Sie sollen sehen, daß es im Grunde um einen gemeinsamen Wert geht, den sie lediglich unterschiedlich interpretieren. Die "Liberalen" setzen sich zwar für die Autonomie von Frauen ein, um über die Geburt eines Kindes zu entscheiden. Doch zugleich hat das ungeborene Leben für sie so viel Eigengewicht, daß eine leichtfertige Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch illegitim erscheint. Umgekehrt lassen viele Lebensschützer Ausnahmen des von ihnen verteidigten Abteibungsverbots zu. Wenn eine Frau nach einer Vergewaltigung schwanger wird oder wenn eine Schädigung des Fötus festgestellt wird, dann hören sie plötzlich auf, bei einem Schwangerschaftsabbruch von "Mord" zu sprechen. Dann aber, so insistiert Dworkin, wäre inkonsequent und fahrlässig, wenn dem Ungeborenen im strengen Sinne ein Lebensrecht zukäme. Wenn schon der Embryo oder Fötus, wie vom Bundesverfassungsgericht verkündet, die "Würde" einer Person besitzt, dann wäre es schlicht kriminell, dem Abtreibungsverbot nicht bedingungslos Geltung zu verschaffen.
Dworkin unterstellt deshalb, daß es den Lebensschützern nicht um ein unhintergehbares, von Interessen abgeleitetes "Recht" auf Leben geht, sondern um den hohen "intrinsischen" Wert jeden menschlichen Lebens, der keinerlei Personalität voraussetzt. Er spricht von der "Heiligkeit" und "Unantastbarkeit11, die wir auch nichtmenschlichen Wesen zusprechen: Wir halten es für ein Sakrileg, wenn Tierarten ausgerottet, aber auch, wenn Kunstwerke oder ganze Kulturen mutwillig zerstört werden.
Diese Aufwertung des Nichtmenschlichen ist für gläubige Christen sicherlich nicht so ohne weiteres akzeptabel. Sie ist aber vor allem die liberale Gegenposition zur "Praktischen Ethik" eines Peter Singer. Dessen Speziesismuskritik, die eine ethisch begründete höhere Stellung des Menschen gegenüber anderen Lebewesen konsequnt ablehnt, relativiert die Autonomie des Menschen so weit, daß der einzelne Mensch in existentiellen Grenzsituationen fast sämtlichen Zugriffen zugänglich wird.
Nicht nur in der kürzlich verabschiedeten Bioethik-Konven- tion des Europarats, sondern auch in den für 1998 von der UNESCO vorbereiteten internationalen Deklarationen zur Anwendung der neuen Biowissenschaften auf den Menschen hat dieses Denken bereits tiefe Spuren hinterlassen. Hiermit wird es kein Bewenden haben. Denn geradezu visionär hat Singer seit Beginn der 80er Jahre jene "Ethik des Sozialdarwinismus" revitalisiert, die wie keine andere Ideologie in der Lage ist, den weltweiten Siegeszug des Märkte und des Kapitals zu legitimieren.
Autonomie als Ideal
In seiner Studie über die Grenzen des Lebens läßt Dworkin keinen Zweifel daran, daß er von allen Faktoren, die bei der menschlichen Entwicklung eine Rolle spielen, die individuelle Selbstgestaltung am höchsten schätzt. Mit Bewunderung, ja mit Ehrfurcht spricht er von der Anstrengung eines jeden, sein eigenes Leben zu führen. Daraus leitet er Maßstäbe her, wie ein jeder mit sich selbst umgehen darf. Eine Person hat, wie Dworkin zeigt, "wertebezogene Interessen", die zum Ausdruck bringen, was es heißt, ein wertvolles, sinnvolles Leben zu führen. Sie unterscheiden sich von "erlebnisbezogenen Interessen", die auf das gerichtet sind, was unmittelbaren Genuß bereitet.
Dworkins eindrucksvolles Plädoyer für eine liberale Regelung der Sterbehilfe geht nun von der Feststellung aus, daß wir einen Tod sterben wollen, der unseren "wertebezogenen" Interessen gerecht wird. Es geht dabei also nicht allein um den Wunsch, daß einem unerträgliche Qualen erspart bleiben. Die Würde einer Person kann auch von einem Lebensende in Mitleidenschaft gezogen werden, von dem sie selbst gar nichts mehr mitbekommt: wenn sie über Jahre mit technischer Unterstützung im "vegetativen Zustand" gehalten und zu einer bloß biologischen Existenz verurteilt wird, die nichts mehr mit dem zu tun hat, was für sie den Sinn des Lebens ausmachte.
Umgekehrt aber, so zeigt Dworkin, gibt es Personen, deren Naturell es entsprechen mag, nicht aufzugeben und mit allen Mitteln ums Überleben zu kämpfen. Die Bedeutung des Todes beruht darauf, daß er nicht nur der Anfang von nichts ist, sondern zugleich das Ende aller Dinge, und die Art, wie wir über das Sterben denken und reden - der Wert, den wir darauf legen, daß es in "Würde" geschehen soll -, zeigt, wie wichtig es ist, daß das Leben angemessen endet, das heißt, daß der Tod mit unserer Vorstellung davon übereinstimmt, wie wir gelebt haben möchten.
Dworkins zugleich behutsame und entschiedene Argumentation macht deutlich, daß nicht nur durch eine fahrlässige oder skrupellose Lebensverkürzung, sondern ebenso durch Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Lebenserhaltung die elementarsten Interessen von Personen verletzt werden können.
Daß Behandlungsverzicht, die hohe Dosierung von Schmerz mitteln und schon gar die "aktive" Tötung die Gefahr des Mißbrauchs mit sich bringen, leugnet Dworkin nicht. Er stellt jedoch energisch in Abrede, daß man umgekehrt niemanden schädigt, wenn man diesen Gefahren durch extensiv betriebene Verlängerung des Lebens entgegenzuwirken versucht. Er zieht aus seinen Überlegungen einen - wie er selbst sagt - erschreckenden Schluß: Patienten in fortgeschrittenem Stadium der Alzheimerschen Krankheit sollten auch bei einer leicht zu heilenden zusätzlichen Erkrankung nicht behandelt werden, wenn sie genau dies verlangt haben, als sie noch bei klarem Verstand waren.
Das solle sogar dann geschehen, wenn der Patient in seinem akuten, verwirrten Zustand eher einen zufriedenen Eindruck mache. Das Recht eines Menschen, über den Gesamtverlauf seines Lebens zu bestimmen und den Behandlungsabbruch schon im voraus zu verfügen, wiegt für Dworkin schwerer als das möglicherweise vorhandene, rein gegenwartsbezogene Lebeninteresse des gleichen, doch inzwischen schwer dementen Patienten.
Dworkins Selbstbestimmungsideal verlangt, daß eine Person auch noch ihr Lebensende dem Bemühen um Charakterbildung ganz und gar einverleibt. Das individuelle Leben soll durch seinen Abschluß zu einem durchgestalteten Ganzen werden. Dies ist aber eine überzogene Konsequenz eines im Ansatz überzeugenden und legitimen Eintretens für Autonomie.
Denn natürlich entzieht sich der Prozeß des Sterbens immer mehr oder minder der eigenen Verfügung. Dies zu leugnen oder auch nur zu verschweigen muß der Selbsttäuschung Vorschub leisten und falsche Vorstellungen von der möglichen Herrschaft über kreatürliche Abläufe beflügeln.
Nur wenn man die konstitutinellen Grenzen der Autonomie mitbedenkt, kann man einen klugen Gebrauch von dieser Auto nomie machen. Selbstbestimmung im Angesicht des Todes kann nur einen relativen, keinen absoluten Sinn haben. Sie kann nicht darin bestehen, das Sterben vollständig programmieren zu wollen, sondern allein darin, daß man sich - wie auch immer - mit dem Unausweichlichen arrangiert, ohne dabei von der medizinischen Technologie oder vom ärztlichen Paternalismus bevormundet zu werden.
Ethik der Fürsorge und des Verzichts
Eine "Ethik der Autonomie" stößt insbesondere an ihre Grenzen, wenn die autonome Selbstbestimmung noch nicht oder infolge psychischer, geistiger, hirnorganischer Störungen
oder krisenhafter Situationen nicht mehr gegeben ist. Die Würde des Menschen darf deshalb nicht als empirisch fest stellbarer Sachverhalt aufgefaßt werden, sondern als eine tranzendentale, jedem Augenblick des Lebens und Sterbens zugeeignete Würde, die das Leben der absoluten Verfügung des Menschen selbst und erst recht der Verfügung anderer entzieht und die deshalb unverlierbar ist. Sonst verkommt die "Ethik der Autionomie" zur Inanspruchnahme aller Verfügungsgewalt über das Leben, zur "Ethik der Macht". An den Rändern des Lebens kommen wir nicht umhin, daß für viele, vielleicht für alle Menschen von anderen entschieden wird, dann wird die Begrenztheit einer Ethik der Autonomie ersichtlich, und eine "Ethik der Fürsorge" (Ulrich Eibach) ist im wortwörtlichen Sinne "not-wendig".
Eine Ethik der Fürsorge, und hierin trifft sie sich durchaus mit Dworkins Autonomie-Konzept, schließt eine Ethik des Seinlassens, des Verzichts und der Annahme eines schweren Schicksals ein, die nicht mit Resignation zu verwechseln ist, die aber der Tatsache Rechnung trägt, daß letztlich nicht die Macht der Medizin, sondern - in dieser Welt - der Tod siegt.
Je länger wir uns hier Selbsttäuschungen hingeben und kritiklos sämtlichen Einflüsterungen der "biomedizinischen Revolution" vertrauen, desto mehr verspielen wir die Voraussetzungen für eine "Ethik der Fürsorge" ebenso, wie für eine "Ethik der Autonomie".
Wenn es etwa auf der Basis der zunehmenden Entschlüsselung genetischer Steuerungsmechanismen gelingt, die Krebskrank heiten zu besiegen, so würde sich allein dadurch die durchschnittliche Lebenserwartung um mehr als zehn Jahre erhöhen. Zuvor aber hätte "die unsichtbare Hand des Marktes" längst über das Niveau der Sozialstandards und der Lebenserwartung, wie über die demokratischen Partizipationsmöglichkeiten entschieden. Und übriggeblieben wäre eine kleine Schweiz mitten in einer großen Wüste.
Forschungsfreiheit, Selbstbestimmung und Menschenwürde
Ohne eine zumindest partielle Einschränkung der Forschungs freiheit, auf dem Felde der Bio- und Gentechnologie, wird sich (langfristig) weder die Achtung vor der Menschenwürde, noch die individuelle Autonomie sichern lassen. Für diese Forschungen sollte zumindest solange ein Moratorium gelten, bis in öffentlicher Debatte geklärt worden ist, für welche Ziele und für wessen Selbstbestimmung sie vorangetrieben werden.
Schon heute sind die "Früchte" dieses Ackers so wider sprüchlich, daß, bis zum Beweis des Gegenteils, der Verdacht mehr als gerechtfertigt zu sein scheint, hier seien, [wie Reinhard Lassek (LM 1/97) schreibt], "Gen-Köche und In-vitro-Hebammen mit hybriden Ambvitionen" am Werke.
Aber es sind auch unsere eigenen Wünsche, die hier im Spiele sind. Denn mit und hinter der Wissenschaftsfreiheit beginnt sich ein "privater" milliardenschwerer biotechnolo-gischer Markt zu entwickeln. Der verspricht seinen finanziell solventen Kunden in Florida und anderswo, sowohl makellose Schönheit wie auch immerwährende Vitalität - letztlich die Überwindung von Altern und Tod. Wir werden uns (auch hier!) entscheiden müssen, ob wir tatsächlich alles machen wollen und haben müssen, was uns der globale Markt anbietet.
Auch in einigen Bereichen der "rein" medizinischen For schung und bei vielen Therapieversuchen geht es nicht nur um die individuelle Hilfe für Parkinson-Kranke oder Kinder mit Down-Syndrom, sondern auch um die oben skeptisch betrachtete Freiheit der Wissenschaft. Ethik-Kommissionen könnten [sofern sie im Sinne von Udo Schlaudraff (LM 11/96 + 2/97) tätig werden] dafür Sorge tragen» daß der Wissenschaftsfreiheit im Zweifel nicht ein höherer Rang eingeräumt wird, als der Entscheidungsfreiheit von Frauen (über "ihre" Embryonen), aber auch der "Freiheit" von Patienten, nicht alle nur möglichen Therapien an sich vollziehen zu lassen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Essay "Ethik der Autonomie und der Fürsorge"?
Der Essay untersucht das Spannungsverhältnis zwischen individueller Autonomie und der Notwendigkeit von Fürsorge, insbesondere in ethischen Dilemmata am Lebensende, wie Sterbehilfe und Transplantationsmedizin. Er kritisiert eine rein auf Autonomie basierende Ethik und plädiert für eine Ethik der Fürsorge, die die Grenzen der Selbstbestimmung berücksichtigt.
Was ist Ronald Dworkins Position zur Autonomie?
Dworkin schätzt die individuelle Selbstgestaltung hoch und betont das Recht einer Person, ihr Leben nach ihren "wertebezogenen Interessen" zu gestalten, einschließlich des Sterbens. Er argumentiert für eine liberale Regelung der Sterbehilfe, die es Menschen ermöglicht, einen Tod zu sterben, der ihren Werten entspricht.
Was ist die Kritik an Dworkins Autonomie-Ideal?
Der Essay kritisiert, dass Dworkins Ideal einer vollständigen Selbstbestimmung bis zum Lebensende überzogen ist, da der Sterbeprozess sich der eigenen Verfügung entzieht. Es wird argumentiert, dass Selbstbestimmung nur einen relativen Sinn haben kann und nicht darin bestehen sollte, das Sterben vollständig zu programmieren.
Was bedeutet "Ethik der Fürsorge" im Kontext des Essays?
Eine "Ethik der Fürsorge" wird als notwendig erachtet, wenn autonome Selbstbestimmung eingeschränkt ist. Sie betont die Unverlierbarkeit der Menschenwürde und schließt eine Ethik des Seinlassens, des Verzichts und der Annahme eines schweren Schicksals ein. Sie berücksichtigt, dass Entscheidungen oft von anderen getroffen werden müssen, insbesondere am Lebensende.
Welche Rolle spielt die Forschungsfreiheit in der Diskussion?
Der Essay argumentiert für eine zumindest partielle Einschränkung der Forschungsfreiheit in der Bio- und Gentechnologie, um die Achtung vor der Menschenwürde und die individuelle Autonomie zu sichern. Es wird gefordert, dass die Ziele und die Nutznießer dieser Forschung in einer öffentlichen Debatte geklärt werden.
Welche Gefahren werden in Bezug auf den globalen Markt und die Biotechnologie angesprochen?
Es wird die Gefahr gesehen, dass ein "privater" milliardenschwerer biotechnologischer Markt entsteht, der seinen solventen Kunden makellose Schönheit und ewige Vitalität verspricht. Der Essay warnt davor, kritiklos alles anzunehmen, was der globale Markt anbietet, und plädiert für eine Auseinandersetzung mit den ethischen Konsequenzen.
Was ist die Bedeutung von Ethik-Kommissionen in der medizinischen Forschung?
Ethik-Kommissionen sollten sicherstellen, dass der Wissenschaftsfreiheit nicht ein höherer Rang eingeräumt wird als der Entscheidungsfreiheit von Frauen über ihre Embryonen oder der Freiheit von Patienten, nicht alle nur möglichen Therapien an sich vollziehen zu lassen.
- Quote paper
- Dr. phil. Walter Grode (Author), 1997, Ethik der Autonomie und der Fürsorge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110592