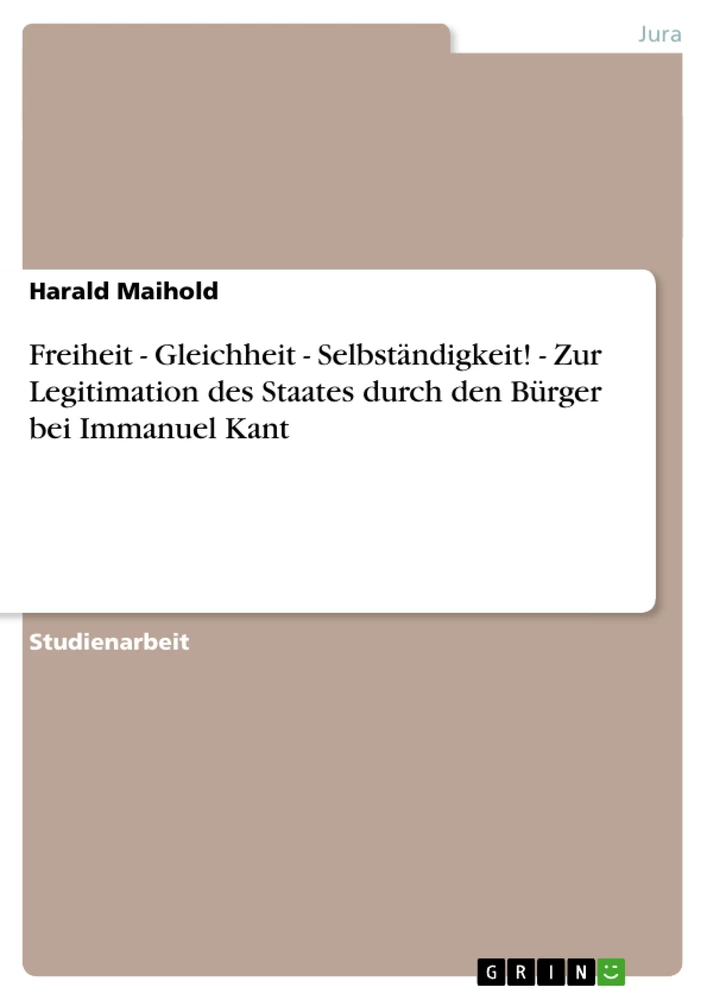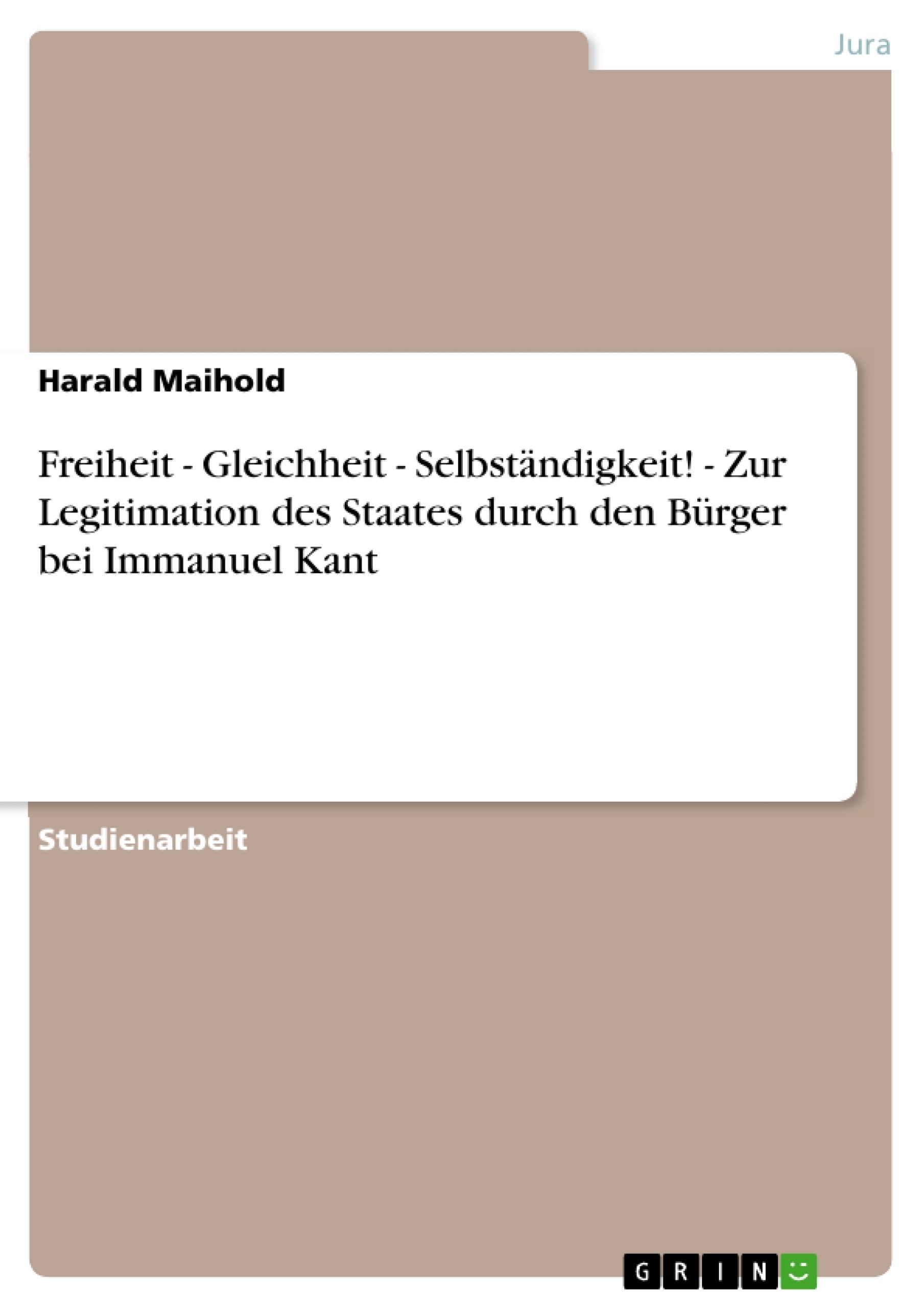Die Arbeit widmet sich der Formel "Freiheit, Gleichheit, Selbständigkeit", mit der Kant den Staatsbürger einer freiheitlichen Staatswesens kennzeichnet. Nach einleitenden Bemerkungen zur Kantischen Staats- und Rechtslehre werden im zweiten Abschnitt die Freiheit als Menschenrecht, die Gleichheit als Untertanenrecht und die Selbständigkeit als Staatsbürgerrecht als Teile der Trias einzeln untersucht und aufeinander bezogen. Im Zentrum steht dabei das umstrittene dritte Merkmal, das hier dynamisch interpretiert wird. Auf dieser Grundlage wird im dritten Abschnitt Kants Staatslehre analysiert, u.a. die Frage, welche Auswirkungen das Staatsbürgerverständnis auf die Verfassung hat, wie der Staat mit Gewissenskonflikten des Bürgers umzugehen hat und ob es ein Recht des Bürgers auf Widerstand gibt. Mit Hilfe der dynamisch verstandenen Selbständigkeit wird versucht, die Spannungen im Verhältnis von Menschenrechten und Volkssouveränität, Individuum und Allgemeinheit, Naturrecht und Rechtspositivismus aufzulösen. Der letzte Abschnitt öffnet die Rechtslehre auf die ethische Dimension und erkennt die Brüderlichkeit als viertes Konstitutionsprinzip des Staatsbürgers.
Inhalt
A. Einleitung
I. Leben und Werk
II. Kants Verhältnis zum Staat
III. Eine nicht-empirische Rechtsphilosophie
B. Der Staatsbürger
I. Freiheit
1. Freiheit als Menschenrecht
2. Gesetzliche Freiheit im idealen Staat
a) Der Rechtsbegriff der Freiheit
b) Der Mensch als Zweck des Rechts
3. Das liberale Rechtsverständnis
II. Gleichheit
1. Gleichheit als Untertanenrecht
2. Das soziale Gleichheitsverständnis
a) Autonomie durch soziale Gleichheit?
b) Das Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit
III. Selbständigkeit
1. Selbständigkeit als Staatsbürgerrecht
a) Zwei Klassen von Staatsbürgern
b) Differenzierungskriterien
2. Kritik der Selbständigkeit
a) Selbständigkeit - ein empirisches Kriterium ?
b) Die Macht der Tradition
3. Versuch einer systematischen Interpretation
a) Selbständigkeit als Mündigkeit
b) Die dynamische Komponente der Selbständigkeit
IV. Das Verhältnis der Merkmale
C. Der Staat
I. Pflicht zum Staat
1. Der Naturzustand
a) Der apriorische Naturzustand
b) Rechtloser Rechtszustand?
2. Die Begründung des Staates
a) Traditionelle Konzeptionen
b) Die apriorische Rechtspflicht zum Staat
c) Die Schaffung peremptorischen Besitzes
d) Die Bedeutung der metaphysischen Begründung
3. Ursprünglicher Vertrag und allgemeiner Wille
4. Disziplinierung der Gesellschaft
5. Die Verfassung
a) Gewaltenteilung
b) Herrschaftsform und Regierungsart
c) Republikanismus
d) Die Notwendigkeit der Repräsentation
e) Die reine Rechtsgesellschaft
f) Die Legitimierung des historischen Staates
II. Recht auf Staat
1. Der ursprüngliche Vertrag
2. Recht auf Demokratisierung
III. Die Verbindlichkeit positiven Rechts
1. Die Unerheblichkeit der Herrschaftsbegründung
2. Der Konflikt
a) Der Gewissenskonflikt
b) Der Rechtsweg
c) Der Widerstand
d) Die Freiheit der Feder
3. Zum Verhältnis von Naturrecht und Positivismus
D. Der ethische Hintergrund
I. Das Verhältnis zwischen Recht und Ethik
1. Trennung
2. Wechselseitiger Bezug
II. Brüderlichkeit
1. Brüderlichkeit als rechtliches Prinzip?
2. Brüderlichkeit als Konstitutionsbedingung des Rechts
E. Perspektiven
F. Thesen
Literatur
Aristoteles
Politik, Schriften zur Staatstheorie, übers. und hrsg. v. Franz F. Schwarz, Stuttgart 1989
Batscha, Zwi (Hrsg.)
Materialien zu Kants Rechtsphilosophie, Frankfurt/Main 1976
Bien, Günther
Revolution, Bürgerbegriff und Freiheit, über die neuzeitliche Transformation der alteuropäischen Verfassungstheorie in politische Geschichtsphilosophie; in: Batscha aaO S. 77
Bodin, Jean
Über den Staat, Stuttgart 1976
Böckenförde, Ernst-Wolfgang
Staat - Gesellschaft - Freiheit, Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht, Frankfurt am Main 1976
Deggau, Hans-Georg
Die Aporien der Rechtslehre Kants, Stuttgart-Bad Cannstatt 1983
Dulckeit, Gerhard
Naturrecht und positives Recht bei Kant, Leipzig 1932, Nachdruck Aalen 1973
Ebbinghaus, Julius
- Das Kantische System der Rechte des Menschen und Bürgers in seiner geschichtlichen und aktuellen Bedeutung, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 50 (1964), 23
- Kants Rechtslehre und die Rechtsphilosophie des Neukantianismus; in: Gerold Prauss (Hrsg.), Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln, Köln 1973
Fetscher, Iring
Immanuel Kant und die Französische Revolution; in: Batscha aaO S. 269
Forschner, Maximilian
Gesetz und Freiheit. Zum Problem der Autonomie bei I. Kant, München 1974
Greiffenhagen, Martin
Freiheit gegen Gleichheit? - zur "Tendenzwende" in der BRD, Hamburg 1975
Habermas, Jürgen
- Publizität als Prinzip der Vermittlung von Politik und Moral (Kant); in: Batscha aaO S. 175
- Wie ist Legitimität durch Legalität möglich?; in: Kritische Justiz 1987, 1
Haensel, Werner
Kants Lehre vom Widerstandsrecht, ein Beitrag zur Systematik von Kants Rechtsphilosophie; in: Kant-Studien, Ergänzungshefte 60, Berlin 1926
Hobbes, Thomas
Leviathan (1651), übers. u. hrsg. v. Jacob Peter Mayer, Stuttgart 1970
Kant, Immanuel
Kants gesammelte Schriften, hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin ab 1902 (Die Schreibweise wurde heutigen Maßstäben angepaßt.)
Band 4: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Berlin 1911
Band 6: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft und Die Metaphysik der Sitten, Berlin 1907
Band 8: Abhandlungen nach 1781, Berlin 1912
Band 23: Vorarbeiten und Nachträge, Berlin 1955
(zit: Kant, Titel, Band, Seite)
Kersting, Wolfgang
Wohlgeordnete Freiheit, Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Berlin, New York 1984
Kühl, Kristian
Naturrecht und positives Recht in Kants Rechtsphilosophie; in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 37: "Rechtspositivismus und Wertbezug des Rechts", hrsg. v. Ralf Dreier, Stuttgart 1990, S. 75
Locke, John
Über die Regierung (The Second Treatise of Government, 1690), übersetzt v. Dorothee Tidow, mit einem Nachwort hrsg. v. Peter Cornelius Mayer-Tasch, Stuttgart 1974
Luf, Gerhard
Freiheit und Gleichheit - Die Aktualität im politischen Denken Kants, Wien, New York 1978
Marcuse, Herbert
Kant über Autorität und Freiheit; in: Gerold Prauss (Hrsg.), Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln, Köln 1973
Mandt, Hella
Historisch-politische Traditionselemente im politischen Denken Kants; in: Batscha aaO S. 291
Mercier, Louis-Sébastien
Das Jahr 2440, ein Traum aller Träume (1771), übersetzt von Christian Felix Weiße, hrsg. v. Herbert Jaumann, Frankfurt/Main 1982
Metzger, Wilhelm
Gesellschaft, Recht und Staat in der Ethik des deutschen Idealismus, Heidelberg 1917, Neudruck Aalen 1966
Naucke, Wolfgang
Rechtsphilosophische Grundbegriffe, 2. Auflage, Frankfurt am Main 1986
Paulsen, Friedrich
Immanuel Kant. Sein Leben und seine Lehre, 2. u. 3. Auflage, Stuttgart 1899
Rhemann, Josef
Zur Theorie der Demokratie; in: Heintel (Hrsg.), Philosophische Elemente der Tradition des politischen Denkens, München 1979, S. 324
Riedel, Manfred
Herrschaft und Gesellschaft, zum Legitimationsproblem des Politischen in der Philosophie; in: Batscha aaO S. 125
Rousseau, Jean-Jacques
Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts, hrsg. v. Hans Brockard, Stuttgart 1977
Saage, Richard
Eigentum, Staat und Gesellschaft bei Immanuel Kant, Stuttgart 1973
Schild, Wolfgang
Freiheit - Gleichheit - "Selbständigkeit" (Kant): Strukturmomente der Freiheit; in: Johann Schwartländer (Hrsg.), Menschenrechte und Demokratie, Kehl am Rhein, Straßburg, 1981, S. 135
Schopenhauer, Arthur
Die Welt als Wille und Vorstellung, erster Band, hrsg. v. Julius Frauenstädt, 2. Auflage, Leipzig 1919
Schwartländer, Johannes
- Demokratie - Verwirklichung oder Gefährdung der Menschenrechte; in: ders., Menschenrechte und Demokratie, Kehl am Rhein, Straßburg, 1981, S. 189
- Der Mensch ist Person. Kants Lehre vom Menschen, Stuttgart 1968
Volkmann-Schluck, Karl-Heinz
Freiheit, Menschenwürde, Menschenrecht. Zum Ethos der modernen Demokratie in der Sicht Kants; in: Schwartländer (Hrsg), Menschenrechte und Demokratie, Kehl am Rhein, Straßburg 1981, S. 177
Säet
Gerechtigkeit
und erntet
nach dem Maße der Liebe.
Hosea 10, 12
Wir wollen uns einen Triptychon denken, einen jener dreiteiligen mittelalterlichen Altäre.
Er zeigt den Staatsbürger in dreifacher Gestalt. In der Mitte die ursprünglichste Tafel, kaum restaurierungsbedürftig, aber in ihren Feinheiten noch nicht erfaßt: die Freiheit; zur linken Seite, ebenfalls noch gut erhalten: die Gleichheit; zur rechten Seite, stark lädiert und ausgeblichen: die Selbständigkeit. Wir sehen drei Seiten des Altars, die ein harmonisches Ganzes darstellen, werden aber durch die Betrachtung derselben hinausgewiesen in die andere Welt, die außerrechtliche, die moralisch-ethische: zur Brüderlichkeit.
A. Einleitung
I. Leben und Werk
Königsberg 1724. Der Sattler Johann Georg Kant erwartet mit seiner Frau Anna Regina geb. Reuter sein viertes Kind. Am 22. April kommt es zur Welt. Es wird nach dem preußischen Kalender "Immanuel" genannt - Gott mit uns. Von seinen Zeitgenossen wird es der "zweite Messias" genannt werden.
Kant wächst in Königsberg auf. Im kleinbürgerlichen, von Mangel geprägten Milieu und unter dem Einfluß des Pietismus wird er groß. Im Alter von acht Jahren wird er auf das Fridericianum geschickt, um dort beim Wolff-Schüler Schultz unterrichtet zu werden. Wiederum acht Jahre später besucht Kant die Universität in Königsberg, und 1746 kommt seine erste Schrift heraus: Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte. Nach der Universität wird er zunächst Hauslehrer, um 1755 zu habilitieren.
Kants philosophische Entwicklung läßt sich in drei Phasen einteilen. Zunächst widmet er sich neben Logik und Metaphysik vor allem der Mathematik und der Naturwissenschaft. Er setzt den Schwerpunkt auf physische, empirische Erkenntnis und zeigt in Weiterentwicklung der Gedanken Newtons, zu dem er auch schriftlichen Kontakt hat, daß die Natur ein System immanenter physischer Kräfte ist. Damit entfernt er den Schöpfungsakt eines äußeren Gottes aus der Naturwissenschaft. In den sechsziger Jahren erwacht die deutsche Philosophie und mit ihr Kants zweite Phase. Kant wendet sich nun vornehmlich anthropologischen und moralischen Fragen zu. Die Erfahrung wird die alleinige Quelle der Erkenntnis der Wirklichkeit. Der moralische Glaube tritt an die Stelle der Demonstration. Kant entdeckt durch Rousseau die Würde eines jeden Menschen.
Diese Erkenntnis gibt er mit seiner dritten Schaffensperiode weiter, indem er die kritische Philosophie begründet. Mittlerweile ist Kant hoch angesehen, sowohl von seinen Kollegen als auch von der Regierung. Kant lehnt jedoch mehrere Berufungen zu anderen Universitäten ab. Den Anfang zur kritischen Philosophie macht er mit einer Schrift von 1770, mit der er das Ordinariat für Logik und Metaphysik antritt. Darin entwickelt er die transzendentale Methode der Metaphysik, welche formale Erkenntnis durch jedem Menschen innewohnende Vernunftprinzipien a priori möglich macht. Die äußere (empirische) Erscheinungswelt tritt gegenüber einer durch reine Begriffe a priori erkennbaren, idealen Welt der Ideen zurück. Dieser Gedanke wird allgemein als "kopernikanische Wende"[1] in der Philosophie beurteilt. In den achtziger und neunziger Jahren erscheinen nun die bedeutenden Schriften, in denen Kant sein neues philosophisches Gebäude errichtet: "Kritik der reinen Vernunft", 1781 - "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten", 1785 - "Kritik der praktischen Vernunft", 1788 - "Kritik der Urteilskraft", 1790 - "Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis", 1792 - "Zum ewigen Frieden", 1795 - "metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre", 1797 - "metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre", 1797. Noch einige Jahre des körperlichen Abbaus vergehen, bis Kant am 12. Februar 1804 stirbt.[2]
II. Kants Verhältnis zum Staat
Kants Verhältnis zum geschichtlichen Staat ist gespalten. Der preußische Staat entspricht mit seiner Erbmonarchie nicht Kants Ideal vom Staat. Sie ist nach Kant nicht legitimiert.[3] Dennoch hat Kant bis 1788 keine Probleme mit dem Staat. Zum einen herrscht der tolerante, aufgeklärte Absolutismus Friedrichs II, zum anderen setzt Kant, auch wenn er Friedrichs II. wegen dessen Kriegführung die "Geißel des Menschengeschlechts" nennt,[4] nicht auf revolutionäre, sondern auf reformistische Veränderung.[5] Unter Friedrich Wilhelm II. jedoch wird 1788 ein der Aufklärung feindlich gesonnener ehemaliger Prediger Minister des Unterrichtswesens. Kant wird zunächst 1794 in religiösen Angelegenheiten der Mund verboten. Anlaß ist seine Schrift "Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" von 1793, in der er sich trotz der prinzipiellen Überlegung zur Französischen Revolution bekennt. Zu alt und schwach, um sich intensiv gegen die landesherrliche Ermahnung zu wehren, sagt er sein Schweigen zu.
III. Eine nicht-empirische Rechtsphilosophie
Kants Rechtsphilosophie ist in der "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" und in der "Metaphysik der Sitten", die beide Bücher über die metaphysischen Anfangsgründe zusammenfaßt, niedergelegt. In letzterer hat auch der Aufsatz über den Gemeinspruch unverändert Eingang gefunden.[6] Die Rechtslehre gliedert sich in drei Teile: eine Einleitung, das Privatrecht und das öffentliche Recht. Das wesentliche Material über den Staatsbürger findet sich im Staatsrecht der Rechtslehre.
"Eine bloß empirische Rechtslehre ist (wie der hölzerne Kopf in Phädrus' Fabel) ein Kopf, der schön sein mag, nur schade! daß er kein Gehirn hat."[7] Kant entwirft einen idealen Staat, ein aus reinen Vernunftbegriffen a priori, also ohne empirische Betrachtung gedachtes Staatssystem: "Eine Metaphysik der Sitten ist also unentbehrlich notwendig, ... weil die Sitten selbst allerlei Verderbnis unterworfen bleiben, solange jener Leitfaden und oberste Norm ihrer richtigen Beurteilung fehlt."[8] Die "Metaphysik" des Rechts besteht in dessen wissenschaftlicher Begründung. Damit tritt mit Kant eine neue Kategorie der Rechtsphilosophie auf, die die Begründungsmodelle der Rechtstheologie und des Rechtsrealismus ablöst. Ihre Kennzeichnung ist: Das Sollen steht vor dem Sein. Aus dem Sein läßt sich nur der Wunsch ermitteln, erst aus einer wissenschaftlichen Begründung vermag sich das "reine Recht" erkennenzugeben, das die Kontrolle über das reale (und damit relativierte) Recht ausüben kann. Kants Metaphysik ist "eine diesseitige, rationale, wissenschaftliche, auf die menschlichen Möglichkeiten bezogene".[9]
Die frühe Auseinandersetzung um Kants Rechtsphilosophie spiegeln sehr eindrucksvoll die Worte Schopenhauers wider: "Die Rechtslehre ist eines der spätesten Werke Kants und ein so schwaches, daß, obgleich ich sie gänzlich mißbillige, ich eine Polemik gegen dieselbe für überflüssig halte, da sie, gleich als wäre sie nicht das Werk dieses großen Mannes, sondern das Erzeugnis eines gewöhnlichen Erdensohnes, an ihrer eigenen Schwäche natürlichen Todes sterben muß." Der erste Hauptvorwurf Schopenhauers besteht in der Bezweiflung von apriorischen Prinzipien überhaupt: "Er will ... die Rechtslehre von der Ethik scharf trennen, dennoch aber erstere nicht von positiver Gesetzgebung, d.h. willkürlichem Zwange, abhängig machen, sondern den Begriff des Rechts rein und a priori für sich bestehen lassen. Allein dieses ist nicht möglich; weil das Handeln, außer seiner ethischen Bedeutsamkeit und außer der physischen Beziehung auf Andere und dadurch auf äußeren Zwang, gar keine dritte Ansicht auch nur möglicherweise zuläßt."[10] Das Vorurteil, das Werk eines senilen Alten vor sich zu haben, hat die Forschung lange von einer intensiveren Beschäftigung mit der Rechtslehre abgehalten. Erst in jüngerer Zeit ist der Versuch unternommen worden, Kant in dieser Hinsicht zu rehabilitieren.[11]
B. Der Staatsbürger
Wir wollen nun daran gehen, unseren Triptychon zu begutachten, um notfalls die einzelnen Figuren zu restaurieren. Es empfielt sich, dabei zunächst einen Überblick zu gewinnen.
Kants Staatsbürgerbegriff umfaßt drei Elemente, die zur Stimmgebung im Staat als apriorische Prinzipien erforderlich sind: "Die zur Gesetzgebung vereinigten Glieder einer solchen Gesellschaft (societas civilis), d.i. eines Staats, heißen Staatsbürger (cives), und die rechtlichen, von ihrem Wesen (als solchem) unabtrennlichen Attribute derselben sind: gesetzliche Freiheit, keinem anderen Gesetz zu gehorchen, als zu welchem er seine Beistimmung gegeben hat; bürgerliche Gleichheit, keinen Oberen im Volk in Ansehung seiner zu erkennen als nur einen solchen, den er ebenso rechtlich zu verbinden das moralische Vermögen hat, als dieser ihn verbinden kann; drittens das Attribut der bürgerlichen Selbständigkeit, seine Existenz und Erhaltung nicht der Willkür eines anderen im Volke, sondern seinen eigenen Rechten und Kräften als Glied des gemeinen Wesens verdanken zu können, folglich die bürgerliche Persönlichkeit, in Rechtsangelegenheiten durch keinen anderen vorgestellt werden zu dürfen."[12]
Die drei Elemente sind den drei Entwicklungsstufen des Menschen zum Staatsbürger entsprechend zugeordnet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
I. Freiheit
Betrachten wir zunächst den Mittelteil des Triptychons; er ist in den ursprünglichen Farben noch gut erhalten und es bedarf daher nur, ihn in seinen groben Umrissen nachzuzeichnen.
1. Freiheit als Menschenrecht
Die Freiheit (liberté) ist für Kant das Recht schlechthin: "Das angeborene Recht ist nur ein einziges. Freiheit (Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür), sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, ist dieses einzige, ursprüngliche, jedem Menschen kraft seiner Menschheit zustehende Recht."[13] Gleichheit und Selbständigkeit sind in der Freiheit schon enthalten und aus ihr ableitbar. Diese Feststellung findet sich in der Einteilung der Rechtslehre und ist grundlegend für Kants Rechtsverständnis.
Der Mensch kann niemals als Mittel für andere Zwecke verwendet werden, weil er Person ist: Dadurch, daß der Mensch aufgrund seiner sittlichen Freiheit, seiner Personalität, die Natur für seine Zwecke einrichten und verändern kann, wird er Herr, ja Zweck der Natur. Diese Freiheit ist zunächst nur eine kausal-naturwissenschaftliche, unter einer subjektiv-teleologischen Betrachtung wird sie aber "inneres Prinzip zur Naturerkenntnis".[14] Mit den Worten Kants: "Die vernünftige Natur existiert als Zweck an sich selbst. So stellt sich notwendig der Mensch sein eigenes Dasein vor; insofern ist es also ein subjektives Prinzip menschlicher Handlungen. So stellt sich aber auch jedes andere vernünftige Wesen sein Dasein zufolge eben desselben Vernunftgrundes, der auch für mich gilt, vor; also ist es zugleich ein objektives Prinzip, woraus, als einem obersten praktischen Grunde, alle Gesetze des Willens müssen abgeleitet werden können. Der praktische Imperativ wird also folgender sein: Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst."[15] Dieses Prinzip ist dabei mit dem kategorischen Imperativ, der Übereinstimmung der Handlungsmaxime mit dem allgemeinen Gesetz, grundsätzlich identisch.[16] Auffallend ist die Beziehung zur lutherischen Ethik.[17]
Jeder Mensch wird durch sein Recht auf Freiheit Selbstzweck: "Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst."[18] Das Recht, von jedermann selbst als Zweck und nicht als Mittel zu anderen Zwecken behandelt zu werden, sprießt aus der Würde des Menschen. Die Menschenwürde wird damit - unabhängig von der empirischen Realität - oberstes Konstitutionsprinzip des Staates.[19]
Dieses Freiheitsrecht ist indes nur auf das Innere bezogen; die Autonomie des Willens ist oberstes Prinzip der Sittlichkeit, die Vereinbarkeit der Handlungen mit diesem Prinzip heißt Moralität. Wenn die Freiheit als Inhalt des subjektiven Willens vorausgesetzt wird, wird sie tauglich als Grundlage für den allgemeinen Willen. "Ein jedes Wesen, das nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum in praktischer Rücksicht wirklich frei".[20]
2. Gesetzliche Freiheit im idealen Staat
Das äußere Mein und Dein aber ist nicht angeboren, sondern muß erworben werden.[21] Auch bei der Konstituierung des vernunftrechtlichen Rechtszustands hat die Freiheit ausschlaggebende Bedeutung. Freiheit bedeutet hier das Recht zur Mitgesetzgebung. "Als ein vernünftiges, mithin zur intelligiblen Welt gehöriges Wesen kann der Mensch die Kausalität seines eigenen Willens niemals anders als unter der Idee der Freiheit denken".[22] Der Rechtsbegriff selbst ist ein Freiheitsbegriff.
a) Der Rechtsbegriff der Freiheit
Recht bezeichnet das äußere Verhältnis zwischen der Form der Willkür des einen und der Form der Willkür des anderen. Das allgemeine Rechtsgesetz lautet demnach: "Handle äußerlich so, daß der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen könne".[23] Oder anders ausgedrückt: Das reine Recht bestimmt den allgemeinen wechselseitigen Zwang als Verhinderung der partikulären Freiheitsdurchsetzung, dem Hindernis der rechtlichen Freiheit. Die gesetzliche Freiheit, keinem anderen Gesetz gehorchen zu müssen, als zu welchem er seine Zustimmung gegeben haben könnte, ist damit das erste Vernunftprinzip a priori des Staatsbürgers.[24] Der Zwang ist dabei nicht Wesens- sondern nur Existenzbedingung der Freiheit.[25]
b) Der Mensch als Zweck des Rechts
Zum Staatsbürger gehört Würde. Wenn aus dem Recht auf Freiheit die Behandlung des Menschen als Zweck verbunden war, so muß dies auch auf das Recht angewendet werden: Der Mensch ist Zweck des Rechts.
Damit einher geht das Toleranzgebot: Die Festlegung von Glückseligkeitsmaßstäben kann nicht Ziel des Rechts sein, denn jeder hat unterschiedliche Vorstellungen von dem, was ihn glücklich macht: "Allein es ist ein Unglück, daß der Begriff der Glückseligkeit ein so unbestimmter Begriff ist, ... daß alle Elemente, die zum Begriff der Glückseligkeit gehören, insgesamt empirisch sind, d.i. aus der Erfahrung müssen entlehnt werden, daß gleichwohl zur Idee der Glückseligkeit ein absolutes Ganzes, ein Maximum des Wohlbefindens, in meinem gegenwärtigen und jedem zukünftigen Zustande erforderlich ist."[26] Der Mensch ist demnach ständig auf der Suche nach seinem eigenen Glückseligkeitsmaßstab. Machte der Staat ein bestimmtes Wohlfahrtskonzept zur verbindlichen Norm, so behandelte er den Menschen bloß als Objekt fremden Willens und nicht als Subjekt eigenen Willens. Ziel des Rechts muß daher sein: die Sicherung äußerer Freiheit, damit jeder auf seine Art glücklich werden kann. Die Vereinbarkeit mit dem formalen Freiheitsrecht ist demnach das Gerechtigkeitskriterium für positive Gesetze, nicht die Tatsache, daß die Untertanen glücklich sind.[27]
3. Das liberale Rechtsverständnis
Vergleichen wir diesen vernunftrechtlich entwickelten Freiheitsbegriff mit dem modernen liberalen Grundrechtsverständnis, so ergibt sich, daß er gänzlich anderer Natur ist. Art. 2 I GG gewährt nach der Rechtsprechung jedem "das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt."[28] Die Reichweite des Rechts ist nicht bestimmbar, es ist vielmehr alles Recht, was nicht Unrecht ist - eine "leere Tautologie".[29] Aber was noch wichtiger ist: Die positive Bestimmung des Freiheitsrechts unterliegt den Schranken des positiven Rechts. Das ist widersprüchlich, weil "ein unveräußerliches Freiheitsrecht als Geltungsbedingung jedes positiven Gesetzes hinsichtlich seiner Geltung nicht von verfassungs- und gesetzesrechtlichen Bestimmungen abhängig gemacht werden kann."[30] Dieser Widerspruch rührt daher, daß das liberale Freiheitsverständnis vom Freiheitsrecht als einem staatsgerichteten Abwehrrecht ausgeht. Der Freiheitsraum des Bürgers entsteht erst mit der Abgrenzung zur staatlichen Machtausübung. Kants reine Rechtslehre aber klammert gerade den empirischen Aspekt eines freiheitsraubenden Staatsapparates aus, um auf reiner Vernunftebene einen freiheitlichen Rechtsstaat zu konstituieren. Das Freiheitsrecht steht nach Kant vor der Staatsbegründung, was zur Folge hat, daß der Träger des Rechts, der Mensch, in einer gemeinschaftlichen Willensbildung erst durch sein Recht auf Freiheit den Rechtszustand Staat schaffen kann. Die Freiheit bringt den Staat hervor und geht in ihm auf.[31]
Die Bestimmung der Freiheit ist damit ausgedehnt auf die Einflußnahme auf die Mitgesetzgeber. Ebbinghaus entwickelt daraus die Konsequenz, daß das Plebiszit, bei dem kein gegenseitiger Meinungsaustausch stattfände, der vernunftrechtlichen Verfassung widerspräche. Gleichermaßen sei damit das gebundene Mandat ausgeschlossen sowie die Bindung der Wähler an Wahlvorschläge der Parteien.[32] Allerdings wäre zu fragen, ob nicht auch bei einem Plebiszit vor der Abstimmung der Meinungsaustausch stattfindet, der zur Ausübung der Freiheit notwendig ist. Schließlich ist ja der Beschluß zu einem Plebiszit auch eine im politischen Meinungsaustausch entstandene parlamentarische Entscheidung.
Das Rechtsgesetz verlangt nicht, "daß ich ganz um dieser Verbindlichkeit" (die das Rechtsgesetz mir auferlegt) "willen meine Freiheit auf jene Bedingungen" (der Vereinbarkeit mit jedes anderen Willkür) "selbst einschränken solle". Durch das Rechtsgesetz "sagt die Vernunft nur, daß (die Freiheit) in ihrer Idee darauf eingeschränkt sei und von anderen auch tätlich eingeschränkt werden dürfe."[33] Das Rechtsgesetz ist also kein kategorischer Imperativ, sondern ein praktisches Gesetz, das durch seine Verwirklichung Rechtsgrund der Zwangsbefugnis wird. Die Legitimation des wechselseitigen Zwanges[34] führt wiederum zu einer Pflicht zur Zwangsvermeidung, was zur Folge hat, daß "der äußere Bestimmungsgrund der Willkür an die Stelle des moralischen Motivs treten" kann.[35]
Die Gesetzgebung geht aus dem allgemeinen Willen der freien Individuen hervor, ist damit aber ein rein formaler Akt, welcher der inhaltlichen Ausfüllung erst noch bedarf. Diese Tatsache birgt die Gefahr, daß das Recht durch seine allzu formale Bestimmung korrumpiert wird. Insofern hat Schopenhauer mit seinem zweiten Kritikpunkt an der Kantischen Rechtsphilosophie nicht ganz unrecht, wenn er sagt: "Seine Bestimmung des Begriffs Recht (ist) ganz negativ und dadurch ungenügend. ... Wir bleiben also bei lauter Negationen und erhalten keinen positiven Begriff, ja erfahren gar nicht, wovon eigentlich die Rede ist, wenn wir es nicht schon anderweitig wissen."[36]
Aus diesen Überlegungen folgt: Eine stärkere positive Berücksichtigung der apriorischen Vernunftidee der Freiheit, die aus der Personalität und Würde des Menschen folgt, könnte bei der Schaffung von Gesetzen dazu beitragen, den negierenden Charakter der Abwehrrechte zugunsten der Konstitution eines vorstaatlichen Rechts auf Freiheit zu schwächen und eine bestimmbare Grenzziehung zwischen dem Freiheitsraum der Individuen und der Staatsmacht vorzunehmen. Das Rechtsgesetz Kants ist kein Imperativ, sondern ein praktisches Gesetz, das die Stelle einer moralischen Instanz dadurch übernehmen will, daß es Zwang legitimiert. Dabei ist die Bestimmung des Rechts rein formal. Nach einem materiellen Abgrenzungsprinzip muß daher weitergesucht werden.
II. Gleichheit
Der Mittelteil lenkt unseren Blick nun auf die linke Seitenhälfte des Altars, die, so vertraut sie uns scheinen mag, doch nur in ihren Umrissen unserem Verständnis entspricht. Der Seitenteil ist gut erhalten und bedarf nur der neuerlichen Farbgebung, um ihn für unsere Zeit verständlich zu machen.
1. Gleichheit als Untertanenrecht
Die Gleichheit (egalité) geht als Recht des Untertanen aus der allgemeinen Freiheit hervor. Sie bildet praktisch das auf die Mitmenschen bezogene Gegenstück zur staatsbezogenen Freiheit. Kant definiert sie als "Unabhängigkeit, nicht zu mehrerem von anderen verbunden zu werden, als wozu man sie wechselseitig auch verbinden kann."[37] Oder positiv gesprochen: Der Untertan muß mit jedem anderen Untertanen zusammen so behandelt werden, wie es der Tatsache entspricht, daß jeder nur soviel vom anderen verlangen kann, als wozu er selbst verpflichtet werden könnte. Diese "Reziprozitätsstruktur der wechselseitigen Verpflichtbarkeit"[38] wird mit gleicher Formulierung auf den Staat übertragen: Im Staat äußert sich die Gleichheit in dem Recht, "keinen Oberen im Volk in Ansehung seiner zu erkennen als nur einen solchen, den er ebenso rechtlich zu verbinden das moralische Vermögen hat, als dieser ihn verbinden kann".[39] Gleichheit meint demnach gleiches Unterworfensein unter allgemeine Gesetze. Dies hat etwa zur Konsequenz, daß gesellschaftliche und rechtliche Positionen jedem gleichermaßen zugänglich sein müssen. Die Abschaffung der Privilegien gehört für Kant demnach zu den a priori erkannten Forderungen. Zulässige Differenzierungskriterien sind nicht zufällige natürliche Gegebenheiten, sondern nur Talent, Fleiß und Glück.[40]
Auch hier gilt indes, daß die Gleichheit ein der Gesetzgebung vorgehendes Recht ist und nicht selbst durch die Gesetzgebung eingeschränkt werden kann.[41] Daraus folgert Ebbinghaus etwa, daß das Recht der Eltern über die Kinder nicht auf staatlichem Gesetz, sondern auf Menschenrecht beruhen muß, um überhaupt das angeborene Recht auf Gleichheit, das auch das Kind hat, während der Zeit der Erziehung einschränken zu können. Zu dieser Frage werden wir später im Zusammenhang mit der Selbständigkeit noch einmal ausführlich zurückkommen.[42] Jedenfalls kann hier die Rechtsgleichheit nicht das letzte Wort haben. Gleiches gilt nach Ebbinghaus aber auch für das Eherecht: Die natürlichen Bedingungen forderten eine Berücksichtigung bei der Bestimmung der gegenseitigen Rechte und Pflichten der Ehepartner. Das staatliche Recht dürfe ihnen "nicht einfach eine wechselseitige Rechtsgleichheit aufkleben mit der Begründung, daß alle Menschen ... oder alle Staatsbürger ... dem Rechte nach gleich sind."[43] Die Frage ist, was Ebbinghaus damit meint. Die Rechtsgleichheit ist ja im Kantischen System immerhin ein apriorisches Prinzip und kann deshalb vom staatlichen Recht gar nicht "aufgeklebt" werden. In Betracht käme wohl etwa, daß ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch - wenn es das gäbe - durch Gesetz nur der Frau gewährt wird. Man sieht: Das staatliche Recht kann gar keine Regelung gegen die natürliche Bestimmung treffen, denn wenn es auch dem Mann ein solches Recht zukommen ließe, so wäre dieser doch aufgrund der natürlichen Bedingungen an der Ausübung seines Rechtes gehindert. Diese Reflexion mag daher - um in Kants Worten zu sprechen - für die Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis.
2. Das soziale Gleichheitsverständnis
Kants Gleichheitsbegriff bezieht sich lediglich auf den rechtlichen, nicht aber auf den ökonomischen Bereich. Nach ihm sind soziale und wirtschaftliche Ungleichheit mit rechtlicher Gleichheit sehr wohl vereinbar. Es sind dennoch Interpretationsversuche unternommen worden, den Kantischen Gleichheitsbegriff sozialstaatlich zu kultivieren.
a) Autonomie durch soziale Gleichheit?
Will man Luf glauben, dann muß die Aufgabe des Gleichheitsbegriffs, Autonomie effektiv zu ermöglichen, zu Differenzierungskriterien führen, die eine Einbeziehung sozialer Gleichheit - gegenüber einer rein rechtlichen Gleichhheit - herbeiführen. Kants Rechtsbegriff sei durchaus offen für sozialstaatliche Gesetzgebung.[44] Dagegen spricht aber, daß Kant selbst niemals sozialstaatliche Konsequenzen aus der Gleichheit gezogen hat. Vielmehr hat Kant sich gerade gegen den Wohlfahrtsstaat ausgesprochen. Gesetze, die etwa durch Besitzumverteilung soziale Gleichheit herbeiführen, sind wohl vom Rechtsbegriff Kants her nicht ausgeschlossen, aber diese Tatsache macht soziale Gleichheit bei Kant noch nicht zum apriorischen Prinzip des Staatsrechts. Im Gegenteil: Das generelle Unberücksichtigtbleiben empirischer Elemente bei Kant macht eine Einbeziehung sozialer Gleichheit schlechthin unmöglich.[45]
b) Das Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit
Im Grundgesetz findet sich neben dem Gleichheitssatz des Art. 3 GG das Sozialstaatspostulat, was bedeutet, daß der Gleichheitssatz in Richtung sozialer Gerechtigkeit ausgelegt werden muß. Dadurch wird aus der Gewährleistung rechtlicher die Gewährleistung tatsächlicher Freiheit und sozialer Gleichheit. Dies entspricht dem Bedürfnis, Freiheit zunächst dort herzustellen, wo sie ausgeübt werden soll, weil ohne die ökonomische Grundlage auch die rechtliche Freiheit notwendig brachliegen muß. Aus dem formalen Rechtsbegriff muß dadurch zwangsläufig ein inhaltlicher werden. Die Gefahr dabei ist, daß partikuläre Glücksvorstellungen als allgemeinverbindliche Norm die rechtliche Freiheit und Gleichheit beeinträchtigen. Es droht, in Kants Terminologie, der Despotismus.[46]
Die dem Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit folgende sozialstaatliche Politik ist (nach Kant) nicht durch die gesetzliche Gleichheit a priori legitimiert. Die Frage, die sich sofort stellt, ist: Wenn Kants Rechtsphilosophie nicht soziale Gerechtigkeit herstellen kann, taugt sie dann überhaupt als Grundlage des idealen Staates? Wir werden noch einen anderen Weg suchen müssen, auf dem sozialstaatliche Politik auch im Sinne Kants begründet werden kann.
III. Selbständigkeit
Wir lassen den Blick nun über den Mittelteil des Triptychons auf den rechten Seitenteil schweifen. Er ist vom Zahn der Zeit stark angegriffen. Mag sein, daß die Bilderstürmer einen Teil dazu beigetragen haben. Er wird, wenn er überhaupt zu retten ist, einer umfangreichen Restaurationsarbeit unterworfen werden müssen.
1. Selbständigkeit als Staatsbürgerrecht
Wie die Gleichheit, so folgt auch die Selbständigkeit (sibisufficientia) aus dem angeborenen Recht der Freiheit. Sie soll das dritte Prinzip a priori darstellen, das zur Mitgesetzgebung notwendig ist. In der Einleitung spricht Kant von der "Qualität des Menschen, sein eigener Herr (sui iuris) zu sein".[47] Wenn wir nach dem Inhalt der Selbständigkeit fragen, so stoßen wir im Staatsrecht jedoch auf die Bestimmung, "seine Existenz und Erhaltung nicht der Willkür eines anderen im Volke, sondern seinen eigenen Rechten und Kräften als Glied des gemeinen Wesens verdanken zu können, folglich die bürgerliche Persönlichkeit, in Rechtsangelegenheiten durch keinen anderen vorgestellt werden zu dürfen."[48] - Was ist damit gemeint?
a) Zwei Klassen von Staatsbürgern
Kant gesteht sich ein, es sei "etwas schwer, die Erfordernis zu bestimmen, um auf den Stand eines Menschen, der sein eigener Herr ist, Anspruch machen zu können."[49] Jedenfalls unterscheidet er mit diesem Prinzip zwei verschiedene Gruppen von Staatsbürgern: den mit der Selbständigkeit ausgestatteten aktiven Staatsbürger (Staatsglied) als Mitgesetzgeber, der "aus eigener Willkür in Gemeinschaft mit anderen handelnder Teil desselben sein will", und den passiven Staatsbürger (Schutzgenosse), dem das Erfordernis der Selbständigkeit fehlt, für den die Gesetze als Untertanen aber gleichwohl Gültigkeit haben, "obwohl der Begriff des letzteren mit der Erklärung des Begriffs von einem Staatsbürger überhaupt im Widerspruch zu stehen scheint."[50] Daher darf Kants Unterscheidung hier auf die Begriffe des Untertanen (= passiven Staatsbürgers) und des (aktiven) Staatsbürgers beschränkt werden.
b) Differenzierungskriterien
Wer ist es, der mit Hilfe der Selbständigkeit aus der Gemeinschaft der Gesetzgebenden ausgeschlossen werden soll? Zunächst nennt Kant zwei natürliche Bedingungen: der Staatsbürger darf "kein Kind, kein Weib" sein.
Sodann werden wir verwiesen auf das, was Kant in § 30 seines Privatrechts zum Hausherren-Recht sagt. Dort begreift Kant in Anlehnung an die alte Hausgemeinschaft das Recht des Hausherren (paterfamilias), über seine Familie die Vatergewalt (patria potestas) auszuüben, als durch das Eigentum des Vaters legitimiert. Frau, Kinder, Dienstboten, Tagelöhner, Hauslehrer, sie alle sind von der Willkür des Vaters abhängig. Ihre Unselbständigkeit ist damit auch Resultat der alten gesellschaftlichen Ordnung. Sobald die Familienmitglieder eigenes Eigentum erwerben und damit in den Stand versetzt werden, sich selbst zu erhalten, werden sie mündig und von der Vatergewalt frei. Sie treten aus einem reinen Sachenrechtsverhältnis heraus in ein Personenrechtsverhältnis.[51]
Hier zeigt sich der gesellschaftliche Wandel, der Kant neben dem alten Haus den im Frühkapitalismus angesiedelten Markt stellen läßt: Als letztes Erfordernis nämlich muß der Staatsbürger "irgend ein Eigentum" haben, "welches ihn ernährt, d.i. daß er in den Fällen, wo er von andern erwerben muß, um zu leben, nur durch Veräußerung dessen, was sein ist, erwerbe, nicht durch Bewilligung, die er anderen gibt, von seinen Kräften Gebrauch zu machen".[52] Derjenige, der auf dem Markt nichts weiter zu seiner Erhaltung anzubieten hat als seine Kräfte, der folglich über nichts verfügt, was er sein Eigen nennen kann, der ist von der Willkür eines anderen abhängig und zur Staatsbürgerschaft nicht mündig. Das führt als Beispiel zu der merkwürdigen Konsequenz, daß der Haarschneider, weil er nur seine Kräfte anbietet, lediglich Untertan, der Perückenmacher dagegen, weil er gleichzeitig das Haar als Eigentum anbieten kann, auch Staatsbürger ist.[53]
2. Kritik der Selbständigkeit
Das Kriterium der Selbständigkeit ist der Zankapfel in der Kant-Literatur zum Staatsbürgerbegriff.
a) Selbständigkeit - ein empirisches Kriterium ?
Der häufigste Einwand bezüglich der Selbständigkeit ist der, daß dieses Prinzip eben kein apriorisches, sondern ein aposteriorisches, ein aus der Erfahrung gewonnenes, empirisches Prinzip sei. Schon Schopenhauer meinte, Kant stütze das Naturrecht auf das positive Recht statt umgekehrt.[54] Der ökonomische Status sei Voraussetzung zur Mitgesetzgebung. Kant erfasse zwar mit der Gesetzgebungsmacht der Freien und Gleichen die "normative Konsequenz der menschenrechtlichen Grundlagen", widerrufe diese Erkenntnis aber sogleich dadurch, daß er "dem empirischen Selbständigkeitsmerkmal rein definitorisch rechtserhebliche Bedeutung" zuweise. Kants Unterscheidung zwischen Untertan und Staatsbürger werde zur Tautologie. Durch die Schummelverpackung eines empirischen Merkmals in ein apriorisches Prinzip werde "die politische Privilegierung der Selbständigen vernunftrechtlich abgesegnet".[55] Kant könne nicht begründen, warum die politische Teilhabe in der "entsittlichten und dekorporativen Welt der durch allgemeine Freiheit und Rechtsgleichheit gekennzeichneten bürgerlichen Erwerbsgesellschaft" wie zuvor in der Hausgemeinschaft von der Selbständigkeit abhängen müsse.[56] Mit dieser Forderung werde das Gesetzgebungsrecht zu einer "Prämie für gelungene wirtschaftliche Emanzipation",[57] für "reine Spontaneität des bürgerlichen Handelns".[58]
Es sollte Wunder nehmen, daß gerade Kant, der an allen Ecken und Enden seiner Rechtsphilosophie nach apriorischen Prinzipien suchte, dem Irrtum erlegen sein sollte, ein empirisches Prinzip als Vernunftprinzip auszugeben. Ist Kant also ein Schwindler?
b) Die Macht der Tradition
Einmal vorausgesetzt, daß es sich bei der Selbständigkeit wirklich um ein empirisches Merkmal handelt, stellt sich folgende Frage: Warum hat Kant scheinbar völlig unüberlegt dieses Merkmal in sein System vom idealen Staat übernommen? Dieser Frage wird in der Kant-Literatur breiter Raum gewidmet.
Die Ansicht, Kant wolle gleichsam die Eigentümer und Steuerzahler vor dem politischen Einfluß der Armen schützen, wird sich wohl ebensowenig halten können wie Versuche, Kant in den Rahmen des marxistischen Klassenkampfes einzuspannen.[59]
Die h.M. in der Kant-Literatur geht wohl dahin, die Selbständigkeit als Folge einer auf die aristotelisch-scholastische Tradition zurückzuführenden Begriffskontinuität zu verstehen. Die seit Aristoteles[60] den Bürgerbegriff bestimmende Überzeugung, daß nur der wirtschaftlich Unabhängige auch über die nötige politische Kompetenz verfüge, habe sich eben auch bei Kant fortgesetzt. Sie sei überhaupt ein "Gemeinplatz ihrer Zeit".[61]
Für Kants Zeitgeist werden verschiedene Angriffspunkte gewählt: Der Ausschluß der Frauen wird auf das patriarchalische Geschlechtsverständnis[62] zurückgeführt. Der Mann war damals eben der einzige, der für eine staatliche Gesetzgebung in Frage kam. Den Ausschluß der Dienstboten und Knechte führt man auf die Betonung der alten Hausgesellschaft[63] zurück. Kant habe seiner Zeit gemäß den Hausvater als alleinigen Machthaber der Familie und damit des Staates verstanden. Das Erfordernis des Eigentums schließlich begründet man mit Kants liberalem Eigentümerideal, das jeden Anbieter auf dem Markt als mündigen Bürger betrachtete. Nur der Bourgeois (Warenproduzent) sei Citoyen (Staatsbürger), weil die Begründung des Staates aus seinem Interesse an rechtlich gesichertem Besitz erfolge.[64]
Letztlich sei die Selbständigkeit von Kant bloß hinzugenommen, weil Kant - salopp gesagt - eben eine Marotte für Triaden gehabt habe.[65] Nicht umsonst habe er an einigen Stellen die Selbständigkeit durch andere Begriffe ersetzt oder gänzlich darauf verzichtet.[66]
All diese Kritik führt letztlich zu dem Ergebnis, die Selbständigkeit aus dem Kosmos des Kantischen Staatsbürgers wegzuinterpretieren: Sie "sei ganz gut, tauge aber nicht für die Praxis".[67] Es verbleiben damit lediglich Freiheit und Gleichheit als apriorische Prinzipien.
3. Versuch einer systematischen Interpretation
Was sollen wir nun von dieser Reduzierung des Systems halten? Ist der dritte Teil unseres Triptychons nicht zu retten, weil er künstlerisch in die Konzeption der beiden anderen Teile nicht paßt, weil er zu sehr der Tradition vergangener Zeiten anhängt? Oder ist er nur einfach so beschädigt, daß man die Figuren nicht mehr nachzeichnen kann? Es kommt ja häufig vor, daß Schätze aus der Vergangenheit nur bruchstückhaft erhalten sind. Was tut ein Restaurator? Er läßt es entweder bei dem Vorhandenen bewenden oder fügt eigenes Material hinzu, um wenigstens den Eindruck des Kunstwerkes einigermaßen wieder herzustellen. Wir wollen bei unserem Altarbild die zweite Alternative wählen. Wir sind uns dabei bewußt, daß wir nicht das ursprüngliche Kunstwerk, aber ein für unsere Zeit verständliches und konsequentes erhalten.
Kant hat dem Prinzip der Selbständigkeit besonderes Gewicht beigemessen. In der Vorstellung der drei Prinzipien im Staatsrecht wiederholt er: "Nur die Fähigkeit der Stimmgebung macht die Qualifikation zum Staatsbürger aus; jene aber setzt die Selbständigkeit dessen im Volke voraus, der nicht bloß Teil des gemeinen Wesens, sondern auch Glied desselben ... sein will."[68] Die Reduzierung seiner Trias auf Freiheit und Gleichheit, wie sie von der h.M. vorgenommen wird, ist allein durch historische Argumente begründbar. Eine bloß historische Begründung der Ablehnung der Selbständigkeit kann aber schon deshalb nicht überzeugen, weil dabei Freiheit und Gleichheit entgegen Kants Verständnis uminterpretiert werden müssen.
Daraus ergibt sich die These: Man wird Kant nicht gerecht, wenn man die Selbständigkeit mit historischen Gründen ablehnen will, sondern muß sich vielmehr um eine heutigen Maßstäben gerechte systematische Interpretation bemühen.[69] Die historische Distanz zu Kant soll dabei keineswegs geleugnet werden; es muß aber einen Weg geben, der Selbständigkeit eine moderne Bedeutung abzugewinnen. Dabei wird man von der Apriorität der Selbständigkeit ausgehen müssen.
a) Selbständigkeit als Mündigkeit
Wenn wir vom a priori gedachten ursprünglichen Vertrag, dem contrat social, als Legitimationsgrundlage für den Staat ausgehen, so müssen wir auch heute eingestehen, daß an diesem Vertrag nicht alle freien und gleichen Menschen teilhaben. In einem Punkte nämlich stimmt unser heutiges Staatsbürgerrecht völlig mit dem Kants überein:
Die Mündigkeit ist Voraussetzung für rechtserhebliche Geschäfte; das Wahlrecht beginnt mit 18 Jahren. Damit haben wir eine Personengruppe der Unselbständigen, mit der das Kriterium der Selbständigkeit bei Kant neu aufgerollt werden kann.[70]
Hier wird die Erziehungslehre Kants relevant. Das Kind ist zwar staatsbürgerlich unmündig, die Rechte auf Freiheit und Gleichheit genießt es aber wie der Erwachsene. Seine Freiheit bedarf noch der Ausbildung. Die Erziehung hat die schwierige Aufgabe, durch Vermittlung von Kultur (äußeres Erziehungsziel) und Gründung eines moralischen Charakters (inneres Erziehungsziel) zur Freiheit freizusetzen; schwierig deshalb, weil man Freiheit nicht erzeugen kann, sondern die Freiheit sich selbst verwirklichen muß.[71]
Die Erziehung zur Mündigkeit ist nun gleichzeitig Erziehung zur Selbständigkeit. Schild bringt mit dem Hinweis auf die Diskussion um die Herabsetzung des Wahlalters ein gutes Beispiel, das zeigen kann, wie diese Erziehung funktioniert: Nach seinen Ausführungen kam es bei jenem Entschluß nicht so sehr auf die erreichte sittliche Reife an - deren Bezweifelung dazu geführt hat, die volle strafrechtliche Verantwortlichkeit erst ab 21 Jahren anzusetzen - als vielmehr auf die praktische Überlegung, durch Gewährung von mehr Freiheit zur Freiheit hin zu erziehen.[72] Dabei ist die Anerkennung der Jugendlichen als Vollbürger ein Vor-Urteil, dem diese erst gerecht werden müssen, dem sie aber nur so auch gerecht werden können.
Dieses Beispiel läßt sich auf die Selbständigkeit aller erweitern. In seinem Aufsatz "Was ist Aufklärung?" stellt Kant die Gewährung von Freiheit als grundlegende Bedingung für die politisch-soziale Mündigkeit der Staatsbürger. Und im Staatsrecht zeigt er, daß das Argument, ein gewisses Volk sei zur Freiheit noch nicht reif, praktisch nicht überzeugen kann, denn "man kann zu dieser nicht reifen, wenn man nicht zuvor in Freiheit gesetzt worden ist ... Die ersten Versuche werden freilich roh, gemeiniglich auch mit einem beschwerlicheren und gefährlicheren Zustande verbunden sein ...; allein man reift für die Vernunft nie anders, als durch eigene Versuche (welche machen zu dürfen man frei sein muß)".[73] An dieser Stelle ist Kant sogar nahe daran, seine Vorurteile gegenüber Frauen und unselbständigen Arbeitern abzulegen - eine Stelle, die für die moderne Interpretation ausschlaggebend sein sollte.[74]
Wir fassen diese Überlegungen zusammen: Die Mündigkeit bzw. Selbständigkeit ist nicht etwas theoretisch Begründbares, sondern ein praktisches Anerkennen, ein Loslassen in die dem Menschen von Geburt an zustehende Freiheit.
b) Die dynamische Komponente der Selbständigkeit
Dabei dürfen wir aber nicht stehenbleiben. Denn theoretisch wäre bei diesem Stand dem Gesetzgeber aller Einfluß auf die Selbständigkeit der Noch-Untertanen gegeben. Er könnte damit die Anzahl seiner Mitgenossen bestimmen. Hinzukommen muß vielmehr eine dynamische Kategorie, die dem Untertanen ein Recht auf Selbständigkeit verleiht.
Auch hier genügt im Grunde ein Rückgriff auf das Familienrecht: Die Eltern sind zur Erziehung des Kindes verpflichtet, weil das Kind aufgrund seiner angeborenen Freiheit mündig werden muß; gleichermaßen muß auch der unselbständige Erwachsene ein Recht auf Erziehung durch die Rechtsgemeinschaft zur Selbständigkeit haben. Nun kommen die Personengruppen der Unselbständigen nach Kant: Frauen, Dienstboten, all jene, die - um mit Rousseau zu sprechen - frei geboren sind und überall in Ketten liegen. Sie haben ein Recht, von den Schon-Selbständigen, also von den Staatsbürgern, in deren Gesetzgebung berücksichtigt zu werden, damit sie zur Staatsbürgerschaft reifen können. Kant im Originalton: "Daraus, daß sie fordern können, von allen anderen nach Gesetzen der natürlichen Freiheit und Gleichheit als passive Teile des Staats behandelt zu werden, folgt ..., daß, welcherlei Art die positiven Gesetze, wozu sie stimmen, auch sein möchten, sie doch den natürlichen der Freiheit und der dieser angemessenen Gleichheit aller im Volk, sich nämlich aus diesem passiven Zustande zu dem aktiven emporarbeiten zu können, nicht zuwider sein müssen."[75]
In der Kant-Literatur finden sich verschiedene Ausprägungen dieser interpretatorischen Einsicht. Ebbinghaus formuliert die Selbständigkeit als "allgemein mögliche Selbständigkeit" um. Die Unselbständigen müßten unter bestimmten Bedingungen an der Gesetzgebung beteiligt werden, um die rechtliche Übermacht der Selbständigen "auf die Bedingungen möglicher Selbständigkeit für alle gesetzlich" einzuschränken.[76]
Volkmann-Schluck sieht in Anbetracht der Tatsache, daß die moderne Gesellschaft dem einzelnen Arbeiter die Möglichkeit der Verselbständigung verbaue, das Bedürfnis zum Zusammenschluß, damit die Unabhängigkeit von den Selbständigen garantiert werden könne.[77] Diese Betrachtung muß nur noch auf den nicht-ökonomischen Bereich ausgedehnt werden, um ein umfassendes Recht auf Emanzipation zu konstituieren.[78]
Viele Autoren sprechen von der Selbständigkeit als einem Recht auf "Teilhabe", "Teilnahme" oder "Mitbestimmung" "am politischen und gesellschaftlichen Gemeinwesen".[79]
An dieser Stelle löst sich das Problem, das die Interpretation des Kantischen Gleichheitsbegriffs im Vergleich mit dem modernen sozialen Gleichheitsverständnis bot: Das subjektive Recht auf Erziehung zur Selbständigkeit bewirkt zugleich, daß der Staat auf die soziale Gerechtigkeit und die Schaffung von Chancengleichheit verpflichtet wird. Allerdings birgt dieser Auftrag auch die Gefahr des Wohlfahrtsstaates: daß der Staat nicht nur zur Freiheit erzieht, sondern bevormundet. Es muß deshalb bei der Gesetzgebung Berücksichtigung finden, daß im Grunde niemand, auch die Selbständigen und politisch Verantwortlichen, vollständig selbständig ist. Die Selbständigkeit wird damit zum Prozeß, den der Bürger in ständiger Erziehung innerhalb "der Gesellschaft von seinesgleichen" durchlaufen muß.[80] Es gibt m.a.W. ein Recht, im "ethischen Naturzustand" zu verbleiben.[81] Und nun wissen wir auch, warum die Selbständigkeit kein empirisches Kriterium sein muß: Gerade in der Unvollkommenheit der Freiheit des Menschen, die erst der Entwicklung und Erziehung bedarf, liegt der apriorische Charakter des Erfordernisses der Selbständigkeit.
Eine Folge dieser Weiterentwicklung ist, daß die Begründung der Todesstrafe in der Kantischen Rechtsphilosophie keinen Halt mehr findet. Diese hatte Ebbinghaus als "rechtlich notwendige Strafe für den Mörder" vorschnell als Kantische Konsequenz einer der Freiheit aller widersprechenden Handlung gezogen,[82] wobei er sich zugegebenermaßen auf Kant stützen konnte.
Die einschlägige Stelle bei Kant lautet:
"Selbst wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstimmung auflöste ..., müßte der letzte im Gefängnis befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit jedermann das widerfahre, was seine Taten wert sind ...", weil das Volk "als Teilnehmer an dieser öffentlichen Verletzung der Gerechtigkeit betrachtet werden kann."[83] Nach unserer Interpretation muß der Mörder dagegen ein Recht auf Erziehung und Eingliederung in die Gesellschaft haben, um erneut zu versuchen, seine Freiheit zu leben. Moderne Strafjustiztendenzen zur Resozialisierung wären damit auch bei Kant im Ansatz schon vorhanden, ohne daß Kant freilich selbst die Konsequenzen gezogen hätte.
Die Bedeutung der Selbständigkeit soll in einer weiteren These erfaßt werden: Das Loslassen, die Erziehung zur Selbständigkeit ist Rechtspflicht der Rechtsgemeinschaft; sie resultiert aus dem angeborenen Recht auf Freiheit, das im Staat nach effektiver Realisierung verlangt. Das Recht auf Erziehung zur Mündigkeit trifft alle Menschen gleichermaßen, da niemand so vollkommen ist, daß er anderen seinen Grad der Selbständigkeit vorschreiben dürfte.
Es hat sich damit gezeigt, daß die Selbständigkeit im Kosmos des Kantischen Staatsbürgers eine wichtige Funktion erfüllen und im Hinblick auf die anderen Prinzipien einige Verlegenheit beseitigen kann, wenn sie systematisch interpretiert wird.
IV. Das Verhältnis der Merkmale
Mit den nun gewonnenen Definitionen der Kantischen Staatsbürger-Trias soll das Verhältnis der einzelnen Merkmale untereinander genauer bestimmt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Man könnte die Staatsbürger-Trias als hermeneutische Interpretationsregel auffassen, was bedeutet, daß die einzelnen Elemente niemals für sich, sondern jeweils im Bezugsfeld zu den anderen ausgelegt werden müssen. Fraglich bleibt jedoch, warum die Trias ein abgeschlossenes Ganzes bildet und in welchem Verhältnis die drei Elemente zueinander stehen.[84]
Die Bestimmung der Trias als Folge einer dialektischen Methode kommt der Verhältnisbestimmung näher. Dabei nimmt die Selbständigkeit eine Sonderstellung ein, die zwischen Freiheit und Gleichheit als sich naturgemäß widersprechenden Gegensätzen zugunsten der Freiheit vermitteln soll.[85]
Gegen diese Auslegung wendet sich Schild mit dem Hinweis, daß alle drei Elemente in einem spannungsreichen Verhältnis zueinander stehen. Die Trias ist demnach als Ganzes Wesensbestimmung und Inhalt einer umfassenderen positiven, politisch-sozialen Freiheit innerhalb des Zusammenlebens der Menschen. Diese Freiheit könnte man auch mit Autonomie übersetzen, d.h. Eigengesetzlichkeit. Die drei Elemente sind damit als Vernunftprinzipien der menschlichen Gesellschaft deren "apriorische Konstitutionsbestimmungen".[86]
Wir halten fest: Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit sind die apriorischen Konstitutionsbedingungen des Staates. Sie sind alle drei gleichberechtigt und können nur als Einheit wirken, bedingen und vermitteln sich jeweils untereinander.
C. Der Staat
Wir haben die Merkmale des Staatsbürgers ausführlich betrachtet und wollen nun untersuchen, wie der so in seinen Rechten bestimmte Staatsbürger den Staat konstituiert. Dieser Schritt erfordert am meisten Energie. Wir dürfen nicht bei der Betrachtung des Triptychons stehenbleiben, sondern müssen vom gesamten Kirchenschiff zumindest versuchen einen Eindruck zu bekommen. Dazu muß die gesamte Staatsphilosophie Kants wenigstens in den Grundzügen einbezogen werden.
I. Pflicht zum Staat
1. Der Naturzustand
Zunächst müssen wir danach fragen, wie der Staat aus den Staatsbürgern gebildet wird. Sogleich stoßen wir auf die traditionellen Linien der englischen Staatsphilosophie.
a) Der apriorische Naturzustand
Kant folgt Hobbes und Locke nur bedingt. Entsprechend seinem Bemühen, die Rechtsphilosophie auf apriorische Prinzipien zu stellen, betrachtet er auch den Naturzustand nicht empirisch, sondern als Idee. Damit wird er von der anthropologischen Begründung des Krieges aller gegen alle frei: Die Menschen "mögen auch so gutartig und rechtliebend gedacht werden, wie man will, so liegt es doch a priori in der Vernunftidee eines solchen (nicht-rechtlichen) Zustandes, daß, bevor ein öffentlich gesetzlicher Zustand errichtet worden, vereinzelte Menschen, Völker und Staaten niemals vor Gewalttätigkeit gegeneinander sicher sein können, und zwar aus jedes seinem eigenen Rechte, zu tun, was ihm recht und gut dünkt, und hierin von der Meinung des anderen nicht abzuhängen".[87]
b) Rechtloser Rechtszustand?
Der Naturzustand ist für Kant im wesentlichen der Zustand des bloßen Privatrechts, in dem "jeder für sich die Ausübungsbedingungen der natürlichen Gesetze über das Mein und Dein" festlegt.[88] Demgemäß gibt es im Naturzustand keine rechtlichen Positionen. Auch der Besitz ist nur ein provisorischer. Im Gegensatz zur materiellen Lockeschen Theorie vom Erwerb durch Arbeit, die dem Gegenstand "etwas hinzufügt, was sein eigen ist",[89] wird der Besitz bei Kant rein formal durch ursprüngliche Aneignung (Okkupation) erworben, die (rechtlich) unter dem Vorbehalt der Zustimmung des allgemeinen Willens steht.[90]
Will man Deggau folgen, liegt in der Konstruktion des Naturzustandes bei Kant ein Widerspruch: Der Naturzustand werde als rechtloser Zustand charakterisiert, kenne aber zumindest privatrechtliche Positionen, sei also ein rechtloser Zustand mit Recht.[91] Diesen Vorwurf müßte Deggau auch gegen Locke machen.
In der Tat äußert sich darin der zwiespältige Sinn, mit dem das Wort "Recht" von Kant im Zusammenhang mit dem Naturzustand gebraucht wird. Kant kennt ein Recht außerhalb des Rechtszustandes. Dieses Recht hat aber als bloßes Privatrecht mindere Qualität als das öffentliche Recht im Rechtszustand. Nur das Recht im Rechtszustand vermag die Trennung von Richter und Prozeßpartei zu gewährleisten. Nur in ihm ist ein unabhängiger Schiedsspruch möglich. Zwischen dem Recht im Naturzustand und jenem im Staatszustand ist also ein erheblicher qualitativer Unterschied. Man wird unter Zugrundelegung dieser Unterscheidung an der Terminologie Kants festhalten können.
2. Die Begründung des Staates
Welches Ziel verfolgt der Mensch mit der Begründung des Staates?
a) Traditionelle Konzeptionen
Zur Beantwortung dieser Frage ist es sinnvoll, einen Schritt in die Vergangenheit zu tun, um zu sehen, wie diese Frage traditionell vor Kant beantwortet wurde: Ziel der Staatsgründung bei Aristoteles war die Polis, in der allein die Menschen, die aufgrund der ökonomischen Bedingungen naturgemäß zur Schaffung des Gemeinwesens bestimmt sind, in Selbsterhaltung und Selbstgenügsamkeit ihre Besonderheiten zugunsten einer Autarkie des Gemeinwesens aufgeben.[92] Das Bedürfnis nach Sicherung des Privateigentums tritt bei Aristoteles nicht in Erscheinung. Für Hobbes, der durch Begründung des Staates den Krieg aller gegen alle der empirischen, sich gegenseitig konkurrierenden Individuen beenden will, findet der Zusammenschluß zum Staat nur aus der Nützlichkeitserwägung statt, sich selbst zu erhalten.[93] Nach Ansicht Saages schmiegt sich die Konzeption Kants praktisch eng an Hobbes an. Die freiheitliche Zustimmung der Rechtsunterworfenen sei als Grundlage des Staates ausgeschlossen. Der Staat sei für Kant vielmehr eine "utilitaristische Vorrichtung", eine "Sphäre hypothetischer Imperative ... , in der der Egoist sich prinzipiell aus der Furcht vor Strafe, nicht aber aufgrund der Autonomie seiner Vernunft sich den Zwangsgesetzen unterwirft."[94]
b) Die apriorische Rechtspflicht zum Staat
Diese Ansicht geht fehl. Für Kant ist der Übergang in den Rechtszustand keine Nützlichkeitserwägung, sondern oberste apriorische Rechtspflicht. Sie entspringt dem praktischen Prinzip, das Kant schon in der Grundlegung entwickelte, der "Idee des Willens jedes vernünftigen Wesens als eines allgemein gesetzgebenden Willens ... Man sah den Menschen durch seine Pflicht an Gesetze gebunden, man ließ es sich aber nicht einfallen, daß er nur seiner eigenen und dennoch allgemeinen Gesetzgebung unterworfen sei ...".[95] In der Metaphysik der Sitten heißt es schließlich: "Das erste, was" dem Menschen "zu beschließen obliegt, wenn er nicht allen Rechtsbegriff entsagen will ... : man müsse aus dem Naturzustande, in welchem jeder seinem eigenen Kopfe folgt, herausgehen und sich mit allen anderen ... dahin vereinigen, sich einem öffentlich gesetzlichen äußeren Zwange zu unterwerfen, also in einen Zustand treten, darin jedem das, was für das Seine anerkannt werden soll, gesetzlich bestimmt und durch hinreichende Macht ... zu Teil wird, d.i. er solle vor allen Dingen in einen bürgerlichen Zustand treten",[96] d.h. in "dasjenige Verhältnis der Menschen untereinander, welches die Bedingungen enthält, unter denen allein jeder seines Rechts teilhaftig werden kann".[97]
Den Grund für dieses Postulat können wir aus einer Betrachtung der Kantischen Rechtspflichten gewinnen, die allesamt aus der angeborenen Freiheit sprießen:[98]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die dritte dieser Rechtspflichten ist die Subsumtion der beiden ersteren. Dabei erinnern wir uns, daß schon die angeborene Freiheit auf die Bedingung eingeschränkt ist, "sofern sie zusammen mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann".[99] Der Mensch hat niemals das "Recht auf alles, die Menschen selbst nicht ausgenommen", wie es Hobbes,[100] nicht dagegen Locke,[101] angenommen hatte. Damit wird der Naturzustand von einer Beweisfigur zum begrifflichen Experiment, das unter Vorstellung reinen Privatrechts den Übergang aus diesem in das öffentliche Recht, in dem durch Konsens Rechtssicherheit hergestellt wird, postuliert. Nur im Staat kann das so definierte Freiheitsrecht durchgesetzt werden.
Herrschaft wird damit unvermeidlich.[102] Aber nur so entsteht öffentliche Gerechtigkeit: "... das formale Prinzip der Möglichkeit" des bürgerlichen Zustandes, "nach der Idee eines allgemein gesetzgebenden Willens betrachtet, heißt die öffentliche Gerechtigkeit ...".[103] Die öffentliche Gerechtigkeit ist die iustitia distributiva, die austeilende Gerechtigkeit, von der schon Aristoteles gesprochen hatte.
Besondere Bedeutung kommt nach Habermas dem Prinzip der Öffentlichkeit im Staat zu: In subjektiver Hinsicht ist es das Prinzip, laut zu denken, ein Anspruch des Einzelnen auf Redefreiheit. Damit ist es Prinzip der Aufklärung. In objektiver Hinsicht ist es der Fortschritt zur vollkommenen Ordnung. Öffentlichkeit heißt hier gerechtes Zusammenleben unter vernünftigen Gesetzen. Damit tut sich im Prinzip der Öffentlichkeit eine Brücke zwischen Politik und Moral auf.[104] Die Staatsgründung erscheint unter dieser Interpretationslupe als allein der Öffentlichkeit, der Allgemeinheit dienend. Das Individuum dient mit seiner Person der Allgemeinheit. Indes darf man das Prinzip der Öffentlichkeit gerade im Hinblick auf die Notwendigkeit der Vermittlung von Politik und Moral nicht überbewerten. Die Individualität und Personalität der Staatsbürger, die für Kant sehr wichtig ist, darf dabei nicht untergehen.
Es sei hier nur angedeutet, daß Kant mit seiner Idee vom Weltfrieden in ähnlicher Weise noch weit über den Staat hinausgeht. Der Staat ist im System aller Staaten aufgrund der Personalität seiner Staatsbürger selbst Person. Das Postulat des Weltfriedens gleicht insoweit dem der Begründung eines rechtlichen Zustandes.[105] Hier soll der Zusammenschluß den Krieg zwischen den Staaten aufheben, denn Kant haßt den Krieg, der "die menschlichen Verhältnisse auf Zufall und Gewalt" stellt und "die bösartigen Triebe der menschlichen Natur zur Entwicklung" bringt, "indem er die Schranken des Rechts und der Moral niederbricht."[106]
c) Die Schaffung peremptorischen Besitzes
Auch vom ungesicherten Besitz her verstehen wir die Notwendigkeit des Staates: Kant geht von der Idee eines ursprünglichen Gemeinbesitzes aus, der bei der Begründung von Privatbesitz die Zustimmung des allgemeinen Willens erforderlich macht. Paradoxerweise wird der Privatbesitz damit durch den Gemeinbesitz begründet, indem er unter dessen Aufhebungsbedingung gestellt wird.[107] Der Vorbehalt des allgemeinen Willens kann aber nur im Rechtszustand erfüllt werden, was die Errichtung des Staates zur Pflicht macht. Im Staat wird das provisorisch Erworbene durch ein Gesetz des allgemeinen Willens "peremptorischer" (d.h. das Provisorische aufhebender) Besitz. Das objektive öffentliche Gesetz bestimmt folglich nicht, was Eigentum ist, sondern dies tut nach wie vor das subjektive Privatrecht (als "Recht außerhalb des Staates"[108] ); aber das Gesetz sichert den aus dem Privatrecht hervorgehenden Besitz. Daher hat das öffentliche Recht auch keine inhaltlichen Antworten auf die Frage nach der Eigentumsordnung.[109]
Das Wesen des Staates kann im Verhältnis zum Eigentum auf folgende Formel gebracht werden: "Der Staat ist die Voraussetzung des peremptorischen Besitzes, steht seinerseits aber unter der Bedingung der Möglichkeit eines provisorischen Besitzes." Damit ist die primäre Funktion des Staates nicht die Monopolisierung der Gewalt, sondern die Ermöglichung der Zustimmung der freien anderen zum freiheitseinschränkenden Eigentumserwerb des einen, die zur Ausübung der Freiheit notwendig ist.[110]
d) Die Bedeutung der metaphysischen Begründung
Wir stellen fest: Der Staat ist bei Kant schon a priori legitimiert durch die Rechtspflicht, den Naturzustand zu verlassen (principium exeundum e statu naturali). Diese metaphysische Begründung des Staates, seiner Herrschaft und seiner Gesetze ist das Bahnbrechende an der Kantischen Rechtsphilosophie, weil dadurch nach den rechtstheologischen Konzepten der Scholastik, die durch die frühneuzeitlichen rechtsrealistischen Kontrakttheorien seit Machiavelli und Hobbes ihre Begründungskraft verloren hatten, erstmals wieder - und zwar gar nicht weit entfernt vom Idealismus der antiken Philosophie - ein Weg gefunden ist, den Staat als repräsentatives Prinzip in seinem Dasein zu berechtigen.[111]
3. Ursprünglicher Vertrag und allgemeiner Wille
Die aristotelisch-scholastische Tradition kennt keinen ursprünglichen Vertrag, weil sie den durch die Staatsbürger als Gemeinschaftswesen (zoon politikon) gebildeten Staat und die Herrschaft als Naturgesetz immer schon voraussetzt.[112] Hobbes hatte mit seinem negativen Menschenbild diesen Vertrag notwendig gemacht. Er überträgt durch den Vertrag alle Macht dem Leviathan. Der Kontrakt will dabei zwei Dinge leisten: Er will den Staat mit seinem Macht- und Herrschaftsanspruch legitimieren, damit auch die Verbindlichkeit der staatlichen Gesetze postulieren; zum anderen legt er die Bedingungen der Gesetzgebung fest und steckt damit die Grenzen ihrer Verbindlichkeit ab. Der in dieser Doppelrolle liegenden Gefahr zu begegnen, daß durch ständige Normenkontrolle der Vertragspartner der Naturzustand zementiert wird, bleibt entweder das Postulat des gerechtigkeitsunabhängigen politischen Gehorsams - so Hobbes - oder das Postulat einer (nicht-rechtlichen) Gehorsamsempfehlung für den Fall einer ungerechten Herrschaft - so Rousseau. Der Kantische Begriff vom allgemeinen vereinigten Willen ist nach Kants Vorstellung unmittelbarer Nachfahre des Rousseauschen Begriffs von der volonté générale. War bei diesem aber noch nicht deutlich, ob es sich um einen empirischen oder normativen Willen handelt, so befreit Kant den allgemeinen Willen von aller Erfahrung. Kants Zweiweltenlehre läßt den Rousseauschen Begriff lediglich als Modell einfließen, "das die Strukturen jener geistigen Welt beschrieb, die die Welt der erfahrbaren Kräfte und Vermögen übersteigt und fundiert."[113]
Welche Rolle spielt der Vertrag nun in Kants apriorischer Konzeption? Kant hat den Vertrag von seiner Doppelrolle befreit. Für ihn fällt die Legitimationsfunktion fort. Der Staat ist auch ohne ursprünglichen Vertrag a priori legitimiert aus den allgemeinen Prinzipien der Freiheit als "geordnetes Verfahren der Rechtssetzung, -anwendung und -durchsetzung zum Zwecke der Sicherung des Rechts eines jeden und der Befriedung der Gesellschaft."[114] Erstmals in der Geschichte der Vertragsphilosophie wird mit der Aufgabe der Doppelrolle des Vertrages durch Kant die Gesellschaft von der Herrschaft unterschieden. Die bürgerliche Gesellschaft ist nicht mehr Ursache des Vertrages, sondern dessen Wirkung.[115]
Damit wird der Vertrag frei für die widerspruchsfreie Erfüllung seiner zweiten Aufgabe, die aber nicht die Begründung des Staates, sondern seine Veränderung betrifft.[116]
4. Disziplinierung der Gesellschaft
Wie sieht es aber mit der Realisierung des allgemeinen Willens aus? Durch das Verlassen des ungesicherten, unberechenbaren Naturzustandes und das Hineintreten in einen geordneten, gesicherten Staatszustand soll der Einzelwille dem Gesamtwillen untergeordnet werden. Das kann nur durch autoritative Herrschaft erreicht werden. Ist nicht die damit erreichte Disziplinierung der Gesellschaft aber im Grunde nichts anderes als eine abgeschwächte Form des Hobbesschen Leviathans? Nur wenn sie gelingt, ist die bürgerliche Gesellschaft auf Dauer überlebensfähig. Der öffentliche Gebrauch der natürlichen Freiheit und das Disziplinierungsinteresse der Gesellschaft stehen in einem Spannungsverhältnis, das mit Hilfe des Rechtsgesetzes aufgelöst werden soll in einer "Einheit von Willkür und Gesetz, Freiheit und Zwang, Individuum und Allgemeinheit." Mit der Äußerlichkeit des Rechtsgesetzes wird aber das Recht von der Verantwortung für die innere Freiheit befreit - und damit "für die Unfreiheit freigegeben."[117] Die Allgemeinheit siegt über das Individuum!
Die Allgemeinheit des Willens ist nicht real. Bedeutet er nicht eine ungerechtfertigte Formalisierung der rechtlichen Begründung? Es scheint tatsächlich so, daß "zwischen der formalen Allgemeinheit des moralischen Gesetzes und seiner möglichen materialen Allgemeingültigkeit ... ein Widerspruch" klafft, "der innerhalb der Kantischen Ethik nicht zu überwinden ist."[118]
5. Die Verfassung
Wie muß nun die Verfassung des Staates aussehen, den zu gründen oberste Rechtspflicht ist?
a) Gewaltenteilung
Durch die Verknüpfung der Staatsgewalten als einer Art Dreieinigkeit des allgemeinen Willens mit den Schritten der Rechtsanwendung erhalten die Gewalten bei Kant apriorischen Charakter: "Ein jeder Staat enthält drei Gewalten in sich, d.i. den allgemein vereinigten Willen in dreifacher Person (trias politica): die Herrschergewalt (Souveränität) in der des Gesetzgebers, die vollziehende Gewalt in der des Regierers (zufolge dem Gesetz), und die rechtsprechende Gewalt (als Zuerkennung des Seinen eines jeden nach dem Gesetz) in der Person des Richters", die verglichen werden können mit "dem Obersatz, der das Gesetz jenes Willens, dem Untersatze, der das Gebot des Verfahrens nach dem Gesetz, d.i. das Prinzip der Subsumtion unter denselben, und dem Schlußsatze, der den Rechtsspruch (die Sentenz) enthält, was im vorkommenden Falle Rechtens ist".[119]
Ja, die Gewaltenteilung hat für Kant sogar eine religiöse Dimension: Er sieht sie in Gott als dem heiligen Gesetzgeber, dem gütigen Regierer und dem gerechten Richter vereinigt. Das irdische Abbild stellt die Vernunftherrschaft dar, die als Ergebnis einer inneren Verfassung moralische Gesetzgebung, Achtung des Gesetzes und Gericht in Gestalt des Gewissens koordiniert.[120]
b) Herrschaftsform und Regierungsart
Wie sieht Kant nun aufgrund der staatsbürgerlichen Prinzipien die Frage der richtigen Verfassung?
Am Anfang verfassungstypologischer Überlegungen stand das Sechs-Verfassungen-Schema des Aristoteles. Er teilte nach der Anzahl der Herrschenden in Monarchie, Aristokratie und Politie als echte Verfassungen, Tyrannis (Despotie), Oligarchie und Demokratie als Fehlentwicklungen dieser Verfassungen. Bodin hat im Zuge einer Entethisierung der Verfassungsrechtslehre dieses Schema auf die "richtigen" Verfassungen reduziert, damit sich die Verfassungslehre nicht in einem "endlosen Labyrinth" verirre und mit unwesentlichen Wertungen ins Uferlose differenziere.[121] Mit Rousseaus Forderung nach Volkssouveränität war die Diskussion um die richtige Verfassung beendet. Souverän war stets das Volk allein. Die Demokratie war als einzige richtige Verfassung erkannt und jede andere Herrschaftsform despotische Anmaßung. Kant allerdings folgt hier nicht seinem großen Vorbild Rousseau, sondern knüpft an das Schema Bodins an. Parallel zur Anzahl der Herrschenden sind antithetisch die Regierungsarten des Republikanismus und des Despotismus gesetzt. Für Kant ist auch nicht die Herrschaftsform, sondern einzig und allein die Regierungsart wichtig: "... in allen drei Staatsformen kann die Regierungsform republikanisch sein."[122] Grundsätzlich könne sogar die Autokratie die republikanische Regierungsart - unter Voraussetzung eines reformfreudigen Herrschers - am wirkungsvollsten verwirklichen.
Die Entwicklung des Verfassungsschemas zeigt das folgende Schaubild.[123]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kants politisches Konzept heißt nicht Revolution. Diese ist unter dem lebendigen Eindruck aus Frankreich für Kant mit unberechenbarem Terror und Rechtsunsicherheit verbunden. Reform zur Republik ist das politische Konzept, das Kant sich für Europa denkt. Kant schwebt eine Reform vor, wie es sich Louis Sébastien Mercier in seiner Utopie "L'An 2440" ausmalte: "Ihr könnt es glauben oder nicht: Die Revolution wurde ohne große Anstrengungen bewirkt, und zwar durch den Heldenmut eines bedeutenden Mannes. Ein Philosoph auf dem Thron, seiner Stellung würdig, weil er sie gering achtete, mehr um das Glück der Menschen als um das Phantom der Macht besorgt ..."[124]
c) Republikanismus
Was meint Kant mit Republikanismus? Die Definition irritiert: "Republikanismus ist das Staatsprinzip der Absonderung der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der gesetzgebenden; der Despotismus ist das der eigenmächtigen Vollziehung des Staats von Gesetzen, die er selbst gegeben hat".[125] Die Unterscheidung von Republikanismus und Despotismus wird hier allein an dem Vorhandensein von Gewaltenteilung festgemacht. Das erscheint wenig überzeugend, kann doch auch ein getrennter Herrschaftsapparat despotische Züge annehmen.[126] Wir haben hier einen weiteren Ausfluß des Kantischen Formalismus vor uns. Die Gewaltenkonzentration beim Hausvater im vorstaatlichen Zustand muß durch Gewaltenteilung im rechtlichen Zustand aufgelöst werden, um eine freiheitliche Gesetzgebung des allgemeinen Willens zu gewährleisten. Republikanismus ist damit die einzige dem Staatsbürger gerecht werdende Regierungsart. Inhaltlich ist damit über das Recht aber noch nichts ausgesagt. Gewaltenteilung kann als Gerechtigkeitskriterium für Herrschaft nicht ausreichen.[127]
Der Staat ist bei Kant als Ideal gedacht. Und dieses Ideal, d.h. der Endzustand der politischen Entwicklung, die Kant fordert, die einzig rechtmäßige Verfassung, ist die Republik. Die Republik aber ist das Ende der Autokratie, ähnlich, wie der Rechtszustand das Ende des Naturzustands war.[128]
Die Republik beinhaltet zum einen die drei Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit als Grundrechte der Staatsbürger, zum anderen das Prinzip der Gewaltenteilung als Organisationsnorm. Diesen Gedanken der Republik muß nach Kant der Herrscher bei allen Handlungen im Auge behalten.
Damit haben wir ein inhaltliches Kriterium gefunden: Nichts anderes als die eingangs diskutierten staatsbürgerlichen Prinzipien bilden den Inhalt des Rechts.
Die Einbeziehungen der Grundrechte führt zu konkreten Konsequenzen. Kant nennt die Abschaffung der Adelsprivilegien, die Ablehnung der Verbindlichmachung eines bestimmten Glaubens sowie das Verbot, ein einmal gegebenes Amt grundlos wieder zu entziehen.[129] Bei völkerrechtlichen Transaktionen darf die Personalität der Staatsbürger nicht aufgehoben werden: Der Feldherr darf seine Untertanen nicht bei Lebensgefahr in den Krieg schicken, denn diese können einer Aufhebung ihrer Personalität unmöglich zugestimmt haben.[130]
Die Regierung muß nach Kant patriotisch i.S.v. vaterländisch sein: Sie behandelt die "Untertanen zwar gleichsam als Glieder einer Familie, doch zugleich als Staatsbürger, d.i. nach Gesetzen ihrer eigenen Selbständigkeit". Eine solche Regierung verschafft dem Staat die Autonomie, sich selbst nach Freiheitsgesetzen zu bilden und zu erhalten. Nicht Glückseligkeit bedeutet das Heil des Staates, sondern "der Zustand der größten Übereinstimmung der Verfassung mit Rechtsprinzipien, als nach welchen uns die Vernunft durch einen kategorischen Imperativ verbindlich macht."[131]
d) Die Notwendigkeit der Repräsentation
Kant hält den im Staat erscheinenden allgemeinen Willen für repräsentierbar: "Alle wahre Republik aber ist und kann nichts anderes sein als ein repräsentatives System des Volks, um im Namen desselben, durch alle Staatsbürger vereinigt, vermittelst ihrer Abgeordneten (Deputierten) ihre Rechte zu besorgen."[132] Der Herrscher ist als Repräsentant, als Stellvertreter des allgemeinen Willens inhaltlich an den allgemeinen Willen gebunden.
Der Gedanke der repräsentativen Demokratie wirft Probleme auf. Wie soll nämlich in einer solchen Staatsform der allgemeine Wille gefunden werden? Kant meint: durch die Mehrheitswahl. Dadurch würde jedoch die vertragliche Realisation zum vernunftrechtlichen Verfassungstext erhoben, die Richtigkeitsgewähr zugunsten einer funktionsfähigen Parlamentsarbeit geopfert. Die Gefahr dabei liegt auf der Hand: Gerade dort, wo es am notwendigsten scheint, wäre die Wirkungskraft der Reformidee lahmgelegt, wäre der partikuläre Wille des Gesetzgebers schon gleichgesetzt mit dem allgemeinen Willen und das System der repräsentativen Demokratie schon das Endstadium, über das hinaus zur Republik zu gelangen nicht mehr notwendig erschiene. Nur wenn man die generelle Vernünftigkeit der Parlamentarier zur Voraussetzung machen wollte, läge keine Gefahr vor. Das aber ist unrealistisch. Vielmehr muß das Prinzip eines omnipotenten Gesetzgebers zugunsten des Verfassungsstaates aufgegeben werden, in dem die vernunftrechtlichen Prinzipien positiv-rechtlich kodifiziert sind und der Gesetzgeber rechtlich an diese gebunden ist. Die Verfassung muß "gegen zwei Verfälschungsmöglichkeiten immunisiert werden: weder darf sie ... Welt- und Menschenbilder verordnen ..., noch darf sie gänzlich dem Zugriff des Gesetzgebers ausgeliefert werden."[133]
e) Die reine Rechtsgesellschaft
Am Ende der Entwicklung steht als Ideal die Republik, die reine Rechtsgesellschaft.
In diesem Ideal Kants liegt nach Meinung Deggaus ein Widerspruch: Indem nämlich der Staat mit seinem Herrschaftsanspruch in der Republik aufgelöst werde, falle der Mensch notwendigerweise in einen Zustand zurück, der mit dem Naturzustand vergleichbar sei. Die reine Rechtsgesellschaft werde dadurch charakterisiert, daß der subjektive Wille des Einzelnen und der allgemeine Wille zu einer Einheit verschmelzten. Das aber ist nach Deggau eine praktisch unmöglich realisierbare Utopie. Kant habe dies wohl auch gesehen und daher die allmähliche Reform des Staates der ungewissen, am Ende auch nicht zum Ideal führenden Revolution vorgezogen.[134]
Es trifft zu, daß Kant sich gefragt hat, ob man nicht einen "Staat von Engeln" voraussetzen müsse, um zur reinen Republik zu kommen. Die Lösung heißt aber gerade nicht - wie bei Aristoteles - Vereinigung der von Natur aus für das Gemeinwesen bestimmten Menschen, sondern Aufhebung der zerstörerischen Egoismen (Volk von Teufeln) durch eine kompensierende Macht.[135] Kant geht es so gesehen gar nicht um die Realisierung einer reinen Rechtsgesellschaft, sondern darum zu zeigen, daß selbst unter noch so widrigen empirischen Bedingungen eine dem Ideal der Republik entsprechende Gesetzgebung möglich ist.
Nach unserer oben entwickelten Interpretation der Selbständigkeit kann man nun dem Reformprozeß zur Republik nicht mehr entgegensetzen, daß die ökonomische Konstitution des Staatsbürgers eine "Auflösung der politischen Herrschaft in einer 'reinen Rechtsgesellschaft'" unmöglich macht.[136]
f) Die Legitimierung des historischen Staates
Die republikanische Regierungsart übernimmt nun bei Kant die Funktion, den Staat in seiner konkreten geschichtlichen Gestalt zu legitimieren. Wir haben gesehen, daß der Staat als solcher schon a priori legitimiert ist. Aber der geschichtliche Staat mit seiner Verfassung bedarf noch der Berechtigung, wenn nicht jedes staatsähnliche Gebilde aus der apriorischen Legitimation her begründet werden soll, denn das hätte zur Folge, daß der geschichtliche Staat überhaupt nicht auf seine Berechtigung hin überprüft werden könnte. Wenn aber der geschichtliche Staat so regiert wird, daß er in der Zukunft irgendwann in die Republik einmündet, dann ist sein Dasein berechtigt, denn er dient dem überzeitlichen Ziel, die einzig wahre Herrschaftsform zu begründen. Durch die Legitimierung des Staates löst Kant "den Gegensatz zwischen der reinen Republik und der geschichtlichen Herrschaftsordnung reformistisch in einen zielgerichteten Prozeß der Realisierung der freiheitsgesetzlichen Ordnung menschlichen Zusammenlebens auf."[137] Der geschichtliche Staat wird durch sein Ideal zwar relativiert, aber nicht an seiner Durchsetzungskraft gehindert, wenn er dem Ideal Rechnung trägt.
Wir bemerken deutlich die Hand, die Kant dem Staat seiner Zeit zum Kompromiß reicht. Kant will sagen: Statt die Republik zu fordern und damit die blutige Revolution zu fördern, legitimiere ich dich in deiner monarchischen Gestalt, wenn du als Gegenleistung dafür republikanisch regierst und den vereinigten Willen des Volkes in deiner Gesetzgebung zur Geltung bringst. - Kant als "devoter Bittsteller",[138] ganz im Sinne des bürgerlichen Liberalismus seiner Zeit. Der Verzicht auf die politische Freiheit, wenn nur die bürgerliche gewährleistet wäre, war im Deutschland Kants konsensfähig.
Für unsere Zeit stellt sich die Frage nach der Vereinbarkeit von Republikanismus und Monarchie nicht mehr, doch gewinnt die Reformidee auch für die moderne Verfassung an Aktualität, weil sie diese, selbst wenn sie dem Ideal der Republik nicht entsprechen sollte, um der Verwirklichung derselben zu legitimieren imstande ist.
II. Recht auf Staat
Wenn wir eine Pflicht zum Staat apriorisch aus der Vernunft gewinnen, dann stellt sich uns die Frage, ob es im Gegenzug auch ein Recht auf Staat, genauer: einen subjektiven Anspruch auf einen bestimmten Staat gibt.
Wir haben die Frage schon beantwortet: Der Republikanismus, der den Herrscher zur Verwirklichung der Republik verpflichtet, ist die verfassungstheoretische Ausprägung dieses subjektiven Rechtes auf den republikanischen Staat. Es gilt jetzt, diese Linie aufzunehmen und zu konkretisieren.
1. Der ursprüngliche Vertrag
Wir werfen zunächst wieder einen Blick auf den ursprünglichen Vertrag. Kann er die Aufgabe übernehmen, ein Recht auf Staat zu vermitteln?
Der ursprüngliche Vertrag ist als gedachter Akt der äußere Ausdruck dafür, daß der Mensch "die wilde, gesetzlose Freiheit gänzlich verlassen" hat, "um seine Freiheit überhaupt in ... einem rechtlichen Zustand unvermindert wieder zu finden; weil diese Abhängigkeit aus seinem eigenen gesetzgebenden Willen entspringt."[139] Der Vertrag wird von allen empirischen Elementen befreit: Es geht bei der Gesetzgebung nicht mehr darum, daß tatsächlich jeder Staatsbürger dem Gesetz zustimmt, sondern nur noch darum, daß er theoretisch hätte zustimmen können; der Herrscher muß die Bürger nicht nach ihrem Willen fragen, aber er darf auch keine Gesetze geben, die mit der Idee eines allgemeinen Willens im Widerspruch stehen.[140] Das aber bedeutet, daß der Vertrag im Grunde keine weiteren Erkenntnisse über den Inhalt des Rechts erlaubt als das allgemeine Rechtsgesetz der Freiheit und Gleichheit.[141]
Ist der Vertrag also in Kants System überflüssig?[142] - Nein, denn er ist als Zustimmung der Allgemeinheit notwendig für die Herstellung der Übereinstimmung des Einzel- mit dem Gesamtwillen. Der Vertrag bewahrt die Freiheit eines jeden, die ihm nach Kant sowieso nur unter der Bedingung der Freiheit der anderen zukommt. Der Vertrag ist ein Prinzip der nicht durch ihn legitimierten Verfassung,[143] eine Formel für den Souverän, mit der er in der Chemieküche der Gesetzgebung die richtige Zusammenstellung finden kann. "Für Kant hat jede personale und institutionelle Autorität sich auszuweisen vor der Idee eines allgemeinen Gesetzes."[144]
Kants Idee von Volkssouveränität sieht also (lediglich) vor, den Herrscher auf die nach Freiheitsgesetzen mögliche Gesetzgebung zu verpflichten. Eine darüber hinausgehende Beteiligung des Volkes sieht Kant nicht vor. Damit findet aber nur eine gedachte Volkssouveränität statt, die sich praktisch gar nicht auswirken kann. Das ist auch nicht beabsichtigt, weil sonst die oben erwähnte Funktion des Staates, die Gesellschaft zu disziplinieren, Gefahr läuft, unerfüllt zu bleiben.
Wir halten dies in einer These fest: Der Herrscher ist Repräsentant des Volkes. Er ist bei der Ausübung der ihm durch einen gedachten Vertrag übertragenen Macht an die Bedingung des vereinigten Willens gebunden, daß die Entscheidung auch vom gesamten Volk getragen werden könnte. Volkssouveränität ist bei Kant auf ein reines Gedankenexperiment abgewertet. Sie bedarf der institutionellen Äußerung nicht, weil der Herrscher bei Berücksichtigung des Gedankens der Volkssouveränität schon aller Rechtsstaatlichkeit Genüge tut.
2. Recht auf Demokratisierung
Stellen wir auf diese Weise etwas ernüchtert fest, daß die Ideale Kants kaum Anspruch erheben, in der gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit realisiert zu werden, so möchten wir uns enttäuscht abwenden und die ganze Kantische Rechtsphilosophie vergessen. Wir sollten uns aber ermuntern lassen durch die dynamische Komponente des Rechts auf Staat. Kant will durch die Transformation der geschichtlichen Faktizität der bürgerlichen Gesellschaft in ein ideales Apriori nicht die bestehende Ordnung verewigen, sondern "in ihr ist auch jene Tendenz zur Transzendierung des bürgerlichen Autoritätssystems wirksam".[145] Wenn gegenüber dem Herrscher keine Revolution möglich, wenn nur Reform durch ihn selbst mit den Prinzipien des Staates vereinbar ist, dann stellt sich die Frage, ob der einzelne Staatsbürger nicht einen subjektiven Anspruch auf ebendiese Reform, auf Demokratisierung hin zur Republik hat.
Wir haben oben gesehen, daß die Selbständigkeit als Prinzip staatlicher Gewalt gerettet werden kann, wenn sie als Recht auf Selbständigkeit gedeutet wird. Wenn die Gründung des (idealen) Staates oberste Rechtspflicht ist, so muß es im Gegenzug auch ein Recht auf diesen Staat geben. Der Rechtspflicht, jedem seine Freiheit zu lassen, korrespondiert als unsichtbare Grenze des freiheitlichen Handelns ein subjektives Recht auf Einhaltung der Bedingungen des Rechtsgesetzes der Freiheit[146] - und damit ein subjektives Recht gegenüber dem zeitlichen Herrscher, so zu regieren, daß der ideale Staat Grundlage der Regierung ist. Die Gewalt des Staates muß für eine freiheitliche Gesetzgebung dienen. Der Mensch hat nicht nur eine "Pflicht zum Staat", sondern auch ein "Recht auf Staat",[147] man könnte auch sagen: ein Recht auf Republik.
Von hier aus läßt sich die Bedeutung der drei Staatsbürger-Rechte genauer fassen: "Sie sind selbst keine Menschenrechte, stehen aber im unmittelbaren Bezug zum ... Menschenrecht auf Staat."[148] Die "Idee einer mit dem natürlichen Rechte der Menschen zusammenstimmenden Konstitution" verlangt, daß "die dem Gesetz Gehorchenden auch zugleich 'vereinigt' gesetzgebend sein sollen".[149] Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit sind die Voraussetzungen des ursprünglichen Vertrages und begründen durch ihn den demokratischen, sozialen Rechtsstaat, in dem jeder durch politische Mitbestimmung sein Recht auf politische Freiheit wahrnehmen kann, - und zwar nur diesen; denn nur in der Demokratie wird das Recht des Menschen auf politische Freiheit durch die aktive politische Mitbestimmung gewährleistet.[150]
Welche Konsequenz ergibt sich nun für die Feststellung des allgemeinen Willens? Durch Wahlen wird die Verantwortung der Staatsbürger auf das Parlament übertragen. Die Beschlüsse des Parlaments werden dann als Bezeugungen des allgemeinen Willens gelten gelassen. Angesichts des entwickelten Rechts auf den idealen Staat, in dem einzelner und allgemeiner Wille identisch sind, kann diese Realität nicht befriedigen. Die Demokratie muß dem Anspruch gerecht werden und in der Realität das Freiheitsprinzip mitreflektieren. "Quantität ist keine adäquate Basis für Demokratie."[151] Das Mehrheitsprinzip kann daher für die demokratische Willensbildung nicht allein ausschlaggebend sein. Hinzukommen muß die Garantie der politischen Freiheit auch außerhalb von Parlamentsmehrheiten.
Die Mehrheit ist nicht notwendig im Besitz der Wahrheit. Ihre Rechtsauffassung wird nur temporär geltendes Recht; daneben ist als prinzipiell gleichberechtigte Alternative die Minderheitsmeinung präsent.[152]
Daraus ergibt sich eine weitere Forderung: Der Staat muß als Institution zur Herbeiführung des herrschaftsfreien Zustandes der Republik die Voraussetzungen politisch-gesellschaftlicher Freiheit des Einzelnen schaffen. Die Ausdehnung und Ausübung der Freiheit steht unter dem Vorbehalt, daß die Freiheit der anderen ebenso geschaffen oder erhalten werden kann.[153] Zur Entwicklung dieser Freiheit gehört die Förderung gesellschaftlicher ("privater") Freiheit: In nicht-politischen Institutionen (Ehe, Vereine, Wirtschaft, Kirchen), die auf begrenzte Zwecke gerichtet sind, kann sich der Mensch orientieren, einen "eigenen Geschmack und Vorlieben bilden". Aber er darf von ihnen nicht "eingesargt" werden. Auch in den nicht-politischen Institutionen müssen Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit Leitbild sein. Die Förderung dieser Institutionen durch den Staat ist notwendig, nicht als Selbstzweck, sondern weil nur dadurch auch die Wahrnehmung politischer Freiheit gewährleistet ist.[154]
Wir wollen unsere Erkenntnisse in einer Formel über das Verhältnis von Volkssouveränität und Menschenrecht zusammenfassen: Die Grundrechte auf Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit sind apriorische Konstitutionsbedingungen für den allgemeinen souveränen Willen. Es zeigt sich, daß Kant das Spannungsfeld zwischen Volkssouveränität (Vorrang des Allgemeinen) und Menschenrechten (Vorrang des Einzelnen) im Staat dadurch harmonisieren will, daß er die menschenrechtlichen Positionen als Konstitutionsbedingungen in den gesetzgeberischen Prozeß einbezieht und darin aufgehen läßt.
III. Die Verbindlichkeit positiven Rechts
Wie wirkt sich nun die Pflicht zum Staat und das Recht auf Staat in der geltungstheoretischen Verbindlichkeit des positiven Rechts aus? "Kants Theorie der Verbindlichkeit positiven Rechts versucht zwischen der Scylla des Naturrechts und der Charybdis des Rechtspositivismus einen mittleren Kurs zu halten." (Kersting) Sie bindet das positive Recht in seiner Gültigkeit nicht an überpositive Normen, spricht ihm aber auch nicht bloß aufgrund seiner Durchsetzungskraft Geltung zu.
1. Die Unerheblichkeit der Herrschaftsbegründung
Die Rechtspflicht zum Staat enthält ganz automatisch auch ein vernunftrechtliches Gebot zur Befolgung der aus dem allgemeinen Willen hervorgehenden Gesetze, wenngleich sie nicht mit der eigenen Rechtsmeinung übereinstimmen. Die (historische) Herrschaft wird so von der "Notwendigkeit fortwährender Selbstbehauptung" befreit und vermag nun ihre Macht selbst gesetzlich auf die Bedingungen der Republik einzuschränken. Sie wird, als Parallelerscheinung zum Eigentumsrecht, von einer bloß provisorischen Herrschaft zu einer peremptorischen.[155]
2. Der Konflikt
Die Herrschaftsbegründung ist aber nur die eine Seite einer möglichen Infragestellung des positiven Rechts. Die andere ist die Herrschaftsausübung. Solange der Herrscher die Bedingungen des Republikanismus erfüllt, mag man sich damit abfinden, daß die Art und Weise, wie er seine Herrschaft erlangt hat, außer Betracht bleibt. Problematisch wird es aber in der Konfliktsituation zwischen Bürger und Staat. Dieser Konflikt kann in verschiedenen Gründen liegen. Insbesondere muß zwischen dem politisch motivierten und dem aus einem Gewissenskonflikt folgenden Widerspruch des Einzelnen zur Allgemeinheit unterschieden werden.
a) Der Gewissenskonflikt
Die Gewissensfreiheit ist Teil der Freiheit. Sie dient dem Bürger, der nach "seiner Facon selig werden" will, aber auch dem Staat, der nur durch Gewährung der Voraussetzung der Glückseligkeitsbedingungen eines jeden Einzelnen durch die damit verbundene Erhaltung der inneren Existenz seiner Staatsbürger als vollständig, auch moralisch legitimiert erscheint. Daraus folgt, daß die Gewissensfreiheit als apriorisches Prinzip der allgemeinen Gesetzgebung dergestalt vorgeht, daß der Einzelne im Falle eines Gewissenskonfliktes Dispens von der Befolgung des allgemeinen Gesetzes verlangen kann. Dabei muß man allerdings berücksichtigen, daß Kants Gewissen als Ausfluß der praktischen Vernunft eine rein rationale Instanz ist.[156]
Wir stellen fest, daß er einen gleichwohl passiven Widerstand in einem Konflikt zwischen einer rechtlichen Gehorsamspflicht und grundlegenden moralischen Pflichten befürwortet, getreu dem Satz "Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen." (Apg 5, 29)
b) Der Rechtsweg
Anders sieht es bei einem bloß politischen Konflikt aus. Bloßer Dispens kann hier nicht verlangt werden, weil damit jede politische Konsensbildung von vornherein ausgeschlossen wäre. In Frage käme eine gerichtliche Durchsetzung der Grundrechte.
Die Grundrechte des Staatsbürgers auf Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit sind aber nach Kant nicht justiziabel. "Denn daß niemand innerhalb des Staates ohne Widerspruch auf Grund eines Rechtes klagen kann, mit der Begründung, daß er dieses Recht innerhalb des Staates, vor dessen Gericht er klagt, gar nicht habe, sieht jeder." Allein klagebefugt wäre die "Idee von einer Vereinigung unter allgemeinen Gesetzen der Freiheit". Das bedeutet aber, daß es eine Grundrechtsgerichtsbarkeit nicht geben kann.[157]
c) Der Widerstand
So bliebe im äußersten Fall noch das Widerstandsrecht. Ein solches lehnt Kant jedoch ab. Das Volk habe mit der Einrichtung des Staates das Urteil über die Gerechtigkeit an diesen abgegeben. Es sei demnach logisch ausgeschlossen, daß der Herrscher Unrecht tun könne, weil er selbst das Recht verkörpere.[158] Zur Rechtmäßigkeit des Widerstandes "müßte ein öffentliches Gesetz vorhanden sein, welches diesen Widerstand des Volks erlaubte, d.i. die oberste Gesetzgebung enthielte eine Bestimmung in sich, nicht die oberste zu sein, und das Volk als Untertan in einem und demselben Urteile zum Souverän über den zu machen, dem es untertänig ist; welches sich widerspricht, und wovon der Widerspruch durch die Frage alsbald in die Augen fällt: wer denn in diesem Streit zwischen Volk und Souverän Richter sein sollte".[159] Das Gericht des Volkes über den Herrscher würde zu einer Verdoppelung der Staatsautorität führen, zu einer dem Gedanken nach endlosen Instanzenreihe (regressus ad infinitum).[160]
Der moralische Wert der Gesetze wird dabei als Folge der allgemeinen Gesetzgebung einfach vorausgesetzt.[161] Im Widerstandsverbot äußert sich aber nicht lediglich die Überbetonung der Rechtssicherheit gegenüber der Gerechtigkeit;[162] es ist Ausfluß der friedensstiftenden Funktion des Rechtszustandes.
Ein positiv-rechtliches Widerstandsrecht würde in der Tat zu einer jederzeitigen Normenkontrolle durch das gesamte Volk führen, was die Selbstaufhebung der Gesetzgebung ins Unverbindliche bedeutete. Aber ist damit auch ein natur-rechtliches Widerstandsrecht unmöglich? Sollte sich Kant so im vernunftrechtlichen Elysium bewegen, daß er die empirische Struktur des Gesetzgebers übersieht?
Das positive Recht ist nur um des Zieles der Republik durch eine friedliche Reform anstatt einer blutigen, unberechenbaren Revolution willen mit absoluter Verbindlichkeit ausgestattet. Wenn die Gesetzgebung des zeitlichen Staatsapparates jedoch der Erreichung dieses Zieles spottet, dann wird die Legitimität der Herrschaft und des Staates aufgehoben: Widerstand wird natur-rechtlich möglich[163] - allerdings mit der sofortigen rechtlichen Pflicht, erneut in einen rechtlichen Zustand zu treten.
Er kann deshalb auch nicht positivrechtlich geregelt werden. Möglicherweise ist es das, was Kant mit seinem Widerstandsverbot sagen will. Das Widerstandsrecht ist für Kant nämlich überhaupt nur in einem rechtlichen Zustand möglich. In dem Fall, daß der Herrscher Feind des Volkes (hostis populi) wird, ist der Rechtszustand aufgegeben und jeder kann Notwehr - nicht Widerstand - leisten.[164]
Nach Ansicht Kerstings widerspräche ein naturrechtliches Widerstandsrecht dem Gebot, in einen Rechtszustand einzutreten, denn mit ihm wäre der Naturzustand zementiert.[165]
Allerdings hält Kersting den faktischen Widerstand in der Kantischen Lehre für möglich, einen Widerstand, der eine neue empirische Ordnung schaffen soll, die dem Prinzip der Selbstherrschaft entspricht.[166]
Im Ergebnis ist kaum ein Unterschied festzustellen; in beiden Fällen steht das positive Recht dem Widerstand entgegen, in beiden Fällen darf dennoch Widerstand geleistet werden. Die Annahme eines vernunftrechtlichen Widerstandsrechtes ist m.E. vorzuziehen, weil ein es auch die Gegenseite einer vernunftrechtlichen Verpflichtung beinhaltet, dem Unrechtsstaat Widerstand entgegenzuhalten, um einen neuen Versuch aus dem Naturzustand heraus beginnen zu können.
d) Die Freiheit der Feder
Was bleibt, ist aber auf jeden Fall die "Freiheit der Feder", um den Herrscher auf Mißstände aufmerksam zu machen und ihn zur Reform zu bewegen. Dieses Recht kann nicht auf das Denken beschränkt werden, sondern muß sich auf die Äußerung erstrecken. Das liegt jedoch nicht daran, daß der Mensch notwendig weltbezogen denkt.[167] Es bliebe dem Menschen auch der Weg in die Einsamkeit und die stille Zwiesprache mit Gott. Die Äußerung von Gedanken an die Welt gehört aber zur Verwirklichung eines bestimmten Glückseligkeitskonzeptes, das der Staat im eigenen Interesse fördern muß. Die Freiheit der Feder bietet damit eine Perspektive, "die eine Umsetzung in heutige Rechtsstaatsverhältnisse" erlaubt. Der - im Hinblick auf die Geschichte ungerechtfertigte - Fortschrittsoptimismus Kants muß allerdings modernen Erfahrungen angeglichen werden.[168]
3. Zum Verhältnis von Naturrecht und Positivismus
Die Beurteilung der Frage nach der Verbindlichkeit des positiven Rechts zieht eine zweite nach sich: die Frage, ob Kant Naturrechtler oder Rechtspositivist war. Über sie ist im Laufe der Zeit viel gestritten worden.
Für Kant als Naturrechtler spricht die Gründung der Rechtsphilosophie auf apriorische Vernunftprinzipien. Besonders augenfällig ist die Vereinigung der Willkür der Menschen als überpositives Prinzip, die Idee des vereinigten Willens als Prinzip universaler Konsensfähigkeit und der Zweck des Menschen als innere Rechtspflicht. Als Kern des Kantischen Naturrechts kann das allgemeine Rechtsgesetz gelten, "die nach Prinzipien vernünftiger Allgemeinheit (=rechtsgesetzlich) eingeschränkte Handlungsfreiheit von jedermann".[169]
Für Kant als Rechtspositivist spricht das unbedingte Gehormsamsgebot und damit zusammenhängend das Widerstandsverbot.
Kant kennt also zwei Rechtsquellen: Die Vernunft und den historischen Willen des Gesetzgebers. Die Gesetzgebung der Vernunft ist dabei grundsätzlich höherrangig. Das ergibt sich auch aus der Tatsache, daß es schon im Naturzustand, vor jedem positiven Gesetz, natürliches Privatrecht gibt. Folglich hat der Philosoph das Supremat vor dem Juristen. Die Metaphysik kann jedoch "nur Annäherung zum System, nicht dieses selbst" leisten.[170] Das liegt zum einen in der mangelnden Konkretheit des Naturrechts. Es bedarf des positiven Rechts, um der Anwendungsvielfalt Herr zu werden. Zum anderen ist das Naturrecht auf eine "rational nicht vollständig zu bändigende Urteilskraft angewiesen", so daß eine verbindliche Entscheidung erst im positiven Recht herbeigeführt werden kann. Daher drängt das Naturrecht nach Konkretisierung in der Positivierung. Damit das positive Recht aber nicht in Erfüllung seiner durch das Naturrecht bestimmten Aufgabe scheitert, braucht der Gesetzgeber das Naturrecht als Anschauung, als Kriterium für ein gutes positives Gesetz.[171] Das Naturrecht wird zur "Richtschnur" für das positive Recht.[172]
Nach Habermas führt das zu einer Überbetonung der Moral. Das "Recht wird zu einem defizienten Modus der Moral herabgestuft." Die Politik verliere dadurch ihre legislatorische Kompetenz.[173] Allerdings wird man wohl einwenden müssen, daß Kants apriorische Prinzipien nur selten direkt zu positiven Regelungen führen.
Der Gesetzgeber hat mithin noch viel Spielraum, um seine politischen Vorstellungen zu realisieren. Im übrigen ist der Gesetzgeber dadurch vor einer Naturrechts-Invasion geschützt, daß seine Regelungen auch bei Unvereinbarkeit mit bestimmten apriorischen Prinzipien Gültigkeit behalten: Ein schlechter Schutz des Rechtes ist immer noch besser als gar keiner. Insofern tritt auch ein Vorrang des positiven Rechts vor dem Naturrecht zutage. Damit ist Kant aber kein Rechtspositivist, denn der erwähnte Vorrang ist wiederum reines Naturrecht. Es liegt in der Vernunft selbst, der positiven Regelung mehr zu gehorchen als der Vernunft. - Ein Widerspruch? Man muß wohl zugeben, daß die Grenze zwischen rechtmäßiger und unrechtmäßiger Gesetzgebung bei Kant nicht leicht zu bestimmen ist.[174]
D. Der ethische Hintergrund
Wir haben nun alles gesehen, was man mit Augen sehen kann: Die drei Teile des Altarbildes, sogar das ganze Kirchenschiff haben wir betrachtet. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Erfassung des ethischen Hintergrundes unseres Triptychons. Wenden wir nun also den Blick vom Äußeren ins Innere und meditieren über das, was wir gesehen haben. Wir vermuten hier, im innersten Bereich des Staatsbürgerbegriffes, das Prinzip der Brüderlichkeit.
I. Das Verhältnis zwischen Recht und Ethik
Es ist selbstverständlich völlig ausgeschlossen, an dieser Stelle auch nur annähernd auf die Bedeutung der Ethik für Kants metaphysische Sittenlehre einzugehen. Wir vermögen nur sozusagen einen Blick durchs Schlüsselloch zu wagen, um den Standort der Frage zu bestimmen und um dann - bloß in Form einer Hypothese - die Bedeutung der Brüderlichkeit bei Kant zu formulieren. Mehr kann und soll hier nicht geschehen.
1. Trennung
Das Rechtsgesetz als äußere und verbindliche Kraft, einen anderen zu verpflichten und das ethische Gesetz als Regelkanon sittlicher, innerer Pflichten sind nach Kant strikt voneinander getrennt. Das Recht ist frei von jeder ethischen Einflußnahme allein auf die äußeren Handlungen bezogen. Die Handlung, welche die Rechtspflicht befolgt, ist sittlich wertlos. Deshalb ist das Recht auch nur mittelbar verbindlich über den Zwang, der die Selbstliebe zu gesetzeskonformem Verhalten motiviert. Die Vernunftbedingungen des menschlichen Handelns werden nicht zum verbindlichen äußeren Gesetz, sondern können nur innerlich verpflichten. Daraus ergibt sich ein Vorrang des konkreteren und mit absoluter Verbindlichkeit ausgestatteten Rechtsgesetzes vor dem ethischen Gesetz, das die Rechtspflicht in sich aufnimmt. Die Befolgung des praktischen Gesetzes ist damit aber immer von empirischen Bedingungen mitabhängig. Deshalb gibt es den kategorischen Imperativ, der die moralische Seite in einem umfassenden ethischen Gesetz der Freiheit zur Geltung bringen will:[175]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Rechtsgesetz ist demnach eine formal apriorische Version des kategorischen Imperativs; das ethische Gesetz ist ein material apriorischer Imperativ.[176] Recht und Ethik sind also von ihrer Verpflichtungsursache her voneinander getrennt.
2. Wechselseitiger Bezug
Nach Kants Rechtsbegriff aber setzt das Recht die transzendentale Freiheit der Vernunft voraus, ist in diesem Sinne also doch abhängig von der Moral. Das Recht zeichnet quasi die innere moralische Verpflichtung nur äußerlich nach. Anders vermag das Rechtsgesetz auch nicht zu überzeugen, denn: "Ich kann einen andern niemals überzeugen als durch seine eigenen Gedanken."[177] Das Rechtsgesetz muß die Personalität und die moralische Pflichtigkeit der Staatsbürger zur Kenntnis nehmen. Ja, aus der moralischen Pflicht folgt erst die Kraft des Rechts, jeden anderen auf die Bedingungen dieser Pflicht zu verpflichten.[178] Diese Begründungs- oder Legitimationsseite der Ethik für das Recht ist das Gegenstück zur Trennung beider Bereiche. Trennung und Legitimation liegen dabei dicht beieinander.
II. Brüderlichkeit
Wenden wir uns nun der Brüderlichkeit (fraternité) zu. Sie ist in der Revolutionsformel "liberté, egalité, fraternité" das dritte Konstitutiv des Staatsbürgers. Sie war eine Forderung der Jakobiner.
1. Brüderlichkeit als rechtliches Prinzip?
Kant hat seinen Staatsbürger mit der Eigenschaft der Selbständigkeit bewußt gegen die Revolutionsformel abgegrenzt. Die Brüderlichkeit enthielt nach Kants Ansicht eine gesinnungsethische Komponente, die eine bestimmte Gesinnung und Grundhaltung - von Kant mit "Menschenfreundschaft" und "Beherzigung der Gleichheit unter Menschen"[179] umschrieben, von Rousseau "Gesinnung des Miteinander"[180] genannt - verlangte. Sie kann in einer praktischen Philosophie nicht Bestandteil der Rechtsordnung werden, weil die Gesinnung nicht überprüfbar oder durchsetzbar ist. Zwar taucht auch die "Welt-Bürgerliche Einheit (Verbrüderung)" in Kants Vorarbeiten zum Gemeinspruch-Aufsatz auf, jedoch nur als innerer Aspekt und auch hier in Verbindung mit der Selbständigkeit.[181] Mit der Ersetzung der Brüderlichkeit durch die Selbständigkeit hat Kant die Gesinnung aus dem Recht zu verbannen gesucht, die im Frankreich seiner Zeit zum Terror mit der absoluten Forderung nach einer revolutionären Gesinnung geführt hatte.[182] Dies entspricht Kants formalem, von der Ethik getrennten Rechtsbegriff. Die Brüderlichkeit ist also kein mit Zwangsmitteln durchsetzbares Rechtsprinzip.
Kant hält die Brüderlichkeit als rechtliches Prinzip nur für den Bereich des Völkerrechts für möglich, als Recht auf Frieden in der Welt. Die Beziehung zu den Grundrechten gewinnt dieses Recht auf Brüderlichkeit dadurch, daß es nur den Staaten, die die Brüderlichkeit als Völkerrecht anerkennen, möglich ist, in einer völkerrechtlichen Gemeinschaft nach einem allgemeinen Rechtsgesetz zu leben. "Die Brüderlichkeit zielt also auf die Grundrechte, gehört aber gerade deswegen nicht dazu."[183]
2. Brüderlichkeit als Konstitutionsbedingung des Rechts
Wenn einerseits der Staatsbürger von jeder moralischen Gesetzgebung, von jeder wohlfahrtsstaatlichen Vorgabe befreit sein soll, dann ist andererseits unklar, warum Kant betont, daß die Politik ohne moralische Grundlage wertlos ist.[184] Hier deutet sich die Funktion an, die die Ethik im Bereich des Rechts ausüben darf:
Demokratie muß notwendigerweise von der Vorstellung brüderlicher Gleichheit begleitet werden, damit sie theoretisch legitimiert und praktisch verwirklicht werden kann.[185] Das hat Rousseau erkannt, als er meinte, der Unterschied zwischen Familie und Staat sei, "daß in der Familie die Liebe des Vaters für seine Kinder ihn entschädigt für die Sorge, die er an sie wendet, und daß im Staat das Vergnügen zu befehlen jene Liebe ersetzt, die das Oberhaupt für seine Völker nicht empfindet."[186]
Der Bruderliebe entspricht das moralische Gebot, nach der eigenen Vollkommenheit einerseits und der fremden Glückseligkeit andererseits zu streben. Es ist keine Rechts-, sondern Tugendpflicht, auf diese beiden Pole der Moralität zuzusteuern.[187] Das Gegenteil, eigene Glückseligkeit und fremde Vollkommenheit, führt dagegen zu wohlfahrtsstaatlicher Bevormundung und zu Egoismus; die Liebe würde zum Zwang.[188]
Auf die Bruderliebe als Streben nach eigener Vollkommenheit und fremder Glückseligkeit wird nun der Staat ausgerichtet. Die Bruderliebe fordert Berücksichtigung bei der Regierungsart. Von der Bruderliebe ausgehend, wird das Recht in einen Prozeß der Harmonisierung zwischenmenschlicher Beziehungen gelenkt. Gewagt ausgedrückt könnte man sagen, die gegenseitige, letztlich auf Gott bezogene Liebe wird zum Inhalt des Rechts in einem langfristigen Prozeß, der auf die ideale Gemeinschaft gerichtet ist, die Kant Republik nennt, und in der die Bruderliebe vollständig verwirklicht ist. Das Streben nach fremder Glückseligkeit wird der Regierung zur Aufgabe, nämlich die Staatsbürger nach ihren eigenen Anschauungen glücklich werden zu lassen.
Hier sind wir an der Grenze des interpretatorisch Vertretbaren angelangt. Kants Begriff von Liebe ist ein rein rationaler Vernunftbegriff, der - wie alles in seiner Rechtsphilosophie - von der Empirie getrennt ist. In der Grundlegung heißt es: "So sind ohne Zweifel auch die Schriftstellen zu verstehen, darin geboten wird, seinen Nächsten, selbst unseren Feind, zu lieben. Denn Liebe als Neigung kann nicht geboten werden, aber Wohltun aus Pflicht selbst, wenn dazu gleich gar keine Neigung treibt, ja gar natürliche und unbezwingliche Abneigung widersteht, ist praktische und nicht pathologische Liebe, die im Willen liegt und nicht im Hange der Empfindung, in Grundsätzen der Handlung und nicht schmelzender Teilnehmung; jene aber allein kann geboten werden."[189] Spätestens bei dem Prinzip der Brüderlichkeit muß man sich aber fragen, ob Kant damit den Menschen nicht auf ein Ideal reduziert, das ihm alle Individualität und Persönlichkeit raubt und ihm zugunsten einer rational-ethischen Tugendlehre die Möglichkeit nimmt, seine natürlichen Empfindungen für gut zu halten. Der Ausschluß der Empfindung ist darum sehr gefährlich, weil die äußere Handlung ohne eine persönliche Beziehung beliebig wird und leicht manipuliert werden kann.
Man sollte daher überlegung, ob nicht oberstes Prinzip einer Sittenlehre sein müßte, sich selbst mit seinen Empfindungen zu akzeptieren und sie für gut halten zu dürfen. Zu einer idealen Gemeinschaft gelangt der Mensch eher, wenn nicht die Liebe von der Handlung her als abstraktes äußerliches Gebot definiert wird, sondern wenn umgekehrt die Handlung natürlicher Ausfluß der Empfindung der Liebe ist.
Wir halten dies in einer letzten These fest: Die Brüderlichkeit ist das vierte Konstitutionsprinzip des Staatsbürgers. Sie ist kein Rechtsprinzip, das zwangsweise durchsetzbar wäre, aber innere Tugendpflicht, die bei staatlichen Entscheidungen zugrundegelegt werden muß.
E. Perspektiven
Wir haben nun die Meditation über unseren Triptychon zu Ende geführt und gesehen, daß jedes der drei apriorischen Grundrechte im Staat fortwirkt.
Die Selbständigkeit, die von den Bauleuten zunächst verworfen wurde, erwies sich dabei als Eckstein des systematischen Staatsgebäudes. Mit dem Recht auf Selbständigkeit erhält die Kantische Staatslehre einen dynamischen Zug, mit dessen Hilfe die Spannungen im Verhältnis von Menschenrechten und Volkssouveränität, Individuum und Allgemeinheit, Naturrecht und Rechtspositivismus gelöst werden können.
Als Hintergrund der Grundrechte trat zuletzt die Bruderliebe in Erscheinung, die als Liebe des Gesetzgebers für die Staatsbürger auf die Gesetzgebung zurückwirkt und erst eine inhaltliche Ausfüllung des Rechtsbegriffes ermöglicht.
Nun könnte man meinen, daß die wissenschaftliche Begründung des Rechts eine bloße philosophische Spielerei ist, die auf die Rechtsanwendung in der Praxis gar keine Wirkung hat. Damit bliebe das Recht letztlich zur politischen Bedeutungslosigkeit verurteilt.[190]
Diese Gefahr besteht in der Tat immer dort, wo Rechtsanwendung und Rechtsphilosophie getrennt betrieben werden. Ihr müßte indes nicht tatenlos zugeschaut werden. Die Verbindung zur Rechtsanwendung herzustellen ist auch Aufgabe der Rechtsphilosophie. Wie kann das geschehen? Kant hält die "Herablassung zu Volksbegriffen" für "sehr rühmlich, wenn die Erhebung zu den Prinzipien der reinen Vernunft zuvor geschehen und zur völligen Befriedigung erreicht ist, und das würde heißen, die Lehre der Sitten zuvor auf Metaphysik zu gründen, ihr aber, wenn sie feststeht, nachher durch Popularität Eingang verschaffen."[191] Vielleicht ist es diese Popularität, die der Kantischen Rechtsphilosophie fehlt.
F. Thesen
I. Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit sind die ursprünglichen Konstitutionsbedingungen des Staates. Sie sind alle drei gleichberechtigt und können nur als Einheit wirken, bedingen und vermitteln sich jeweils untereinander.
II. Die Freiheit folgt aus der Personalität und Würde des Menschen. Die stärkere positive Berücksichtigung bei der Schaffung von Gesetzen könnte dazu beitragen, den negierenden Charakter der Abwehrrechte zugunsten der Konstitution eines vorstaatlichen Rechts auf Freiheit zu schwächen und eine bestimmbare Grenzziehung zwischen dem Freiheitsraum der Individuen und der Staatsmacht vorzunehmen.
III. Die Gleichheit als solche beinhaltet nach Kant nicht die soziale Gleichheit.
IV. Die Selbständigkeit ist ein apriorisches Prinzip. Es ist identisch mit der familienrechtlichen Mündigkeit und nicht etwas theoretisch Begründbares, sondern ein praktisches Anerkennen, ein Loslassen in die dem Menschen von Geburt an zustehende Freiheit. Das Loslassen, die Erziehung zur Selbständigkeit ist Rechtspflicht der Rechtsgemeinschaft; sie resultiert aus dem angeborenen Recht auf Freiheit, das im Staat nach effektiver Realisierung verlangt. Das Recht auf Erziehung zur Mündigkeit trifft alle Menschen gleichermaßen, da niemand so vollkommen ist, daß er anderen seinen Grad der Selbständigkeit vorschreiben dürfte.
V. Der Staat ist bei Kant schon a priori legitimiert durch die Rechtspflicht, den Naturzustand zu verlassen (principium exeundum e statu naturali). Einer Legitimierung durch den ursprünglichen Vertrag bedarf es nicht mehr.
VI. Der allgemeine, vereinigte Wille ist ein Leifaden für den Gesetzgeber. Jedes Gesetz gilt als vernunftrechtlich legitimiert, das die Bedingungen der wechselseitigen Freiheitsgewährung und -einschränkung beachtet. Damit leistet er eine Disziplinierung der Gesellschaft. Er wird rein formal bestimmt und bedarf der inhaltlichen Ausfüllung.
VII. Die richtige Verfassung liegt für Kant in der Regierungsart des Republikanismus. Die Herrschaftsform ist für ihn gleichgültig. Der geschichtliche Staat wird legitimiert, um eine revolutionäre Umstürzung der Rechtsordnung zu verhindern und in einem zielgerichteten Reformprozeß der Republikanisierung eine sicherere Garantie für die Erreichung der reinen Rechtsgesellschaft zu erhalten. Die Reformidee gewinnt auch für die moderne Verfassung an Aktualität, weil sie diese, selbst wenn sie dem Ideal der Republik nicht entsprechen sollte, um der Verwirklichung derselben zu legitimieren imstande ist.
VIII. Der Herrscher ist Repräsentant des Volkes. Er ist bei der Ausübung der ihm durch einen gedachten Vertrag übertragenen Macht an die Bedingung des vereinigten Willens gebunden, daß die Entscheidung auch vom gesamten Volk getragen werden könnte. Volkssouveränität ist bei Kant auf ein reines Gedankenexperiment abgewertet. Sie bedarf der institutionellen Äußerung nicht, weil der Herrscher bei Berücksichtigung des Gedankens der Volkssouveränität schon aller Rechtsstaatlichkeit Genüge tut.
IX. Der Rechtspflicht zum Staat entspricht ein Recht auf Staat. Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit sind die Voraussetzungen des ursprünglichen Vertrages und begründen durch ihn den demokratischen, sozialen Rechtsstaat, in dem jeder durch politische Mitbestimmung sein Recht auf politische Freiheit wahrnehmen kann, - und zwar nur diesen; denn nur in der Demokratie wird das Recht des Menschen auf politische Freiheit durch die aktive politische Mitbestimmung gewährleistet. Der Staat muß als Institution zur Herbeiführung des herrschaftsfreien Zustandes der Republik die Voraussetzungen politisch-gesellschaftlicher Freiheit des Einzelnen schaffen.
X. Das Spannungsfeld zwischen Volkssouveränität (Vorrang des Allgemeinen) und Menschenrechten (Vorrang des Einzelnen) will Kant im Staat dadurch harmonisieren, daß er die menschenrechtlichen Positionen als Konstitutionsbedingungen in den gesetzgeberischen Prozeß einbezieht und darin aufgehen läßt.
XI. Das positive Recht ist bei Kant um der Bedingung verbindlich, daß der Rechtszustand erhalten bleibt. Insoweit ist die Begründung der Herrschaft für ihre Legitimation unerheblich. Im Falle des Gewissenskonfliktes geht die Gewissensfreiheit dem allgemeinen Gesetz vor. Der politische Konflikt wird bei Kant mit dem Widerstandsverbot zulasten des Individuums gelöst. Kant leugnet aber nicht, daß das Volk faktisch Widerstand leisten kann. Soweit der Herrscher Feind des Volkes wird, kommt auch ein naturrechtliches Widerstandsrecht in Betracht.
XII. Die Brüderlichkeit ist das vierte Konstitutionsprinzip des Staatsbürgers. Sie ist kein Rechtsprinzip, das zwangsweise durchsetzbar wäre, aber innere Tugendpflicht, die bei staatlichen Entscheidungen zugrundegelegt werden muß.
[...]
[1] Vgl. Forschner S. 141.
[2] Zur Biographie Paulsen S. 26ff, 37ff, 43ff, 48ff, 79ff, 81ff, 91ff.
[3] Fetscher S. 279.
[4] Zit. nach Paulsen S. 48.
[5] Fetscher S. 285.
[6] Riedel S. 138.
[7] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 230.
[8] Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 4, 389.
[9] Naucke S. 95ff, Zitat S. 100.
[10] Schopenhauer S. 626.
[11] Vgl. Kersting, Vorwort S. VII.
[12] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 314.
[13] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 237.
[14] Schwartländer, Der Mensch ist Person S. 20ff.
[15] Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 4, 429.
[16] Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 4, 437.
[17] Vgl. dazu Marcuse S. 310.
[18] Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 4, 429.
[19] Kersting S. 94.
[20] Vgl. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 4, 439f, Zitat 448.
[21] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 237.
[22] Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 6, 452f.
[23] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 231.
[24] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 171.
[25] Volkmann-Schluck S. 181.
[26] Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 4, 417f.
[27] Kersting S. 233ff; Deggau S. 263.
[28] BVerfGE 6, 36.
[29] Vgl. Kant, Zum ewigen Frieden, 8, 350, Anm.
[30] Kersting S. 237; Ebbinghaus ARSP 1964, 23, 40, der auch die Hessische Verfassung als Beispiel heranzieht.
[31] Kersting S. 238ff.
[32] Ebbinghaus S. 41f.
[33] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 231.
[34] Vgl. Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 233.
[35] Kersting S. 8ff unter Berufung auf Menzer.
[36] Schopenhauer S. 626f.
[37] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 237.
[38] Kersting S. 14, 97, 241; vgl. auch Ebbinghaus ARSP 1964, 46.
[39] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 314.
[40] Kersting S. 241; Ebbinghaus ARSP 1964, 45.
[41] Vgl. Ebbinghaus mit einem Beispiel aus der Hessischen Verfassung, ARSP 1964, 44ff.
[42] S. S. 18.
[43] Ebbinghaus S. 46f.
[44] Luf S. 145ff.
[45] Vgl. Kersting S. 244ff
[46] Vgl. Kersting S. 246ff.
[47] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 238.
[48] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 314.
[49] Kant, Zum ewigen Frieden, 8, 295, Anm.; vgl. auch Schild S. 138.
[50] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 314.
[51] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 282f.
[52] Kant, Zum ewigen Frieden, 8, 295.
[53] Vgl. Kersting S. 252ff.
[54] Schopenhauer S. 627.
[55] Kersting S. 250f; so auch Riedel S. 139f; Deggau S. 258.
[56] Kersting S. 253.
[57] Kersting S. 255.
[58] Riedel S. 140.
[59] Dazu Kersting S. 256f.
[60] Vgl. Aristoteles, zum Staatsbürger allgemein: S. 154ff, zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit: S. 164ff.
[61] H. Krüger, bei Bien S. 99 Anm. 46c; Bien S. 80; Kersting S. 257; Paulsen S. 356; Riedel S. 140.
[62] Krüger S. 55.
[63] Batscha S. 16ff; Bien S. 77ff; Luf S. 160ff; Metzger S. 90; Riedel S. 141f.
[64] Fetscher S. 276ff; Mandt S. 296; Marcuse S. 316f; Saage S. 87; Deggau S. 258.
[65] Metzger S. 89.
[66] Vgl. Kant, Vorarbeiten; in: Batscha S. 64ff.
[67] So, ironisch gemeint, Ebbinghaus ARSP 1964, 51.
[68] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 314.
[69] Dies hat insbesondere Schild versucht; zum Folgenden vgl. Schild S. 143ff.
[70] Deggau streift diesen Aspekt nur am Rande, S. 257.
[71] Schild S. 144f; vgl. schon Rousseau S. 6f.
[72] Schild S. 146f.
[73] Kant, bei Schild S. 148.
[74] Schild S. 147.
[75] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 315.
[76] Ebbinghaus ARSP 1964, 52.
[77] Volkmann-Schluck, bei Schild S. 150.
[78] Schwartländer, Menschenrechte und Demokratie S. 193ff.
[79] Huber, Tödt, Greiffenhagen, Schwartländer, bei Schild S. 151f.
[80] Schild S. 152ff.
[81] Saage S. 101.
[82] Ebbinghaus ARSP 1964, 55.
[83] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 333.
[84] Vgl. Schild S. 156f.
[85] Ebbinghaus ARSP 1964, 48.
[86] Schild S. 158ff.
[87] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 312.
[88] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 306f; Zitat Kersting S. 205.
[89] Vgl. Locke S. 22ff.
[90] Kersting S. 205ff.
[91] Deggau S. 279.
[92] Aristoteles S. 78.
[93] Saage S. 97; vgl. Hobbes S. 151ff; Locke S. 4ff.
[94] Saage S. 101ff, Zitat 103f (ein "sich" ist zuviel).
[95] Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 4, 431f.
[96] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 312.
[97] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 305f.
[98] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 236.
[99] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 237.
[100] Hobbes S. 119.
[101] Locke S. 5.
[102] Vgl. Kersting S. 204f.
[103] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 305f.
[104] Habermas, Publizität S. 176ff.
[105] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 355.
[106] Paulsen S. 361.
[107] Marcuse S. 314f.
[108] Kersting S. 209.
[109] Kersting S. 210; a.A. Luf S. 87.
[110] Kersting S. 212f.
[111] Vgl. Kersting S. 289, Naucke S. 105f.
[112] Riedel S. 131.
[113] Forschner S. 102ff, Zitat 109.
[114] Kersting S. 217ff.
[115] Riedel S. 133ff.
[116] S. S. 37.
[117] Marcuse S. 311f, 312.
[118] Marcuse S. 316f, 319.
[119] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 313.
[120] Kersting S. 260ff.
[121] Bodin, Über den Staat S. 252.
[122] Kant, Vorarbeiten zum Gemeinspruch, 23, 158.
[123] Entnommen Bien S. 97 Anm. 27.
[124] Mercier S. 162.
[125] Kant, Zum ewigen Frieden, 8, 352.
[126] Kersting S. 282.
[127] Vgl. Kersting S. 286.
[128] Vgl. Kersting S. 297ff.
[129] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 327ff.
[130] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 343ff.
[131] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 317ff.
[132] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 341.
[133] Vgl. Kersting S. 307ff, Zitat 310; vgl. auch Ebbinghaus, Neukantianismus S. 325.
[134] Deggau S. 277.
[135] Saage S. 97f.
[136] So, nach der traditionellen Interpretation, Riedel S. 143; Deggau S. 262.
[137] Kersting S. 290.
[138] Kersting S. 294.
[139] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 316.
[140] Kant, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, 8, 297.
[141] Kersting S. 223.
[142] So Haensel und Dulckeit, bei Kersting S. 224f.
[143] Kersting S. 226ff.
[144] Marcuse S. 320.
[145] Marcuse S. 313.
[146] Vgl. Kersting S. 76.
[147] Schild S. 162f.
[148] Schild S. 163.
[149] Kant, bei Schild S. 164.
[150] Schild S. 164f.
[151] Rhemann S. 328, 345.
[152] Schild S. 166 unter Hinweis auf Grimm.
[153] Böckenförde S. 342f.
[154] Schild S. 169ff.
[155] Kersting S. 351, 354f.
[156] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 400f.
[157] Ebbinghaus ARSP 1964, 54.
[158] Deggau S. 269f.
[159] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 320.
[160] Deggau S. 269f; Kant hatte selbst im Gemeinspruch, 8, 301 ein Widerstandsrecht des ganzen Volkes als Verfassungsorgan vertreten, später aber abgelehnt. vgl. Kersting S. 314ff.
[161] Vgl. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 4, 437.
[162] So Dreier, bei Kühl S. 91.
[163] So auch Haensel S. 56; Dulckeit S. 56.
[164] Kersting S. 336f.
[165] Kersting S. 340ff.
[166] Vgl. Kersting S. 344.
[167] Vgl. Volkmann-Schluck S. 182, 186.
[168] Kühl S. 93.
[169] Kühl S. 77f.
[170] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 205.
[171] Marcuse S. 82ff.
[172] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 313.
[173] Habermas, Kritische Justiz S. 6.
[174] Kühl S. 88ff.
[175] Kersting S. 20ff, 71ff, 85, 87.
[176] Kersting S. 83.
[177] Kant, bei Kersting S. 78.
[178] Vgl. Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 232, 239.
[179] Kant, Vorarbeiten zum Gemeinspruch, 23, 139.
[180] Rousseau S. 151.
[181] Kant, Vorarbeiten zum Gemeinspruch, 23, 139.
[182] Kersting S. 248; Schild S. 139f.
[183] Ebbinghaus ARSP 1964, 48.
[184] Vgl. Saage S. 105.
[185] Greiffenhagen S. 65.
[186] Rousseau S. 7.
[187] Kant, Metaphysik der Sitten, 6, 391ff.
[188] Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 4, 442.
[189] Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 4, 399.
[190] So Naucke S. 104ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Einleitung?
Die Einleitung behandelt das Leben und Werk von Kant, sein Verhältnis zum Staat und eine nicht-empirische Rechtsphilosophie.
Was sind die drei Merkmale des Staatsbürgers nach Kant?
Die drei Merkmale sind Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit.
Wie definiert Kant Freiheit?
Freiheit ist das angeborene Recht, die Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür, sofern sie mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann.
Was bedeutet gesetzliche Freiheit im idealen Staat?
Gesetzliche Freiheit bedeutet, keinem anderen Gesetz gehorchen zu müssen, als zu welchem er seine Zustimmung gegeben haben könnte.
Wie unterscheidet sich Kants Freiheitsbegriff von liberalem Grundrechtsverständnis?
Kants Freiheitsrecht steht vor der Staatsbegründung, während liberales Freiheitsverständnis vom Freiheitsrecht als einem staatsgerichteten Abwehrrecht ausgeht.
Wie definiert Kant Gleichheit?
Gleichheit ist die Unabhängigkeit, nicht zu mehrerem von anderen verbunden zu werden, als wozu man sie wechselseitig auch verbinden kann.
Bezieht sich Kants Gleichheitsbegriff auch auf den ökonomischen Bereich?
Nein, Kants Gleichheitsbegriff bezieht sich lediglich auf den rechtlichen, nicht aber auf den ökonomischen Bereich.
Was bedeutet Selbständigkeit als Staatsbürgerrecht?
Selbständigkeit bedeutet, seine Existenz und Erhaltung nicht der Willkür eines anderen im Volke, sondern seinen eigenen Rechten und Kräften als Glied des gemeinen Wesens verdanken zu können.
Welche Kritik gibt es an Kants Kriterium der Selbständigkeit?
Der häufigste Einwand ist, dass das Prinzip der Selbständigkeit kein apriorisches, sondern ein aposteriorisches, aus der Erfahrung gewonnenes, empirisches Prinzip sei.
Wie interpretiert man Selbständigkeit im modernen Kontext?
Selbständigkeit kann als Mündigkeit interpretiert werden, als Erziehung zur Freiheit und als Recht auf Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Gemeinwesen.
Wie ist das Verhältnis der Merkmale Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit zueinander?
Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit sind die apriorischen Konstitutionsbedingungen des Staates. Sie sind alle drei gleichberechtigt und können nur als Einheit wirken, bedingen und vermitteln sich jeweils untereinander.
Wie begründet Kant die Pflicht zum Staat?
Die Pflicht zum Staat ist keine Nützlichkeitserwägung, sondern oberste apriorische Rechtspflicht, die dem praktischen Prinzip entspringt, dem Willen jedes vernünftigen Wesens als eines allgemein gesetzgebenden Willens zu folgen.
Welche Rolle spielt der Naturzustand in Kants Staatsphilosophie?
Der Naturzustand ist für Kant im Wesentlichen der Zustand des bloßen Privatrechts, in dem jeder für sich die Ausübungsbedingungen der natürlichen Gesetze über das Mein und Dein festlegt, jedoch ohne Rechtssicherheit.
Was ist der ursprüngliche Vertrag in Kants Staatsphilosophie?
Der ursprüngliche Vertrag ist ein Prinzip der nicht durch ihn legitimierten Verfassung, eine Formel für den Souverän, mit der er in der Chemieküche der Gesetzgebung die richtige Zusammenstellung finden kann.
Wie sieht Kants ideale Verfassung aus?
Kants politisches Konzept ist nicht Revolution, sondern Reform zur Republik. Republikanismus, das Staatsprinzip der Absonderung der ausführenden Gewalt von der gesetzgebenden, ist für ihn wesentlich.
Gibt es ein Recht auf Staat nach Kant?
Ja, es gibt ein Recht auf Staat, ein subjektiver Anspruch auf Reform, auf Demokratisierung hin zur Republik.
Wie beurteilt Kant die Verbindlichkeit positiven Rechts?
Kant versucht, einen mittleren Kurs zwischen Naturrecht und Rechtspositivismus zu halten, indem er das positive Recht in seiner Gültigkeit nicht an überpositive Normen bindet, ihm aber auch nicht bloß aufgrund seiner Durchsetzungskraft Geltung zuspricht.
Welche Position nimmt Kant im Gewissenskonflikt ein?
Kant befürwortet einen passiven Widerstand in einem Konflikt zwischen einer rechtlichen Gehorsamspflicht und grundlegenden moralischen Pflichten.
Besteht nach Kant ein Widerstandsrecht gegen den Staat?
Grundsätzlich lehnt Kant ein Widerstandsrecht ab, gesteht aber im Falle eines Tyrannen faktischen Widerstand zu.
Wie bewertet Kant das Verhältnis von Recht und Ethik?
Recht und Ethik sind von ihrer Verpflichtungsursache her voneinander getrennt, dennoch setzt das Recht die transzendentale Freiheit der Vernunft voraus.
Welche Rolle spielt die Brüderlichkeit in Kants Staatsphilosophie?
Die Brüderlichkeit ist kein mit Zwangsmitteln durchsetzbares Rechtsprinzip, sondern innere Tugendpflicht, die bei staatlichen Entscheidungen zugrundegelegt werden muss.
- Quote paper
- Harald Maihold (Author), 1994, Freiheit - Gleichheit - Selbständigkeit! - Zur Legitimation des Staates durch den Bürger bei Immanuel Kant, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110662