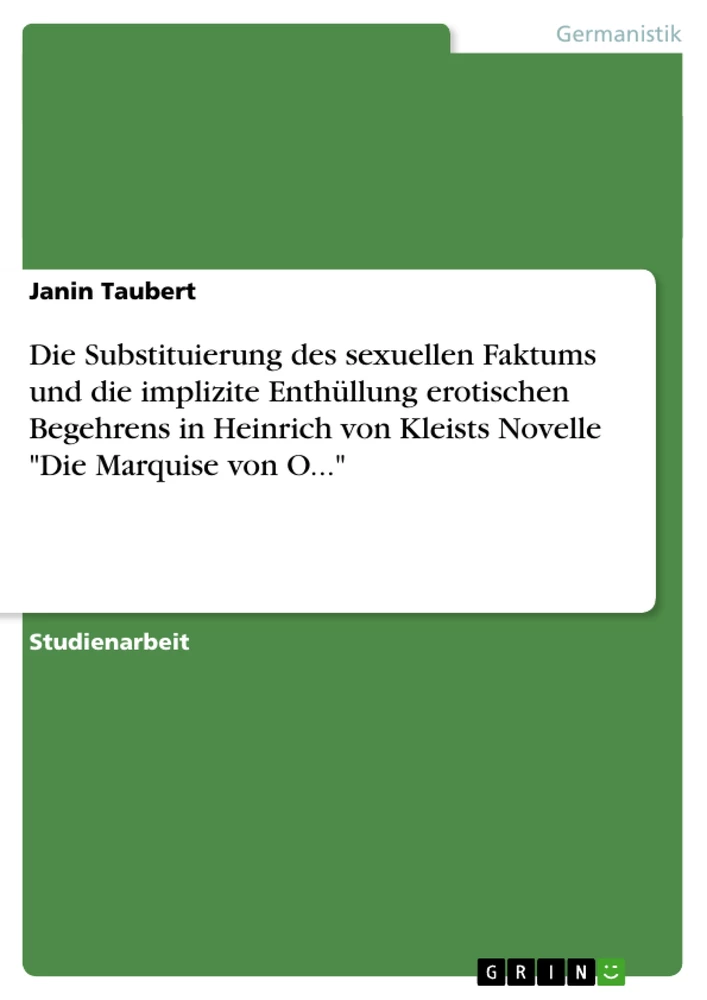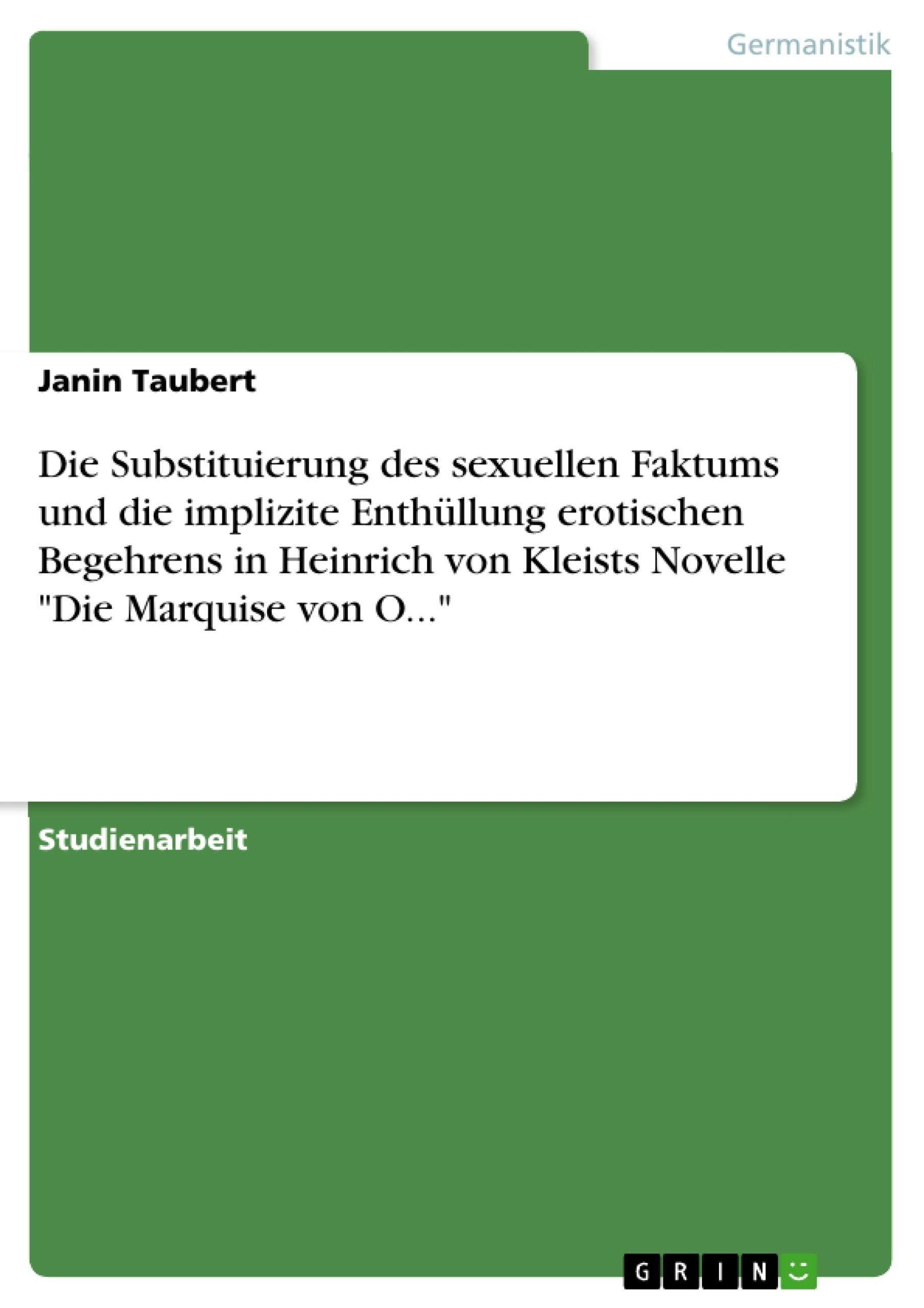„Mich beschleicht nämlich schon seit einiger Zeit das Gefühl, daß die Novelliererei zu einer allgemeinen Nivelliererei geworden sei, einer Sintflut, in der herumzuplätschern kein Vergnügen und bald auch keine Ehre mehr sei.“[1] Kritisch äußert sich Gottfried Keller zur Novellistik des 19. Jahrhunderts, die zu diesem Zeitpunkt bereits ihren ästhetischen und marktwirtschaftlichen Höhepunkt erreicht hat. Neben dem Roman hat sich die Novelle zwischen 1850 und 1890 im deutschsprachigen Raum zur dominierenden literarischen Gattung entwickelt, wobei es zur Differenzierung in künstlerisch anspruchsvolle, in den literarischen Kanon eingegangene Novellen und in jene von Keller kritisierte, triviale und massenpopuläre Novellen kam. Während zahlreiche deutsche Autoren im 19. Jahrhundert die Novelle zur anspruchsvollsten Gattung, die den Rang des Dramas eingenommen habe, emporstilisierten, empfand Heinrich von Kleist die Hinwendung zur Novellistik als Degradierung seiner künstlerischen Fähigkeit und nicht wie Keller als Ehre: „[S]ich vom Drama zur Erzählung herablassen zu müssen, [habe] ihn grenzenlos gedemütigt.“[2] Tatsächlich entstehen Kleists Erzählungen in einer Zeit, in der, im Gegensatz zum poetischen Realismus, die Novelle als Gattung gegenüber dem Drama gering geschätzt wird. Die Bedeutung und Stellung Kleists innerhalb der Novellengeschichte ist dementsprechend umstritten. Während Heyse trotz lobender Erwähnung Kleists in Tieck den Begründer der modernen Novelle sieht,[3] postuliert Freund, dass „mit den 1810 und 1811 in zwei Bänden erschienenen Erzählungen von Heinrich von Kleist [...] die Geschichte der modernen deutschen Novelle ein[setzt].“[4] Aust wiederum verweist darauf, dass Kleist den Novellenbegriff stets vermieden hat und das ursprüngliche Vorhaben, die Sammlung unter dem Titel ‚Moralische Erzählungen’ herauszugeben, nicht Kleists Nähe zur Tradition der Cervantschen Novellistik andeute sondern „die radikale Form seiner Abrechnung mit ihr [...].“[5] Samuel geht demgegenüber davon aus, dass Kleist sich bewusst „in die Tradition eben der europäischen Novelle [stellt]“[6] und Greiner sieht in Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter den zentralen Bezugstext Kleistscher Novellen.[7]
Inhaltsverzeichnis
- I. Präliminarien
- II. Das sexuelle Faktum – Hannelore Schlaffers Poetik der Novelle – Heinrich von Kleist - Die Marquise von O...
- 1. Die Verdrängung des sexuellen Faktums
- 1. Mittels der Verschiebung des Argumentums
- 2. Mittels sozialer und lokaler Verschiebungen
- 2. Die Substituierung des sexuellen Faktums: die Taktik der impliziten Darstellung
- 1. Sprachliche Zeichen
- 2. Körperliche Zeichen
- 3. Metonymien
- 4. Symbolische Zeichen
- 3. Die implizite Enthüllung weiblichen Begehrens und die Verrätselung der Marquise
- 4. Der Leser als Forensiker und verführter Voyeur
- III. Fazit oder Das Begehren nach Ordnung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Novelle "Die Marquise von O..." im Hinblick auf die Darstellung von Sexualität und erotischem Begehren. Es wird untersucht, wie Kleist das "sexuelle Faktum" verdrängt und durch welche literarischen Strategien er eine implizite, aber spürbare sexuelle Aufladung des Textes erzeugt. Die Rolle des Lesers als Interpret und "verführter Voyeur" wird ebenfalls beleuchtet.
- Verdrängungs- und Substitutionsstrategien des sexuellen Faktums in Kleists Novelle
- Analyse der impliziten Darstellung erotischen Begehrens
- Die Rolle sprachlicher und körperlicher Zeichen in der Konstruktion sexueller Spannung
- Interpretation der Marquise als Figur und die Ambivalenz ihres Begehrens
- Der Leser als aktiver Teilnehmer der Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
I. Präliminarien: Dieses einleitende Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Einschätzungen von Kleists Novellistik in der Literaturgeschichte. Es diskutiert die Position Kleists innerhalb der Gattungsentwicklung der Novelle im 19. Jahrhundert und hebt die kontroversen Perspektiven auf seine Nähe zu oder Distanz von traditionellen Novellentypen hervor. Die Kapitel skizziert den Fokus auf das "sensationell Unerhörte" im Bereich der Sexualität in Kleists Werk und führt in die zentrale These der Arbeit ein: die Analyse der Verdrängungs- und Substitutionsstrategien des sexuellen Faktums in "Die Marquise von O...". Der Text setzt Kleists Werk in den Kontext der damaligen Debatten um die Novelle als literarische Gattung und stellt seine spezifische Behandlung des Themas Sexualität in den Vordergrund.
II. Das sexuelle Faktum – Hannelore Schlaffers Poetik der Novelle – Heinrich von Kleist - Die Marquise von O...: Dieses Kapitel erörtert zunächst Hannelore Schlaffers These vom zentralen Stellenwert des sexuellen Aktes in Novellen des 19. Jahrhunderts und die damit verbundene verdrängende und substituierende Darstellung. Anschließend wird die Anwendung dieser These auf Kleists "Die Marquise von O..." untersucht. Die verschiedenen Strategien der Verdrängung (Verschiebung des Argumentums, soziale und lokale Verschiebungen) und Substituierung (sprachliche, körperliche, metonymische, symbolische Zeichen) werden detailliert analysiert, um aufzuzeigen, wie Kleist die sexuelle Spannung im Text aufbaut und gleichzeitig die explizite Darstellung vermeidet. Der Fokus liegt auf der methodischen Entschlüsselung des impliziten Erotischen.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Die Marquise von O..., Novelle, Sexualität, Erotik, Verdrängung, Substitution, implizite Darstellung, Zeichen, Symbol, Leserrezeption, Begehren, Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der impliziten Darstellung von Sexualität in Kleists "Die Marquise von O..."
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Novelle "Die Marquise von O..." unter besonderer Berücksichtigung der Darstellung von Sexualität und erotischem Begehren. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung, wie Kleist das "sexuelle Faktum" literarisch verdrängt und dennoch eine implizite sexuelle Aufladung des Textes erzeugt. Die Rolle des Lesers als aktiver Interpret und "verführter Voyeur" wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Verdrängungs- und Substitutionsstrategien des sexuellen Faktums, die Analyse der impliziten Darstellung erotischen Begehrens, die Rolle sprachlicher und körperlicher Zeichen in der Konstruktion sexueller Spannung, die Interpretation der Marquise als Figur und die Ambivalenz ihres Begehrens sowie die aktive Rolle des Lesers im Interpretationsprozess.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Ein einleitendes Kapitel (Präliminarien) beleuchtet Kleists Novellistik im Kontext der Literaturgeschichte. Das Hauptkapitel analysiert Kleists "Die Marquise von O..." im Hinblick auf die Darstellung des sexuellen Faktums, wobei die Theorien von Hannelore Schlaffer zur Poetik der Novelle herangezogen werden. Ein abschließendes Kapitel (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse basiert auf der detaillierten Untersuchung der sprachlichen Mittel, die Kleist zur Darstellung (oder Verdrängung) von Sexualität einsetzt. Dabei werden verschiedene Strategien der Verdrängung (z.B. Verschiebung des Argumentums, soziale und lokale Verschiebungen) und Substitution (z.B. sprachliche, körperliche, metonymische, symbolische Zeichen) analysiert. Die Arbeit nutzt eine literaturwissenschaftliche Herangehensweise, um die implizite sexuelle Spannung im Text methodisch zu entschlüsseln.
Welche Rolle spielt der Leser in dieser Analyse?
Der Leser wird als aktiver Teilnehmer des Interpretationsprozesses betrachtet. Er wird als "verführter Voyeur" beschrieben, der durch die implizite Darstellung von Sexualität in den Text hineingezogen und zur aktiven Mitarbeit an der Deutung des erotischen Untertons aufgefordert wird. Die Analyse berücksichtigt die Rezeptionsgeschichte und die unterschiedlichen Lesarten des Textes.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die Arbeit verwendet Schlüsselbegriffe wie Heinrich von Kleist, Die Marquise von O..., Novelle, Sexualität, Erotik, Verdrängung, Substitution, implizite Darstellung, Zeichen, Symbol, Leserrezeption, Begehren und Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts.
Welche Bedeutung hat Hannelore Schlaffers Poetik der Novelle in dieser Arbeit?
Die Arbeit bezieht sich auf Hannelore Schlaffers Thesen zum zentralen Stellenwert des sexuellen Aktes in Novellen des 19. Jahrhunderts und dessen verdrängender und substituierender Darstellung. Schlaffers Ansatz dient als methodische Grundlage für die Analyse der impliziten Sexualität in Kleists "Die Marquise von O...".
- Quote paper
- Janin Taubert (Author), 2006, Die Substituierung des sexuellen Faktums und die implizite Enthüllung erotischen Begehrens in Heinrich von Kleists Novelle "Die Marquise von O...", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110671