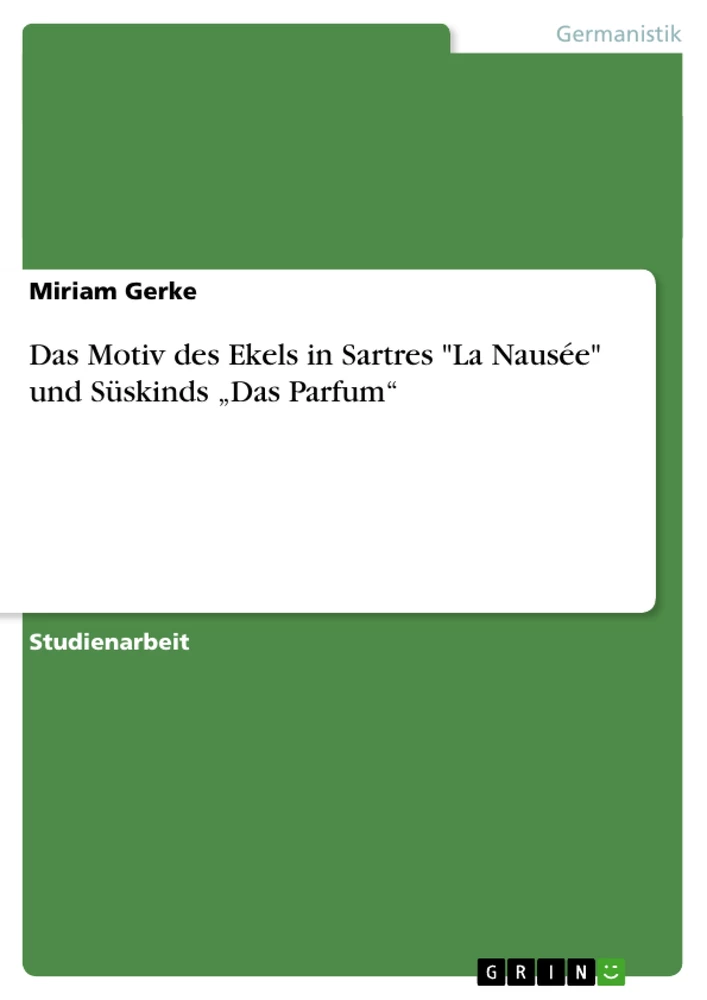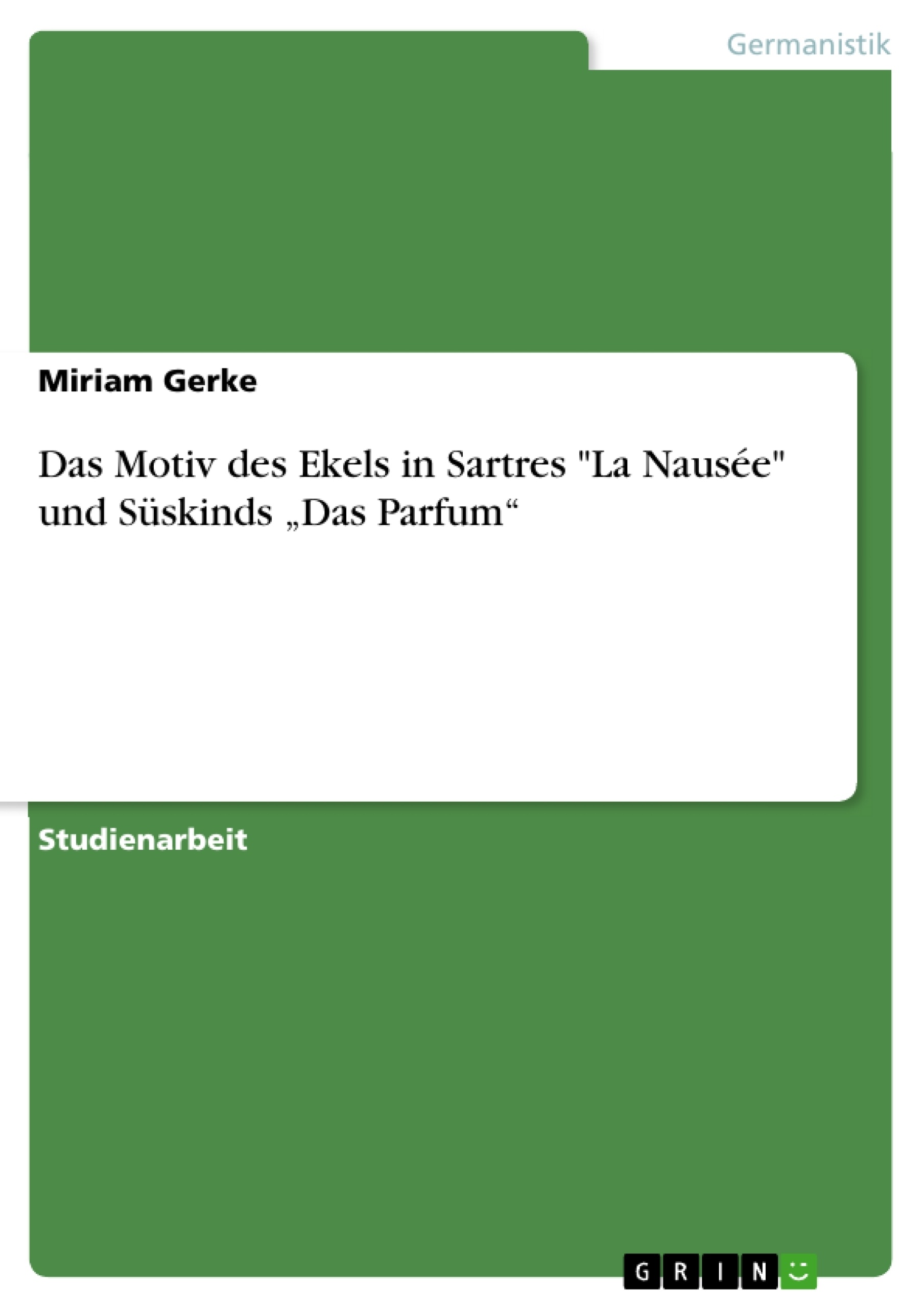1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Motiv des Ekels in den Romanen
„La Nausée“ von Sartre und „Das Parfum“ von Süskind, zwei völlig verschiede- nen Romanen aus verschiedenen literarischen Epochen mit unterschiedlichster Thematik. Dennoch weisen sie, wie sich zeigen wird, einige Parallelen auf, vor allem im Hinblick auf die Funktion des Ekels.
Als Grundlage dient dieser Untersuchung eine phänomenologische Studie aus dem Jahre 1929, die die Grundzüge des Ekels skizziert und nach wie vor ihres- gleichen sucht.
Aurel Kolnai hat 1929 in Husserls Jahrbuch für Philosophie und phänomenologi- sche Forschung den scharfsinnigen und lange Zeit einzigen Versuch unternom- men, das „merkwürdig breite Erstreckungsgebiet“ der gleichzeitig höchst „zuge- spitzten“ Ekelreaktion umfassend zu kartographieren. Die 50 dichten, unerhört unterscheidungsreichen Seiten sind immer noch das Fundament einer jeden Beschreibung des Ekels.1
Aurel Kolnais Aufsatz „Der Ekel“ von 1929 dient bis heute der Ekel- Forschung als Grundlage und bietet sich auch dieser Arbeit als Basis an, da die Studie in zeitlicher Nähe zur Entstehung von Sartres „La Nausée“ steht. Somit wird sie dem Phänomen Ekel auch aus damaliger Sicht gerecht. Kolnais Ausführungen sollen im Folgenden kurz zusammengefasst werden.