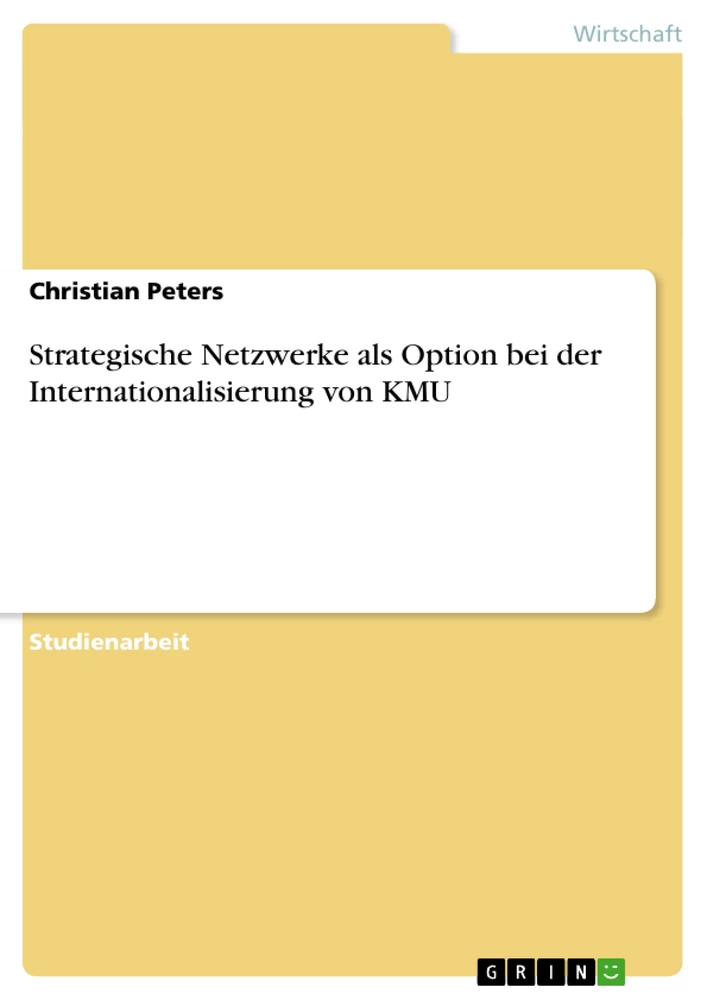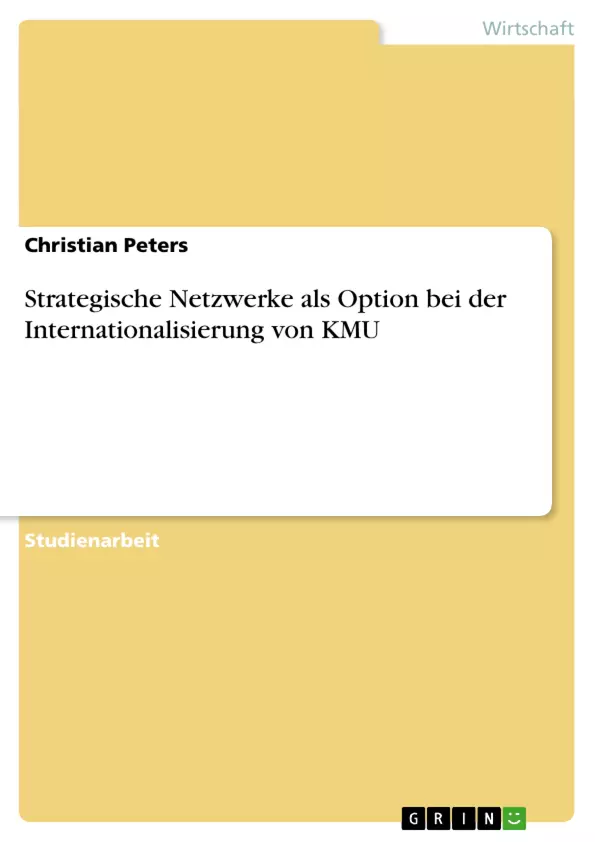Die Öffnung europäischer und globaler Märkte bietet Unternehmen immer weitreichendere Handlungsspielräume für internationale Aktivitäten.[1] Doch intensiverer Handel und steigende internationale Faktormobilität führen im Gegenzug auch auf den heimischen Märkten zu einer erhöhten Wettbewerbsintensität, die einheimische Untern., speziell KMU, unter Druck setzt und zu Anpassungen zwingt.[2] Es entsteht ein Zwang zur Erschließung internationaler Märkte.[3] In den nächsten Abschnitten soll gezeigt werden, wie und warum internationalisiert wird, wie Kooperationen gerade KMU dabei helfen können und wie Koop. wissenschaftlich erklärt wird. Strategische Netzwerke als eine spezielle Form der Int. werden näher erläutert und es wird auf Vertrauen als Grundlage jeder kooperativen Beziehung eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
1. Der Zwang zur Internationalisierung
2. Internationalisierung von KMU
2.1 Internationalisierungstrend und Erklärungsansätze
2.2 Formen der Internationalisierung
2.3 Größenspezifische Probleme der Internationalisierung und Auswege
3. Internationalisierung durch Kooperation
3.1 Motive für Kooperation speziell im internationalen Bereich
3.2 Formen, Definitionen und Verbreitung der Kooperation
3.2.1 Kooperation und verwandte Begriffe
3.2.2 Definition und Formen von Kooperation
3.2.3 Das Verhältnis von Kooperation und Wettbewerb
3.2.4 Verbreitung von Kooperation als Internationalisierungsstrategie von KMU
3.3 Erklärungsansätze für die Existenz kooperativer Organisationsformen
3.4 Probleme und Gefahren der Kooperation
4. Das Strategische Netzwerk
4.1 Das Strategische Netzwerk in Abgrenzung zu anderen Formen der kooperativen Organisation
4.2 Beispiele für Strategische Netzwerke
4.3 Vor- und Nachteile von strategischen Netzwerken für die beteiligten Unternehmen
5. Vertrauen in kooperativen Beziehungen
6. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abb.1: Kooperation im Rahmen des Transaktionskostenansatzes 10
1. Der Zwang zur Internationalisierung
Die Öffnung europäischer und globaler Märkte bietet Unternehmen immer weitreichendere Handlungsspielräume für internationale Aktivitäten.1 Doch intensiverer Handel und steigende internationale Faktormobilität führen im Gegenzug auch auf den heimischen Märkten zu einer erhöhten Wettbewerbsintensität, die einheimische Untern., speziell KMU, unter Druck setzt und zu Anpassungen zwingt.2 Es entsteht ein Zwang zur Erschließung internationaler Märkte.3 In den nächsten Abschnitten soll gezeigt werden, wie
und warum internationalisiert wird, wie Kooperationen gerade KMU dabei helfen können und wie Koop. wissenschaftlich erklärt wird. Strategische Netzwerke als eine spezielle Form der Int. werden näher erläutert und es wird auf Vertrauen als Grundlage jeder kooperativen Beziehung eingegangen.
2. Internationalisierung von KMU
2.1 Internationalisierungstrend und Erklärungsansätze
„Während über die fortschreitenden Internationalisierungszwänge mittelständischer Unternehmen Einigkeit besteht, ist der Informationsstand über Art und Umfang ihrer Internationalisierungsaktivitäten mit sehr großen Lücken behaftet“.4 Nach Auswertung sowohl von amtlichen als auch nicht-amtlichen Statistiken kommen Kokalj/Wolff zum Ergebnis, das die Int. von KMU weit fortgeschritten ist, da schon ca. 33% aller deutschen KMU in irgendeiner Form international tätig sind, was die Großuntern. zumindest zahlenmäßig stark übertrifft.5 Als Erklärung für die häufige Wahl von Int. als strategische Alternative wird in erster Linie der verstärkte internationale Wettbewerb bzw. die Globalisierung genannt,6 weiterhin die starke Konkurrenz durch fusionierte
Großuntern., insbesondere in Märkten mit Größendegressionspotentialen,7
ferner die Sättigung der Märkte im Konsumgüterbereich, der verschärfte Preiswettbewerb, eine Ausweitung von kostenverursachenden Vorschriften in Deutschland und eine Änderung des Konsumentenverhaltens durch stagnierende bzw. sinkende Einwohnerzahlen.8 All diese Rahmenbedingungen erzeugen im Ergebnis einen stärkeren Wettbewerb. Im Gegensatz zu Großuntern. fehlt KMU in der Regel das Kapital zur Finanzierung effizienterer Produktionstechnologien,9 somit erscheint die Nutzung und Neuerschließung von internationalen Märkten sinnvoll, um die Wettbewerbsposition zu sichern bzw. zu stärken. Man kann Int.-motive nach der Logik des Realgüterprozesses systematisieren:10
1. Beschaffungsorientierte Gründe (Sicherung von Ressourcen jeder Art),
2. Produktionsorientierte Gründe (Nutzung von Economies of Scale/Scope),
3. Absatzorientierte Gründe (Erschließung neuer Märkte) und
4. Umweltorientierte Gründe (Nutzung vorteilhafter länderspezifischer Rahmenbedingungen).
2.2 Formen der Internationalisierung
Int. als Strategie ist dann gegeben, wenn ein Untern. in einem ausländischen Markt tätig wird, um ein neues Geschäftsfeld zu erschließen.11 Der internationale Markteintritt läßt sich prinzipiell unterscheiden in vertragliche und investive Formen. Unter vertragliche Formen fallen Im-/Export, Sub-Contracting, Auftrags- bzw. Lohnfertigung und pachtähnliche Verhältnisse wie z. B. Lizenz- und Franchiseverträge. Investive Formen sind Beteiligungen an oder Übernahme von ausländischen Untern. bzw. die Gründung eines Joint-Ventures oder eines Tocherunternehmens.12 Systematisiert nach zunehmendem Grad der Kontrolle über das Auslandsgeschäft kann man Export, Lizenzvergabe, Franchising und Direktinvestition als Idealtypen der Int. ansehen.13
2.3 Größenspezifische Probleme der Internationalisierung und Auswege
Int. ist eine geeignete Strategie zur Reaktion auf den stärker werdenden Wettbewerbsdruck, jedoch für KMU nicht problemlos einsetzbar. Es herrscht verbreitet die Auffassung, das eine Reihe von Restriktionen existiert.14 In erster Linie sind dies begrenzte Ressourcen sowohl finanzieller als auch personeller Art,15 die die Planung, Finanzierung und Durchführung von Auslandsengagements erschweren oder unmöglich machen. Ein weiterer großer Nachteil wird in der Unternehmensführung durch die Unternehmer
selbst, der geringen Arbeitsteilung und der sich daraus ergebenden Inflexibilität und Überforderung in komplexer Umwelt gesehen.16 Weitere Restriktionen sind die Spezialisierung der Angebotspalette, eine regionale Orientierung und ein Mangel an Informationen über potentielle Märkte.17
Diese Restriktionen können als größenbedingte Markteintrittsbarrieren verstanden werden, denen von Seiten der mit begrenzten Ressourcen ausgestatteten KMU durch Kooperation begegnet werden kann.18 Allgemein
wird Koop. als besonders geeignet für KMU angesehen,19 weil damit, z.B. in
Netzwerken, Marktproblemen durch Erzielung höherer Renten, Minimierung der Wertschöpfungskonkurrenz und Abwehr von Substitutionskonkurrenz besser begegnet werden kann, ebenso wie die weit verbreiteten Ressourcenprobleme durch Poolung gemindert werden können.20
3. Internationalisierung durch Kooperation
3.1 Motive für Kooperation speziell im internationalen Bereich
Wird Koop. als bewußt gewählte Strategie verstanden und nicht nur als unvermeidliche Reaktion auf die vorgenannten Umweltbedingungen, muß es gute Gründe für diese Wahl geben. Grundsätzlich muß die erzielbare Koop.- rente höher sein als die erwartete Rente durch kompetetives Handeln im Allein- gang, anderenfalls bestünde keinerlei Anreiz zum Eingehen einer Koop..21 Child/Faulkner sehen zwei grundsätzliche Motive für kooperative Strategien: Lernen und Fähigkeitssubstitution.22 Weitere Motive für Koop.:23
1. Risikoreduktion z.B. in instabilen Ländern im politischen Umbruch24 oder
durch die Vermeidung von „sunken costs“ im Rahmen von Integration oder Eigenaufbau und eine dadurch resultierende Erhöhung der Flexibilität.25
2. Realisierung von Economies of Scale und/oder Rationalisierung durch externe Synergiepotentiale.26
3. Technologieaustausch und Know-How-Transfer.27
4. Wettbewerbsabwehr durch Reduktion der Rivalität.28
5. Überwindung von staatlichen Handels- oder Investitionsbarrieren.29
6. Erleichterung der ersten Int.. unerfahrener Firmen.
7. Vertikale Quasi-Integrationsvorteile durch Verbindung der komplementären Beiträge der Partner in der Wertkette.30
[...]
1 Vgl. Maaß/Wallau (2003), S. 1.
2 Vgl. ebd., S. 1, Gerum (1999), S. 1, Kokalj/Wolff (2001), S. 1, Henke (2003), S. 2.
3 Vgl. Kaufmann (1996), S. 1 ff., Kokalj/Wolff (2001), S. 1, Stauffert (1993), S. 39.
4 Kokalj/Wolff (2001), S. 1.
5 Vgl. ebd. S. 43 ff.
6 Vgl. Enßlinger (2003), S. 129, Kittler (2003), S. 171, Balling (1997), S. 7, Gerum (1999), S. 1, Müller (1990), S. 351 ff.
7 Vgl. Henke (2003), S. 1 ff., Stauffert (1993), S. 39, Holtbrügge (2003), S. 3.
8 Vgl. Müller (1990), S. 352, Stauffert (1993), S. 39.
9 Vgl. Stauffert (1993), S. 39.
10 Vgl. Gerum (1999), S. 2 f.
11 Vgl. ebd., S. 2.
12 Vgl. Kokalj/Wolff (2001), S. 2, Stauffert (1993), S. 40 ff.
13 Vgl. Gerum (1999), S. 4.
14 Vgl. Kaufmann (1996), S. 8, Gerum (1999), S. 3, Torres (2002), S. 231.
15 Vgl. Kokalj/Wolff (2001), S. 1, Müller (1990), S. 354 ff., Holtbrügge (2003), S. 4, Gerum (1999), S. 3, Torres (2002), S. 230 f.
16 Vgl. Müller (1990), S. 354 ff., Henke (2003), S. 7, Gerum (1999), S. 3.
17 Vgl. Müller (1990), S. 354 ff., Kokalj/Wolff (2001), S. 1, Gerum (1999), S. 3.
18 Vgl. Maaß/Wallau (2003), S. 1.
19 Vgl. Haussmann (1997), S. 459 ff., Henke (2003), S. 1, Wildemann (1997), S. 418, Pichler/Pleitner/Schmidt (2000), S.24.
20 Vgl. Gerum (1999), S. 12 f.
21 Vgl. Gerum (1999), S. 7, ähnlich Hamer/Linke (1991), S. 183.
22 Vgl. Child/Faulkner (1998), S. 102.
23 Vgl. ebd., S. 67.
24 Vgl. Stauffert (1993), S. 43.
25 Vgl. Balling (1997), S. 36, Henke (2003), S. 17.
26 Vgl. Henke (2003), S. 17.
27 Vgl. Backhaus/Meyer (1993), S. 331 .
28 Vgl. Gerum (1999), S. 13, Henke (2003), S. 17.
29 Vgl. Stauffert (1993), S. 42., Gerum (1999), S. 12 f.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Abhandlung?
Diese Abhandlung behandelt die Internationalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), insbesondere durch Kooperationen und strategische Netzwerke. Es werden die Gründe für die Internationalisierung, die Formen der Internationalisierung, die größenspezifischen Probleme von KMU bei der Internationalisierung und die Rolle von Kooperationen bei der Bewältigung dieser Probleme untersucht. Ein besonderer Fokus liegt auf strategischen Netzwerken und dem Vertrauen als Grundlage kooperativer Beziehungen.
Warum ist Internationalisierung für KMU wichtig?
Die Öffnung der Märkte führt zu einem erhöhten Wettbewerbsdruck, dem sich KMU stellen müssen. Die Internationalisierung bietet eine Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen, Wettbewerbsvorteile zu sichern und zu stärken, sowie Ressourcen zu sichern und Produktionsvorteile zu nutzen. Dies kann helfen, die eigene Position im globalen Wettbewerb zu behaupten.
Welche Formen der Internationalisierung gibt es?
Es gibt verschiedene Formen der Internationalisierung, die sich in vertragliche und investive Formen unterteilen lassen. Vertragliche Formen umfassen Im-/Export, Sub-Contracting, Auftragsfertigung und Lizenzverträge. Investive Formen sind Beteiligungen an ausländischen Unternehmen, Übernahmen oder die Gründung von Joint-Ventures oder Tochterunternehmen. Grundsätzlich kann man von Export, Lizenzvergabe, Franchising bis Direktinvestition sprechen.
Welche Probleme haben KMU bei der Internationalisierung?
KMU stehen bei der Internationalisierung vor besonderen Herausforderungen, insbesondere durch begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen. Weitere Restriktionen sind die Unternehmensführung durch die Unternehmer selbst, die geringe Arbeitsteilung, Spezialisierung der Angebotspalette und Mangel an Informationen über potentielle Märkte.
Wie können Kooperationen KMU bei der Internationalisierung helfen?
Kooperationen können KMU helfen, größenbedingte Markteintrittsbarrieren zu überwinden. Durch die Bündelung von Ressourcen, den Austausch von Know-how und die gemeinsame Nutzung von Netzwerken können KMU ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und die Risiken der Internationalisierung reduzieren. Dies kann z.B. in Netzwerken geschehen.
Was sind strategische Netzwerke?
Strategische Netzwerke sind eine spezielle Form der kooperativen Organisation, die darauf abzielt, die strategischen Ziele der beteiligten Unternehmen gemeinsam zu erreichen. Sie ermöglichen den Zugang zu Ressourcen, Märkten und Technologien, die einzelnen Unternehmen möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Sie sind somit ein guter Weg zur Internationalisierung für KMU.
Welche Rolle spielt Vertrauen in kooperativen Beziehungen?
Vertrauen ist eine wesentliche Grundlage für erfolgreiche kooperative Beziehungen. Es fördert die Zusammenarbeit, reduziert Transaktionskosten und ermöglicht den Austausch von sensiblen Informationen. Vertrauen ist somit ein kritischer Erfolgsfaktor für die Internationalisierung durch Kooperation.
Welche Motive gibt es für die Kooperation im internationalen Bereich?
Motive für Kooperationen im internationalen Bereich sind Risikoreduktion, Realisierung von Economies of Scale, Technologieaustausch, Wettbewerbsabwehr, Überwindung von Handelsbarrieren, Erleichterung der ersten Internationalisierung und vertikale Quasi-Integrationsvorteile.
- Quote paper
- Dipl.-Kfm. Christian Peters (Author), 2004, Strategische Netzwerke als Option bei der Internationalisierung von KMU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110875