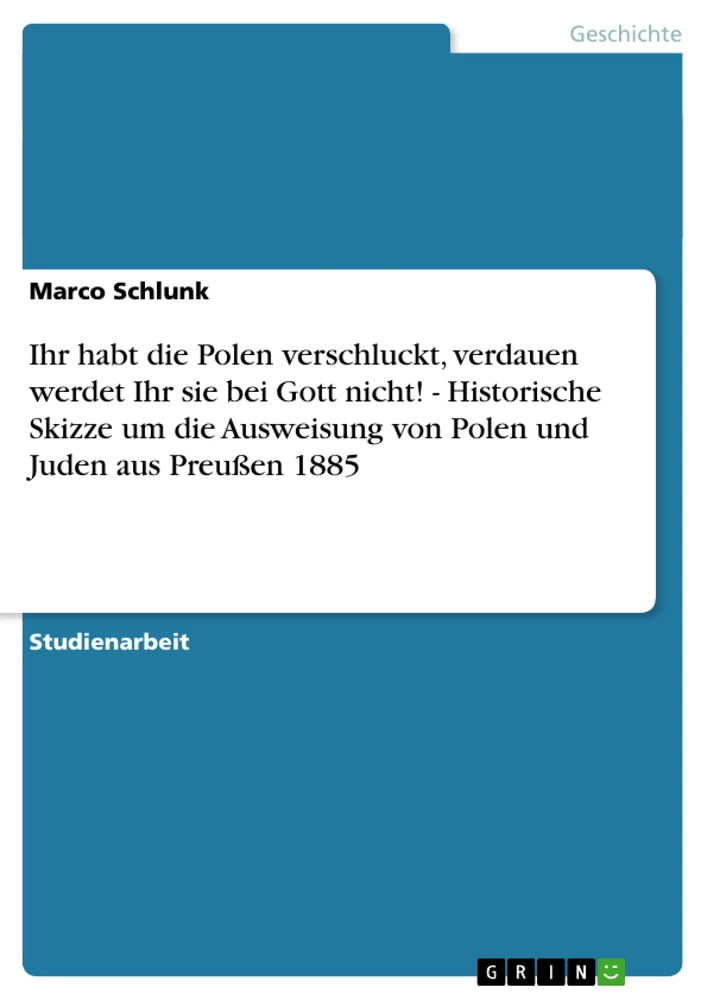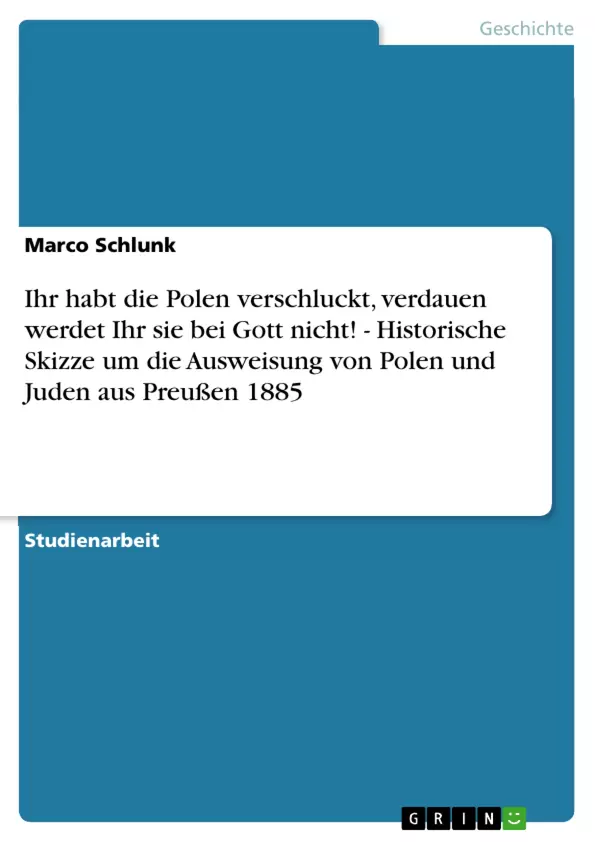Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Welt, in der Ihre Identität, Ihre Sprache und Ihre Kultur systematisch unterdrückt werden. Dieses Buch enthüllt die düstere Realität der preußischen Polenpolitik im 19. Jahrhundert, insbesondere die Repressionen in Posen und Westpreußen. Es ist eine Geschichte von Widerstand, erzwungener Migration und dem unerbittlichen Kampf um nationale Identität. Beleuchtet wird der historische Kontext von Polens Teilungen und dem polnischen Widerstand gegen die preußische Herrschaft. Im Fokus steht die brutale Germanisierungspolitik, die von Bismarck und seinem Kulturkampf vorangetrieben wurde, einschließlich Schulpolitik, Ansiedlungspolitik und der Vertreibung von etwa 26.000 Polen aus Preußen. Das Buch analysiert die Methoden des preußischen Staates, die mit Kultur- und Bodenpolitik die Weichen für die Repressionen stellten, und untersucht die Beweggründe und Konsequenzen dieser Zwangsmigration. Es wird der Frage nachgegangen, ob Bismarck sein Ziel der Germanisierung Posens und Westpreußens erreichte, und bewertet die langfristigen Auswirkungen dieser Politik auf die polnische Bevölkerung. Eine erschütternde Analyse staatlicher Repression und des unbezwingbaren Geistes eines Volkes, das entschlossen war, seine Identität zu bewahren. Dieses Buch bietet einen tiefen Einblick in ein dunkles Kapitel der deutsch-polnischen Geschichte und regt zum Nachdenken über die Mechanismen von Zwangsmigration und kultureller Unterdrückung an. Es ist ein Muss für alle, die sich für Geschichte, Politik und die komplexen Beziehungen zwischen Nationen interessieren. Erfahren Sie, wie die preußische Politik das Leben von Tausenden von Polen beeinflusste und die Grundlage für zukünftige Konflikte legte. Ein aufrüttelndes Porträt einer vergessenen Tragödie. Die Analyse der preußischen Polenpolitik bietet wertvolle Einblicke in die Dynamik von Nationalismus, Imperialismus und Zwangsmigration und ist relevant für das Verständnis moderner Konflikte und die Bedeutung des Schutzes von Minderheitenrechten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Historischer Kontext 1790
2.1. Polens Teilung und Widerstand im 19. Jahrhundert
2.2. Preußens Polenpolitik im 19. Jahrhundert
3. Fokus: Repressionen in Posen und Westpreußen 1880
3.1. Kulturkampf und Ostmarkenpolitik bis
3.1.1. Schul- und Kulturpolitik
3.1.2. Ansiedlungspolitik3
4. Fokus: Die Ausweisung von ca. 26000 Polen aus Preußen
5. Ergebnisse
1. Einleitung
„Die Polen wollen nur Preußen mit 24-stündiger Kündigung sein, `Was nicht deichen will, muß weichen`“4 sagte Bismarck 1887 in einer Reichstagsrede um die Ausweisung von 25917 Polen aus Preußen zu verteidigen. Die Ausweisung von Polen und Juden war in diesem Fall keineswegs ein autonomer Akt, sondern ist eingebettet in eine Reihe von Repressionen, die die polnischen Bürger Preußens erdulden mußten. Spätestens nach der Gründung des deutschen Reiches 1871 verschärfte sich der des preußischen
Staatsapparates gegenüber den Polen. Ihnen wurde mangelnde Assimilation, ja sogar die Reichsfeindschaft vorgeworfen. Die Regierung Preußens reagierte auf Unruhen vor allem in Posen mit einem massiven Germanisierungskatalog, der hier noch genauer besprochen werden soll.
An erster Stelle sollen in kurzer Form die politischen Beziehungen beleuchtet werden, die Polen und Deutsche in den letzten einhundert Jahren vor der Germanisierungs- politik eingegangen sind. Nur durch die wechselvolle Beziehungsgeschichte zwischen den beiden Nationen ist die mißlungene Integration der Polen ins preußische Imperium zu erklären. Beginnend mit der Geschichte des polnischen Widerstandes gegen die preußischen Besatzer soll der Bogen zur Gegenseite geschlagen werden. Obwohl die Polenpolitik nur ein kleiner Teil der gesamten Politik Preußens gewesen ist, muß hier gründlich vorgegangen werden, da gerade im Agieren des (später) deutschen Staates der Schlüssel für die Erklärung der Repressionen gegen die polnische Bevölkerung liegt.
Deswegen soll im Kapitel 3 der Fokus auf die Methoden des preußischen Staates gerichtet werden, der mit Kultur- und Bodenpolitik die Weichen für die Repressionen stellte.
Im nächsten Kapitel soll nun die Aufmerksamkeit endlich auf die Ausweisung der
~26000 Polen gelegt werden, die jedoch auch „nur“ Teil der aggressiven Gangart Preußens war. Hier wird zu beachten sein, warum Polen russischer und österreichischer Staatsbürgerschaft in den Provinzen Posen und Westpreußen lebten und wie genau die Ausweisung durchgeführt wurde. Erreichte Bismarck damit sein Ziel, Posen und West- und Südpreußen zu germanisieren?
Abschließend soll dieser Vorgang unter dem Gesichtspunkt der Zwangsmigration betrachtet werden.
2. Historischer Kontext
2.1. Polens Teilung und Widerstand im 19. Jahrhundert
Ein markanter Punkt in der Geschichte der polnischen Nation ist mit Sicherheit das Jahr 1792 und schon im Vorfeld muß man der verhinderten Nation Polen einige politische Unzulänglichkeiten nachweisen.5
Nicht nur, dass das polnische Königreich von ausländischen Königen regiert wurde und der König keine wirkliche Macht im Staatsgefüge besaß, auch der polnische Hochadel war untereinander zerstritten. So wundert es nicht, dass dringende Reformen unterlassen wurden. Um die seit Jahrzehnten herrschende Schwäche auszugleichen, leitete Polen 1790/91 eine aufgeklärte Verfassungsreform ein (die als erste moderne Verfassung Europas gilt). Aber auch diese Reform konnte das innenpolitische Problem nicht lösen. Zarin Katharina II marschierte daraufhin, die Schwäche nutzend, mit ihren Truppen in Polen ein. Durch drei Teilungen (1792, 1793 und 1795) wurde Polen nun zerrissen.
Die Gebiete fielen an die Nachbarn Preußen (Posen, Westpreußen, Großpolen = Südpreußen, Masowien), Rußland (Litauen, Podolien, Wolhynien) und Österreich (Galizien, Kleinpolen = Westgalizien)6. Im Zuge napoleonischen Herrschaft in Europa entstand in Warschau 1807 ein kleines Herzogtum. Nach dem Wiener Kongreß 1815 wurde das konstitutionelle Königreich Polen („Kongreßpolen“) geschaffen, dass sich bis
1831 relativ autonom verwalten konnte, obwohl es formal mit dem russischen Zarenhaus verbunden war.
In den Folgejahren versuchte Rußland seinen Einfluß auf Polen zurückzugewinnen, denn die Teilung Polens brachte den siegreichen Mächten neben Gebietsgewinnen auch massive innenpolitische Probleme. Kulminationspunkt dieses Problems war der Novemberaufstand 1830. Im Zuge der national motivierten Revolten beschloß der polnische Senat, den Zaren nicht mehr als Herrscher anzuerkennen, der sich diesem Affront nicht bieten ließ und militärisch intervenierte.
Das Ergebnis war für Polen katastrophal7. Die Gebiete rechts der Weichsel waren
verwüstet, viele Dörfer und damit eine Grundversorgung gab es nicht mehr und die polnische Wirtschaft geriet immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten. Diese
Gesamtniederlage nutzten Preußen und Rußland um die polnischen Gebiete wirtschaftlich wie auch kulturell zu durchdringen. In der Folgezeit bis 1863 betrieben die beiden Besatzungsmächte einer verstärkte Germanisierung und Russifizierung der polnischen Gebiete. Diese Repressionsmethoden bestanden vor allem aus der Unterdrückung der polnischen Sprache im öffentlichen Raum (Schulen, Ämter) sowie durch Ansiedlungsverbote und Ausweisungen oppositioneller Polen ins Exil (siehe unten). Im Gegenzug wanderten viele Polen nun russischer und österreichischer Staatsbürgerschaft nach Preußen um an den besseren Wirtschaftlichen Bedingungen zu partizipieren.
1863 kam es zu einer weiteren Erhebung gegen Preußen. Diesmal hatten die Aufständischen aber weder genügend Waffen noch ausreichend Kräfte. Nach einem Partisanenkampf der Polen wurde die Erhebung nach 15 Monaten im Sinne des preußischen Staates beendet.
Danach verstärkte Preußen die Germanisierungspolitik in den polnischen Gebieten. Selbst die Bezeichnung Polen wurde als Nationalitätsbezeichnung verboten. Im
„Kulturkampf“ Bismarcks setzten sich die Repressionen fort. Die massiven Behinderungen der katholischen Kirche waren aber auf lange Sicht für den preußischen Staat kontraproduktiv.
2.2. Preußens Polenpolitik im 19. Jahrhundert
Schon lange vor der eigentlichen Teilung Polens galt das polnische Gebiet zwischen Pommern und Ostpreußen preußischen Königen als erstrebenswerter Besitz um so eine Landbrücke zwischen dem geteilten Land zu sichern. Nach der Annexion 1772 setzte in dem betreffenden Gebiet (Westpreußen) auch sofort eine „Verpreußung“ des Landes ein. Durch Heranziehung deutscher Neusiedler wurden in der Verwaltung die
„gewonnenen“ Landstriche sehr schnell als deutsches Gebiet behandelt.
Die Inbesitznahme Großpolens8 (später Südpreußen) war für den preußischen Staat indessen nicht so einfach. Während in Westpreußen, bedingt durch die Ostsiedlung des Deutschen Ordens, Deutsche, Polen und Kaschuben nebeneinander lebten, war der polnische Bevölkerungsanteil in Großpolen wesentlich höher. Nach dem Wiener Kongreß bekam das Gebiet einen Sonderstatus, der von Autonomie aber weit entfernt war.
So verfolgte Preußen in den Jahren nach dem Kongreß eine gemäßigte Politik gegen Polen. Durch den „königlichen Zuruf“9 wurden die Rechte der Polen festgeschrieben:
„Ihr werdet meiner Monarchie einverleibt, ohne eure Nationalität verleugnen zu dürfen… Eure Religion soll aufrechterhalten… Eure Sprache soll neben der deutschen in allen öffentlichen Verhandlungen gebracht werden, und jedem unter Euch soll nach Maßgabe seiner Fähigkeiten der Zutritt zu den öffentlichen Ämtern des Großherzogtums, sowie Ämtern, Ehren und Würden meines Reiches offenstehen.“
Trotz aller Verschärfungen und späteren Repressionen gegen Polen beriefen sich diese durch das ganze 19. Jahrhundert hinweg auf oben stehenden Zuruf. Nachdem der Novemberaufstand 1830 scheiterte und in diesem auch Adlige und polnische Beamte des preußischen Staates involviert waren, nahm das preußische Kabinett eine Ablehnende Haltung gegenüber der polnischen Nationalbestrebungen ein. Eduard v.
Flottwell wurde als Oberpräsident eingesetzt und suchte die Germanisierung der polnischen Bevölkerung voranzutreiben10. 1832 erschien eine Verordnung, die die deutsche Sprache hervorhob. Der polnische Adel wurde von der regionalen Verwaltung ausgeschlossen.
Als das Jahr 1848 in ganz Europa Veränderungen brachte, glaubten auch die Polen an eine Herstellung ihres Staates und im deutschen Parlament in Frankfurt herrschte eine gewisse „Polenbegeisterung“. Demokraten, wie F. Engels, nahmen propolnische Positionen ein. 1848 beriet die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche über die Polenfrage. In der neuen rheinischen Zeitung schrieb Friedrich Engels 1848
darüber11:
„Die ganze Debatte hinterläßt einen wehmütigen Eindruck. So viel lange Reden und so wenig Inhalt, so wenig Bekanntschaft mit dem Gegenstande, so wenig Talent! … In der Tat, eine Versammlung wie diese hat noch nie und nirgends gesessen! Die Beschlüsse sind bekannt. Man hat 3 / 4 von Posen erobert; man hat sie erobert weder durch Gewalt noch durch "deutschen Fleiß", noch durch den "Pflug", sondern durch Kannegießerei, erlogene Statistik und furchtsame Beschlüsse. "Ihr habt die Polen verschluckt, verdauen werdet Ihr sie bei Gott nicht!"
Durch die Aufnahme einiger Teile Großpolens in den deutschen Bund war diese Hoffnung jäh zu Ende. Erneut war das polnische Kernland gespalten. Nach den Kriegen gegen Dänemark (1864), Österreich (1866) und Frankreich (1870/71) und der
Schaffung des Deutschen Reiches (1871) war nun kein Raum mehr für Sonderstellungen. Polen, Dänen und Lothringer teilten ihr Los. Germanisierung und jedwede Ablehnung von Nationalitätenschutz waren die Antworten des preußisch, deutschen Staates. Bismarcks Kulturkampf, das Sozialistengesetz und die Germanisierungsmaßnahmen schlossen vor allem auch die Polen ein.
Zusammenfassend kann man an dieser Stelle sagen, dass die preußische Innen- wie Außenpolitik darauf ausgerichtet war, dass eine Selbstständigkeit oder Nationenbildung Polens verhindert wird. Im Gegenteil, durch staatliche Maßnahmen wurde bewußt eine Unterdrückung polnischer Angelegenheiten in Kultur, Bildung und Politik forciert.
[...]
1 Janiszewski, Mitglied des Posenschen Nationalkomitees; Quelle: http://www.mlwerke.de/me/me05/me05_319.htm Absatz: 348 (eingesehen am 17.02.2006).
2 Quelle: http://www.deutsche-undpolen. de/_/_servlet/de.blueorange.xred.util.getfile/db=dup/imgcol=bild_voll/key=id/keyval=8774/tbl=int_xredimage/au sweisung+von+polen+durch+einen+preu%25c3%259fischen+landpolizisten.jpeg (eingesehen am 17.02.2006).
3 Balzer ,
4 Zitat nach Zitzewitz, S. 47
5 Hellmann, S. 154ff; Landgrebe, S. 211ff; Rhode, S. 399ff
6 Schimkus, Der große historische Weltatlas S. 260.
7 Gill, S. 186 – 188.
8 Balzer, S. 24.
9 Broszat, S. 55.
10 Balzer, S. 25ff.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Er befasst sich mit der preußischen Politik gegenüber Polen im 19. Jahrhundert, insbesondere mit Repressionen, Germanisierungspolitik und der Ausweisung von Polen aus Preußen.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind: Polens Teilung und Widerstand, preußische Polenpolitik, Repressionen in Posen und Westpreußen (Kulturkampf, Ostmarkenpolitik, Schul- und Kulturpolitik, Ansiedlungspolitik), die Ausweisung von Polen aus Preußen und Zwangsmigration.
Welchen historischen Kontext beleuchtet der Text?
Der Text beleuchtet den historischen Kontext ab 1790, beginnend mit Polens Teilungen und dem Widerstand im 19. Jahrhundert. Er beschreibt auch die preußische Polenpolitik in dieser Zeit, einschließlich der Einflüsse des Wiener Kongresses und der nachfolgenden Germanisierungsbestrebungen.
Was wird über die Repressionen in Posen und Westpreußen gesagt?
Der Text konzentriert sich auf die Repressionen in Posen und Westpreußen ab 1880, insbesondere den Kulturkampf und die Ostmarkenpolitik. Er behandelt die Schul- und Kulturpolitik sowie die Ansiedlungspolitik, die darauf abzielten, die deutsche Bevölkerung zu stärken und den polnischen Einfluss zu verringern.
Was war die Ausweisung von Polen aus Preußen?
Der Text thematisiert die Ausweisung von etwa 26.000 Polen aus Preußen. Es wird untersucht, warum Polen russischer und österreichischer Staatsbürgerschaft in den Provinzen Posen und Westpreußen lebten und wie die Ausweisung durchgeführt wurde. Ziel war die Germanisierung dieser Gebiete.
Welche Schlüsselfiguren werden erwähnt?
Otto von Bismarck wird im Zusammenhang mit seiner Politik der Germanisierung und den Repressionen gegen Polen erwähnt. Eduard von Flottwell wird als Oberpräsident genannt, der die Germanisierung der polnischen Bevölkerung vorantrieb. Friedrich Engels wird im Zusammenhang mit seiner Kritik an der preußischen Politik in Posen zitiert.
Welche Ereignisse sind von Bedeutung?
Wichtige Ereignisse sind die Teilungen Polens (1792, 1793, 1795), der Novemberaufstand 1830, die Revolutionen von 1848 und die Gründung des Deutschen Reiches 1871.
Welche Quellen werden im Text verwendet?
Der Text verweist auf verschiedene Quellen, darunter Zitate von Bismarck und Engels, sowie auf Werke von Balzer, Broszat, Gill, Hellmann, Landgrebe, Rhode und Schimkus.
- Quote paper
- Marco Schlunk (Author), 2006, Ihr habt die Polen verschluckt, verdauen werdet Ihr sie bei Gott nicht! - Historische Skizze um die Ausweisung von Polen und Juden aus Preußen 1885 , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110876