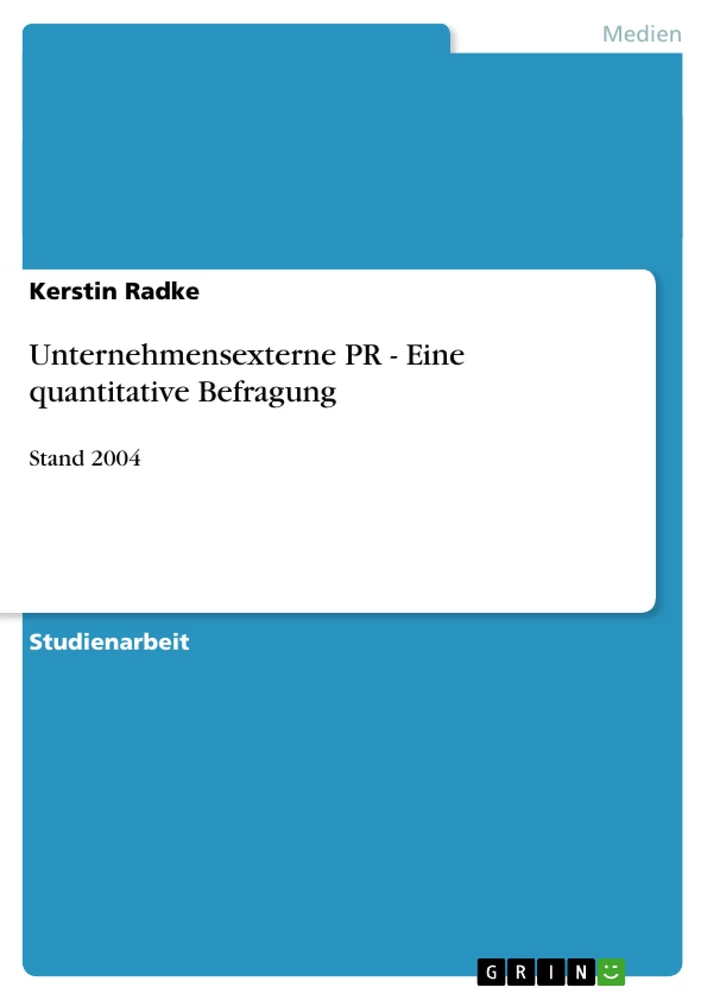PR im Netz stellte sich als wichtiges ergänzendes Instrument zu klassischer PR heraus. Es zeigte sich, dass das Internet Unternehmen viele neue Handlungsoptionen und Zugangsmöglichkeiten zu potentiellen Kunden bietet. Zu diesen neuen Möglichkeiten und Chancen zählen beispielsweise Interaktivität, Hypertextualität, Aktualität und Multimedialität.
Doch auch Probleme wurden in der Literatur angesprochen. So machte eine Gegenüberstellung der Studie von Felix Friedlaender[1] und der ProfNet-Studie Journalisten 2000[2] deutlich, dass eine Diskrepanz zwischen Angebot von Seiten der PR und Nachfrage der Journalisten vorliegt. Das heißt, obwohl die PRler erkannt haben, dass die neuen Merkmale des Internets wichtig für sie sind, ist die Umsetzung nicht immer dementsprechend. Es stellt sich die Frage, ob und wie die neue Option der PR im Netz von Internetusern wahrgenommen und genutzt wird.
Interessant erscheint dabei auch die Bewertung der Unternehmensseiten, die von den Journalisten eher negative Kritik erfahren hatten. Schließen sich die „gewöhnlichen“ Internetuser ihrer Meinung an? Neben dieser Frage diesen Untersuchungen gilt unser Forschungsinteresse den erinnerten bzw. genutzten Elementen, die Aufschluss darüber geben sollen, ob die die neuen Handlungsoptionen im Speziellen erkannt und angewandt werden.
So widmet sich die Untersuchung Ausarbeitung folgenden konkreten forschungsleitenden Fragen:
1. Werden unternehmenseigene Webauftritte von Internetusern wahrgenommen?
1.1. Wie werden Unternehmensauftritte im Netz bewertet?
1.2. Werden Webauftritte von Unternehmen über Wahrnehmung hinaus genutzt?
1.2.1. Welche einzelnen Elemente der Seiten werden wahrgenommen?
1.3.1. Welche Elemente der Seiten werden genutzt?
Inhalt
I. Einleitung
II. Operationalisierung der Fragestellung
2.1.1. Definitionen
2.2. Methoden auswahl
2.3. Das Erhebun gsinstrument
2.4. Methodend urchführ ung
III. I. Auswertung
3.1.1 .Einleitende Variablen ( V 1 - V 4 )
3.2. Wahrnehmung von unternehmenseigenen Seiten (V 5 )
3.3.3. Beurteilungder Unt ernehmensseiten ( V 6 )
3.4. Nutzung der Unter nehmensseiten ( V 7 )
3.5. Genutzte und erinnerte Elemente (V8-V9)
3.6.6. Fazitder Auswer tungsergebnisse
IV. Reflexion
4.1. Probleme be im Ausfüllender Fragebögen
4.2. Probleme bei der Auswert ung
4.3. Was würden wir anders machen
V. Literatur
I. Einleitung
„There is a revolution taking place all around us. Those who believe the information age is about technology are missing the point, this revolution is about communications” Weber 1995 zitiert nach Dierks/ Drees/ Clasen/ Wallbrecht 1999: 367
Dieses Zitat galt im letzten Semester als ein Beleg für grundlegende Veränderungen in unserer Gesellschaft. Dass diese Entwicklung auch – oder insbesondere – den Bereich PR betrifft, war das Ergebnis der weiteren Untersuchungen. So lautete unsere Fragestellung, ob es nicht für Unternehmen notwendig erscheint, die gesellschaftlichen Umgestaltungen aufzunehmen, indem sie das Mittel der Online-PR nutzen.
Die Ergebnisse waren nahezu eindeutig. PR im Netz stellte sich als wichtiges ergänzendes Instrument zu klassischer PR heraus. Es zeigte sich, dass das Internet Unternehmen viele neue Handlungsoptionen und Zugangsmöglichkeiten zu potentiellen Kunden bietet. Zu diesen neuen Möglichkeiten und Chancen zählen beispielsweise Interaktivität, Hypertextualität, Aktualität und Multimedialität.
Doch auch Probleme wurden in der Literatur angesprochen. So machte eine Gegenüberstellung der Studie von Felix Friedlaender1 und der ProfNet-Studie Journalisten 20002 deutlich, dass eine Diskrepanz zwischen Angebot von Seiten der PR und Nachfrage der Journalisten vorliegt. Das heißt, obwohl die PRler erkannt haben, dass die neuen Merkmale des Internets wichtig für sie sind, ist die Umsetzung nicht immer dementsprechend.
Ausgehend von diesen Ergebnissen des letzten Semesters, stellt sich nun die Frage, ob und wie die neue Option der PR im Netz von Internetusern wahrgenommen und genutzt wird.
Interessant erscheint dabei auch die Bewertung der Unternehmensseiten, die von den Journalisten eher negative Kritik erfahren hatten. Schließen sich die „gewöhnlichen“ Internetuser ihrer Meinung an? Neben diesen Untersuchungen gilt unser Forschungs- interesse den erinnerten bzw. genutzten Elementen, die Aufschluss darüber geben sollen, ob die neuen Handlungsoptionen im Speziellen erkannt und angewandt werden.
So widmet sich die Ausarbeitung folgenden konkreten forschungsleitenden Fragen:
1. Werden unternehmenseigene Webauftritte von Internetusern wahrgenommen?
1.1. Wie werden Unternehmensauftritte im Netz bewertet?
1.2. Werden Webauftritte von Unternehmen über Wahrnehmung hinaus genutzt?
1.2.1. Welche einzelnen Elemente der Seiten werden wahrgenommen?
1.3.1. Welche Elemente der Seiten werden genutzt?
II. Operationalisierung der Fragestellung
Zur sinnvollen Operationalisierung der Fragestellung werden zunächst die zentralen Begriffe unserer Fragestellung definiert (siehe Kapitel 2.1.). Anschließend erfolgt die Begründung der Methodenauswahl (siehe Kapitel 2.2.), die Vorstellung des Erhebungsinstrumentes (siehe Kapitel 2.3.) und abschließend für die Operationalisierung die Erläuterung der Methodendurchführung (siehe Kapitel 2.4.)
2.1. Definitionen
Wie bereits erwähnt, ist eine Definition der zentralen Begrifflichkeiten unserer forschungsleitendenden Fragen für das weitere Vorgehen unerlässlich.
So definieren wirInternetuserals alle diejenigen, die mindestens einmal in ihrem Leben das Internet aufgerufen haben.
AlsWahrnehmergelten die Internetuser, die mindestens einmal den Webauftritt eines Unternehmens gesehen haben.
Nutzersind die Internetuser, die mehr als einmal den Webauftritt eines Unternehmens gesehen oder mindestens ein Element des Auftrittes aktiv aufgerufen haben.
Elemente des Webauftrittesbezeichnen alle diejenigen, die den Internetuser mindestens eine Ebene weiter in den Webauftritt führen, wie zum Beispiel eine Suchmaschine oder ein Link.
Dass es sich bei den Definitionen vonWahrnehmerundNutzerum sehr „weiche“ Auslegungen handelt, ist uns bewusst; jedoch wäre eine andere Abgrenzung als über das ein- oder mehrmalige Aufrufen bzw. die Nutzung von Elementen nur schwer möglich umsetzbar gewesen.
Besonders problematisch stellt sich die Definition des BegriffesUnternehmendar, da Unternehmen, die sich ausschließlich über das Internet präsentieren, wie es unter anderem bei Ebay oder Amazon der Fall ist, nicht in die Betrachtung miteinbezogen werden. Begründet liegt diese Begrenzung darin, dass untersucht werden soll, ob Online-PR als Ergänzung zu klassischer PR wahrgenommen und genutzt wird. Demnach sindUnternehmenin dieser Untersuchung alle diejenigen, die nicht nur im Internet präsent sind; das heißt, sich nachträglich zu einem Internetauftritt entschlossen haben.
2.2. Methodenauswahl
Als sinnvollste Methode erscheint die quantitative Befragung. Die Befragung macht es möglich, direkten Kontakt zu den Probanden aufzunehmen und damit ein Meinungsbild zu skizzieren.
Um eine möglichst breit angelegte Gruppe von Befragten zu erreichen, wählten wir die quantitative Variante der Methode. Diese soll erreichen, über das Auszählen von Häufigkeiten konkrete Werte ablesen zu können, die von der Stichprobe auf einen allgemeinen Trend schließen lassen. Um die Trendausrichtung detaillierter zu analysieren, wäre zur Fortführung der Untersuchung eine qualitative Befragung möglich.
2.3. Das Erhebungsinstrument
Aus der konkreten forschungsleitenden Fragestellung leiten sich die folgenden Variablen ab, die Grundlage für das Erhebungsinstrument – also den Fragebogen – darstellen.
V1: Nutzer Internet V2: Geschlecht
V3: Alter V4: Beruf
V5: Wahrnehmung von unternehmenseigenen Seiten V6: Beurteilung der Unternehmensseiten
V7: Nutzung der Unternehmensseiten V8: Wahrgenommene Elemente
V9: Genutzte Elemente
Der schriftliche Fragebogen3 besteht aus 15 sowohl offenen, wie auch geschlossenen Fragen. Die Fragen 13 bis 15 werden nochmals in eine Haupt- und Unterfrage aufgesplittet. Den Anfang des Fragebogens
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3 Siehe Anhang, Seite 23/24
bildet die erste Filterfrage zur Nutzung des Internet, bei deren Verneinung der Fragebogen beendet ist. Anschließend erfolgt das Abfragen der demografischen Daten Alter, Geschlecht und Beruf. Diese an den Anfang der Befragung zu stellen, erscheint motivationspsychologisch sinnvoll, da zunächst kurze Fragen den Probanden zu den längeren inhaltlichen Fragen „hinführen“. Dadurch wird dem frühzeitigen Abbrechen entgegengewirkt.
Der weitere Verlauf des Fragebogens orientiert sich an der Reihenfolge der Variablen, wobei Variable fünf der Frage fünf, Variable sechs den Fragen sechs bis neun, Variable sieben den Fragen zehn bis 13, Variable acht der Frage 14 und Variable neun der Frage 15 zuzuordnen sind.
Die Antwortmöglichkeiten sind zum einen über eine quasi-metrische Skala, das heißt nach dem Schulnotensystem von eins bis sechs, gegeben. Dadurch ist die Auswahl eines absoluten Mittelwertes aller Noten nicht möglich, so dass der Befragte sich für eine Ausrichtung entscheiden muss. Die zweite Antwortvorgabe stellt eine Klassifikation von „Ja“, „Nein“ und „Weiß nicht“ über eine Nominalskala dar.
2.4. Methodendurchführung
Nach der Vorstellung des Erhebungsinstrumentes wird im Folgenden in kurzer Form die Durchführung der Befragung erläutert.
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Erhebungsinstrument um einen schriftlicher Fragebogen, wobei die Ansprache der Probanden jedoch mündlich erfolgte. Dadurch wird ein hoher Rücklauf mit möglichst geringer Reaktivität gewährleistet.
Nach einem Pre-Test, der an drei weiblichen und drei männlichen Personen durchgeführt wurde, sowie zweimaliger Überarbeitung des Fragebogens, fand die Erhebung an einem Vormittags- und einem
Nachmittagstermin im Foyer des Bürgeramtes Münster statt. Als öffentlich zugänglicher Ort sollte dort zu den verschiedenen Tageszeiten eine gemischte Münsteraner Probandengruppe angesprochen werden. Somit stellt die Münsteraner Bevölkerung im Allgemeinen die Grundgesamtheit der Untersuchung dar. Über eine einfache Zufallsstichprobe wurden daraus siebzig Personen ausgewählt.
III. Auswertung
Die Auswertung erfolgt in Anlehnung an die Variablen, wobei zunächst kurz die erste Filterfrage, sowie die demografischen Daten (siehe Kapitel 3.1.) vorgestellt werden. Die zentrale inhaltliche Auswertung untergliedert sich anschließend in die Blöcke Wahrnehmung (siehe Kapitel 3.2.), Beurteilung (siehe Kapitel 3.3.), Nutzung (siehe Kapitel 3.4.) und Elemente (siehe Kapitel 3.5.). Den Abschluss bildet ein Fazit (siehe Kapitel 3.6.)
3.1. Einleitende Variablen (V1 - V4)
Da es sich bei der Grundgesamtheit um die Münsteraner Bevölkerung handelt, untersucht die erste Frage zunächst den Anteil der Internetuser unter den Befragten. Nur diese 88% sind für weitere Analysen relevant, da die Untersuchung sich ausschließlich auf Verhalten bezüglich des Internets bezieht.
Die demografische Verteilung von Alter, Beruf und Geschlecht stellt sich als sehr ungleichmäßig heraus. Am wenigsten gravierend erscheint dieses in der Verteilung von weiblichen (58%) und männlichen (42%) Probanden.
[...]
1 Vgl. Friedländer, 1999
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung untersucht, ob und wie die neue Option der PR im Netz von Internetusern wahrgenommen und genutzt wird. Dabei wird insbesondere auf die Bewertung von Unternehmensseiten und die Wahrnehmung bzw. Nutzung spezifischer Elemente geachtet.
Welche forschungsleitenden Fragen werden untersucht?
Die zentralen Fragen sind:
- Werden unternehmenseigene Webauftritte von Internetusern wahrgenommen?
- Wie werden Unternehmensauftritte im Netz bewertet?
- Werden Webauftritte von Unternehmen über Wahrnehmung hinaus genutzt?
- Welche einzelnen Elemente der Seiten werden wahrgenommen?
- Welche Elemente der Seiten werden genutzt?
Wie werden die zentralen Begriffe definiert?
Die Ausarbeitung definiert:
- Internetuser als alle, die mindestens einmal das Internet aufgerufen haben.
- Wahrnehmer als Internetuser, die mindestens einmal den Webauftritt eines Unternehmens gesehen haben.
- Nutzer als Internetuser, die mehr als einmal den Webauftritt eines Unternehmens gesehen oder mindestens ein Element des Auftrittes aktiv aufgerufen haben.
- Elemente des Webauftrittes als alle, die den Internetuser mindestens eine Ebene weiter in den Webauftritt führen.
- Unternehmen als diejenigen, die nicht nur im Internet präsent sind, sondern sich nachträglich zu einem Internetauftritt entschlossen haben.
Welche Methode wurde für die Untersuchung verwendet?
Es wurde eine quantitative Befragung durchgeführt, um ein Meinungsbild der Internetuser zu erhalten. Dabei wurde ein schriftlicher Fragebogen verwendet, der sowohl offene als auch geschlossene Fragen enthielt.
Wie war die Methodendurchführung gestaltet?
Die Befragung erfolgte mündlich im Foyer des Bürgeramtes Münster. Es wurden zufällig siebzig Personen ausgewählt, um eine gemischte Münsteraner Probandengruppe zu erreichen. Vor der eigentlichen Erhebung wurde ein Pre-Test durchgeführt.
Welche Variablen wurden in der Auswertung berücksichtigt?
Die Auswertung erfolgte in Anlehnung an folgende Variablen:
- V1: Nutzer Internet
- V2: Geschlecht
- V3: Alter
- V4: Beruf
- V5: Wahrnehmung von unternehmenseigenen Seiten
- V6: Beurteilung der Unternehmensseiten
- V7: Nutzung der Unternehmensseiten
- V8: Wahrgenommene Elemente
- V9: Genutzte Elemente
Was sind die wichtigsten Punkte bei der Auswertung?
Die Auswertung gliedert sich in die Blöcke Wahrnehmung, Beurteilung, Nutzung und Elemente. Zunächst werden die einleitenden Variablen (V1-V4) vorgestellt, bevor die inhaltliche Auswertung erfolgt.
- Quote paper
- Kerstin Radke (Author), 2004, Unternehmensexterne PR - Eine quantitative Befragung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110966