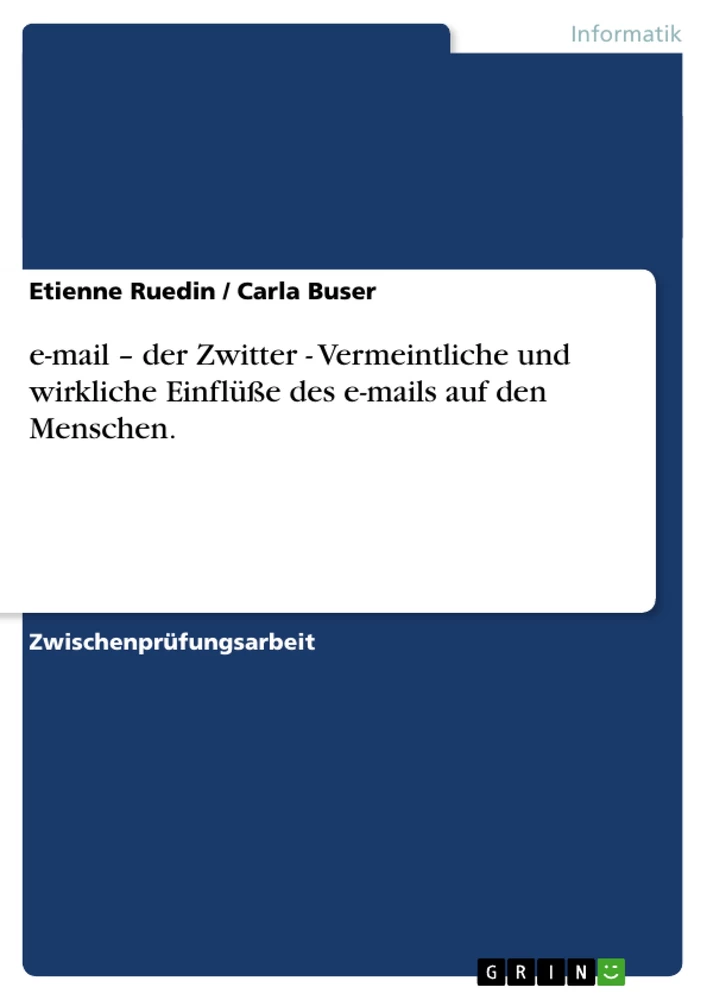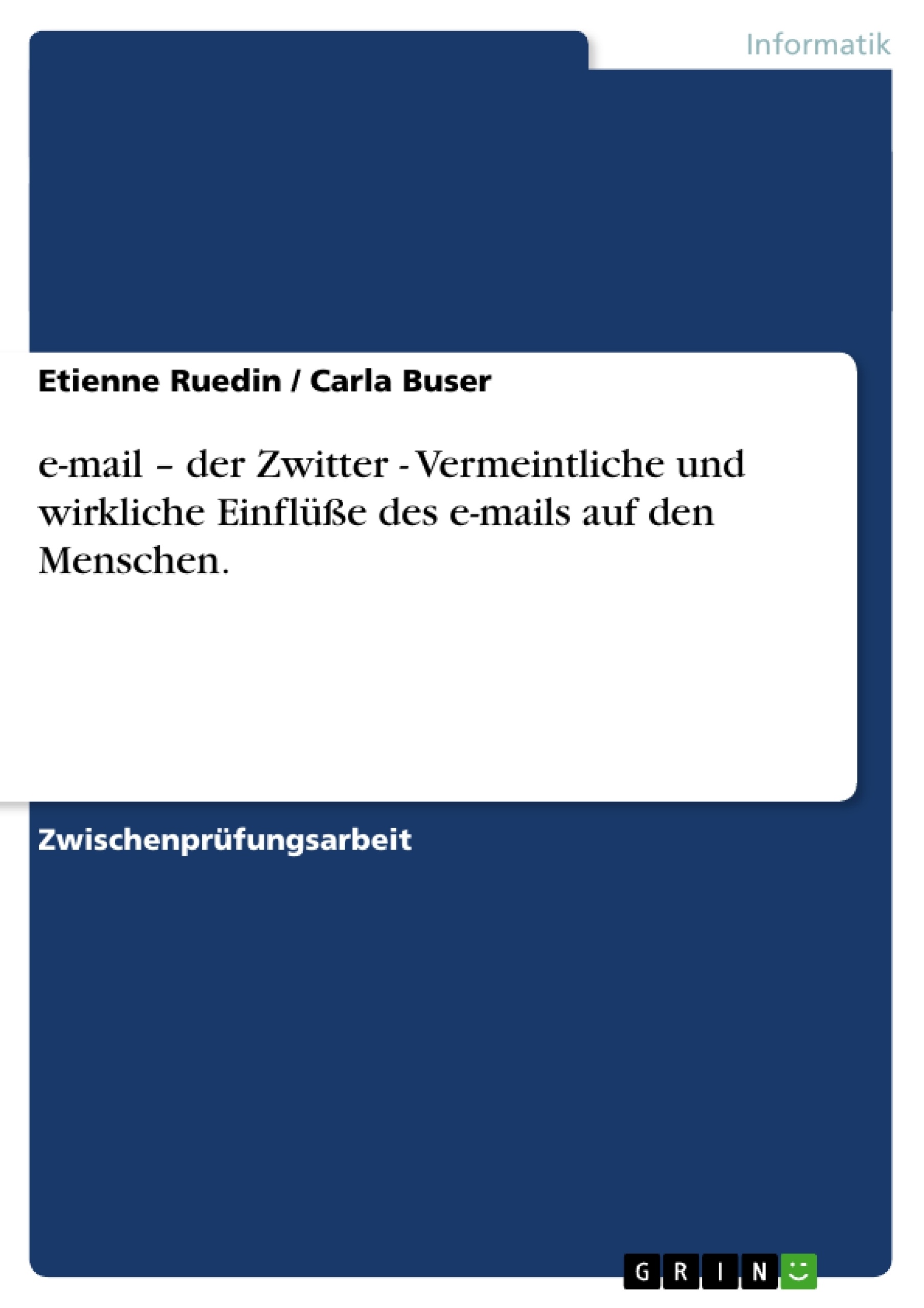Auch wenn der Gebrauch von e-mail stark verbreitet ist, ist oft nicht klar, wodurch sich e-mail von anderen Medien abgrenzt – oder gar abgrenzen läßt. Ist das e-mail der künftige Nachfolger des Briefes oder ein «neues», ergänzendes Medium? Von solchen Fragen ließen wir uns anfänglich ebenso leiten, wie von derjenigen, ob die These stimme, e-mail forciere den Sprachwandel. Dabei zeigte es sich sehr bald: Jedermann meint die Antworten zu kennen, und eine erste Recherche im Internet bracht eine sehr große Anzahl Treffer zur Technik des e-mails. Viele Thesen entpuppten sich als unbelegte Behauptungen.
In dieser Arbeit klammern wir die technischen Aspekte aus. Nach einer Definition des e-mails suchten wir seinen Platz im Prozeß der Mediatisierung, um dann auf linguistische Aspekte zu sprechen zu kommen. In diesem Kapitel kommt ein Großteil der eingangs angetönten Fragen zur Sprache. Dabei haben wir versucht, uns eng an die uns zugängliche Literatur über die aktuelle email- Forschung zu halten, auch wenn die meisten aufregenden Thesen des ‹Mannes von der Straße› damit vor der Türe bleiben mußten. In einem dritten Teil geht es um die soziale Geschlechterrolle (gender) bei der Anwendung von e-mail.
Auffallend ist die große Ähnlichkeit des e-mails mit anderen Medien. Dazu seien zwei Bemerkungen dem Schlußwort vorweggenommen: Primo ist das e-mail ein Medium wie manch′ anderes auch. All zu große Luftsprünge dürfen sich da trotz des großen digitalen hype Ende der 1990er-Jahre nicht erwarten lassen. Und secundo werden wir im Laufe der Arbeit nur zwei kleine Merkmale finden, welche nur beim e-mail zu beobachten sind. Sollte die Arbeit gar vielschichtig erscheinen, erinnern wir mit Dürscheid daran, daß sich «keine pauschalen Aussagen» über ‹das› email machen lassen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlegendes
2.1. Definitionen
2.2. Vorund Nachteile
3. Mediatisierung
3.1. Veränderungen
3.2. Glaubwürdigkeit
4. Linguistische Aspekte
4.1. Stark geprägte Mündlichkeit
4.2. Huhn vor Ei?
4.3. Hierarchie versus Egalität
5. Gender
6. Schlußwort
7. Verzeichnisse
7.1. Verwendete Quellen
7.2. Weiterführende Literatur
8. Anhang
8.1. Beispiel einer Netiquette
8.2. Beispiel von Ideogrammen aus vorelektronischer Zeit
Scriptis enim codicibus nunquam impressi ex equo comparantur;
nam orthographiam et ceteros liborum ornatus impressura plerumque negligit. Scriptura autem maioris industrie est.
Johannes Trithemius, XV. Jh.
1. Einleitung
Auch wenn der Gebrauch vone-mailstark verbreitet ist, ist oft nicht klar, wodurch siche-mailvon anderen Medien abgrenzt – oder gar abgrenzen läßt. Ist dase-mailder künftige Nachfolger des Briefes oder ein «neues», ergänzendes Medium? Von solchen Fragen ließen wir uns anfänglich ebenso leiten, wie von derjenigen, ob die These stimme,e-mailforciere den Sprachwandel. Dabei zeigte es sich sehr bald: Jedermann meint die Antworten zu kennen, und eine erste Recherche im Internet bracht eine sehr große Anzahl Treffer zur Technik dese-mails.Viele Thesen entpuppten sich als unbelegte Behauptungen.
In dieser Arbeit klammern wir die technischen Aspekte aus. Nach einer Definition dese-mails suchten wir seinen Platz im Prozeß der Mediatisierung, um dann auf linguistische Aspekte zu sprechen zu kommen. In diesem Kapitel kommt ein Großteil der eingangs angetönten Fragen zur Sprache. Dabei haben wir versucht, uns eng an die uns zugängliche Literatur über die aktuelleemail-Forschung zu halten, auch wenn die meisten aufregenden Thesen des ‹Mannes von der Straße› damit vor der Türe bleiben mußten. In einem dritten Teil geht es um die soziale Geschlechterrolle (gender) bei der Anwendung vone-mail.
Auffallend ist die große Ähnlichkeit dese-mails mit anderen Medien. Dazu seien zwei Bemerkungen dem Schlußwort vorweggenommen:Primoist dase-mailein Medium wie manch' anderes auch. All zu große Luftsprünge dürfen sich da trotz des großen digitalenhypeEnde der 1990er-Jahre nicht erwarten lassen. Undsecundowerden wir im Laufe der Arbeit nur zwei kleine Merkmale finden, welche nur beime-mailzu beobachten sind. Sollte die Arbeit gar vielschichtig erscheinen, erinnern wir mit Dürscheid daran, daß sich «keine pauschalen Aussagen»1über ‹das›emailmachen lassen.
2. Grundlegendes
2.1. Definitionen
Die Definition des Begriffse-mailist in der Literatur nicht einheitlich, da die Zugänge von verschiedenen Seiten erfolgen. So geht Huber die Definition aus mündlich-anwenderorientierter Sicht an und spricht von einem sprachlichen Mittelding zwischen SMS undchat.2Dem steht die brieforientierte3 Sicht entgegen, wie sie von Dürscheid und anderen vertreten wird. Von der aktuellene-mail-Forschung ausgehend, welche vor allem in ihren Anfängen zwischen 1994 und 1998 dase-mailvom Brief abzugrenzen versuchte,4 aber seit 2002 die Gemeinsamkeiten erkennt und hervorhebt,5muß die Abgrenzung dese-mails vom Brief als terminologisch nicht korrekt bezeichnet werden, da dase-mailein Brief ist.6Die Abgrenzung wurde nur schon dadurch schwierig, nachdem 1998e-mailvon Runkehl/Schlabonski/Siever als eine «in der Praxis [. . .] auf schnellere Kommunikation reduzierte Briefpost»7definiert worden war. Dem folgte die Definition als ‹schriftliches Telefon›8im Jahre 2003. Dies bedeutet nach Höflich, daße-mailje nach dem briefartig oder telefonartig sein kann. An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß dasemaildiese Zwitterstellung bis auf den heutigen Tag innehat, auch wenn es je länger desto mehr Funktionen des Briefes übernimmt.9
Der Unterschied zum Brief besteht zweifelsfrei darin, daß der gesamte Weg dere-mailKommunikation über ein einziges Medium verläuft, wie Dürscheid bereits 2003 feststellte.10 Auch fehlt ein materiell übermittelter Zeichenträger.11Daraus leiten wir die folgende Definition ab: Einemailist ein Brief, der am Bildschirm verfaßt, versandt und gelesen wird – und dessen Inhalt im Hauptfeld dese-mails übertragen wird. Somit werden die als Anhänge (attachement) versandten Briefe zwar ausgeschlossen, da sie jedoch den Kriterien des Briefes entsprechen, müssen diese aus dem brieflichen Blickwinkel betrachtet werden, weshalb sie nicht Bestandteil dieser Arbeit sind.12
2.2. Vorund Nachteile
Die über 35jährige Geschichte dese-mails13ist nicht Bestandteil dieser Abhandlung. Auch technische Aspekte14bleiben weitgehend ausgeklammert. Nur kurz sollen die Vorund Nachteile dese-mails in einem kleinen Exkurs in Erinnerung gerufen werden. Zu den Vorteilen15gehören:
geringer Aufwand
weltumspannende Überwindung der Ortsund Zeitgebundenheit
Schnelligkeit
günstiger Preis16
Dem gegenüber stehen eine Reihe von Nachteilen:
technische Ausrüstung wird benötigt
Zugangsanbieter (provider) wird benötigt
Mißbrauch (Viren, Spam)
Einschränkung: nur virtuelle Beilagen
Informationsflut (newsletter, Spam)
Schwierigkeit, Prioritäten zu setzen
Tendenz, Verantwortung abzuschieben (weiterleiten =forwarding)
Qualität der Sprache
Diese Vorund Nachteile lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Einerseits technische, bei welchen oft ein Punkt entweder zum Voroder Nachteil gereicht. Als Beispiel muß genügen: Ist die technische Ausrüstung vorhanden, resultiert daraus ein geringer Aufwand. Andererseits gibt es eine Reihe von Nachteilen, welche in erster Linie damit zusammenhängen, wie der Nutzer das Medium nutzt. Sie hängen also nicht vom Medium selbst ab, sondern von den Kompetenzen dessen Nutzers.
3. Mediatisierung
3.1. Veränderungen
Wenn der Mensch Medien verwendet, stehen dahinter immer eine Anzahl von Praktiken. Die Kultur der Vermittlung basiert nach Höflich nicht allein auf der VerwendungeinesMediums,17sondern in umfassender kommunikativer medialer Aktivität.18Und Bausinger ergänzt: «Wer sich [. . .] sinnvoll mit dem Gebrauch von Medien auseinandersetzt, muß verschiedene Medien ins Auge fassen, er muß rechnen mit dem Medienensemble, mit dem heute jeder umgeht.»19Ergokann von einem Prozeß der Mediatisierung gesprochen werden. Um die räumlichen, zeitlichen und ausdrucktechnischen Begrenzungen der menschlichen Kommunikation20 stetig zu verringern, wurden im Verlaufe der Zeit immer neue Kommunikationsmedien entwickelt, welche die Anwendungsbereiche der alten Medien zum Teil veränderten, ergänzten oder übernahmen. Dadurch, daß jedoch nicht jedes neue Medium ein altes komplett ersetzt, wird unser gesellschaftliches Leben mehr und mehr von Medien mitbestimmt.21
Die Telematisierung ist ein spezifischer Teil dieser umfassenden Mediatisierung.22 Dabei geht es konkret um die Entwicklung der Medien der Fernkommunikation, wozu auch dase-mailgehört. Als ein solches Medium hat es den Prozeß der Mediatisierung und auch die gesellschaftlichen Anwendungen der Medien geprägt. Inwiefern dase-mailVeränderungen an der Sprache und interpersonalen Beziehungen herbeigeführt hat, wird später untersucht.
Trotz stetem Wandel und Veränderung bleiben sich aber gewisse Gegebenheiten gleich; so die Reziprozität, das Prinzip der Gegenseitigkeit, die auf die Kommunikation bezogen besagt, daß wer viel schreibt, auch viele Antworten bekommt.23 Auf der medialen Seite wird die Reziprozität so verstanden, daß eine Kommunikation innerhalb ein und desselben Mediums bleibt. Seit dem Aufkommen der elektronischen Medien hat sich dieses Verhalten jedoch geändert, so wird zum Beispiel ein SMS heute gerne mit eineme-mailbeantwortet.24
3.2. Glaubwürdigkeit
Als Folge der ständigen, dabei aber auch wechselnden Beeinflussung der Medien auf den Gebraucher kann ermittelt werden, inwiefern sich dessen Meinung und Neigung gegenüber einem Medium verändert. Ganz konkret betrachten wir hier, für wie glaubwürdig eine Mitteilung eingeschätzt wird, die mit dem Medium e-mail vermittelt wird. Zum Vergleich werden die Glaubwürdigkeit von Telefon25und Brief herangezogen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Grafik26 kann entnommen werden, daß der Brief27als Mitteilungsträger als sehr glaubwürdig gilt, gefolgt vom Festnetztelefon28. Dem klar neueren Mediume-mail29hingegen, stehen die Menschen noch skeptischer gegenüber.
Daraus folgt, daß die Glaubwürdigkeit weniger mit der Nutzung, als mit der Vertrautheit eines Mediums zusammenhängt.30Insbesondere fällt auf, daß die Anzahl Unglaubwürdigkeitsnennungen mit 8.8% beime-mailsignifikant über den Werten des Briefes (3.2%) und insbesondere des Festnetztelefones (1.1%) liegen. Im direkten Vergleich Brief unde-mailwird vor allem das Briefgeheimnis genannt, welches auch bei Jugendlichen «besonders hoch eingeschätzt wird und dem Brief eine Qualität zukommen läßt.»31Über diese Qualität verfügte-mailnicht. Zudem haben die Massen von Spam und Werbemails, die täglich in allee-mail-Briefkästen geraten, deme-mailals glaubwürdiges Medium bestimmt auch geschadet.
4. Linguistische Aspekte
4.1. Stark geprägte Mündlichkeit
Die Schnelligkeit dese-mails wird durch seine stark geprägte Mündlichkeit deutlich herausgehoben. Höflich geht dabei sogar soweit, den deutschen Beredsamkeits-Theoretiker und Philosophen des 18. Jahrhunderts, Christian Fürchtegott Gellert32, als «einen Vordenker einer von allen Zwängen entbundenen elektronischen Post»33zu sehen, weil dieser den Brief schon immer als ein Redesubstitut, respektive als ein ‹schriftliches Gespräch› gesehen habe und als Vordenker des ‹schreibe so wie du redest› gälte. Vor allem der Gebrauch dese-mails in einer Art und Weise, wie sie weiter oben als ‹schriftliches Telefon› genannt wurde, weist die Typika der mündlichen Kommunikation auf. Dabei nimmt die Mündlichkeit Einfluß auf den Schreibstil, sodaßde factoeine Mischung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit auftritt,34wobei die Kommunikate meist dem Gespräch zuzuordnen sind.35 Das hängt auch vom geringeren Planungsgrad ab, denn je geringer dieser ist, desto stärker die Abweichung von der Norm von distanzsprachlichen Texten.36Am deutlichsten zeigt sich dieser diskursive Charakter beim direkten Quoting, einer Technik, die für herkömmliche Briefe so nicht üblich ist. Dittmann neigt dazu von einem Pseudo-Dialog zu sprechen.37Wie Dürscheid38ausführt, wird dabei auf eine einführende Bezugnahme verzichtet, sondern die Bezugnahme direkt in den eingerückten erhaltenen Text auf die nächste Zeile geschrieben. Dieses Merkmal spielt sich auf einer äußerst pragmatischen Ebene ab.39 Die dabei vorkommenden Adjazenzellipsen40, typisch für Alltagsgespräche, unterscheidet Klein für die direkte Quote-Technik wie folgt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
41
Außer dem genannten direkten Quoting, einem Dialogex post,42zeigt sich die Mündlichkeit dieses schriftlichen Mediums43 in der Verwendung von Regionalismen (respektive auch von Dialektwörtern oder ganzen Sätzen, die mehr oder weniger dialektaler Syntax folgen) und umgangssprachlichen Ausdrücken. Gerade diese Wortwahl suggeriert eine große Nähe, was zu einer neuen Skalierung der Nähe-Distanz-Spanne führt.44 Außerdem unterstreicht dies die Schnelligkeit des Mediums. Das bereits erwähnte Quoting kommt auch in abgeschwächter Form (indirekt) vor, wenn der ganze Text zu Beginn oder zum Schluß eingerückt wird. Des weiteren gehört die beim Antworten automatisch ausgefüllte Betreffzeile, die dann mit «Re:» oder «AW:» beginnt ebenfalls in den Bereich der Intertextualität,45was ebenfalls die Dialogität und somit die Mündlichkeit hervorhebt. Durch den Wegfall des Verbativen entsteht auf der Beziehungsebene ein Mangel.46 Dieser Wegfall von sichtbaren Beziehungsaspekten wird versucht mit dem Einsatz von Ideogrammen wie Emotikons, Majuskeln, emulierte Prosodie47und aus Buchstaben erzeugten Bildern48zu kompensieren. Es handelt sich hier, wie auch bei den verwendeten Formulierungen, um einen sichtlich spielerischen Umgang mit der Sprache.
[...]
1 Dürscheid, S. 6.
2 Huber, S. 3.
3 Unter Brief wird hier ohne weitere Definition der klassische Brief verstanden, unabhängig davon, ob er in einem Couvert, per Telefax (Fernkopie), elektronisch (als Anhang einese-mails oder per ftp) oder anderweitig versandt wird.
4 Vergleiche Günther/Wyss [in Hess-Lüttich, u. a.] oder Pansegrau [in Weingarten].
5 Zum Beispiel Schmitz [in Ziegler/Dürscheid] oder Elspaß [in Schmitz/Wyss].
6 Dürscheid, S. 3.
7 Zitiert nach Dürscheid, S. 5.
8 Joachim Höflich; in: Höflich/Gebhardt, S. 55.
9 Dürscheid, S. 4.
10Dürscheid, S. 3.
11Dittmann, S. 1.
12In Anlehnung nach Dürscheid, S. 4, Fußnote.
13Zur Geschichte siehe u. a. Runkehl/Schlobinski/Siever.
14Vergleiche Beutner, Bittner oder Voigt.
15Vorund Nachteile nach Knill, S. 3–4.
16 Beim Preis sind regional durchaus markante Unterschiede festzustellen, was vermutlich vor allem auf wirtschaftspolitische Gründe zurückzuführen ist.
17Hervorhebung durch uns.
18Höflich; in: Höflich/Gebhardt, S. 40.
19Bausinger, S. 32/33, zitiert nach Höflich/Gebhardt.
20Schulz, S. 2.
21Nach Höflich [in Höflich/Gebhardt], S. 41 in Anlehnung an Krotz.
22Höflich; in: Höflich/Gebhardt, S. 41.
23Höflich; in: Höflich/Gebhardt, S. 57; Aussage, welche durch Ergebnisse von Studien belegt ist, auch wenn Briefschreiber manchmal andere Erfahrungen machen; vgl. Mortensen (1972).
24Höflich; in: Höflich/Gebhardt, S. 57; Es gilt auch: Wer viele SMS verschickt, schreibt auch mehre-mails und eher Briefe.
25Das Mobiltelefon wurde separat erhoben und wird hier nicht miteinbezogen.
26Buser/Ruedin, basierend auf Angaben aus dem Jahre 2001 von Höflich/Gebhardt, S. 45.
2745.1% glaubwürdig und 51.6% sehr glaubwürdig ergeben 96.7% von mindestens glaubwürdig.
2853.2% glaubwürdig und 38.6% sehr glaubwürdig ergeben 91.8% von mindestens glaubwürdig.
2944.1% glaubwürdig und 40.9% sehr glaubwürdig ergeben 85.0% von mindestens glaubwürdig.
30Höflich; in: Höflich/Gebhardt, S. 46.
31Ebenda.
32Zu Gellert siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Fürchtegott_Gellert [4. Juli 2006].
33Höflich; in: Höflich/Gebhardt, S. 39.
34May/Werner, S. 2.
35Huber, S. 1.
36Dittmann, S. 3.
37Dittmann, S. 6.
38Dürscheid, S. 10.
39Dürscheid, S. 13.
40«Kombinierte Subjektund Verbtilgungen [. . .] sind eine Form der Ellipse, die der konzeptionellen Mündlichkeit zuzuordnen ist, und zwar typischerweise als Adjazenzellipse. Sie beruhen in der Regel auf einer impliziten Übernahme der syntaktischen Struktur der initiierenden Äußerungen; Standardbeispiel ist die [. . .] elliptische Antwort auf eine wFrage: ‹Wie viele Räder hat ein Auto?[ ›] – [‹]Vier.›» [Dittmann, S. 14]. Bei Adjedanzellipsen ist der respondierende Beitrag grammatisch unvollständig; einer sprachlichen Ausprägung nähesprachlicher Syntax. [Dittmann, S. 7].
41Klein, S. 768.
42Dittmann, S. 6.
43Das Folgende dieses Abschnittes, sofern nicht anders referenziert, nach Stichworten von May, S. 5.
44Dürscheid, S. 12.
45May/Werner, S. 5.
46Owens/Neale; in: Höflich/Gebhardt, S. 192; siehe auch Dittmann zur minimal ausgeprägten somatischen Dimension der Kommunikation.
47Vonto emulate= nacheifern. Beispiel: «Es tut mir leid, daß ich mich mit der Antwort sooo verspätet habe.» [nach Dittmann, S. 9].
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die einen Titel, ein Inhaltsverzeichnis, Ziele und Hauptthemen, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt das Thema E-Mail-Kommunikation aus verschiedenen Perspektiven.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis aufgeführt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Einleitung, Grundlagen (Definitionen, Vor- und Nachteile), Mediatisierung (Veränderungen, Glaubwürdigkeit), Linguistische Aspekte (stark geprägte Mündlichkeit, Hierarchie versus Egalität), Gender, Schlusswort und Verzeichnisse (Quellen und weiterführende Literatur).
Wie definiert das Dokument den Begriff "E-Mail"?
Das Dokument stellt verschiedene Definitionen von E-Mail vor, von denen Huber E-Mail als sprachliches Mittelding zwischen SMS und Chat ansieht, während andere E-Mail eher mit Briefen vergleichen. Das Dokument definiert E-Mail als einen Brief, der am Bildschirm verfasst, versandt und gelesen wird, wobei der Inhalt im Hauptfeld der E-Mail übertragen wird.
Welche Vor- und Nachteile von E-Mail werden genannt?
Zu den Vorteilen von E-Mail zählen geringer Aufwand, weltumspannende Überwindung der Orts- und Zeitgebundenheit, Schnelligkeit und günstiger Preis. Zu den Nachteilen gehören der Bedarf an technischer Ausrüstung und Zugangsanbietern, Missbrauch (Viren, Spam), Einschränkungen (nur virtuelle Beilagen), Informationsflut, Schwierigkeiten bei der Prioritätensetzung, Tendenz, Verantwortung abzuschieben und Qualität der Sprache.
Was versteht das Dokument unter Mediatisierung?
Mediatisierung wird als ein Prozess verstanden, bei dem das gesellschaftliche Leben mehr und mehr von Medien mitbestimmt wird, da neue Kommunikationsmedien entwickelt werden, die die Anwendungsbereiche der alten Medien teilweise verändern, ergänzen oder übernehmen. Die Telematisierung wird als ein Teil dieser umfassenden Mediatisierung gesehen.
Wie wird die Glaubwürdigkeit von E-Mail im Vergleich zu anderen Medien bewertet?
Das Dokument vergleicht die Glaubwürdigkeit von E-Mail mit der von Telefon und Brief. Der Brief gilt als sehr glaubwürdig, gefolgt vom Festnetztelefon. E-Mail wird von den Menschen skeptischer gesehen. Es wird festgestellt, dass die Glaubwürdigkeit weniger mit der Nutzung als mit der Vertrautheit eines Mediums zusammenhängt.
Welche linguistischen Aspekte von E-Mail werden diskutiert?
Die stark geprägte Mündlichkeit von E-Mail wird hervorgehoben. Es wird die Mischung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, der geringere Planungsgrad und der diskursive Charakter des Mediums betont. Die Verwendung von Regionalismen, umgangssprachlichen Ausdrücken und Ideogrammen wird ebenfalls erwähnt.
- Arbeit zitieren
- Etienne Ruedin (Autor:in), Carla Buser (Autor:in), 2006, e-mail – der Zwitter - Vermeintliche und wirkliche Einflüße des e-mails auf den Menschen., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111051