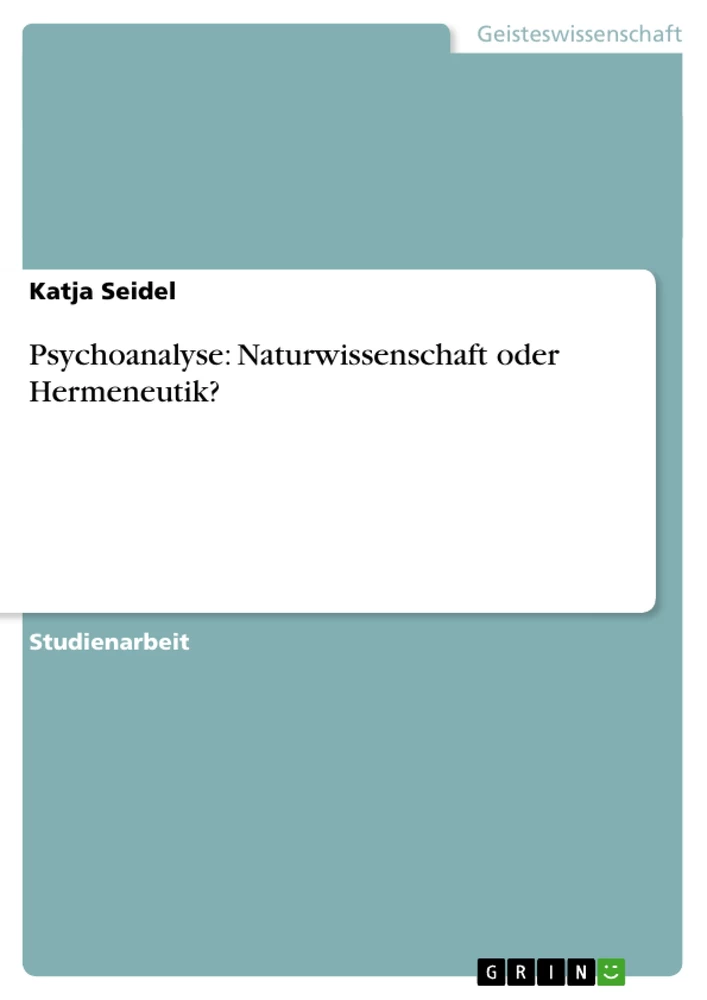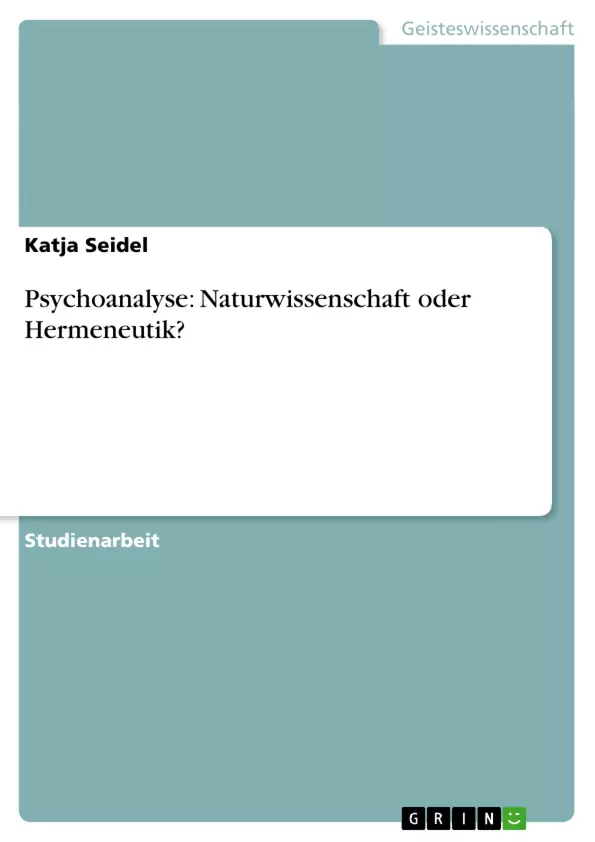In der vorliegenden Arbeit soll geklärt werden, ob die Psychoanalyse den Naturwissenschaften zuzuordnen oder eher als Hermeneutik zu begreifen ist und welche praktischen Konsequenzen sich daraus ergeben können.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hermeneutik vs. Naturwissenschaften
3. Die Psychoanalyse
4. Die Verortung der Psychoanalyse
4.1 Die naturwissenschaftliche Auffassung der Psychoanalyse
4.2 Psychoanalyse und Hermeneutik
4.3 Kritik an der hermeneutischen Auffassung der Psychoanalyse
5. Schlussbetrachtung
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Die wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung der Psychoanalyse liegt darin, dass sie den Gegensatz von „Verstehen“ und „Erklären“ aufgehoben hat.“1
In der vorliegenden Arbeit soll geklärt werden, ob die Psychoanalyse den Naturwissenschaften zuzuordnen ist oder eher als Hermeneutik zu begreifen ist und welche praktischen Konsequenzen sich daraus ergeben können. Bei dieser Betrachtung der unterschiedlichen Auffassungen wird klar werden, wie die Psychoanalyse dazu beigetragen hat, den Gegensatz zwischen Verstehen und Erklären zu überwinden, hin zu „verstehenden Erklärungen“.
Um eine Antwort auf diese Frage der Verortung der Psychoanalyse geben zu können, soll zuerst der Unterschied zwischen Hermeneutik und Naturwissenschaft beleuchtet werden. Danach sollen verschiedene Auffassungen über den Status der Psychoanalyse vorgestellt werden. Die beiden populärsten Vertreter dieser Debatte sind dabei Freud und Habermas, die ganz gegensätzliche Meinungen vertreten. Daher soll zunächst die naturwissenschaftliche Auffassung von Freud und dann die eher hermeneutische Positionierung von Habermas näher betrachtet werden, um dann in einem dritten Schritt die Kritik von Grünbaum an der hermeneutischen Auffassung der psychoanalytischen Theorie und Therapie entgegen zu stellen.
Abschließend soll dann geklärt werden, welche Auswirkungen die eine oder andere Betrachtungsweise auf die weitere Erforschung und Theorieentwicklung haben können.
2. Hermeneutik vs. Naturwissenschaften
Der Begriff Hermeneutik kommt aus dem Griechischen (hermeneúein –„erklären“) und steht mit Hermes in Verbindung, der den Menschen die Botschaften der Götter übermitteln und diese verständlich machen sollte. Er meint im engeren Sinn die Kunst und Theorie der Auslegung von Texten. Dazu kommt im weiteren Sinn das Verstehen von Sinnzusammenhängen in menschlichen Lebensäußerungen aller Art.2
Ihre Ursprünge hat die heutige Hermeneutik im 16. Jahrhundert mit der Aufnahme der antiken Rhetoriktradition, welche versuchte, die Bibel ohne Orthodoxie zu verstehen, nur mit Hilfe der Textauslegung. Hier zeigte sich der hermeneutische Zirkel noch als Kreisbewegung3, da wir „ […] von einem ersten Verständnis der Teile über ein erstes Verständnis des Ganzen zu einem korrigierten Verständnis der Teile gelangen, das uns endlich ein vollständiges Verständnis des Ganzen ermöglicht. “4
Der hermeneutische Zirkel ist demnach „ Dieses Verhältnis von Teil und Ganzem, vom Verstehen des Teiles und Verstehen des Ganzen, […] “5. Er ist die Grundfigur des Verstehens. (Abb. 1)6
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Der hermeneutische Zirkel
Die Frage wie aber das Verstehen von Text, einer Handlung und Geschichte möglich ist, versuchte erst Giambattista Vico 1725 zu beantworten. Nach seiner Auffassung kann dies möglich sein, da Geschichte, wie eben auch Texte, von den Menschen selbst hervorgebracht und gerade deshalb verstanden werden können. Im Gegensatz dazu sieht er die Natur als unverständlich und im Verborgenen bleibend an.7
Allerdings wird auch hier noch nicht klar, wie es möglich ist, einen fremden Autor und dessen Text zu verstehen. Friedrich Schleiermacher kann diese erkenntnistheoretische Lücke 1829 durch die Vertiefung der hermeneutischen Problemstellung schließen, indem er das Verstehen als ein Sichhineinversetzen in ein anderes Individuum begreift.8 Dazu gehören zwei sich ergänzende Elemente:
1. Die Komparation, die die Vorgehensweise meint, „ […] Textstücke unter Ähnlichkeitsgesichtspunkten miteinander zu vergleichen und dadurch vom Verstehen eines bekannten Textes oder Textelementes auf das Verständnis eines sehr ähnlichen anderen zu schließen. “9 So ist nur der Zugang zu etwas möglich, das dem schon Bekannten gleich ist. Hier wird 2. Der divinatorische Akt nötig, der in jedem Menschen als kreative Fähigkeit angenommen wird. Er umfasst also einen schöpferischen oder nachschöpferischen Akt des Verstehens, womit die Hermeneutik eine psychologische Dimension erhält.10
Nach Schleiermacher ermöglichen also erst Gefühl und Einfühlungsvermögen das Verstehen, das somit zu einem Rekonstruktionsprozess der fremden Individualität wird. Dieser ist nach seiner Auffassung in letzter Instanz vollständig. Hier setzten Kritiker in der Folgezeit an, da Schleiermacher voraussetzt, dass man die zeitliche Differenz zwischen dem Leser und dem Autor bzw. dessen in der Vergangenheit geschrieben Text überspringen kann. Vielmehr sind dem Verstehen der Geschichte Grenzen gesetzt11, „ […] die in der Überlieferung begründet sind und in meiner eigenen gegenwärtigen Auffassung. “.12 Dies wurde vor allem von Johann Gustav Droysen aufgedeckt.13
Wilhelm Dilthey hat die verschiedenen Überlegungen von Vico, Schleiermacher und Droysen dann zu den Ansätzen einer Hermeneutiktheorie zusammengefasst. Demnach wird angenommen, dass Geschichtswissenschaft nur möglich ist, weil jedes Ich ein geschichtliches Wesen ist; dass das vorwissenschaftliche Lebens- und Weltverständnis Grundlage des Verstehens ist; und allen Thesen und Theorien der Geisteswissenschaften nur eine relative Gültigkeit, auf die jeweilige Lebenswelt des Interpreten, zuerkannt wird. Bei seinen Betrachtungen versucht er die Standortgebundenheit zu überwinden, indem er einen methodologischen Rahmen entwirft, der ähnlich wie die Naturwissenschaften auf Objektivität abzielt. Dies konnte allerdings nicht gelingen, da Methodologie immer ein gewisses Vorverständnis erfordert, ohne dass es eben kein Verstehen geben kann. Es bleibt also bei einer relativen Gültigkeit. Dennoch stellt Dilthey fest, dass das Verstehen grundlegend für die Geisteswissenschaften ist.14 Dabei überträgt er den Begriff der Hermeneutik aus seinem philologischen Zusammenhang auf die Psychologie.15 In seinen „Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie“ konkretisiert er seinen Entwurf über eine hermeneutische Psychologie: „ Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir. “16
Wilhelm Dilthey unterscheidet zwischen „erklären“ und „verstehen“. Dabei sind die Naturwissenschaften bestrebt, die „positiv“ erkennbaren Gegebenheiten der Welt von außen zu erklären, während es die Aufgabe der Geisteswissenschaften ist, die „Erscheinungen“ der Welt von innen zu verstehen.17
Der so definierte hermeneutische Ansatz, der den Geisteswissenschaften entstammt, zielt also auf das Ganze, wogegen der analytische Ansatz der Naturwissenschaften stets auf das begrifflich Abgrenzbare abzielt und so von der Einzelbeobachtung bis zum Gesetz sowie zur Theorie kommt.18
Wilhelm Windelband hat nun den Gegensatz zwischen Natur- und Geisteswissenschaften in seiner Rektoratsrede „Geschichte und Naturwissenschaft“ von 1894 durch die Unterscheidung zwischen idiographischen19 und nomothetischen20 Wissenschaften21 beschrieben: als
„ […] Gegensatz zwischen Wissenschaften, die Individuelles beschreiben, und solchen, die Gesetze ihres Gegenstandsbereichs, also Universelles suchen. “22
Mit den Worten von Poser lässt sich das zusammenfassen:
„ Die Geisteswissenschaften mit ihrer Methode des Verstehens haben das Individuelle, Einmalige und Unwiederholbare in eben dieser Einmaligkeit, Individualität und Unwiederholbarkeit zu erfassen, während die Erfahrungswissenschaften mit der Methode des Erklärens in völligem Gegensatz hierzu auf das Allgemeine, Gesetzmäßige, Wiederholbare in Gestalt universeller Gesetzesaussagen abzielen. “23
Allerdings muss zu den gemachten Betrachtungen gesagt werden, dass auch die Erfahrungswissenschaften geschichtlichen Veränderungen im Methodengefüge und einer historischen Bedingtheit in ihren Aussagen und Grundauffassungen unterliegen. Es sollen allerdings die Methoden der Erfahrungswissenschaften nicht durch Hermeneutik ersetzt werden, sondern es ist zu bedenken, dass diese fraglichen Methoden nicht durch sich selbst erfassbar sind. Um also dargestellt werden zu können, bedarf es des hermeneutischen Zugangs.24
Mit der Aufnahme einiger Gedanken von Martin Heidegger, der das Verstehen auf alles bezieht, was dem Mensch begegnet, macht dann allerdings erst Hans- Georg Gadamer den entscheidenden Schritt zur gegenwärtigen Auffassung der Hermeneutik. Ursprünglich war die Hermeneutik also eine Methodenlehre, seit Schleiermacher eher ein Zweig der Erkenntnistheorie und Heidegger weitet sie zur fundamentalen ontologischen Theorie. Hier hat der Universalitätsanspruch der Hermeneutik seinen Ursprung.25
Gadamer ersetzt nun in seinem Modell den hermeneutischen Zirkel durch eine Spiralbewegung, um zu zeigen, wie fremdes Meinen überhaupt verstanden werden kann (Abb. 2).26
Beide Gesprächspartner müssen hier in einem gemeinsamen Überlieferungszusammenhang stehen, um ein Verstehen zu ermöglichen und eine Kommunikationsgemeinschaft entstehen zu lassen.
Bei der Spiralbewegung wird also „ […] der eigenen Meinung […] die fremde Meinung entgegengesetzt, beide aber sind verbunden durch den Überlieferungszusammenhang einer gemeinsamen Sprache. Im nächsten Schritt rekonstruiere ich die fremde Meinung im eigenen Denken und gelange so zu einer revidierten Auffassung, die ich dem Gesprächspartner darlege, der entsprechend verfährt usf. Die Ausrichtung des Gesprächs ist dabei eune Ausrichtung an der Sache. “27 Zu einem Ende kann es in diesem Prozess dann nur kommen, wenn beide Dialogpartner in dieser Sache übereinstimmen – die Horizont- verschmelzung.28
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Der hermeneutische Zirkel als Spiralbewegung des Verstehens29
Da sich also vor allem nach Dilthey die Unterscheidung der verschiedenen wissenschaftlichen Methoden nach dem Gegenstand richtet, muss zunächst der Gegenstand der Psychoanalyse ausgeführt werden.
[...]
1 Thomä / Kächele 2006, S. 78.
2 Vgl. Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim, 2006; und Poser 2001, S. 212.
3 Vgl. Poser 2001, S. 212.
4 Poser 2001, S. 212.
5 Poser 2001, S. 211.
6 Ebd.
7 Vgl. Vico 1966, S. 51; zitiert nach Poser 2001, S. 213.
8 Vgl. Poser 2001, S. 213.
9 Poser 2001, S. 213.
10 Vgl. Poser 2001, S. 213.
11 Vgl. ebd., S. 213f.
12 Poser 2001, S. 214.
13 Vgl. Poser 2001, S. 214.
14 Vgl. Poser 2001, S. 215.
15 Vgl. Grünbaum 1988, S. 158.
16 Dilthey 1894, S. 144; zitiert nach Bittner 1998, S. 56.
17 Vgl. Dilthey 1924, S. 318ff.
18 Vgl. Poser 2001, S. 209.
19 idiographisch (nach griech. idios: eigentümlich)
20 Nomothetisch (nach griech. nomos: Gesetz)
21 Windelband´s Vorstellungen gehen auf Johann Gustav Droysen zurück.
22 Windelband 1924, S. 145.
23 Poser 2001, S. 209.
24 Vgl. Poser 2001, S. 210.
25 Vgl. ebd., S. 210f.
26 Vgl. ebd.
27 Poser 2001, S. 215.
28 Vgl. Poser 2001, S. 217.
29 Poser 2001, S. 216.
- Quote paper
- M.A. Katja Seidel (Author), 2007, Psychoanalyse: Naturwissenschaft oder Hermeneutik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111106