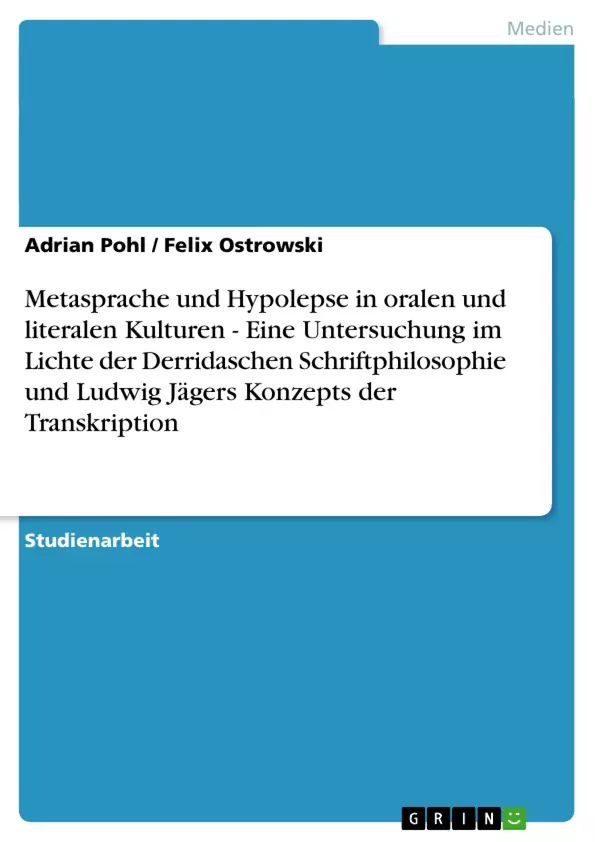Inhalt
1 Einleitung
2 Die Great-Divide-Hypothese
2.1 Die klassische Literalitätshypothese
2.2 Rückzugsgebiete der literacy hypothesis
2.2.1 Metalinguistic Activity
2.2.2 Kulturelle Kohärenz & intertextueller Anschluss
2.2.2.1 Rituelle Kohärenz
2.2.2.2 Textuelle Kohärenz
2.2.2.3 Hypolepse
3 Die sprachkonstitutive Funktion der Schrift bei Derrida
3.1 Derridas Bild der abendländischen Philosophie: Logo- und Phonozentrismus
3.2 Abwesenheit
3.3 Iteration
3.4 Kontextwechsel
3.5 Signifikanten von Signifikanten
3.6 Zwischenbilanz
4 Transkriptivität, Metasprache und intertextueller Anschluss in oralen Kulturen
4.1 Von Derrida zum Verfahren der Transkription Jägers
4.2 Prätext, Transkript und Skript
4.3 Warum es in oralen Kulturen Metasprache geben muss
4.4 Empirische Untersuchungen zur Metasprache und intertextuellem Anschluss in oralen Kulturen
4.5 Hypolepse in oralen Kulturen?
5 Fazit
6 Literatur
1 Einleitung
In dieser Arbeit befassen wir uns mit zwei Rückzugsgebieten von Vertretern der Great-Divide-Hypothese. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Derridaschen Schriftbegriffs und dem Verfahren der Transkription bei Ludwig Jäger.
Zunächst skizzieren wir die klassische Literalitätshypothese, um sodann zwei bis heute verteidigte Unterschiede literaler und oraler Gesellschaften darzustellen. Dies sind zum einen metalinguistische Aktivitäten, von denen angenommen wird, dass sie nur in Schriftkulturen möglich seien und zum anderen die Unterscheidung von ritueller und textueller Kohärenz bei Jan Assmann.
Die gemeinsamen Konstitutionsbedingungen von Sprache und Schrift erläutern wir anschließend mit Jacques Derrida, welcher die Auffassung von Schrift – mittels einer Verschiebung des Schriftbegriffs – als einem alle Zeichen konstituierenden Prinzip vertritt.
Aufbauend auf Derridas Philosophie der Schrift entwickelt Jäger seine Theorie der Transkription als zentrales Prinzip zur Herstellung kultureller Semantik, den wir im letzten Teil einführen.
Abschließend untersuchen wir auf der Grundlage dieses Konzepts der Transkriptivität erstens die Behauptung der Metasprachlichkeit als Eigentümlichkeit von Schriftkulturen, und zweitens betrachten wir das textuelle Kohärenz herstellende Verfahren der Hypolepse bei Jan Assmann. Aufgrund theoretischer Überlegungen mit Derrida und Jäger sowie durch Heranziehen empirischer Studien stellen wir die Möglichkeit heraus, die Hypolepse zu einem auch in oralen Kulturen angewandten Verfahren der Herstellung kultureller Kohärenz auszuweiten.
2 Die Great-Divide-Hypothese
2.1 Die klassische Literalitätshypothese
Die Leitfrage der Literalitätshypothese lautet:
„Ist die westliche Kultur in all ihren Erscheinungsformen wie wissenschaftliches Denken, Logik und theoretische Neugierde, Geschichtsbewusstsein, monotheistische Religion, Seelenglaube und Individualismus, Trennung von Staat und Kirche, Technologie, Demokratie und Marktwirtschaft letztlich aus dem Geist der Schrift – und zwar der griechischen Alphabetschrift – geboren?“1 In den Anfängen der Oralitätsdebatte wurde diese Frage von der Mehrheit der Forscher bejaht, wir nennen sie Vertreter der starken Literalitätshypothese. Unter zunehmender Kritik jedoch wurde die Literalitätshypothese auf wenige Punkte reduziert. Wichtig ist es anzumerken, dass die Arbeiten zur Oralität-Literalität-Debatte sich häufig auf die Alphabetschrift beschränken und den Wandel von einer oralen zu einer literalen Kultur vorzugsweise am Beispiel Griechenlands betrachteten, wo etwa um 700 v. Chr. die erste vollständige Alphabetschrift eingeführt wurde. Eric Havelock geht zum Beispiel so weit, die Alphabetschrift als eigentlichen Schritt zur Literalität zu sehen: „Die Griechen erfanden nicht nur einfach ein Alphabet; sie erfanden die Literalität und die literale Grundlage des modernen Denkens.“2 Dieser eurozentristische Schriftbegriff wird in dieser Arbeit nicht reproduziert; wir schließen uns der Kritik von Assmann/Assmann (1990) an Havelock sowie anderen okzidentalen Schrifthistorikern an, dass sie „die Kulturleistungen der umliegenden Gesellschaften unterschätz[en]“3. Schließlich gibt es „keinen Laut, kein Wort, keinen Satz, keinen Gedanken der jeweiligen Sprache, der sich in der zugehörigen Schrift nicht ausdrücken ließe“, wenn diese Schrift auch schwerer zu lernen und schwerer zu handhaben ist4.
Das Interesse der Kulturwissenschaften für die Bedeutung der Literalität in einer Gesellschaft entspringt aus dem Interesse für orale Kulturen, der Weitergabe von Wissen in ihnen und den damit verbundenen Gedächtnisleistungen. Diese Oralitätsforschung hat ihre Wurzeln in den altphilologischen Arbeiten Milman Parrys zu den Werken Homers in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Parry wies in akribischen Untersuchungen der Ilias und Odyssee nach, dass es sich um ursprünglich oral überlieferte Mythen handeln müsse. Er deutete die Hexameter-Struktur der Homerschen Verse sowie die regelmäßige Verbindung bestimmter Eigennamen mit bestimmten Epitheta (z.B. „der listenreiche Odysseus“) als einer Ökonomie der oralen Wiedergabe geschuldet. Unter Druck des mündlichen Improvisationszwanges, dem ein Rhapsode bei der ‚Aufführung’ der homerischen Epen unterliege, sei die Entwicklung einer oralen Mnemotechnik unerlässlich, die sich im Rhythmus und den verwendeten Epitheta widerspiegle. Der Rhapsode „näht“ also gleichermaßen ein „Lied“ aus überlieferten, vorgefertigten und für die jeweiligen Stellen passgenauen Formeln zusammen (ράπτειν bedeutet ‚nähen’ und ώδή ‚das Lied’5 ). Der Mythos wird dabei nicht nur einfach in einem bestimmten Versmaß vorgetragen, vielmehr spielen auch andere Mnemotechniken neben dem Hexameter und den Epitheta eine wichtige Rolle. Als Ganzes bilden diese Mnemotechniken „[j]enes Ensemble, das die Griechen μουσική bezeichneten (Sprache, Melos, Rhythmus, Tanz, Masken, Mimik, Gestik)“6.
Aufbauend auf Parrys Forschungsarbeiten zur oralen Poetik entwickelte sich in den 60er Jahren die in ihren Untersuchungen weitergehende Forschung zur „oralen Noetik“, die sich der Untersuchung einer „oralen Geistesverfassung, eines oralen Kulturzustands“7 widmete. Außerdem befassten sich auch Soziologen und Sozialanthropologen mittels Feldforschungen in oralen Gesellschaften mit der Thematik eines oralen Denkens und Gedächtnisses.
Ein wichtiger Vertreter der oralen Noetik ist der schon erwähnte Eric A. Havelock, ein weiterer Altphilologe, der die Mentalität in oralen Kulturen anhand von Homer sowie die Auswirkungen der Schrift auf das Denken anhand der Texte Platons untersuchte.8 Jack Goody sei als Vertreter der empirischen Forschungen in oralen Kulturen genannt. Er wird im Folgenden noch erwähnt werden.
Einige Annahmen der Literalitätshypothese seien hier – an die eingangs zitierte Leitfrage anknüpfend – aufgeführt. Diese Annahmen kann man als Teil der ‚starken’ Literalitätshypothese verstehen, in dem Sinn, dass viele sehr weitgehend sind, im Laufe der Literalitätsdebatte aber abgemildert, modifiziert oder zurückgenommen wurden. Schrift ist demnach notwendige Bedingung für die Entstehung von
- Naturwissenschaften, Kunstwissenschaft9,
- Geschichtsbewusstsein und Geschichtswissenschaft,
- Philosophie10,
- Individualismus11,
- Demokratie12,
- Sprachwissenschaft13,
- Metasprachlichkeit14 und
- „textueller Kohärenz“15.
Im Folgenden werden wir die letzen beiden Punkte, welche auch heute noch vertreten werden, genauer betrachten: die Metasprachlichkeit in Abschnitt 2.2.1, stark an David Olsons Aufsatz Literacy as metalinguistic activity16 orientiert, der versucht, die Literalitätshypothese „along somewhat more defensible lines“17 zu formulieren, indem er sich auf die Behauptung zurückzieht, die Schrift sei konstitutive Bedingung für eine orale Metasprache, ja sogar für „linguistic awareness“18.
In Abschnitt 2.2.2 werden wir dann die Unterscheidung von „ritueller“ und „textueller Kohärenz“ bei Jan Assmann erläutern und Formen des intertextuellen Anschlusses, besonders die Hypolepse, betrachten.
2.2 Rückzugsgebiete der literacy hypothesis
2.2.1 Metalinguistic Activity
David R. Olson vertritt die Auffassung, dass Literalität nicht nur auf individuelle Lese- und Schreibkompetenz beschränkt ist. Um eine Unterscheidung zwischen oralen und literalen Gesellschaften aufrecht zu erhalten zieht er sich von der ‚starken’ Literalitätshypothese zurück und führt Bedingungen bezüglich der „general competence required to participate in a literal tradition“19 auf:
1. Es muss „some device for ‚fixing’ and accumulating texts“20 geben, wobei unter Texten ausdrücklich auch oral fixierte verstanden werden. Diese Fixierung von Texten macht es möglich, sie zu archivieren. Solche Archive können durch neue Texte ergänzt werden, während für alte, überkommene die Möglichkeit des Herausnehmens besteht. Insbesondere dieser Ergänzungsprozess, die Wissensanhäufung, ist nach Olson nur anhand von Schrift zu perfektionieren, denn „[w]riting has an enormous advantage in that it allows the accumulation of texts that go far beyond the storage capacities of any knower“21.
2. Für eine literale Gesellschaft ist darüber hinaus eine institutionelle Nutzung von Texten konstitutiv.
3. Speziellen Institutionen wie der Schule kommt nicht nur das Vermitteln von Textkompetenz, sondern als „institutions for inducting learners into those institutions“, ebenso die Vertrauensbildung in diese zu.
4. Die in Olsons Ansatz wichtigste Bedingung ist die einer oralen Metasprachlichkeit als Basis „for talking and thinking about the structures and meanings of … accumulated texts and the intentions of their author and their interpretation in particular contexts“22.
Eine der Hauptbedingungen für den (weiten) Literalitätsbegriff von Olson ist also, dass Sprache durch Sprache thematisiert werden kann. „If the ability to use language is ‘linguistic ability’, the ability to reflect on the language used is ‘metalinguistic ability’.“23 Die Schrift ist nach Olsons Auffassung die einfache Abbildung oraler Sprachzeichen in literale, denn “just as language is a device for ‘fixing’ the world in such a way as to make it an object of reflection, so writing ‘fixes’ language in such a way as to make it an object of reflection”24. Die Leistung der Schrift beschränkt sich jedoch nicht auf die Ebene der Lautdarstellung, sondern erstreckt sich auch auf „larger units of text including words, sentences, and texts“25. Während orale Kulturen also über eine Sprachkompetenz im Sinne einer ‚linguistic ability’ verfügen, fehle ihnen durch das Abhandensein von Schrift die Metasprachkompetenz bzw. ‚metalinguistic ability’. Olson besteht darauf, dass „such metalinguistic knowledge” keine “precondition of literacy but rather (...) a product of literacy“26 ist. Wie sich die Erfindung von Schrift ohne die Möglichkeit, Einheiten in der Rede zu identifizieren – ohne Metasprachlichkeit also – vollzogen haben soll, lässt er jedoch offen.
Neben der metasprachlichen Fähigkeit, anhand der verobjektivierten Sprache Buchstaben, Sätze usw. zu identifizieren gibt es nach Olson noch eine orale Metasprachlichkeit, die darin besteht, die identifizierten Einheiten zu benennen und sie sowohl als diskrete sprachliche Einheiten als auch auf inhaltlicher Ebene zu diskutieren.
Schrift ist als Metasprache per se aufzufassen: “writing is intrinsically metalinguistic”27, denn „writing makes language into an object“28. Sie erzeugt eine „mental language“29 und ebnet so erst den Weg für eine orale Metasprache. Diese wiederum erschöpft sich für Olson nicht in der Referenz auf sprachliche Einheiten, sondern ermöglicht auch erst die Bezugnahme auf den Inhalt, die Semantik der verobjektivierten Texte: „Judgement about truth and falsity are … metalinguistic judgements“30.
Deutlich wird eine logo- und phonozentrische Auffassung von Sprache bei Olson31: Dinge in der Welt werden von der gesprochenen Sprache benannt, die Schrift bildet die Rede ab, und ‚Dinge in der Rede’ werden wiederum durch eine orale Metasprache benannt. In Abschnitt 3.1 werden wir diese Auslegung näher betrachten und Derrida folgend einer Kritik unterziehen.
Nachdem Olson die Metaprachlichkeit als Resultat der Literalisierung konstruiert hat, sieht er auf dieser Basis auch andere Hypothesen bezüglich der Unterscheidung von Schriftlichkeit und Oralität bestätigt. Erst durch den Erwerb von Lese- und Schreibkompetenz würden metasprachliche Fähigkeiten entwickelt. Dadurch habe die Literalität durchaus einen Effekt auf die Kognition32 , denn nun können auch in der fluktuanten Rede diskrete Einheiten wahrgenommen werden.
Da die Sprache durch die Schrift zugänglich gemacht wird, sieht Olson darüber hinaus auch die modality hypothesis33 bestätigt, welche besagt, dass die Schrift die „visual modality that picks up and processes the orthography, the system for representing language“34 erzeugt habe.
Diese Veränderung in Kognition und Modalität führe dann zwangsläufig auch zur Entwicklung spezieller literaler Genres und Diskursstrukturen35: „It is through the resource of writing as a medium of communication that specialized forms of discourse arose”36. Obwohl Olson darauf hinweist, dass es auch in oralen Kulturen verschiedene Arten des Diskurses gibt, sieht er erst durch die Literalität die Möglichkeit gegeben, durch den Zugang zu (exklusiv literalen) Genres ein „specialized set of intellectual competencies“37 zu erwerben. Wir werden in Abschnitt 4.3.1 auf die Funktionsweise von Textsorten in oralen Kulturen zurückkommen.
Obwohl Olson in seinem Aufsatz zunächst auf Basis empirischer Untersuchungen gewisse Eingeständnisse an die Fähigkeiten oraler Kulturen macht, nimmt er diese letzendlich zurück. Sein abschließendes Zitat von McLuhan macht deutlich, daß seine “defensible lines” keineswegs ein Rückzug von der starken Literalitätshypothese implizieren: „Only the phonetic alphabet makes a break between eye and ear, between semantic meaning and visual code; and thus only phonetic writing has the power to translate men from the tribal to the civilized sphere, to give him an eye for an ear“38.
2.2.2 Kulturelle Kohärenz & intertextueller Anschluss
Jan Assmann unterscheidet in seinem Buch Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in den frühen Hochkulturen39 zwei Formen des kollektiven Gedächtnisses: das kommunikative und das kulturelle Gedächtnis.40 „Das kommunikative Gedächtnis umfaßt Erinnerungen, die sich auf die rezente Vergangenheit beziehen“ und etwa achtzig bis hundert Jahre in die Vergangenheit reichen. Es ist jenes Gedächtnis, welches in der alltäglichen face-to-face-Kommunikation der Individuen entsteht, es ist informell und naturwüchsig. Das kommunikative Gedächtnis soll hier aber nicht weiter betrachtet werden, stattdessen gehen wir auf das kulturelle Gedächtnis und seine beiden Organisationsformen der rituellen Kohärenz und textuellen Kohärenz näher ein.41
Was versteht Assmann unter kulturellem Gedächtnis oder „kultureller Kohärenz“? Die kulturelle Kohärenz, d.h. der Zusammenhang einer Gesellschaft, beruht auf der Erinnerung, dem Gedächtnis einer Gruppe, durch welche diese ihre Identität erhält. Denn, „Identität ist … eine Sache von Gedächtnis und Erinnerung (…) [und] so vermag auch eine Gruppe ihre Gruppenidentität nur durch Gedächtnis zu reproduzieren.“42 Assmann schließt hier explizit an Maurice Halbwachs an, der gezeigt hat, „daß die sozialen Rekonstruktionen der Vergangenheit gruppenbezogene Kontinuitätsfiktionen darstellen.“43 Da der Gruppe im Gegensatz zum Individuum für diese rekonstruierenden Gedächtnisprozesse aber keine neuronale Basis zur Verfügung steht, entwickelt sie Formen der kulturellen Kohärenz.
Assmann behauptet: „Durch die Schrift teilt sich diese Geschichte [der konnektiven Struktur von Gesellschaft, Anm. von uns] in zwei Phasen: die Phase ritengestützter Repetition und die Phase textgestützter Interpretation.“44
2.2.2.1 Rituelle Kohärenz
Die rituelle Kohärenz ist nach Assmann die einzige Form des kulturellen Gedächtnisses, die einer oralen Gesellschaft zur Verfügung steht. Das schließt natürlich Formen ritueller Kohärenz in literalen Kulturen nicht aus, die es selbstverständlich auch gibt, aber nicht in „Reinform“, weil sie immer von der sie umgebenden Literalität beeinflusst sein dürften.45
Rituelle Kohärenz ist an Repetition, an Wiederholung gekoppelt: an Wiederholung von Mythen, von Liedern, Tänzen, Sprichwörtern, Gesetzen etc. „Solange Riten die Zirkulation des identitätssichernden Wissens in der Gruppe garantieren, vollzieht sich der Prozeß der Überlieferung in der Form der Wiederholung. Es liegt im Wesen des Ritus, daß er eine vorgegebene Ordnung möglichst abwandlungsfrei reproduziert.“46
Da allein das menschliche Gedächtnis zu Wahrung der zu wiederholenden Texte dienen kann, wird das kulturelle Erinnern in oralen Kulturen spezialisiert: „Das kulturelle Gedächtnis hat immer seine speziellen Träger. Dazu gehören die Schamanen, Barden, Griots ebenso wie die Priester, Lehrer, Künstler, Schreiber, Gelehrten, Mandarine und wie die Wissensbevollmächtigten alle heißen mögen.“47
Zum einen werden zur Reproduktion der erinnerten Formen – wie in 2.1 erwähnt – verschiedene Mnemotechniken wie Versmaß und Gesang angewendet. Rituale sind dadurch per se multimedial, indem sie mehrere Sinne ansprechen. Zum anderen finden die Reproduktionen von Mythen selber zu sich wiederholenden Anlässen wie Festen statt, was zur „Vorstellung einer in sich kreisförmigen Zeit“48 führt. Der Polarität zwischen kommunikativem Gedächtnis und ritueller Kohärenz „entspricht also in der Zeitdimension die Polarität zwischen Fest und Alltag“.49
Wie u.a. Goody schreibt, ist es dem kontinuierlichen Wiedererinnern in einer oralen Kultur inhärent, dass Mythen wie auch Genealogien als Formen der Erinnerung sich wandeln und an äußere Umstände anpassen. Beispiele dafür liefern Jack Goody und Ian Watt: z.B. das der Gonja in Nordghana, deren Ursprungsmythos der Gonja-Stämme auf einen Urvater zurückgeführt wurde, der seine Söhne als Herrscher der verschiedenen Gonja-Bezirke einsetzte. Aufzeichnungen der Briten vom Ende des 19. Jahrhunderts und sechzig Jahre später zeigen nun, dass die Anzahl der Söhne sich an Schwankungen der Zahl der Stämme anglich. So hatte der Urvater der ersten Aufzeichnung nach sieben Söhne, der Anzahl von sieben Gonja-Stämmen entsprechend, sechzig Jahre später waren es nur noch derer fünf, weil zwei Stämme durch Eingliederung und Grenzänderung verschwunden waren. Die Gonja selbst waren sich der ‚Objektivität’ des Mythos sicher, ihnen war kein Wandel ihres Mythos bewusst.50 Goody schreibt: „[E]ven formal recitations are influenced by contemporary concerns. (…) It is their present existence that prompted the history, not, of course, memory itself.“51
Goody betont also das Element der Variation, welches mit einer oralen Kultur verbunden ist. Mit seinen eigenen Feldforschungen bei den LoDagaa in Nordghana beobachtet er: „Since there is no fixed text from which to correct, variation is constantly creeping in, partly due to forgetting, partly due perhaps to unconscious attempts at improvement, adjustment, creation.“52
Diese Annahme Goodys ist scheinbar konträr – und hier deutet sich schon das Prinzip der Iterabilität an, welches wir im folgenden, dritten Teil dieser Arbeit behandeln werden – zur schon erwähnten Annahme Assmanns, dass sich rituelle Kohärenz in der „Form der Wiederholung“ vollzieht, dass es einen „Wiederholungszwang“ in oralen Gesellschaften gebe.53 Wir werden sehen, ob sich diese scheinbar konträren Ansichten miteinander vereinbaren lassen.54
2.2.2.2 Textuelle Kohärenz
Mit dem Übergang von oralen Gesellschaften zu Schriftkulturen „tritt“ – so Assmann – „das Element der Wiederholung zurück, weil ja nun ein anderes Gefäß für den Sinn gefunden wurde“55, nämlich die Schrift. Zunächst in der Verwaltung bzw. Alltagskommunikation verwendet, entwickelte sich anhand ihrer alsbald auch eine Literatur, „die nicht als Vertextung mündlicher Überlieferung, sondern aus dem Geist der Schrift heraus“56 entstand. In der so entstehenden Schriftkultur sind die Texte keineswegs stillgestellt. Sie werden – in parallel entstehenden Institutionen57 – bearbeitet und ergänzt. Dabei werden sie miteinander in Beziehung gesetzt, und können so auch miteinander konkurrieren. Durch diesen Prozeß trennt sich gewissermaßen die Spreu vom Weizen und es etablieren sich Texte, die „zum Inbegriff normativer und formativer Werte“58 werden. Diese sind die sogenannten Klassiker.
Das Wissen ist vom Wissenden getrennt59, es besteht kein Wiederholungszwang zur Bewahrung der Erinnerung mehr, das Gedächtnis existiert vermeintlich getrennt von Menschen in Texten. Mit der Auslagerung des Wissens aus den Köpfen (bzw. der oralen Zirkulation) in die Texte werden jedoch die sozialen, kommunikativen Aspekte des Rituals zugunsten der Möglichkeit des individuellen Lesens und Schreibens allein im Medium der Schrift ausgeklammert. Hier knüpft Assmann an Ong an, der feststellte, dass „[w]riting … the source of the communication (the writer) from the recipient (the reader), both in time and space”60 distanziert. Einmal aufgeschrieben existiert ein Text, unabhängig davon, ob er gelesen bzw. vorgelesen wird. Assmann stellt fest, dass genau diese Persistenz verschrifteten Wissens die Gefahr mit sich bringt, daß Texte „eher zu einem Grab als zu einem Gefäß des Sinns“61 werden, denn „Sinn bleibt nur durch Zirkulation lebendig“62.
Während sowohl diese Zirkulation als auch die Aktualisierung von Sinn in oralen Kulturen durch die rituelle Repetition des Wissens sichergestellt ist, besteht, so Assmann, in literalen Gesellschaften die Gefahr eines Bruchs zwischen den fixierten Texten und den sich wandelnden kulturellen und politischen Gegebenheiten:
Weil der Buchstabe fest ist und kein Jota geändert werden darf, weil aber andererseits die Welt des Menschen fortwährendem Wandel unterworfen ist, besteht eine Distanz zwischen festgestelltem Text und wandelbarer Wirklichkeit, die nur durch Deutung zu überbrücken ist. So wird die Deutung zum zentralen Prinzip kultureller Kohärenz und Identität.63
Dieses „zentrale Prinzip“ der Deutung als „Gestus der Erinnerung“64 markiert für Assmann den geschichtlichen Wendepunkt zwischen ritueller und textueller Kohärenz. Assmann sieht den „Hauptunterschied zwischen textueller und ritueller Kohärenz … darin, daß rituelle Kohärenz auf Wiederholung basiert, d.h. Variation ausgeschlossen wird, während textuelle Kohärenz Variation zuläßt, sogar ermutigt“65. Wie bereits erwähnt impliziert hingegen laut Goody das permanente Anpassen des Wissens an die Wirklichkeit in oralen Kulturen eine unabdingbare, kontinuierliche Veränderung der das Wissen transportierenden Rituale.
Um den Sinn eines fixierten Textes zu ‚beleben’, um einen Beziehungshorizont über den Bruch zwischen dem in der Vergangenheit fixierten Text und der Gegenwart herzustellen, bedarf es der Interpretation. Dies geschieht nach Assmann in literalen Gesellschaften durch Formen des „intertextuellen Anschlusses“66.
Als solche Formen intertextuellen Anschlusses nennt Assmann das Imitieren, Kommentieren und Kritisieren eines Textes durch einen anderen.
Imitation findet bei klassischen Texten statt, sie macht einen Text erst zu einem klassischen. Zu den klassischen Texten zählen z.B. die Schriften Homers, die etwa von Vergil imitiert werden.67
Der Kommentar bezieht sich in der Regel auf sogenannte kanonische Texte, die eine feste Form im „Strom der Tradition“68 angenommen haben. Kanonische Texte haben die „Hochverbindlichkeit eines Vertrages“69, d.h. ihnen wird absolute Wahrheit zugesprochen und zu ihnen zählen religiöse Werke wie die Bibel, der Koran oder auch Gesetzestexte. „Da sie weder fortschreibbar, noch imitierbar, noch kritisierbar sind, vielmehr in ihrem Wortlaut ein für allemal festliegen“70, kann Variation nur auf einer Ebene stattfinden, die der Integrität des kanonischen Textes gerecht wird: Dies ist die Ebene des Kommentars.
„ Kritisiert werden fundierende Texte im Rahmen des wissenschaftlichen Diskurses“71 wie z.B. die Werke Platons, Aristoteles’ oder Euklids. Diese Form des intertextuellen Anschlusses, wie wir sie im philosophischen und wissenschaftlichen Betrieb des Abendlandes antreffen, wird von Assmann auch Hypolepse genannt. Wir werden sie im Folgenden näher erläutern und am Ende der Arbeit einer Kritik unterziehen.
2.2.2.3 Hypolepse
In der abendländischen Wissenschaft und Philosophie, ihrem „logischen Regeln der Wahrheitssuche verpflichteten“72 Diskurs sieht Assmann also eine besondere Form der Herstellung von Kohärenz, die er als Hypolepse bezeichnet.73 Der Ausdruck ‚Hypolepse’ wurde ursprünglich für orales Interaktionsgeschehen verwendet: im Rhapsodenwettkampf und der Rhetorik. „In beiden Fällen bezeichnet hypólepsis das Prinzip, nicht von vorn anzufangen, sondern sich in anknüpfender Aufnahme an Vorangegangenes anzuschließen und in ein laufendes Kommunikationsgeschehen einzuschalten.“74 Assmann nennt drei Kriterien, welche diese autoreferentielle „Bezugnahme auf Texte der Vergangenheit in der Form einer kontrollierten Variation“ ermöglichen und den hypoleptischen Diskurs konstituieren, der damit also über die bloße intertextuelle Bezugnahme hinausgeht: Schrift, Rahmen und Wahrheit.
Die Schrift ermögliche als persistentes Medium die „trans-situative Verfestigung des Gesagten “75, wodurch Sprache als Text eine vom Sinn unabhängige Gestalt gewinnt. „Damit ‚das, was der Vorredner gesagt hat’, auch bei Abwesenheit des Vorredners präsent und der hypoleptischen ‚Aufnahme’ … und Anknüpfung zugänglich bleibt, muß es fixiert sein. Das ist nur in der Schrift möglich.“76 Die Schrift ist aber nur einer der drei Pfeiler, auf die sich das Verfahren der Hypolepse stützt: Sie ist nur notwendige, nicht hinreichende Bedingung.
Die Besonderheit eines Textes, der in der Schrift fixiert bzw. ausgebettet wird, ist es, dass seine Form den situativen Rahmen seines Entstehens überdauert, dass er sich aus der „ empraktischen Einbettung in Situationen “77 gelöst hat. Um „sowohl die Akte der Überlieferung des Gesagten als auch die Akte der hypoleptischen Anknüpfung an das Gesagte“78 zu steuern und zu organisieren, „bedarf es eines neuen Rahmens, der diesen Verlust situativer Determination kompensiert“79. Dieser Rahmen entspricht einer „gedehnten“ Interaktionssituation80, einer Ausweitung des Kommunikationskontexts. Es müssen Institutionen für den hypoleptischen Umgang mit Texten entstehen, welche Texte konservieren und ihr Verständnis fördern und die intertextuelle Verkettung gewissen „Regeln der Wiederaufnahme“81 unterwerfen. Der Rahmen als zweites Standbein der Hypolepse besteht also aus Institutionen wie der platonischen Akademie, Schulen, Universitäten usw., welche das Spiel des intertextuellen Anschlusses bestimmten Regeln unterwerfen.
Die dritte Bedingung für den hypoleptischen Diskurs ist nach Assmann die Wahrheit, bzw. der Glaube an eine stetige Annäherung an ein Wahrheitsideal, der eine „Kultur des Konflikts“82 begründet. Im Gegensatz zur kommentierenden Intertextualität, welche den kanonisierten Werken letztinstanzliche Wahrheit zuspricht geht die Hypolepse „davon aus, daß Wahrheit immer nur annäherungsweise zu haben ist. Der hypoleptische Prozeß ist der Prozeß dieser Annäherung.“83 Zu welchen Fragen werden aber wahre Antworten gesucht? Das Themenfeld, welches Wissenschaft und Philosophie beackern wird durch die Vorgabe von „Problemen“ bestimmt, die eine gewisse Relevanz haben und „das organisierende Element des hypoleptischen Diskurses“84 bilden.
Es wird deutlich, dass diese dritte Bedingung der Annahme einer Wahrheit, der Charakterisierung der „Wissenschaft als organisierter Wahrheitssuche“85 eng verbunden mit der Bedingung des institutionellen Rahmens ist, wird die Entwicklung dieses Rahmens doch durch den Wahrheitsgedanken beeinflusst und schafft der Rahmen doch diesen argumentativen Kampf um die Wahrheit. Wir können also von zwei interdependenten Aspekten einer Entwicklung sprechen.
Sybille Krämer charakterisiert die Hypolepse – ohne explizit auf den Terminus Bezug zu nehmen - sehr schön am Anfang ihres Aufsatzes Erfüllen Medien eine Konstitutionsleistung? Thesen über die Rolle medientheoretischer Erwägungen beim Philosophieren. So schreibt auch sie, nicht allein „der Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit per se lässt das Philosophieren zu einer kulturellen Institution werden“ vielmehr bedarf es einer „Kultur der Literalität, die agonale Auseinandersetzungen um Wahrheitsansprüche im Medium von Texten zulässt“.86 Im Unterschied zu Assmann, der auch „polemische, agonistische Prinzipien“87 in der hypoleptischen „Kultur des Konflikts“ erkennt, sieht Krämer diese agonale Kultur bereits in der Mündlichkeit der Griechen angelegt. Wir werden nach unserem Exkurs zu Derrida und Jäger darauf zurückkommen.
3 Die sprachkonstitutive Funktion der Schrift bei Derrida
Im vorhergehenden Teil dieser Arbeit sind Widersprüche zwischen den Auffassungen Assmanns und Goodys in Bezug auf die Identität eines Textes in oralen wie literalen Kulturen aufgetreten: Assmann bezeichnet orale Kulturen überwiegend als repetitiv während Goody das Moment der Variation betont. Dieses Element der Variation sei nach Assmann wiederum in literalen Gesellschaften vorherrschend.
Die folgende Darstellung der Derridaschen Philosophie der Schrift hat nun eine zweifache Funktion:
Erstens wird sie aufweisen, dass es sich bei diesen Widersprüchen um einen begrifflichen Gegensatz handelt, „der nicht aufzulösen, sondern als Denkerfahrung auszuhalten ist.“88 Es wird sich zeigen, dass dieser begriffliche Gegensatz – bei Derrida als Iteration bezeichnet – das konstituierende Prinzip jeglicher Zeichen überhaupt darstellt.
Zweitens bereitet die Derridasche Schriftphilosophie das Jägersche Konzept der Transkription vor, welches im vierten Teil unsere erneute Betrachtung und die mit ihr einhergehende Kritik der metalinguistic hypothesis und der Hypolepse leiten wird.
Wir werden zunächst den Rahmen der Derridaschen Schriftphilosophie, seine Kritik der Präsenzmetaphysik und des Logozentrismus kurz erläutern, um sodann – uns überwiegend an dem Vortrag Signatur Ereignis Kontext orientierend89 – seine Dekonstruktion des klassischen Schriftbegriffs darzustellen.
3.1 Derridas Bild der abendländischen Philosophie: Logo- und Phonozentrismus
In seinem 1967 erschienen Werk Grammatologie nimmt sich Derrida zur Aufgabe, die Präsenzmetaphysik durch eine Kritik des Zeichenbegriffs zu dekonstruieren. Diese Präsenzmetaphysik ist letztendlich ein Konstrukt Derridas, seine vereinheitlichende Sichtweise der traditionellen abendländischen Philosophie. Diese sei ein „Logozentrismus“, „der zugleich ein Phonozentrismus ist“90.
Wie lassen sich diese grundlegenden Begriffe des Derridaschen Denkens ‚Logozentrismus’, ‚Phonozentrismus’, ‚Präsenzmetaphysik’ und ‚Dekonstruktion’ verstehen und in Beziehung setzen? Wir wollen uns in dieser Arbeit damit begnügen, kurz und vereinfacht Derridas Sichtweise der philosophischen Tradition als Präsenzmetaphysik darzustellen, um dann in den folgenden Abschnitten die Dekonstruktion am Beispiel der Entwicklung seiner Philosophie der Schrift in Signatur Ereignis Kontext darzustellen.
Derrida führt den Charakter der gesamten abendländischen Philosophie, der Metaphysik, auf die Problematik des Zeichens, des signe (signum) als Einheit von signifiant (signans) und signifié (signatum) zurück.
Durch das Beibehalten der im wesentlichen und im rechtlichen Sinn strengen Trennung zwischen signans und signatum sowie der Gleichstellung von signatum und Begriff bleibt von Rechts wegen die Möglichkeit offen, einen Begriff zu denken, der in sich selbst Signifikat ist, und zwar aufgrund seiner einfachen gedanklichen Präsenz und seiner Unabhängigkeit gegenüber der Sprache, das heißt gegenüber einem Signifikantensystem. (…) Er erfüllt die klassische Forderung nach einem, wie ich es genannt habe, „transzendentalen Signifikat“, das von seinem Wesen her nicht auf einen Signifikanten verweist, sondern über die Signifikantenkette hinausgeht, und das von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr die Funktion eines Signifikanten hat.91
Der traditionelle Zeichenbegriff impliziert also die Möglichkeit eines „transzendentalen Signifikats“ als Seiendem, Präsentem, denn „[d]as formale Wesen des Signifikats ist die Präsenz “.92 Dieses transzendentale Signifikat lässt sich mit dem logos gleichsetzen, welcher in der Hierarchie der Signifikate die höchste Stufe einnimmt. Auf der nächsten Stufe steht die orale Sprache als Signifikant des logos und Signifikat der Schrift. Die Annahme eines transzendentalen Signifikats ist also eng mit dem Logozentrismus verknüpft.
Die Schrift ist Erweiterung, Ergänzung – Derrida gebraucht den Ausdruck Supplement93 – der oralen Sprache und existiert allein in Abhängigkeit von dieser, sie ist nur „Signifikant des Signifikanten“94. Diese Charakterisierung der Schrift, die Derrida in der gesamten abendländischen Philosophie zu erkennen meint, bezeichnet er als „Erniedrigung der Schrift“95, die einhergeht mit dem Phonozentrismus als einer Privilegierung des Lautes. So trage nämlich der Begriff des Zeichens nicht nur die Notwendigkeit eines transzendentalen Signifikats in sich, sondern auch „die Notwendigkeit …, die phonische Substanz zu privilegieren. (…) Die phone ist in der Tat die bezeichnende Substanz, die sich dem Bewußtsein gegenüber als enge Verbündete der Vorstellung vom bezeichneten Begriff ausgibt und von diesem Gesichtspunkt aus ist die Stimme das Bewußtsein selbst.“96 Die „absolute Nähe der Stimme zum Sein“97 mache die orale Sprache zu einem transparenten Signifikanten, welches im Hervorbringen seines Signifikats, des logos, verschwindet: „Nicht nur scheinen sich Signifikant und Signifikat zu vereinigen, sondern in dieser Verschmelzung scheint der Signifikant zu erlöschen oder durchsichtig zu werden, um dem Begriff die Möglichkeit zu geben, sich selbst als das zu zeigen, was er ist, als etwas, das auf nichts anderes als auf seine Präsenz verweist.“98
Derrida stellt sich nun die Aufgabe, die Maschine der abendländischen Philosophie, die Ergebnis und Ausdruck der Präsenzmetaphysik und des Logo- und Phonozentrismus ist, zu dekonstruieren. Diese Dekonstruktion bedient sich der Bestandteile der Maschine selbst, um sie zu zerlegen.99 In diesem Fall sind es die überkommenen Begriffe des philosophischen Diskurses des Abendlandes, die zu seiner Dekonstruktion dienen sollen. Derrida wählt Texte, die sein Bild der Metaphysik exemplifizieren und dekonstruiert mit diesen Texten gleichsam die Metaphysik selbst. Dabei ist – wie sich zeigen wird – ein häufig zu beobachtendes Vorgehen die Umkehrung etablierter Begriffshierarchien.
Was es nun konkret heißt, den Logozentrismus anhand von exemplarischen Texten zu dekonstruieren, wird sich in den folgenden Abschnitten zeigen. Mit unserer Darstellung des Vortrages Signatur Ereignis Kontext, dessen erste Hälfte gewissermaßen in Kurzform die Logozentrismuskritik und die Entwicklung einer Philosophie der Schrift in der Grammatologie nachzeichnet, stellen wir exemplarisch eine Dekonstruktion Derridas vor und bereiten sogleich der Boden für unsere weiteren Überlegungen.
3.2 Abwesenheit
Derrida löst die zentralen Begriffe seines Textes Signatur Ereignis Kontext aus der Betrachtung der traditionellen philosophischen Interpretation der Schrift heraus, um sie schließlich als Eigenschaften von Kommunikation überhaupt, gar als konstitutive Bedingungen von Zeichen und Kommunikation umzudeuten.
Er beginnt mit der Explikation der Eigenschaften des traditionellen Schriftbegriffs anhand eines exemplarischen Textes der abendländischen Metaphysik, anhand Condillacs Versuch über den Ursprung der menschlichen Erkenntnisse100 . Dieses Werk ist – nach Derrida – eine Exemplifikation des „System[s] dieser Interpretation“ von Schrift, das „in der gesamten Geschichte der Philosophie repräsentiert worden“ ist101.
Dieses „System der Interpretation“ sieht Schrift als ein Kommunikations mittel, das den „homogenen Raum“102 der Kommunikation als Supplement, d.h. als Ergänzung, der oralen Kommunikation ausdehnt, sowohl zeitlich als auch räumlich, ohne dass dabei „die Integrität des Sinns (…) wesentlich in Mitleidenschaft gezogen würde“.103 Diese Auffassung geht also von der Möglichkeit der Existenz eines medienunabhängigen Sinns, d.h. eines transzendentalen Signifikats aus. Dieser Sinn kann demnach sowohl in der oralen Sprache als auch in der literalen Sprache transportiert werden, wobei die Schrift nichts anderes tut als die räumliche und zeitliche Dimension auszudehnen, in der Kommunikation stattfinden kann. Diese Interpretation der Schrift zeigt sich bei Ong, wenn er sagt „writing distances the source of the communication (the writer) from the recipient (the reader), both in time and space“104 und auch bei Olson. Wie sich angedeutet hat und im Folgenden deutlicher wird, ist Olson – wie wir ihn in Abschnitt 2.2.1 als exemplarischen Vertreter der ‚metalinguistic hypothesis’ dargestellt haben – auch ein exemplarischer Vertreter des Logozentrismus.105
Hinter dem erwähnten „System der Interpretation“ steckt, so Derrida, die „Ideologie“106 von der Kommunikation als einer doppelten Repräsentation: „eine Theorie des Zeichens [signe] als Repräsentation der Idee, die selbst wiederum die wahrgenommene Sache repräsentiert“107. Schrift ist danach eine Art der hierarchisch übergeordneten Gattung Kommunikation, ihre spezifische Differenz ist die Abwesenheit, durch welche die Schrift zum Supplement der Rede, zum „Signifikanten des Signifikanten“108 werden kann. Bei dieser Abwesenheit handelt es sich aber um die „fortgesetzte Modifikation und fortschreitende Entkräftung der Anwesenheit“, die „homogene Wiederherstellung und Modifikation der Anwesenheit“.109 Der abwesende Autor bzw. Empfänger wird gleichermaßen durch die Schrift entfernt anwesend.
Nach Derridas Aufnahme des traditionellen Schriftbegriffs gelangt er durch die radikale Weiterentwicklung des Begriffs der Abwesenheit als Eigentümlichkeit der Schrift zum Begriff der Iteration, wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird.
3.3 Iteration
Die Rede von der Schrift als hierarchisch untergeordnetem Supplement der oralen Sprache, als bloßer Signifikant des Signifikanten impliziert auch die Nachgängigkeit der Schrift im Verhältnis zur Sprache.110 Derrida wird dieses Verhältnis umkehren. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Kritik des soeben skizzierten Begriffs der Abwesenheit als „homogene[n] Wiederherstellung und Modifikation der Anwesenheit“. Derrida postuliert eine „absolute Abwesenheit“111 unter deren Voraussetzung eine Schrift lesbar bleiben müsse: „Eine Schrift, die nicht über den Tod des Empfängers hinaus strukturell lesbar – iterierbar – wäre, wäre keine Schrift.“112 Dieser „testamentarische Charakter des Schriftzeichens“113 ist die Grundlage für Derridas Schriftbegriff. „Denn damit ist klar, daß, was Schrift leistet, nicht mehr abgeleitet werden kann aus einer Modifikation jener Vollzüge, die sich beim Gespräch unter Anwesenden ereignen.“114 Das Wesen der Schrift liegt also nicht in ihrer Funktion als Brücke, die eine zeitliche und räumliche Kluft zwischen Sender und Empfänger schließt, damit diese gleichsam entfernt anwesend sind, sondern in seiner strukturellen Lesbarkeit.
Diese „strukturelle Lesbarkeit“ wird von Derrida mit Iterierbarkeit der Schrift gleichgesetzt. Iterierbarkeit ist die Verknüpfung der Wiederholbarkeit mit gleichzeitiger Veränderung: „[ I ] ter, nochmals, kommt von itara, anders im Sanskrit, und alles Folgende kann als Ausbeutung dieser Logik gelesen werden, die die Wiederholung mit der Andersheit verknüpft“115. Eine Schrift ist also lesbar, wenn eine Person in der Lage ist, die Zeichen zu iterieren.116
Schrift wird hier also allein als ein Symbolschema, als eine Menge von Signifikanten und nicht als Symbolsystem betrachtet.117 Der Signifikant tritt in den Vordergrund und verdrängt gleichsam das (transzendentale) Signifikat.
Die Möglichkeit der Klassifizierung eines Zeichens als Schrift ist nun notwendigerweise daran gebunden, dass „es in seiner Identität als Zeichen [marque, Anm. des Übersetzers] durch einen Code geregelt“118 ist. Der Code ist „Organon der Iterabilität“, und kein Code kann „strukturell geheim“ sein119, d.h. aus den Inskriptionen eines Schemas lassen sich, so es sich um eine Schrift handelt, die Charaktere des Schemas erschließen.120
Wie lässt sich diese Iterabilität der Schrift nun auf die orale Kommunikation, auf sämtliche Zeichenprozesse ausdehnen? Derrida betrachtet dazu die orale Sprache und ersetzt den – skriptizistisch geprägten – Ausdruck des Codes durch die „Selbstidentität“121 eines Elements, welche die Erkennung und Wiederholung dieses Elements erlauben muss. Bedingung der Möglichkeit der Selbstidentität eines Zeichens ist nun widersprüchlicherweise die Iterabilität, die zugleich die Selbstidentität des Zeichens verunmöglicht, weil sie ja Andersheit impliziert. Iterabilität – d.h. variierte Wiederholung – konstituiert die „Einheit der signifikanten Form“122, den type, der wiederum als Regel für seine Iterabilität gilt: „Es kann nicht ein einziges Mal nur ein Mensch einer Regel gefolgt sein“123, wie Wittgenstein ganz richtig anmerkt, denn eine Regel, wie auch der type oder die „Einheit der signifikanten Form“ werden erst durch Iteration und die damit verbundene kontinuierliche Veränderung erschaffen.
„Weil nämlich [die] Einheit der signifikanten Form nur durch ihre Iterabilität konstituiert wird“124 und „jede Wiederholung zugleich mit einer Andersheit verbunden“125 ist, ist das zeichenkonstituierende Prinzip gleichzeitig das, was ihre Identität unmöglich macht. Hier wird deutlich, was es heißt, Widersprüche aushalten zu müssen.
Mit der Iteration haben wir nun eine zeichenkonstitutive Operation, die der Präsenzmetaphysik und ihrem Identitäs- und Präsenszdenken etwas entgegensetzt. Aus der Iterabilität als konstitutive Bedingung von Zeichen folgt eine weitere grundlegende Eigenschaft derselben: die „Kraft zum Bruch mit seinem Kontext“126, welche im Folgenden erläutert werden soll.
3.4 Kontextwechsel
Die prinzipielle Möglichkeit jedes Zeichens, in beliebig vielen Kontexten iteriert zu werden, die aus der Iterabilität der Zeichen folgt, entwickelt Derrida in einer Auseinandersetzung mit Austins How to do things with words127 .
Er wendet die von Austin zum Sonderfall der Sprache erklärte „parasitäre Ausnutzung“128 des normalen Sprachgebrauchs zur Möglichkeitsbedingung von Zeichen. Es ist nämlich für den Vollzug eines Performativs notwendig, eine iterierte und erneut iterierbare Formel, kurz: ein Zitat, auszusprechen um überhaupt ein Gelingen zu ermöglichen. Der scheinbar kontingente, akzidentelle, dem Perfomativ äußerliche Fall des parasitären Gebrauchs von Sprache ist folglich dem Performativ im Gegenteil wesentlich. Ich muss zum Vollziehen einer sprachlichen Handlung ein „Zitat“ aussprechen, eine Formel, die „als einem iterierbaren Muster konform identifiziert“129 ist.
„Aufgrund seiner wesensmäßigen Iterabilität kann man ein schriftliches Syntagma immer aus der Verkettung, in der es gefasst oder gegeben ist, herausnehmen, ohne daß es dabei alle Möglichkeiten des Funktionierens und genau genommen alle Möglichkeiten der ‚Kommunikation’ verliert.“130 Die – von Austin herausgearbeitete – starke Bedeutung des Kontexts131 wird damit relativiert, die Intention des Zeichenproduzenten sowie die historischen Begebenheiten oder der Erfahrungshorizont der Beteiligten spielen eine untergeordnete Rolle.
Im gleichen Zug wird die Möglichkeit des Kontextwechsels unterstrichen, die Möglichkeit, ein jedes Zeichen aus seinem jeweiligen Kontext zu lösen und in einen anderen zu setzen. „Man kann ihm [dem schriftlichen Syntagma] eventuell andere [Kontexte] zuerkennen, indem man es in andere Ketten einschreibt oder es ihnen aufpfropft. Kein Kontext kann es abschließen.“132
Diese Unabschließbarkeit bedeutet die Möglichkeit der Aufpfropfung von Zeichen, die Möglichkeit also, „auf absolut nicht sättigbare Weise unendlich viele neue Kontexte [zu] zeugen. Das heißt nicht, daß das Zeichen außerhalb eines Kontexts gilt, sondern ganz im Gegenteil, daß es nur Kontexte ohne absolutes Verankerungszentrum gibt.“133
3.5 Signifikanten von Signifikanten
Für Derrida reicht es aus, dass er Eigenschaften, die traditionellerweise der Schrift zugeschrieben werden, als grundlegend für jegliche Zeichen erkennt, um die Begriffshierarchien umzuwälzen.134 Also verwendet er den Schriftbegriff für jene Möglichkeitsbedingung, die jeder Kommunikation vorausgeht, womit die Schrift „nicht mehr eine Art der Kommunikation“135 ist, sondern einen quasi transzendentalen Status erlangt.136 Mit diesem quasi transzendentalen Status der Schrift für jede Kommunikation wird jegliches Zeichen zum Signifikanten des Signifikanten, die oben erwähnte Verdrängung des (transzendentalen) Signifikats ist vollendet.
Nicht daß das Wort ‚Schrift’ aufhörte, den Signifikanten des Signifikanten zu bezeichnen; in einem ungewohnten Licht aber wird deutlich, daß ’Signifikant des Signifikanten’ nicht länger eine akzidentelle Verdopplung und abgefallene Sekundarität definiert. ’Signifikant des Signifikanten’ beschreibt im Gegenteil die Bewegung der Sprache – in ihrem Ursprung (…). Das Signifikat fungiert darin seit je als ein Signifikant. Die Sekundarität, die man glaubte der Schrift vorbehalten zu können, affiziert jedes Signifikat im allgemeinen, affiziert es immer schon, das heißt, von Anfang, von Beginn des Spieles an. Es gibt kein Signifikat, das dem Spiel aufeinander verweisender Signifikanten entkäme, welches die Sprache konstituiert, und sei es nur, um ihm letzten Endes wieder anheimzufallen.137
Derridas Gegenentwurf zum zweistelligen hierarchischen Zeichenbegriff kann als „Modell des unendlichen Verweises“138 oder „Modell der Signifikantenkette“139 bezeichnet werde. Das Saussuresche Prinzip der Differenz ist somit radikalisiert, jeder Signifikant verweist in seiner Iteration auf vorherige Verwendungen wie auch auf die anderen Elemente im Zeichensystem, so dass „sich jedes ‚Element’ … aufgrund der in ihm vorhandenen Spur der anderen Elemente der Kette oder des Systems konstituiert.“140 Deshalb ist der Ausdruck ‚Signifikantenkette’ irreführend und sollte besser durch ‚Gewebe’ oder ‚Text’ ersetzt werden, wie auch Derrida es vorschlägt.141
3.6 Zwischenbilanz
Es hat sich gezeigt, dass der Widerspruch von Repetition und gleichzeitiger Variation in den Erzählungen oraler Kulturen als solcher auszuhalten ist, weil er konstituierend für orale – wie auch für literale – Zeichenprozesse ist.
Auch wurde die strukturelle Ähnlichkeit der Kommunikation in literalen und oralen Gesellschaften deutlich. Die widersprüchliche Verknüpfung der Reproduktion mit Kreation, der Repetition mit Variation, kurz: die Iteration ist grundlegend für orale Diskurse wie auch für literale Kommunikation, weil sie schließlich Möglichkeitsbedingung von Kommunikation überhaupt ist. Mit Derridas Begriffen der Schrift, des Signifikantengewebes und der Iteration haben wir zudem einen Gegenentwurf zur Präsenzmetaphysik und der Annahme eines transzendentalen Signifikats, einen Gegenentwurf, der Abwesenheit und Differenz als zeichenkonstitutiv erkennt anstatt Präsenz und Identität.
Im Folgenden werden wir zeigen wie Jäger an Derrida anschließt und ein Modell kultureller Semantik entwickelt, das von einem transzendentalen Signifikat absieht und symbolsystem-immanente Prozesse, d.h. sozusagen Operationen im Signifikantengewebe, als grundlegend zur Herstellung von Semantik ansieht.
4 Transkriptivität, Metasprache und intertextueller Anschluss in oralen Kulturen
4.1 Von Derrida zum Verfahren der Transkription Jägers
Wenn Sybille Krämer sagt, dass Derrida mit seiner Verschiebung des Schriftbegriffs „die Verfahren akademischer Argumentation hinter sich läßt“142, so kann man mit gewissen Einschränkungen behaupten, dass Ludwig Jäger an diesem Punkt den Faden aufnimmt und die Argumentation – an Derrida anschließend – akademisch weiterführt.
Jäger schließt mit seinem Begriff der Transkriptivität unmittelbar an viele Gedanken Derridas an143, kehrt dabei aber erneut – sprachhistorisch und empirisch begründet anstatt dekonstruierend – die von Derrida etablierte Hierarchie von Schrift und Sprache um. Er möchte Derridas Gedanken „so zu wenden versuchen, daß umgekehrt Skripuralität als das Ergebnis einer ursprünglichen ‚rekursiven Transkriptivität’ nonliteraler Sprachlichkeit erscheint: als das Ergebnis einer Verfahrenslogik, die bereits in mündlichen Kulturen in Sprache eingeschrieben ist“144. Schrift sei somit „die Fortsetzung der Rede mit anderen Mitteln“145.
Er kommt zu dem Schluss, Derridas Kritik des Logozentrismus lasse sich „als Präludium zu einer Argumentation lesen, der es zunächst und vor allem um die Herausarbeitung einer grundlegenden operativen Logik von Zeichensystemen geht.“146 Diese Logik unterlaufe die gängige Unterscheidung von literaler und oraler Sprache und sei der Ursprung jeglicher Kommunikation.147 Jäger nennt diese Logik Transkriptivität.148
Worum handelt es sich nun genau bei der Transkriptivität und wie entsteht ihre Theorie aus dem Geiste der Derridaschen Logozentrismuskritik? Welches sind die Eigenschaften dieser „operativen Logik von Zeichensystemen“?
Derrida ging es darum, mit seiner Dekonstruktion der Präsenzmetaphysik die Annahme eines transzendentalen Signifikats zu erschüttern und kam zu dem Schluss, dass jedes Signifikat letztlich ein Signifikant sei, der auf andere Signifikanten einer vorangegangenen Iteration bzw. des Signifikantengewebes verweise. Jäger behauptet analog, es gebe keinen „medien-transzendenten Beglaubigungshorizont von Semantik“149 – also kein transzendentales Signifikat, sei es der logos oder die Gegenstände der Welt – sondern „immer nur symbolsystem-immanente Verfahren der semantischen Ratifizierung“.150 Er betrachtet besonders zwei dieser ‚symbolsystem-immanenten Verfahren der semantischen Ratifizierung’, zwei Weisen der Transkription: Erstens „ein intra mediales Verfahren das die ‚eigentümliche Doppelstruktur’ der natürlichen Sprachen, nämlich ihre Eigenschaft nutzt, mit Sprache über Sprache zu kommunizieren“, wozu z.B. Paraphrase, Erläuterung, Explikation und auch Hypolepse und Kommentar gehören.
Zweitens „ein inter mediales Verfahren, das mindestens ein zweites mediales Kommunikationssystem zur Kommentierung, Erläuterung, Explikation und Übersetzung (der Semantik) eines ersten Systems heranzieht.“
Wir werden unsere Betrachtung auf die intramedialen Verfahren beschränken und ihre Anwendung besonders in oralen Kulturen in den folgenden Abschnitten einer genaueren Betrachtung unterziehen. Es ist dies besonders das Verfahren der „rekursiven Transkriptivität“, das Jäger als einen Operationsmodus der oralen Sprache sieht, den „die Schrift in ihrer Genese operativ nutzt“.151
4.2 Prätext, Transkript und Skript
In diesem Abschnitt werden kurz auf einer abstrakten Ebene grundlegende Begriffe zu Jägers Theorie der Transkription vorgestellt, Begriffe, die im Abschnitt 4.4 bei der Betrachtung oraler Metasprache eine Anwendung finden werden.
Wie oben erwähnt dienen die beiden Weisen der Transkription der „Bedeutungs- Erschließung “, die „in einem bestimmten Sinne auch die Konstitution der erschlossenen Bedeutung miteinbeschließt.“152 Transkribieren ist demnach „ein Prozeß der Konstitution von Skripten aus Prätexten“153, ist „Lesbarmachen“154. Dabei wird aus „in einer gewissen Hinsicht unlesbaren Prätexten ein[] Ausschnitt fokussiert, ihm eine semantische Ordnung“ gegeben und also in einen Status der Lesbarkeit überführt.[155] Was lässt sich nun genauer unter der Begriffstriade ‚Prätext’, ‚Skript’ und dem noch nicht erwähnten ‚Transkript’ verstehen? Wir werden wie gesagt vorerst eine theoretische Erläuterung der Begriffe mit Jägers Worten geben.156
- Der Prätext ist „das zugrunde liegende symbolische System selbst, das fokussiert und in ein Skript verwandelt wird“.157
- Das Transkript stellt die „symbolischen Mittel, die das jeweils transkribierende System für eine Transkription verwendet“ dar158.
- Das Skript sind „die durch das Verfahren lesbar gemachten, das heißt transkribierten Ausschnitte des zugrunde liegenden symbolischen Systems“159, d.h. des zugrunde liegende Prätextes.160
Mit der Wahl eines Transkripts, eines Mittels der Transkription, ist das aus dem Prätext generierte Skript, der lesbargemachte Sinn, allerdings nicht determiniert. Es besteht kein Repräsentationsverhältnis zwischen Skript und Prätext, „Transkriptionen stellen also … keine Abbilder von Skripten dar, weil sie diese in einer bestimmten Hinsicht erst erzeugen.“161 Diese Annahme würde ja das Postulat eines transzendentalen Signifikats implizieren.
Folglich bietet jeder Prätext eine Vielzahl von Möglichkeiten der Lesbarmachung, und [d]ie Transkription konstituiert also in gewissem Sinne nicht nur das Skript, sondern sie öffnet über den bestimmten Weg, den sie durch das Netzwerk der Prätexte nimmt, zugleich auch andere Navigations-Optionen, andere Lektüren, deren Unangemessenheit sie im gleichen Maße postuliert, in dem sie dieses Postulat Legitimationsdiskursen aussetzt. Die in der Transkription enthaltene Behauptung einer bestimmten Lektüre nutzt einen diskursiven Modus, in dem zugleich notwendigerweise auch die Möglichkeit des Zweifels, der Korrektur und der Bestreitung implementiert ist.162
Mit anderen Worten: Jede Transkription eröffnet die Möglichkeit von Postskripten, die entgegen dem Postulat der vorgängigen Transkription eine alternative Lesbarmachung des Prätextes vollziehen und „die ihrerseits als Skript-Behauptungen das iterativ-endlose Spiel der Lektüren in Gang halten“.163
Dieses Spiel kann – unter gewissen Bedingungen – als hypoleptisches Spiel bezeichnet werden, auf das wir in Abschnitt 4.4.2 erneut zu sprechen kommen werden.
4.3 Warum es in oralen Kulturen Metasprache geben muss
An dieser Stelle soll nun gezeigt werden, dass die Verwendung metasprachlicher Praktiken auch in oralen Kulturen nicht nur möglich, sondern sogar notwendig ist. Wir werden dazu die Rolle, die eine Störung als Auslöser expliziter Transkription in einem Kommunikationsprozess spielt, näher betrachten.
Wie bereits erläutert, gibt es keinen „medien-transzendenten Beglaubigungshorizont von Semantik“164. Die klassische Kommunikationstheorie, nach der eine Nachricht vom Sprecher durch einen Kanal zum Empfänger gelangt, geht jedoch von solchen diskreten, semantisch abgeschlossenen Informationseinheiten, in denen „zwischen Repräsentant und Repräsentat eine Relation medial unvermittelter, wahrheitswertfähiger Abbildung gestiftet wird“165, aus. Fließt die Information nicht wie gewünscht vom Sender zum Empfänger, so liegt dies nach diesem Modell daran, dass die vom Sprecher intendierte Semantik nicht auf eine Art und Weise ‚verpackt’ wurde, die dem Empfänger einen Zugang dazu gewährt. Durch korrektive Maßnahmen (sog. Repairs166 ) kann der ungestörte Informationsfluss wieder hergestellt werden.
In seinem Aufsatz Störung und Transparenz167 klassifiziert Jäger die oben erwähnten Verständigungsprobleme als „Störung mit dem Indexunfall(= Störungu)“168. Störungen diesen Typs bzw. die zugehörigen Repairs leugnet Jäger keineswegs, aber [d]ie Rolle von Repairs erschöpft sich nicht in einer durch Störung ausgelösten Korrekturleistung. (…) Über die zweifellos existierende korrektive Funktion hinaus haben Repairs [] eine grundlegendere konstruktive Funktion: Sie ermöglichen die Ausfaltung der zu Redebeginn unausartikulierten Intention im Zuge interaktiver Verständigungshandlungen.[169]
Konstruktive ‚Störungen’ dieser Art bezeichnet Jäger als „Störung mit dem Indextranskriptiv (= Störungt)“170. Bedeutung wird anhand solcher Störungent medien-immanent erzeugt – nicht bevor, sondern während des Sprechens (bzw. Schreibens) – indem der Äußerer seine Äußerung kontinuierlich selbst wahrnimmt und transkribiert171: „Jedes Element, das durch das Monitoring ‚nachträglich’ ratifiziert ist, erweist sich so als Transkription einer ‚ursprünglichen’ Redeintention, die in dieser Form zu Beginn der Rede nicht existent war.“172
Wird während der Rede (sei es Dialog oder Monolog) durch das Monitoring eine Störungt ausgemacht (sei es vom Sprecher oder Zuhörer), so wird der „transparente“173 Sprachfluss unterbrochen und die Sprache selbst tritt in den Mittelpunkt, so dass „die klärende Ausarbeitung der Redeintention vorangetrieben werden kann“174.
„[D]as interaktive Spiel der Medien … als genuiner Konstitutions-Ort von Semantik“175, die Unabschließbarkeit des Kontextes eines (sprachlichen) Zeichens und die Unmöglichkeit „medial unvermittelte[r] Erkenntnis“176 setzen voraus, „dass die Sprecher … in einen Diskurs über ihren eigenen Sprachgebrauch eintreten können“177. Kommunikation würde ansonsten durch einen eklatanten Mangel an Möglichkeiten der Semantisierung zusammenbrechen bzw. von vornherein unmöglich.
Dieser Diskurs über den eigenen Sprachgebrauch ist genau das, was Olson als Metasprache allein der Literalität zuschreibt. Die Folge der metalinguistic hypothesis nach Olson wäre also, „daß präliterale bzw. nonliterale Sprachen nicht als natürliche Sprachen angesehen werden könnten“178. Wir gehen jedoch davon aus, dass auch orale Kulturen über (natürliche) Sprachen verfügen. Die Schrift ist somit keine Bedingung für Metasprachlichkeit und Transkriptivität, sondern stellt eine auf diesen der Rede inhärenten Eigenschaften aufbauende Technik dar. Der Unterschied zwischen Oralität und Literalität ist „a matter of degree rather than of kind because the important cognitive process of reflecting on a reflection (called ‚going meta’ these days) is faciliated by the mechanism of oral genre”179. Die Schrift ermöglicht die aus dem Geist der Rede hervorgegangene Transkription über einen größeren Zeitraum hinweg. Sie bietet lediglich einen persistenteren, größeren ‘Speicher’ als die Rede und sie ermöglicht ein exponentielles Wachstum des Wissens180, ist aber fest in der oralen Sprache verwurzelt – verwurzelt nicht im Sinne der Abbildung von Lauten durch die Alphabetschrift, sondern vor allem in den Strukturen ihrer Anwendung.
4.4 Empirische Untersuchungen zur Metasprache und intertextuellem Anschluss in oralen Kulturen
Der Begriff der Transkription beinhaltet als zentrales Prinzip das Isolieren von Text- oder Redeausschnitten, um auf diese – metasprachlich – Bezug zu nehmen. Nach Olson181 ist für dieses Isolieren die Schrift, als Bedingung oraler Metasprache, notwendig. Wir führen nun einige empirische Untersuchungen an, welche die von uns dargelegte Argumentation zur Metasprache in oralen Kulturen unterstützen.
Carol Fleisher Feldman belegt anhand verschiedener empirischer Studien, dass es auch in oralen Kulturen verschiedene, „highly patterned and artful“182 Genres gibt, welche mit denen in literalen Gesellschaften vergleichbar sind.
Als Beispiel dafür führt Fleisher Feldman eine Studie von R. Rosaldo183 an. Bei dessen Erforschung der Ilongot184 stellte sich heraus, dass diese dreizehn Genres anwenden, und – viel wichtiger – diese auch unterscheiden und benennen. Die Genres werden von ihnen in drei Hauptkategorien unterteilt: ‚straight speech’, ‚crooked speech’ und ‚the language of spell’185. Die drei Genres der ‚straight speech’ beziehen sich auf die Gegenwart, die nahe Vergangenheit und eine entfernte Vergangenheit. Sie werden auf Grund ihrer äußeren Form unterschieden und benannt. Dies kommt der in literalen Kulturen üblichen Kategorisierung von Zeitformen anhand äußerlicher grammatikalischer Merkmale der verwendeten Wörter bzw. Sätze zumindest sehr nahe, d.h. sie weisen „characteristics similar to some of our literary genres“186 auf.
Die Tatsache, dass auch orale Kulturen ihre Genres unterscheiden und benennen können, impliziert, dass sie sich sehr wohl der Äußerlichkeiten der verwendeten Sprache bewusst sind und nicht nur auf eine implizite Sprachkompetenz zurückgreifen187. Eine weitere empirische Untersuchung188 lässt auch die Behauptung zusammenbrechen, dass Schrift notwendig für die Trennung von Ausdruck und Inhalt ist, dass erst sie die orale Sprache verobjektiviere und belegt, dass „[t]ranskriptive Verfahren wie Kommentare […] auch in nichtliteralen Kulturen nicht nur möglich, sondern für diese geradezu konstitutiv“189 sind.
Jane Atkins untersuchte die zahlreichen sprachlichen Genres der Wana, eines indonesischen Volkes. Fleisher Feldman greift aus dieser Studie den kiyori, eine poetische Form des politischen Diskurses, heraus. Dieser hebt sich durch seine äußere Form von der Alltagssprache ab, nämlich durch ein spezielles Vokabular, eine gewisse Reimstruktur und die extensive Verwendung von Metaphern.190
Ein solcher kiyori ist darauf angelegt, eine metaphorische und gewissermaßen ambige, auf Ästhetik abzielende Form zu erzeugen, welche daraufhin diskutiert wird. Diese Form wird zunächst fixiert, gewissermaßen oral vertextet, indem sie sowohl vom Sprecher als auch vom Publikum wiederholt wird. Die für den kiyori charakteristische „brief form and the redudancies of rhyme and meter, are plainly designed to fix the locution in memory“191, also um Missverständnisse, etwa durch unklare Aussprache, zu unterbinden192. Es wird eine fixierte symbolische Form, ein Schema, eine Textur – mit Jägers Worten: ein Prätext – geschaffen.
Nachdem die äußere Form fixiert ist, findet eine Diskussion verschiedener Interpretationen statt. Der kiyori wird also transkribiert, es finden nacheinander eine „Isolierung und Stillstellung von Redeausschnitten sowie d[ie] Bearbeitung der stillgestellten ‚Elemente’ der Rede“193 statt. Die Äußerung wird – um mit Jäger zu sprechen – auf eine „ semantische Aushandlungsbühne “194 gehoben und weiter diskutiert. Dieser Vorgang des Diskutierens ist nichts anderes als ein Transkript, mit welchem vom Prätext ausgehend Sinn generiert wird. So entstehen ein bzw. mehrere Skripte, welche Anlass zu Postskripten geben oder wiederum als Prätexte die weitere Diskussion speisen können.
Dieses transkriptive Moment ist integraler Bestandteil des kiyoris, welcher überhaupt nicht auf das transparente Verstehen, sondern als Anstoß zur Interpretation und Diskussion konzipiert ist. Zugespitzt kann man auch sagen, dass der Kiyori als Störungt angelegt ist. Deshalb kann eine solche Transkription nicht ein Resultat davon sein, „daß der Sprecher nicht in der Lage ist zu sagen, was er meint bzw. offensichtlich nicht meint, was er sagt, oder … dass der Rezipient nicht versteht, was der Sprecher sagt, oder nicht versteht, was der Sprecher mit dem, was er sagt, meint etc.“195. Es findet von vornherein eine klare Trennung zwischen dem, was gesagt wird und dem, was gemeint sein könnte statt: ein klares Indiz für die bewußte/explizite Anwendung von metasprachlichen, d.h. transkriptiven Techniken.
Ein kiyori wird darüber hinaus in der Kultur der Wana auch ‚missbraucht’ bzw. ‚parasitär ausgenutzt’. Er wird scherzhaft, ironisch verwendet und stellt so eine „form of reflection or metainterpretation on the making of serious kiyori itself“196 dar. Der „parasitäre Gebrauch“ ergänzt den „normalen Gebrauch“, auch dieses Parodieren ist eine Möglichkeit des Transkribierens bzw. ein intertextueller Anschluss an vorhergegangene kiyoris.
Jan Vansina stellt in seiner Untersuchung von nonliteralen Kulturen im ehemaligen Kolonialgebiet Belgiens in Afrika gar eine Typologie oraler Kommunikationsformen zusammen197. Er kategorisiert dabei Formulae, Poetry, Lists, Tales und Commentaries mit jeweils eigenen Unterkategorien und Typen.198 Aus letzterer Kategorie dienen erklärende Kommentare der Erläuterung anderer ‚oral traditions’: „they are designed to throw light on those parts of the other testimony which are unintelligible“199. Sie treten also dann als Transkript in Erscheinung, um den primären Text, den Prätext, zu semantisieren, wenn die Rede aus dem Zustand der Transparenz in den der Störungt übergeht.
Es kann jedoch auch geschehen, dass Kommentare im Laufe der Zeit untergehen. Wenn der primäre Text seine erläuternden Kommentare überlebt, und daraufhin transkribiert werden muss, so steht es dem Erzähler frei, einen eigenen Kommentar zu erfinden.200 Wichtig ist also nicht der Inhalt eines ergänzenden Kommentars, sondern vielmehr der Vorgang des Innehaltens und des Reflektierens über den primären Text an sich – seine Semantisierung, das Transkribieren.
Texte, die im kulturellen Gedächtnis einer nonliteralen Kultur vorhanden sind, bedürfen also, wie auch in literalen Kulturen, der Transkription, um in das kommunikative Gedächtnis überführt zu werden. Auch orale Texte bergen die Gefahr, zu einem ‚Grab für den Sinn’ zu werden und benötigen Formen des intertextuellen Anschlusses – in diesem Fall des Kommentars – um der sich wandelnden Gesellschaft zugänglich zu bleiben.
4.5 Hypolepse in oralen Kulturen?
Wie die beiden vorherigen Abschnitte gezeigt haben, gibt es auch in oralen Kulturen Metasprachlichkeit und Formen des intertextuellen Anschlusses. Wie verhält es sich nun mit der Hypolepse in der abendländischen Philosophie und Wissenschaft, die nach Assmann die Literalität zur Voraussetzung hat?
In Abschnitt 4.2 haben wir theoretisch, in Abschnitt 4.4 auf der Basis empirischer Forschungen belegt: Formen „intertextuellen Anschluss“, Weisen der Transkription wie Kommentar oder Paraphrasierung gibt es auch in oralen Kulturen.
Haben wir es also womöglich auch in der präliteralen abendländischen Kultur mit hypoleptischen Verfahren zu tun? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die anderen beiden notwendigen Bedingungen für die Hypolepse überprüfen. Wie ist es mit dem institutionellen Rahmen, der mit der Annäherung an die Wahrheit eng verbunden ist?201
Sybille Krämer schreibt: „Da im antiken Griechenland keine Buchreligion die Kanonisierung eines Textes erzwang, konnten Texte zu öffentlichen Foren werden: Politische Spielregeln der öffentlichen Rede avancieren so zu Spielregeln des Textes.“ Sie geht also davon aus, dass Regeln der oralen Kommunikation als Grundlage für die literale „Kultur des Konflikts“ dienten. Folglich sei – genau wie bei Assmann – die Schrift nicht der einzige Grund für die Entwicklung der abendländischen Philosophie mit ihrer hypoleptischen Diskursorganisation, sondern: „Entscheidend ist vielmehr die für den antiken griechischen Denkraum so einzigartige Inszenierung dialogisch-agonaler Mündlichkeit im Medium der Textualität. “ Interpretieren wir nun diese „dialogisch-agonale Mündlichkeit“ als Rahmen, welcher als Bedingung für die Hypolepse den Kampf zur Wahrheit leitet, so wird deutlich, dass sich mit guten Gründen für eine hypoleptische Diskursorganisation in der präliteralen abendländischen Kultur streiten lässt, wozu allerdings der präliterale Wahrheitsbegriff zu untersuchen wäre. Eine ausführliche historische Argumentation für die hier – mit Krämer – postulierte Existenz „dialogisch-agonaler Mündlichkeit“ und einen präliteralen Wahrheitsbegriff muss leider ausbleiben.202
5 Fazit
Wir haben unsere Betrachtung des Verhältnisses zwischen oralen und literalen Kulturen mit einem näheren Blick auf zwei Hypothesen begonnen, die der Literalität eine grundlegende Rolle für die Entwicklung neuer kognitiver und diskursiver Strukturen zuschreiben: die metalinguistic hypothesis nach David R. Olson und die Unterscheidung zwischen ritueller und textueller Kohärenz nach Jan Assman.
Ein Exkurs über die sprachkonstitutive Funktion der Schrift nach Jacques Derrida eröffnete eine Umkehrung des hierarchischen Verhältnisses von Kommunikation und Schrift, sowie die Erkenntnis einer allen Zeichenprozessen gemeinsamen Funktionsweise, in welcher das (transzendentale) Signifikat ausgeklammert und das Prinzip der Signifikantenkette, des Gewebes, an dessen Stelle gesetzt wird.
Ausgehend von Derridas Dekonstruktion des klassischen Schriftbegriffes haben wir uns dem Verfahren der Transkription nach Ludwig Jäger zugewandt. Unter Annahme der Unmöglichkeit eines transzendentalen, medien-unabhängigen Zugangs zu einer ‚realen’ Welt hat sich die Transkription als das Verfahren erwiesen, das durch intra- und intermediale Bezugnahme von einem Zeichen auf andere die Konstitution von ‚Sinn’ erst möglich macht.
Anhand dieser These zur grundlegenden Funktionsweise jeden Zeichensystems im Allgemeinen und der Sprache im Besonderen haben wir anschließend dargelegt, dass metasprachliche Transkription auch in rein oralen Sprachen nicht nur existieren muss, sondern dass sie eine notwendige Bedingung für natürliche Sprachen ist. Wenn sich nun also diese metasprachlichen Verfahrensweisen der Oralität in der Literalität wiederfinden, so liegt es nahe, dass „sowohl unsere Lektürepraktiken, als auch die Herausbildung unserer skripturalen kulturellen Kompetenzen, von einer essentiellen Mündlichkeit imprägniert sind, die konstitutiv in deren Herausbildung eingeschrieben ist“203. Zwei empirische Studien, die wir näher betrachtet haben, untermauerten diese Argumentation.
Aus dem Vorhandensein von Metasprache in jedweder Kommunikation wurde abschließend die Möglichkeit aufgezeigt, das Konzept der Hypolepse als Resultat einer ‚dialogisch-agonalen Mündlichkeit’ in der präliteralen antiken griechischen Kultur zu rekonstruieren. Damit würde das hypoleptische Prinzip des geregelten Anknüpfens an Texte zu einem Verfahren ausgeweitet, das weder der textuellen noch der rituellen Kohärenz exklusiv zur Verfügung stünde. Es wäre dann vielmehr eine Möglichkeit des intertextuellen Anschluss zur Herstellung und Wahrung kultureller Kohärenz in literalen und nonliteralen Gesellschaften. Ob der schriftliche wissenschaftliche Diskurs, der Wettstreit um die Wahrheit, die Wurzeln seiner Funktionsweise in der Rede hat, gilt es an anderer Stelle genauer zu untersuchen.
In dieser Arbeit wurden einige Aspekte bezüglich dessen betrachtet, was Literalität nicht von Oralität unterscheidet. Dass es grundlegende Unterschiede zwischen den Sprachen literaler und nonliteraler Kulturen gibt, wollen wir damit keineswegs leugnen. Wir begnügen uns an dieser Stelle mit der Feststellung, dass die Schrift– wie jedes Medium – eine Veränderung der „Struktur, Reichweite und Komplexität von Symbolsystemen ebenso wie ihre[r] Vernetzungsdichte“204, aber keine grundsätzlich neue „operative Logik von Zeichensystemen“ mit sich bringt.
6 Literatur
Assmann, Aleida/Assmann, Jan (1990): Schrift – Kognition – Evolution. Eric A. Havelock und die Technologie kultureller Kommunikation in: Havelock, Eric A.: Schriftlichkeit. Das griechische Alphabet als kulturelle Revolution, Weinheim, S.1-35.
Assmann, Aleida/Assmann, Jan (1992): Schrift in: Ritter, Joachim/Gründer, Karlfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 8: R–Sc, Basel, Sp. 1417-1429.
Assmann, Jan (1997): Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in den frühen Hochkulturen, München.
Austin, John L. (1979): Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart; Originaltitel: How to do things with words, Oxford 1962.
Derrida, Jacques (1972): Die Schrift und die Differenz, Frankfurt/Main; Originaltitel: L’Écriture et la Différence, Paris 1967.
Derrida, Jacques (1974): Grammatologie, Frankfurt/Main; Originaltitel: De la grammatologie, Paris 1967.
Derrida, Jacques (1986): Positionen. Gespräche mit Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine, Guy Scarpetta, Graz/Wien.
Derrida, Jacques (2001): Signatur Ereignis Kontext in: ders.: Limited Inc, hg. von Peter Engelmann, Wien, S.15-45.
Fleischer Feldman, Carol (1991): Oral metalanguage in: Olson, David R./Torrance, Nancy (Hg.): Literacy and Orality, Cambridge/New York/Port Chester u.a., S.47-65.
Goodman, Nelson (1997): Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, Frankfurt/Main; Originaltitel: Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis 1968.
Goody, Jack/Watt, Ian (1997): Konsequenzen der Literalität in: dies./Gough, Kathleen (Hg.): Entstehung und Folgen der Schriftkultur, Frankfurt am Main, S.63-122; Originaltitel Consequences of literacy erschienen in: Goody, Jack (Hg.): Literacy in Traditional Societies, Cambridge 1968.
Goody, Jack (2000): The Power of the Written Tradition, Washington/London.
Havelock , Eric (1963): Preface to Plato, Cambridge u.a.
Havelock, Eric A. (1990): Schriftlichkeit. Das griechische Alphabet als kulturelle Revolution, Weinheim.
Jäger, Ludwig (2002): Transkriptivität. Zur medialen Logik der kulturellen Semantik in: ders. (Hg.): Transkribieren Medien, Lektüre, München, S.19-41.
Jäger, Ludwig (2004): Der Schriftmythos. Zu den Grenzen der Literalitätshypothese in: ders./Linz, Erika (Hg.): Medialität und Mentalität. Theoretische und empirische Studien zum Verhältnis von Sprache, Subjektivität und Kognition, München, S.327-345.
Jäger, Ludwig (2005a): Gedächtnis als Verfahren – zur transkriptiven Logik der Erinnerung [unveröffentlichtes Typoskript].
Jäger, Ludwig (2005b): Versuch über den Ort der Schrift. Die Geburt der Schrift aus dem Geist der Rede [unveröffentlichtes Typoskript].
Jäger, Ludwig (2005c): Störung und Transparenz. Skizze zur performativen Logik des Medialen [unveröffentlichtes Typoskript].
Krämer, Sybille (2001): Sprache, Sprechakt, Kommunikation, Frankfurt am Main.
Krämer, Sybille (2003): Erfüllen Medien eine Konstitutionsleistung? Thesen über die Rolle medientheoretischer Erwägungen beim Philosophieren in: Münker, Stefan et al.: Medienphilosophie. Beiträge zur Klärung eines Begriffs, Frankfurt/Main, S.78-90.
Lagemann, Jörg (1998): Dem Zeichen auf der Spur. Derrida – Eine Einführung, hg. von Klaus Gloy, Aachen.
Olson, David R. (1991): Literacy as metalinguistic activity in: Ders./Torrance, Nancy (Hg.): Literacy and Orality, Cambridge/New York/Port Chester u.a., S.251-270.
Ong, Walter J. (1986): Writing is a technology that restructures thought in: Baumann, Gerd (Hg.): The Written Word. Literacy in Transition (= Wolfson College Lectures 1985), Oxford, S. 23-50.
Ong, Walter J. (1987): Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes, Opladen; Originaltitel: Oralitiy and Literacy. The Technologizing of the word, London 1982.
Stetter, Christian (1997): Schrift und Sprache, Frankfurt/Main.
Stetter, Christian (2005): Medienphilosophie der Schrift in: Sanbothe, Mike & Nagl, Ludwig: Systematische Medienphilosophie, Berlin.
Vansina, Jan (1965): Oral Tradition – A Study in Historical Methodolgy, Harmondsworth/Ringwood.
Wittgenstein, Ludwig (1999): Werkausgabe Band 1. Tractatus logico-philosophicus [u.a.], Frankfurt am Main, 12. Auflage.
[...]
1 Assmann, Aleida und Jan (1990): Schrift – Kognition – Evolution. Eric A. Havelock und die Technologie kultureller Kommunikation in: Havelock, Eric A. (1990): Schriftlichkeit. Das griechische Alphabet als kulturelle Revolution, Weinheim, S. 1-35, hier: S. 3.
2 Havelock, Eric A. (1990): Schriftlichkeit. Das griechische Alphabet als kulturelle Revolution, Weinheim , S.71.
3 Assmann/Assmann (1990), S.8.
4 ebd., S.9.
5 Vgl. Ong, Walter J. (1987): Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes, Opladen, S.29.
6 Assmann, Aleida/Assmann, Jan (1992): Schrift in: Ritter, Joachim/Gründer, Karlfried (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 8: R–Sc, Basel, Sp. 1417-1429, hier: Sp.1418.
7 Havelock, Eric A. (1986): The Modern Discovery of Orality, in: The Muse Learns to Write. New Haven, S.24-25 zitiert nach: Assmann/Assmann (1990), S.5.
8 Vgl. Havelock, Eric (1963): Preface to Plato, Cambridge u.a.
9 Ong (1982), S.22.
10 Vgl. Havelock, Eric (1984): The Orality of Socrates and the literacy of Plato: With some reflections on the historical origins of Moral Philosophy in Europe in: Kelly, Eugene (Hg.): New Essays on Socrates, New York-London S.67-93, wo Havelock die Entstehung der Moralphilosophie an die Erfindung der Schrift koppelt.
11 Vgl. Goody, Jack/Watt, Ian (1997): Konsequenzen der Literalität in: dies./Gough, Kathleen (Hg.): Entstehung und Folgen der Schriftkultur, Frankfurt am Main, S.63-122, hier: S.113: „ein Hauptzug der literalen Kultur…: die Bedeutung des Individuums. (…) insgesamt … ist der Grad an Individualität persönlicher Erfahrung in nicht-literalen Kulturen geringer als in literalen.“
12 ebd. S.104: „Zunächst ist die Leichtigkeit, die alphabetische Schrift zu schreiben und zu lesen, wahrscheinlich ein bedeutsamer Faktor in der Entwicklung der politischen Demokratie in Griechenland gewesen.“
13 Christian Stetter erkennt darauf aufbauend ein „linguistisches Relativitätsprinzip“, welches besagt, dass es „von der Art und Leistungsfähigkeit der jeweiligen Schrift ab[hängt], was als linguistisches Objekt phänomenal in Erscheinung treten kann.“ Vgl. Stetter, Christian (1997): Schrift und Sprache, Frankfurt/Main, S.131.
14 Vgl. Olson, David R. (1991): Literacy as metalinguistic activity in: Ders./Torrance, Nancy (Hg.): Literacy and Orality, Cambridge/New York/Port Chester u.a., S.251-270. Diese Ansicht werden wir in Abschnitt 2.2.1 erläutern und sie in 4.2 und 4.3 einer Kritik unterziehen.
15 Vgl. Assmann, Jan (1992): Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in den frühen Hochkulturen, München, S. 87-103.
16 Olson (1991).
17 ebd., S.252.
18 ebd., S.260f.
19 Olson (1991), S.252.
20 ebd., S.253.
21 ebd., S.253 Es sei darauf hingewiesen, dass wir – wie auch im Fazit deutlich werden wird – in diesem Punkt mit Olson übereinstimmen.
22 ebd., S.254.
23 ebd., S.258.
24 Olson (1991), S.266.
25 ebd., S.259.
26 ebd.
27 ebd., S.260.
28 ebd., S.261 Diese Auffassung kommt der von Ong gleich, der konstatiert: “Writing seperates the known from the knower. It promotes objectivity.” Vgl. Ong (1986), S.37
29 Olson (1991), S.254.
30 ebd., S.265.
31 Vgl. ebd., S.260.
32 Vgl. Olson (1991), S.257f.
33 Vgl. ebd., S.254f.
34 ebd., S.267.
35 Vgl. ebd., S.255f.
36 ebd., S.267; Hervorhebung von uns.
37 ebd., S.267.
38 McLuhan, M. (1961): The Gutenberg Galaxy, Toronto, hier zitiert nach Olson (1991), S.267.
39 Assmann (1992).
40 ebd. S.48-66.
41 Wir orientieren uns hierbei auch an Assmann (1992), S.87-103.
42 ebd., S.89.
43 ebd., S.88.
44 ebd., S.96.
45 Ong spricht im Zusammenhang mit oralen Praktiken von Nicht-Literalen in literalen Kulturen von „sekundärer Oralität“. Vgl. Ong, Walter J. (1986): Writing is a technology that restructures thought in: Baumann, Gerd (Hg.): The Written Word. Literacy in Transition (= Wolfson College Lectures 1985), Oxford, S. 23-50, hier S.23f.
46 Ong (1986), S.89
47 Assmann (1992), S.54
48 ebd., S.89
49 ebd., S.55
50 Vgl. Goody, Jack/Watt, Ian (1997): Konsequenzen der Literalität in: dies./Gough, Kathleen (Hg.): Entstehung und Folgen der Schriftkultur, Frankfurt am Main, S.63-122, hier: S.71f; Originaltitel: Consequences of literacy erschienen in: Goody, Jack (Hg.): Literacy in Traditional Societies, Cambridge 1968
51 Goody, Jack (2000): The Power of the Written Tradition, Washington/London, S.31
52 Goody (2000), S.40.
53 Vgl. Assmann (1992), S.89.
54 Um Jan Assmann nicht Unrecht zu tun, müssen wir hier klarstellen, dass er sich dieser Variation bewusst ist. Er spricht aber von der Wiederholung der „Mitteilung“, der „Information“ [Assmann (1992), S.97], während Goody die Form betrachtet. Nichtsdestotrotz lassen sich Widersprüche in den Ergebnissen der beiden Autoren finden. Es handelt sich dabei um jene Widersprüche, die mit Derrida in Abschnitt 3 dieser Arbeit behandelt werden.
55 Assmann (1992), S.91.
56 ebd., S.92.
57 Vgl. Olson (1991), S.253.
58 Assmann (1992), S.92.
59 Vgl. Ong (1986), S.37.
60 Ong (1986), S.39.
61 Assmann (1992), S.91.
62 ebd.
63 ebd., S.96.
64 ebd.
65 Assmann (1992), S.97. Es sei angemerkt, daß Assmann an dieser Stelle die Variation von Sinn, nicht äußerer Form meint.
66 Vgl. Assmann (1992), S. 102.
67 Vgl. Assmann (1992), S. 102.
68 Vgl. ebd., S.91ff.
69 ebd., S.94.
70 ebd., S.192; Hervorhebung von uns.
71 ebd.
72 Assmann (1992), S.280.
73 Im übrigen betont Assmann, dass es sich nicht um „eine exklusiv griechische Errungenschaft“ [Assmann (1992), S.289] handelt, sondern auch die „Blüte der chinesischen Philosophie in der Nachfolge des Konfuzius … auf demselben Prinzip der Hypolepse“ beruht. [ebd.]
74 Assmann (1992), S.282f.
75 Assmann (1992), S.283.
76 ebd.
77 ebd.
78 ebd., S.284.
79 ebd.
80 Vgl. ebd.
81 ebd, S.285.
82 ebd., S.286.
83 Assmann (1992), S.287. Assmann knüpft hier offensichtlich an die Poppersche Wissenschaftstheorie an, die sein Bild von der abendländischen Wissenschaft und Philosophie durchaus beeinflusst zu haben scheint.
84 ebd., S.288.
85 ebd., S.287.
86 Krämer, Sybille (2003): Erfüllen Medien eine Konstitutionsleistung? Thesen über die Rolle medientheoretischer Erwägungen beim Philosophieren in: Münker, Stefan et al.: Medienphilosophie. Beiträge zur Klärung eines Begriffs, Frankfurt/Main, S.78-90, hier S.78.
87 Assmann (1992), S.286.
88 Krämer, Sybille (2001): Sprache, Sprechakt, Kommunikation, Frankfurt am Main, S. 239.
89 Wir orientieren uns bei dieser Darstellung zwar hauptsächlich an Derridas Vortrag Signatur Ereignis Kontext [Derrida, Jacques (2001): Signatur Ereignis Kontext in: ders.: Limited Inc, hg. von Peter Engelmann, Wien, S.15-45], ziehen aber auch grundlegende Stellen der Grammatologie heran [Derrida, Jacques (1974): Grammatologie, Frankfurt/Main; Originaltext: De la grammatologie, Paris 1967].
90 Derrida (1974), S.25.
91 Derrida, Jacques (1986): Positionen. Gespräche mit Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine, Guy Scarpetta, Graz/Wien, S.55f.
92 Derrida (1974), S.35.
93 Vgl. Derrida (2001), S.21.
94 Vgl. Derrida (1974), S.17.
95 Vgl. ebd., S.12.
96 Derrida (1986), S.59f Derridas „symbiotische Engführung von Logo- und Phonozentrismus“ [Jäger, Ludwig (2005b): Versuch über den Ort der Schrift. Die Geburt der Schrift aus dem Geist der Rede (unveröffentlichtes Typoskript), S.6] und deren Zuschreibung zur gesamten abendländischen Philosophie sind durchaus kritikwürdig. Derrida erarbeitet diese Verbindung stringent anhand seiner Husserl-Lektüre in Die Stimme und das Phänomen, um sie in der Grammatologie weniger nachvollziehbar auf die gesamte abendländische Philosophie zu übertragen. So scheinen z.B. die Aristoteles- und Saussure-Lektüren Derridas einseitig auf die Bestätigung dieses Theorems angelegt zu sein. Derrida unterzieht mit seiner „Saussure-Lektüre“ nur die dogmatisierte Saussure-Interpretation des Strukturalismus einer ausgiebigen Kritik, setzt sich aber z.B. mit den Notes Item gar nicht auseinander. [Vgl. Lagemann, Jörg (1998): Dem Zeichen auf der Spur. Derrida – Eine Einführung, hg. von Klaus Gloy, Aachen, S.96ff.] Jäger behauptet gar, man könne geradezu davon ausgehen, „dass es zentrale Annahmen des phonozentrischen Denkens im Übergang des 18. zum 19. Jahrhundert sind, aus denen sich die Kritik des Logozentrismus Derridascher Provenienz … herleiten ließe“.
97 Derrida (1974), S.25.
98 Derrida (1986), S.60.
99 Diese Maschinenmetapher verwendet Derrida erstmals in Derrida, Jacques (1974) Die Schrift und die Differenz, Frankfurt/Main 1972, S. 430 im Zusammenhang mit dem ‚Bricolage’-Begriff bei Lévi-Strauss. Vgl. auch Derrida (1972), S.29
100 Derrida (2001), S.19-23.
101 Vgl. ebd., S.18f.
102 Vgl. ebd., S.18.
103 ebd.
104 Ong (1986), S.39.
105 Und auch ein Vertreter des Phonozentrismus: Wenn er auch die literale Sprache für Sprünge in der kognitiven Entwicklung des Menschen verantwortlich macht, so sieht er in ihr doch nur eine Repräsentation des Gesprochenen und nicht mehr als ein Supplement dessen. Vgl. Olson (1991), S.160.
106 Vgl. Derrida (2001), S.23.
107 ebd.
108 Vgl. Derrida (1974), S.17.
109 Derrida (2001), S.21.
110 Darüber hinaus geht Condillac nach Derrida von dem „Motiv einer ökonomischen, homogenen und mechanischen Reduktion“ in der Schriftgeschichte aus, das besagt, „soviel Raum und Zeit wie nur irgend möglich durch die bequemste Abkürzung zu gewinnen.“ [Derrida (2001), S.20-21.] Demnach ist mit der Alphabetschrift die Evolution der Schrift abgeschlossen. Hier zeigt sich ähnlich wie bei Havelock wieder der Eurozentrismus, der mit der Lobpreisung der Alphabetschrift verbunden ist.
111 Vgl. Derrida (2001), S.24.
112 ebd.
113 Vgl. Krämer (2001), S.226.
114 Krämer (2001), S.226.
115 Derrida (2001), S.24.
116 So war es z.B. vor der Entdeckung des Steins von Rosette zwar nicht möglich, die Hieroglyphen – im alltagssprachlichen Sinn – zu lesen. Allerdings war durchaus klar, dass es sich bei den fraglichen Marken um Schriftzeichen handelt, wenn man auch nicht in der Lage war, sie zu übersetzen. Die Erkenntnis, dass es sich um iterierbare Marken handelt, reichte aus, um die Marken als Schrift zu klassifizieren. Wir stimmen also mit Derrida darin überein, dass Iterierbarkeit notwendige Bedingung für Schrift ist.
117 Zu den Ausdrücken ‚Symbolschema’ und ‚Symbolsystem’ vgl. Goodman, Nelson (1997): Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, Frankfurt/Main, S.128-149.
118 Derrida (2001), S.25.
119 Vgl. Derrida (2001), S.25.
120 Zu den Ausdrücken ‚Inskription’ und ‚Charakter’ vgl. Goodman (1997), S.128.
121 Derrida (2001), S.28.
122 ebd., S.29.
123 Wittgenstein, Ludwig (1999): Werkausgabe Band 1. Tractatus logico-philosophicus [u.a.], Frankfurt am Main, 12. Auflage, S.433, §199.
124 Derrida (2001), S.29.
125 Krämer (2001), S.226.
126 Derrida (2001), S.27.
127 Austin, John L. (1979): Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart; Originaltext: How to do things with words, Oxford 1962.
128 Vgl. Austin (1979), S.44.
129 Derrida (2001), S.40.
130 ebd., S.27.
131 Derrida unterstellt Austin sogar die Annahme eines „erschöpfend determinierbaren“ Kontextes, eines „totalen Kontext[es]“. [Vgl. Derrida (2001), S.34]. Diese Sichtweise finden wir nicht uneingeschränkt in Austins Text bestätigt, mit der zeichenkonstitutiven Möglichkeit des Kontextwechsels und der Aufpfropfung stimmen wir aber überein.
132 Derrida(2001), S.27.
133 ebd., S.32.
134 Zu diesem für die Dekonstruktion wesentlichen Verfahren der „Neutralisierung etablierter Begriffshierarchien“ vgl. Krämer (2001), S.219-221.
135 Derrida (2001), S.23.
136 In der Grammatologie und anderen früheren Publikationen verwendet Derrida auch Begriffe wie ‚Urschrift’, ‚Urspur’ und différance, die mit dem hier skizzierten Schriftbegriff eng verwandt sind. Im Rahmen dieser Arbeit muss eine genauere Erläuterung ausbleiben.
137 Derrida (1974), S.17.
138 Vgl. Lagemann (1998), S.122.
139 Vgl. ebd., S.124.
140 Derrida (1986), S.67.
141 Vgl. ebd.
142 Krämer (2001), S.225.
143 Nicht an alle, so er doch – wie in Fußnote 96 erläutert – gegen Derridas „symbiotische Engführung von Logo- und Phonozentrismus“ opponiert, weil „[d]ie Dekonstruktion der präsenzmetaphysischen Idee eines ‚absoluten Logos’, der sich als ‚Ausdruck reiner Intelligibiltät’ versteht, … ihre Evidenz nicht aus einer Kritik der Stimme herzuleiten“ braucht [Jäger (2005b), S.6.]
144 Jäger, Ludwig (2005c): Störung und Transparenz. Skizze zur performativen Logik des Medialen [unveröffentlichtes Typoskript], S.5.
145 ebd. S.4.
146 Jäger (2005b), S.7.
147 Vgl. ebd.
148 Mit Derrida verbindet Jäger hier eine weitere bemerkenswerte Sache, nämlich, dass seine Anwendung von Termen „aus dem Wortfeld der Skripturalität auch auf nonliterale Symbolsysteme“ „ausdrücklich intendiert“ sei. [Jäger (2002), S.30] Er verwendet also zur Bezeichnung und Erläuterung seiner quasi transzendentalen „operativen Logik“ von Zeichensystemen Ausdrücke wie „Skript“, Transkript“ etc., ähnlich der derridaschen Anwendung des Schriftbegriffs, auf die gesamte Kommunikation.
149 Jäger (2002), S.27.
150 ebd., S.29.
151 Jäger (2005b), S.4.
152 Jäger (2002), S.29.
153 ebd., S.35.
154 Vgl. ebd., S.29.
155 ebd., S.35.
156 Sollte also die Erläuterung – zugegebenermaßen – in diesem Abschnitt dunkel bleiben, so wird sich das Verständnis bei unserer Anwendung der Begriffe auf die empirische Forschung in Abschnitt 4.4 leichter einstellen.
157 Jäger (2002), S.30.
158 ebd. Uns ist nicht klar, was das Transkript vom transkriptiven Verfahren selbst unterscheidet und ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Wahrscheinlich möchte Jäger damit auf die Mannigfaltigkeit der transkriptiven Mittel verweisen, die vom Kommentar über das Zitat bis zur Paraphrase reichen, seien sie oral oder literal.
159 ebd.
160 Das Verhältnis von Prätext und Skript lässt sich gut mit Christian Stetters Medienbegriff und seinen Begriffen der „Textur“ und des „Textes“ erläutern: Wenn das Medium ein Verfahren ist und „Medium und Mediatisiertes … zusammen ein einziges Ereignis, genau eine Performanz“ bilden und die Geige nur Medium ist, „indem sie gespielt wird“ [Stetter, Christian (2005): Medienphilosophie der Schrift in: Sandbothe, Mike & Nagl, Ludwig: Systematische Medienphilosophie, Berlin, S.130], so kann man analog sagen: Skript ist der Prätext nur, indem er transkribiert wird. Gleichfalls lassen sich die von Stetter – allerdings nur auf die Skripturalität angewendeten – Begriffe der „Textur“ und des „Textes“ zur Verständlichung verwenden. [Vgl. Stetter (1998), S.294] Textur ist danach „Text vor oder nach der Bearbeitung“ [ebd.], also Prätext, „das, was geschrieben ist und gelesen wird.“ Text hingegen „ist dasjenige, was geschrieben und verstanden wird “, sprich das Skript.[ebd.]
161 Jäger (2002), S.32.
162 ebd., S.33.
163 Vgl. ebd.
164 Jäger (2002), S.27.
165 ebd., S.25.
166 Vgl. Jäger (2005c), S.7f.
167 Jäger (2005c).
168 ebd., S.6.
169 Jäger (2005c), S.9.
170 Jäger (2005c), S.9.
171 Jäger bezeichnet diesen Vorgang als ‚Monitoring’. Vgl. ebd., S.10.
172 ebd.
173 Zum Begriff der Transparenz vgl. ebd., Abschnitt 3 (S.11ff).
174 Jäger (2005c), S.9.
175 Jäger (2002), S.27.
176 ebd., S.23.
177 Jäger (2005b), S.15.
178 Jäger (2004), S.341.
179 Fleischer Feldman, Carol (1991): Oral metalanguage in: Olson, David R./Torrance, Nancy (Hg.): Literacy and Orality, Cambridge/New York/Port Chester u.a., S.47-65, hier S.57.
180 Diese Anhäufung ist eher eine Akkumulation von Texten. Das ausgelagerte Wissen muss durch Transkription im kommunikativen Gedächtnis zugänglich gemacht werden.
181 Vgl. Abschnitt 2.2.1.
182 Fleisher Feldman (1991), S.47.
183 Vgl. ebd., S.50ff.
184 Bei den Ilongot handelt es sich um eine orale Gesellschaft auf den Philippinen.
185 Vgl. Fleisher Feldman (1991), S.51.
186 Fleisher Feldman (1991), S.51.
187 Fleisher Feldman unterscheidet zwei generelle, universal gültige Sprachmodi: „first to salivate over words or seek for elegant expression, and second, to want to interpret or make meanings of utterances” [Fleisher Feldman 1991, S.52]. Diese Unterscheidung weist eine strukturelle Ähnlichkeit mit der Unterscheidung zwischen Transparenz und Störung bei Jäger auf: „‚Störung’ und ‚Transparenz’ sind … die beiden Aggregatzustände, die alle Prozesse medialer Sinn-Inszenierung durchlaufen.“ [Jäger 2005c, S.19.]
188 Vgl. Fleisher Feldman (1991), S.53ff; Es ist dies eine Untersuchung von Jane Atkinson aus dem Jahre 1984.
189 Jäger (2005b), S.13.
190 Eine Veränderung in der Struktur und auch der Komplexität von Texten, wie von Olson behauptet, lässt sich folglich nicht auf die Erfindung der Schrift zurückführen.
191 Fleisher Feldman (1991), S.54.
192 Vgl. die Erläuterung zu Mnemotechniken in Abschnitt 2.1.
193 Jäger (2005b), S.4.
194 Jäger (2005c), S.10.
195 ebd., S.6.
196 Fleisher Feldman (1991), S.55.
197 Vansina (1965).
198 Vgl. ebd., S.144.
199 ebd., S.161.
200 Vgl. Vansina (1965), S.161.
201 Vgl. Abschnitt 2.2.2.3 dieser Arbeit.
202 Bemerkenswert ist Assmanns Sicht der ‚Bricolage’ bei Lévi-Strauss im Vergleich zur Anwendung des Konzepts durch Derrida. Assmann schreibt: „Das Verfahren des Wilden Denkens, das ‚Basteln’ (bricolage), ist ein Umgang mit der Tradition, der der hypoleptischen Disziplin diametral entgegensteht. ‚Bricolage’ ist ein Hantieren mit vorgefundenen Materialien, die in der Umfunktionierung untergehen.“ [Assmann (1992), S.288] Derrida wendet eine Abwandlung dieses ‚Verfahren des Wilden Denkens’ auf die hypoleptisch organisierte abendländische Präsenzmetaphysik an, um diese – besonders auch ihren Wahrheitsbegriff – zu erschüttern. Dabei bedient er sich ausgiebig Verfahren des intertextuellen Anschlusses und vereint somit zwei nach Assmann unvereinbare Methoden – Hypolepse und ‚Wildes Denken’ – miteinander. Eine Betrachtung der Derridaschen Philosophie mit den Begriffen Assmanns dürfte erhellend sein.
203 Jäger, Ludwig (2005a): Gedächtnis als Verfahren – zur transkriptiven Logik der Erinnerung [unveröffentlichtes Typoskript], S.7.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Great-Divide-Hypothese?
Die Great-Divide-Hypothese untersucht, ob die westliche Kultur, mit ihren verschiedenen Ausprägungen wie wissenschaftliches Denken, Logik, Geschichtsbewusstsein, Religion, Technologie, Demokratie und Marktwirtschaft, aus dem Geist der Schrift, speziell der griechischen Alphabetschrift, entstanden ist.
Was sind die Rückzugsgebiete der Literalitätshypothese?
Zwei wichtige Bereiche, in denen der Unterschied zwischen literalen und oralen Gesellschaften weiterhin betont wird, sind metalinguistische Aktivitäten (die Fähigkeit, über Sprache zu reflektieren) und die Unterscheidung zwischen ritueller und textueller Kohärenz.
Was ist die sprachkonstitutive Funktion der Schrift nach Derrida?
Jacques Derrida argumentiert, dass der Schriftbegriff neu definiert werden muss. Er sieht Schrift nicht nur als Mittel zur Aufzeichnung von Sprache, sondern als ein konstituierendes Prinzip aller Zeichen. Er kritisiert den Logo- und Phonozentrismus, der der gesprochenen Sprache Vorrang einräumt und Schrift als bloße Repräsentation betrachtet.
Was bedeutet Iteration bei Derrida?
Iteration ist ein zentraler Begriff bei Derrida. Es bezeichnet die Verknüpfung von Wiederholbarkeit mit gleichzeitiger Veränderung. Ein Zeichen kann nur durch Iteration, also variierte Wiederholung, seine Identität erhalten.
Was ist Transkriptivität nach Ludwig Jäger?
Ludwig Jäger entwickelt den Begriff der Transkriptivität als eine operative Logik von Zeichensystemen. Transkriptivität beschreibt die Prozesse, durch die Bedeutung erschlossen und konstituiert wird. Er unterscheidet zwischen intramedialen (innerhalb eines Mediums) und intermedialen (zwischen Medien) Verfahren der Transkription.
Gibt es Metasprache in oralen Kulturen?
Entgegen der Auffassung, dass Metasprache nur in Schriftkulturen möglich ist, wird argumentiert, dass auch orale Kulturen über metasprachliche Praktiken verfügen. Störungen in der Kommunikation können dazu führen, dass Sprache selbst thematisiert wird und eine Reflexion über den eigenen Sprachgebrauch stattfindet.
Was ist der Unterschied zwischen Prätext, Transkript und Skript?
Diese Begriffe sind zentral für Jägers Theorie der Transkription. Der Prätext ist das zugrunde liegende symbolische System, das fokussiert und in ein Skript verwandelt wird. Das Transkript sind die symbolischen Mittel, die für eine Transkription verwendet werden. Das Skript sind die durch das Verfahren lesbar gemachten Ausschnitte des Prätextes.
Was ist rituelle Kohärenz?
Rituelle Kohärenz ist eine Form des kulturellen Gedächtnisses, die in oralen Gesellschaften vorherrscht. Sie basiert auf der Wiederholung von Mythen, Liedern, Tänzen und anderen kulturellen Ausdrucksformen. Diese Wiederholung dient dazu, das identitätssichernde Wissen in der Gruppe zu bewahren.
Was ist textuelle Kohärenz?
Textuelle Kohärenz tritt mit dem Aufkommen von Schriftkulturen in den Vordergrund. Anstelle der reinen Wiederholung ritueller Elemente rückt die Interpretation von Texten in den Mittelpunkt. Intertextueller Anschluss, also die Beziehung zwischen verschiedenen Texten, wird zum zentralen Prinzip kultureller Kohärenz.
Was ist Hypolepse?
Hypolepse ist eine Form des intertextuellen Anschlusses, die besonders in der abendländischen Wissenschaft und Philosophie anzutreffen ist. Sie bezeichnet die Bezugnahme auf Texte der Vergangenheit in der Form einer kontrollierten Variation. Notwendige Bedingungen für Hypolepse sind Schrift, ein institutioneller Rahmen und der Glaube an eine stetige Annäherung an ein Wahrheitsideal.
- Quote paper
- Adrian Pohl (Author), Felix Ostrowski (Author), 2006, Metasprache und Hypolepse in oralen und literalen Kulturen - Eine Untersuchung im Lichte der Derridaschen Schriftphilosophie und Ludwig Jägers Konzepts der Transkription, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111120