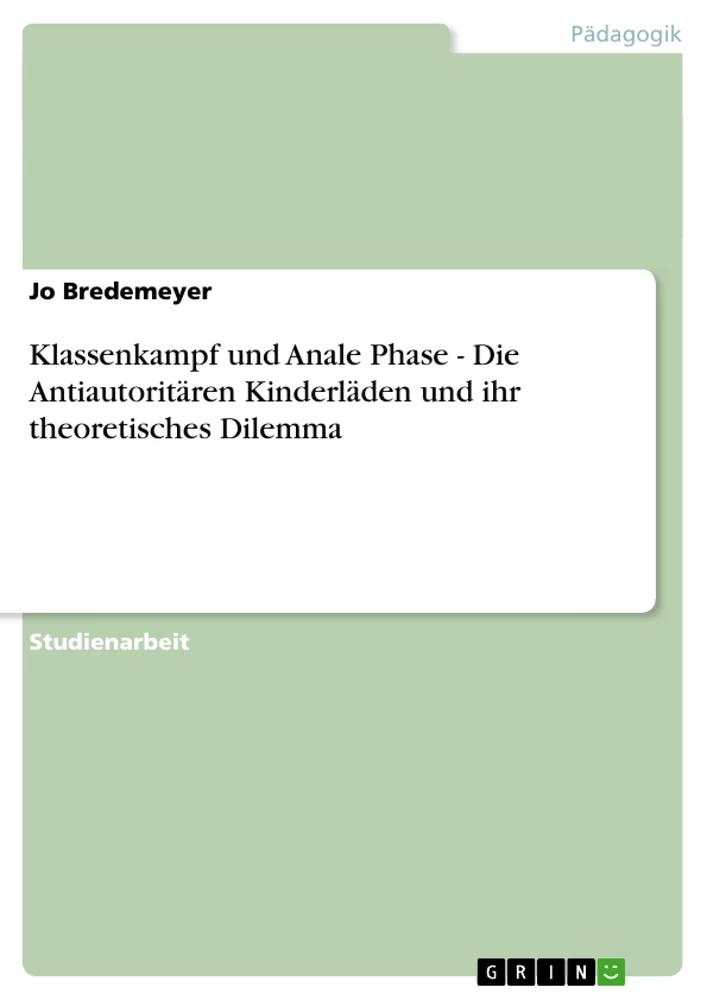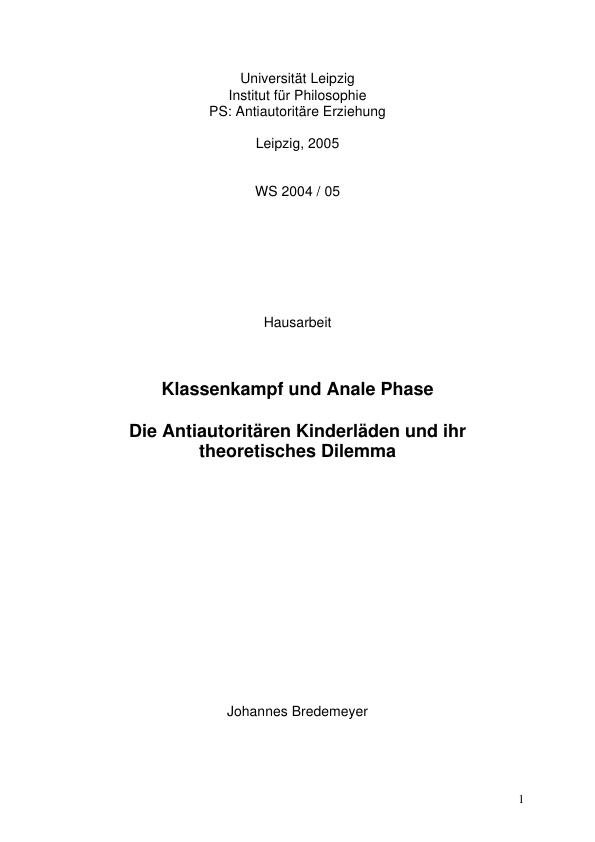Inhalt
1. Einleitung
2. Theoretische Ansätze der Kinderladen – Bewegung
2.1. Psychoanalytische Ansätze
2.1.1. Anale Phase
2.1.2. Sexualität
2.1.3. Aggressivität
2.2. Marxistische Ansätze
2.2.1. Antiautoritär vs. Revolutionär
2.2.2. Kinderläden und Antiimperialismus
3. Praktische Schwierigkeiten
3.1. Problemfaktor Psychoanalyse
3.2. Problemfaktor Marxismus
3.3. Problemfaktor Philosophie
4. Schluss
1. Einleitung
„Wir waren uns einig, dass Erziehung nur erforscht werden kann und angewandt werden sollte in Beziehung zu dieser Gesellschaft, die wir zerstören und der neuen Gesellschaft, die wir aufbauen wollen.“1
Das Entstehen der Antiautoritären Kinderladen-Bewegung in der BRD ab 1968 steht im Spannungsverhältnis verschiedener sozialer, philosophischer und politischer Komponenten.
Die Hinwendung antiautoritärer Eltern und Pädagogen zur Selbstorganisation in pädagogischer Praxis fällt in eine Zeit des Defizits im nahezu gesamten Infrastrukturbereich in Zeiten der Wachstumsstagnation in Westdeutschland (Übergang zum Postfordismus). Symptomatisch für dieses Phänomen steht die Formel vom „privaten Reichtum und öffentlicher Armut“.2 Ludwig Erhardts Primat der Ökonomie hatte dafür gesorgt, dass gesellschaftliche Sektoren, die nicht unmittelbar rentabel waren, wie der Bildungsbereich, vernachlässigt wurden. Ein dieses Problem aufgreifender Diskurs kam erst auf, als die Mängel schon unübersehbar waren.3
Die von West-Berlin ausgehende Bewegung der Antiautoritären Kinderläden ist trotz dieses unbestreitbaren sozioökonomischen Zusammenhangs, der sich etwa in der Anzahl der verfügbaren Kindergartenplätze4 ausdrückt, nicht vorwiegend als eine private Korrekturmaßnahme eines öffentlichen Infrastrukturmangels zu begreifen.
Mit dem allgemeinen Diskursdefizit5 in der BRD der 60er Jahre einhergehend kommt es in einigen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im akademischen Milieu mehr und mehr zu einem Legitimationsverlust etablierter bürgerlicher Werte:
„Durch die Kinder werden die Eltern mit ihrer eigenen Sozialisation konfrontiert; ist diese den Eltern fragwürdig geworden, zerbricht auch die Sicherheit in die Erziehung der Kinder.“6
Dieser zweite, für die vorliegende Hausarbeit entscheidende Ansatz entspringt einer tiefgreifenden intellektuellen Verunsicherung über die herrschende postfaschistische Gesellschaftsordnung, dem Nachdenken über ihre Wurzeln und ihre Legitimität.
Die sich aus diesen subjektiven Zweifeln an einer als ungerecht empfundenen Welt speisende „Linke Bewegung“, die sich Ende der 1960er Jahre um den Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) herum bildete, eröffnete für die Einzelnen ein starkes Identifikationsangebot, ebenso, wie sie nach kollektiver Aktion und praktischer Realisierung theoretischer Gesellschaftskritik verlangte.
Fällt in einer Biographie zunehmende politische Radikalisierung, die auf Demonstrationen und Kongressen als überwiegend kollektive erlebt wird, mit der gleichzeitigen Erfahrung von Elternschaft zusammen, deren Belastung weder traditionell von der Großfamilie noch fordistisch vom Staat kompensiert werden kann (Auflösungserscheinungen traditioneller Sozialisation auf der einen, „Bildungskatastrophe“ auf der anderen Seite), noch dies subjektiv überhaupt erwünscht wäre, da Familie als patriarchale „Keimzelle des Staates“, der Staat selbst überwiegend als Repressionsapparat erfahren und interpretiert wird, ergibt sich daraus ein ausreichender Handlungsdruck um das öffentlich wahrnehmbare und vieldiskutierte Projekt „Kinderläden“ entstehen zu lassen.
Neben ihrer innovativen Selbstorganisation, die für die meisten Beteiligten etwas Neues darstellte7 und ihrer konzeptionellen Radikalität mit der sie sich in Opposition zu nahezu allen bestehenden Strukturen begab (siehe Abschnitt 2.) ist es vor allem die enge politische Bindung an den SDS und die „Sozialistische Bewegung“, die die Bedeutung der Kinderladen-Bewegung „ weit über den einer Selbsthilfeorganisation im Infrastrukturbereich “8 hinausgehen ließ. So entwickelte sich der „Zentralrat der sozialistischen Kinderläden Berlin“ im Sommer 1968 aus dem „Aktionsrat zur Befreiung der Frau“, der während des vom SDS organisierten antiimperialistischen Vietnam-Kongresses vom 18.-21. Februar desselben Jahres eine kollektive Kindertagesstätte organisierte.9
Trotz aller Konflikte und Brüche zwischen den OrganisatorInnen der Kinderläden und der radikalen Linken, speziell zwischen Aktionsrat und SDS, sind beide Bewegungen schon historisch kaum voneinander zu trennen. Auf diese, für die Kinderläden teilweise fatale, Bindung werde ich in Abschnitt 2.2. näher eingehen.
Die theoretischen Grundlagen, Probleme und das letztendliche Scheitern der Kinderladen-Bewegung zu analysieren, soll Inhalt der vorliegenden Hausarbeit sein. Besondere Aufmerksamkeit soll dabei dem Versuch zukommen, praktische Arbeit aus Theorien heraus zu entwickeln, deren zwei populäre Hauptstränge, Psychoanalyse und Marxismus, ich trotz weitgehender Verknüpfung seitens der Kinderladen-TheoretikerInnen gesondert behandeln werde. Um die entsprechenden theoretischen Gebäude anschaulicher nachvollziehen zu können, habe ich auf die Verwendung des Konjunktivs weitgehend verzichtet. Dies bedeutet nicht unbedingt eine Zustimmung meinerseits.
Abschließend werde ich versuchen die Frage zu beantworten, ob das Scheitern der Kinderladen-Theorie von vornherein absehbar war.
2. Theoretische Ansätze der Kinderladen-Bewegung
Eine in sich geschlossene Kinderladen-Theorie existiert natürlich kaum, vielmehr ein Querschnitt verschiedener AutorInnen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Entscheidender Konsens für die „Kinderladen-Theorie“ ist meines Erachtens die revolutionär-pädagogische Denkrichtung.
2.1. Psychoanalytische Ansätze
„Eine bewusste massenhafte Bearbeitung der Aggressionen und Ängste, ihre Zurückführung auf ihren infantilen Kern, würde den psychischen Sprengstoff freisetzen, der diese Gesellschaft verändert.“10
Als umfassender Erklärungsansatz zum Verständnis individueller und damit auch gesellschaftlicher Probleme im fortgeschrittenen kapitalistischen Zeitalter bot sich die Psychoanalyse für progressive pädagogische Konzepte aufgrund ihres Sicherheit suggerierenden Wahrheitsanspruchs und ihrer relativen Popularität im akademischen Milieu an.
Der „Arbeitskreis Erziehung“ des Aktionsrates (später Kinderladen Charlottenburg), war die erste Gruppe, die sich ab Februar 1968 intensiv mit pädagogischer Theorie befasste, seit April ergänzt durch die Mitglieder des SDS-Projekts Kommune 2 (K2). Insbesondere die Theorien Wilhelm Reichs11 und Vera Schmidts12 wurden von der Gruppe intensiv bearbeitet, sowie die Einrichtung eines Psychoanalytischen Zentrums geplant.13
Im Vordergrund der Untersuchungen steht die Frage nach den Wurzeln bürgerlich-kapitalistischer Subjektkonditionierung und ihre Transformation in revolutionäre Sozialisation mittels wissenschaftlicher Erkenntnis, nach der Formel:
„Das Kinderkollektiv soll die psychischen Schäden des kleinfamiliären Milieus korrigieren.“14
Ausgehend von Freuds Erkenntnis über das Unterbewusstsein und seiner Theorie der menschlichen Entwicklungsphasen mit ihren jeweiligen Auswirkungen auf die Charakterbildung und die entscheidende Rolle der Triebunterdrückung im autoritären System soll im Kinderladen Psychoanalyse objektiv praktisch umgesetzt werden. Die individual-psychologische Ebene wird so direkt auf die gesellschaftlich-ökonomische übertragen: „die repressive Erziehung erklärt sich nicht nur aus dem rigiden elterlichen Über-Ich, dieses ist seinerseits nur Ausdruck der systematischen Verkrüppelung des Menschen zur Fortdauer der Herrschaft von Menschen über Menschen im Interesse des Kapitals.“15
Die Bedeutung der frühkindlichen Sozialisation erfährt so mittels Psychoanalyse eine beträchtliche Aufwertung – ihr wird nicht nur gesellschaftsverändernde, sondern sozialrevolutionäre Potenz zugesprochen. Insbesondere drei Aspekte spielen für die psychoanalytische Rezeption der Kinderladen-Theorie im Hinblick auf autoritäre oder revolutionäre Charakterformung eine entscheidende Rolle: Die anale Phase, die Sexualität, die Aggressivität.
2.1.1. Anale Phase
Insbesondere während des zweiten Lebensjahres wird nach der Freudschen Phasenlehre die kindliche Erogenität „weitgehend auf die Afterzone verschoben.“16 Die Phase ist demnach bestimmt von der „Objektliebe zum Kot“ und vom Wunsch des Kleinkinds, „seine analen Freuden durchzusetzen“17, der ihm von der bürgerlichen „Reinlichkeitsdressur“18 verwehrt wird: „Der Widerspruch zwischen Autonomiestreben des Kindes und Erwartungen der Eltern wird in unserer Kultur besonders bei der sogenannten Reinlichkeitserziehung deutlich, die die anale Phase in ihrem ganzen Ausmaß bestimmt.“ 19 Die fatale Konsequenz dieser Erziehung, in der jeglicher Widerstand des Kindes im „Kampf um die Autonomie“20 durch die Erzieher gebrochen wird und das entstehende Über-Ich die Analbedürfnisse verdrängt, ist der „Anal- oder Zwangscharakter“21, der in der bürgerlichen Gesellschaft zum vorherrschenden Typ wird.
Insbesondere im Kinderladen Charlottenburg gehen die praktischen Konsequenzen dieser Erkenntnis von fördernder Akzeptanz „analer Vorgänge“(„Die Erwachsenen müssen sich bemühen, ihre eigenen anerzogenen Ekelgefühle abzubauen und keinesfalls zu äußern.“)22 bis zu „Regressionsphasen unter therapeutischer Anleitung“, also die „abgebrochenen Interessen, Bedürfnisse und Möglichkeiten nachzuholen und befriedigend abzuschließen“.23 Es handelt sich hier also um pädagogische Verhaltenssteuerung auf Basis analytischer Theorie.
2.1.2. Sexualität
Nach Freud ist die Genitale oder Phallische Phase, die speziell das dritte Lebensjahr dominiert, entscheidend für die Entwicklung der Sexualität. Getrieben von „intensivem Wissenstrieb auf sexuellem Gebiet“24 beginnt das Kind mit Inzestphantasien zu onanieren; latenter Wunsch des Jungen in dieser Phase ist es, „von der Mutter masturbiert zu werden“ während sich die Phantasie des Mädchens auf den Vater konzentriert.
Diese höchst aktive kindliche Sexualität prallt nach antiautoritärer Auffassung in der Realität überall an die Schranken bürgerlicher Sexualmoral mit Inzest- und Onanieverbot25 als wichtigsten Einschränkungen . Konsequenz dieser Disziplinierung ist die Herausbildung eines dominanten Über-Ichs: „Eine Folge der Versagung ist die (…) vollständige Identifizierung mit dem versagenden Objekt.“26 Gerade der Zusammenhang der genitalen Verdrängungen mit denen der analen Phase sorgt für die Herausbildung eines neurotischen Zwangscharakters: Sexualität wird so mit dem tabuisierten Schmutz identifiziert, das Kind entwickelt aus der latenten Angst vor Bestrafung seiner eventuellen Genitalbetätigung einen „Panzer aus Angsreaktionen“27 (Phobien). Die Unterdrückung der kindlichen Sexualität kann so als Prototyp repressiver Persönlichkeitsformung gesehen werden, als „ Verzicht auf die Befriedigung eigener Bedürfnisse zugunsten fremder Bedürfnisse “.28
Der so konditionierte Mensch ist demnach für das herrschende System in zweierlei Hinsicht von entscheidender Bedeutung: Zum einen identifiziert er sich mit der patriarchalen Autorität, etwa in Form des Staates,29 zum anderen hat er das Bedürfnis, seine Triebunterdrückung zu entsublimieren. Dies geschieht im fortgeschrittenen Kapitalismus in Form der „ Repressiven Entsublimierung “,30 in der Sexualität nicht ausschließlich verdrängt wird, sondern einen Warencharakter annimmt. Durch Anknüpfung an verdrängte subjektive Triebansprüche (sexualisierte Werbung, etc.), wird die beim Übergang zum Postfordismus unerlässliche Konsumsteigerung errreicht, der Übergang selbst als „Befreiung“ verkauft.31
Diese Zusammenhänge in der Praxis bewusst aufzugreifen und zu überwinden war erklärtes Ziel der Antiautoritären Kinderläden. Der Anspruch war zudem, falsche Einflüsse aus dem kleinfamiliären Milieu zu kompensieren. Die Kinderläden sollten, gemäß der Forderung Wilhelm Reichs, ein „ Gegengewicht gegen den übermächtigen Druck der gesellschaftlichen Atmosphäre “32 bilden.
Demzufolge genügte etwa dem Kinderladen Charlottenburg keine einfache „Duldung“ der Sexualität, die „Bejahung“33 war entscheidend: „ Wir müssen versuchen, die sexuellen Bedürfnisse direkt anzusprechen.“34 Pädagogische Arbeit war im Sinne der Psychoanalyse auch hier in erster Linie therapeutisch darauf ausgelegt, Bildung von Neurosen zu verhindern und bestehende auszumerzen, oder wenigstens zu problematisieren, wie etwa die bereits tief verinnerlichte repressive Sexualmoral der Eltern und die daraus resultierenden kindlichen Verdrängungen.
Dementsprechend wird als Aufgabe des Kinderladens Charlottenburgs in diesem Bereich die „ Realisierung unserer Erziehungsziele “ gegen „ eine bereits errichtete Ekel- und Abwehrschranke gegen die Genitalien oder die infantile Sexualität allgemein “35 definiert.
2.1.3. Aggressivität
Nach Wilhelm Reich ist das Ziel der Aggression „stets die Ermöglichung der Befriedigung eines lebenswichtigen Bedürfnisses.“ Sie äußert sich in Destruktion „als Reaktion auf die Versagung einer lebenswichtigen Bedürfnisbefriedigung, vor allem der sexuellen.“36 Die als Konsequenz bürgerlich-autoritärer Anal- und Genitalunterdrückung auftretenden, dem Triebbedürfnis entspringenden Aggressionen, werden im nämlichen System unterbunden oder in genehme Bahnen gelenkt. So richtet sich der Hass des unterdrückten Subjekts gegen sich selbst, gegen „Feinde“ oder gesellschaftliche Randgruppen (Sadismus), ohne in der Lage zu sein, gegen seine Ursachen vorzugehen. Ähnlich dem Umgang mit analen oder genitalen Vorgängen, wird auch das direkte und bewusste Ausleben subjektiver Aggressionen ohne Verdrängung und Kompensation wiederum auf die gesellschaftspolitische Ebene übertragen: „Bleibt dieser Hass bewusst, so kann er zu einer mächtigen individuellen revolutionären Triebkraft werden; er wird der Motor der Lösung aus dem Familienverband und kann sich leicht auf die rationalen Ziele des Kampfes gegen diejenigen Zustände übertragen, die diesen Hass verursachen.“37
Dementsprechend steht für Antiautoritäre Kinderladen-Pädagogik ein offensiv befürwortender Umgang mit kindlicher Aggressivität im Vordergrund: „ Die Aggressionen der Kinder müssen so weit wie möglich ausgelebt werden, auch wenn sie sich in körperlichen Angriffen auf andere Kinder oder Erwachsene äußern.“38 Diesem politisch radikalen Ansatz, in dem Aggression nahezu als positiver Selbstzweck ausgelegt werden kann (revolutionäre Triebkraft) steht ein therapeutischer gegenüber, dem es insbesondere um erkennen und behandeln kindlicher Konflikte geht, wie etwa Probleme mit den Eltern, die sich in Aggressivität gegen andere äußern. Entsprechend dieser emphatisch-pragmatischeren Variante geht es weniger um bloßes Ausleben des Destruktionstriebes, als darum, „ die Ursache für die Aggression zu erkennen und dort andere Bedingungen zu schaffen. “39
Da Aggressivität einerseits als positiv-schöpferisch aufgefasst, andererseits der Versuch unternommen wird, ihre Ursachen zu beseitigen, ist hier seitens der Kinderladen-Theorie also eine gewisse Ambivalenz zu beobachten.40
2.2. Marxistische Ansätze
„Die Sprengkraft der Kinderladen-Bewegung liegt nicht so sehr in der Auseinandersetzung mit der Vorschulerziehung sondern im politischen Zusammenhang mit der linken Bewegung.“41
Der revolutionäre Anspruch der Antiautoritären Kinderläden ist nicht zu trennen von dem der Außerparlamentarischen Opposition (APO), deren politisches Identifikationsangebot für die Legitimation der Kinderladen-Theorie entscheidend war. Gemäß Dutschkes Proklamation, dass „ in der revolutionären Phase kein Bereich der Gesellschaft ausschließlich privilegiert “ sei, „ die Interessen der Gesamtbewegung zu repräsentieren “,42 speiste sich die Motivation der Kinderladen-Bewegung aus der anspruchsvollen Interpretation, das pädagogische Standbein der Revolution zu sein. Unterstützt wurde sie zudem von Marcuses optimistischer Randgruppentheorie,43 nach der die gesellschaftliche Umwälzung nicht unbedingt von der streikenden Arbeiterschaft ausgehen müsse, sondern von außen an diese herangetragen werden könne: „Die Kinderläden entstanden in einer Phase, als sich die politische Praxis aus der Hochschule auch auf Bereiche außerhalb verlagerte.“44
2.2.1. Antiautoritär vs. Revolutionär
Im Kontext des revolutionären antikapitalistischen Kampfes und seinem entsprechenden Handlungsdruck interpretiert, reichte für die Kinderladen-TheoretikerInnen bloße antiautoritäre (repressionsfreie) Erziehung bei weitem nicht mehr aus um der historischen Aufgabe gerecht zu werden.
Bereits mit dem Beginn des Kinderladen-Diskurses widmen sich verschiedene Autoren deshalb der politischen45, proletarischen46, oder sozialistischen47 Erziehung. Wichtigstes Moment dieser materialistischen Kritik ist die Herausarbeitung einer antiautoritären Pädagogik, die nicht in liberale Reformen integriert wird, sondern klassenkämpferischen Charakter entwickelt: „Die bürgerliche Erziehung proletarischer Kinder muss bekämpft werden durch eine Erziehung, die das proletarische Kind einreiht in den Emanzipationskampf seiner Klasse.“48
Die Kinderladen-TheoretikerInnen stellen sich mit ihrer Forderung nach Erziehung zum Klassenkampf kritisch in die Tradition sozialrevolutionärer Pädagogen wie Max Adler, der mit der Wiederentdeckung des subjektiven Faktors für die Revolution in den 1920er Jahren ähnliche Schlüsse zog: „Indem (…) offenbar wurde, wie sehr der Sozialismus außer der ökonomischen Reife seiner materiellen Bedingungen zugleich noch die subjektiv psychologische Reife des Proletariats für seine neuen Ziele vermissen ließ, wurde nun mit fast elementarer Gewalt die Frage der Erziehung in den Vordergrund gerückt.“49.
Entscheidend für ihre kritische Position zu den meisten alternativen Erziehungskonzepten der Vorkriegszeit, wie etwa A.S. Neills Summerhill -Modells, Vera Schmidts Psychoanalytischer Erziehung (s.o.), der Kinderfreundebewegung („Die deutschen Kinderfreunde erziehen keine Klassenkämpfer, sondern wirklichkeitsnahe, tatkräftige und geschickte Menschen.“50 ) oder auch Alice und Otto Rühles Klassenkampferziehung („Ist der Abbau der Autorität dringendste revolutionäre Aufgabe, so ist die anti (oder besser) unautoritäre Erziehung heute das bedeutsamste Mittel zu Lösung dieser Aufgabe.“51 ) ist deren Klassifikation als „entpolitisierende Inselpädagogik“.52 Diese sei nicht in der Lage oder willens, die Klassengesellschaft als solche anzugreifen: „Der antiautoritäre Klassenkampf sollte, als die objektiven gesellschaftlichen Bedingungen seiner Führung nicht gegeben waren, durch antiautoritäre Erziehung möglich gemacht werden.“ Zudem kaschiere sie ihren Hauptwiderspruch: „Die Kämpfer von Morgen wurden nicht auf dem Kampfplatz erzogen, sondern in der Idylle entpolitisiert.“53 In diesem Kontext steht entsprechend auch die marxistische Kritik an den Antiautoritären Kinderläden, deren theoretische und praktische Ansätze im Hinblick auf die Revolution problematisiert werden: „In diesem Verhältnis kann man zwar von Klassenkampf reden, aber nicht das Kind praktisch revolutionieren.“ Dieses geschehe ausschließlich „in der siegreichen Konfrontation der Kindermassen mit der herrschenden Klasse im Klassenkampf“54 .
Ohne in der Lage zu sein, dieses Ziel umzusetzen, laufe die gutgemeinte Kinderladen-Bewegung Gefahr, zum Instrument liberaler bürgerlicher Reformisten zu werden und damit zum Teil der Reaktion, da diese „die krassesten Folgeerscheinungen eines Nebenwiderspruchs ausmerzen und gleichzeitig den Zusammenhang mit dem Grundwiderspruch verschleiern.“55
Praktische Umsetzung einer proletarischen Erziehung, „die zum Angriff auf dieses System befähigt“ geht demzufolge über die idealistisch-humanistische Forderung nach der Ausbildung allseitiger Menschen dahingehend hinaus, dass sie diese „nur in Verbindung mit dem Sieg derjenigen Bewegung begreift, die in der Lage ist, von der Basis der Gesellschaft her soziale Herrschaft und Unterdrückung tendenziell aufzuheben.“56 Erziehung zum Klassenkampf, die das bürgerlich-antiautoritäre Dilemma überwinden will, müsse deshalb, „sexuelle und politische Tabus“ der Kinder brechen, „über die gesellschaftlichen Grundlagen der Unterdrückung“ so früh wie möglich aufklären und „kindgemäße Ansätze des Angriffs gegen diese Grundlagen“ entwickeln. Entscheidend sei die „Sozialisation im kämpfenden Kollektiv“.57
Durch die Weiterentwicklung einer solchen Strategie wird für die Kinderladen-Bewegung die „Utopie einer menschbezogenen Gesellschaft“58 realisierbar: Sie „schafft die Kinder- und Erwachsenenkollektive, die in der Lage sind, mit der Ausdehnung des sozialistischen Kampfes die gesellschaftlichen Voraussetzungen eines Zusammenlebens von freien, autonomen Menschen zu erkämpfen, auf der Grundlage sozialistischer Produktionsverhältnisse.“59
2.2.2. Kinderläden und Antiimperialismus
Im Vergleich zu oben genannten alternativ-pädagogischen Konzepten und ihrer überwiegend negativen Interpretation, tun sich für die marxistische Kinderladen-Theorie mögliche Vorbilder in den organisierten linken und antiimperialistischen Bewegungen auf. So findet ein positiver Rückbezug auf die Jugendarbeit der KPD der 1920er statt, in der freiheitliche Elemente nahezu komplett den Interessen der Bewegung untergeordnet wurden: „Nur als Glied im kommunistischen Gesamtkörper, nur als straff untergeordneter Teil der großen Armee können die Kindergruppen mitmarschieren und ihren Zweck erfüllen.“60 Für die AutorInnen erlauben die Theorien des KPD-Strategen Edwin Hoernles eine Affirmation: „Der Kinderkampf kann von Hoernle richtig als „Teilkampf im Klassenkrieg der arbeitenden Klasse“ bestimmt werden.“61
Zeitgenössische Vorbilder für die Politisierung der Kindermassen finden sich in den Liberation Schools der Black Panther Party, in denen die „Negerkinder (…) begreifen, warum ihre Väter demonstrieren und agitieren, warum sie sich aus den Fesseln der Weißen befreien wollen“62, sowie in den „nationalen Befreiungsbewegungen“ der Vietcong und der Al Fatah, in deren Trainingscamps die Kinder neben militärischem Drill die „Geschichte ihres Volkes“ und die „Bedeutung ihres Kampfes für den internationalen Klassenkampf“ gelehrt bekommen: „Die Kinder, die an den Folgen der zionistischen Eroberungskriege schwer zu leiden haben, werden jede Möglichkeit ergreifen, ihren Teil zur Befreiung von Elend und Unterdrückung beizutragen.“63
Diese praktischen Konzepte stellen für die marxistische Kinderladen-Theorie eine Möglichkeit dar, „die Illusion vom Niemandsland der unbeschwerten Kindheit“64 zu zerstören und den Antiimperialistischen Befreiungskampf entfalten zu können.
Deutlich wird hier die Instrumentalisierung von Kindern für politische Interessen. Emanzipatorische Ansätze schlagen auf diese Weise in autoritär-faschistoide Praxis um, deren erklärtes Ziel einer „Befreiung“ für die Kinder abstrakt bleiben muss.
3. Praktische Schwierigkeiten
Die Probleme, denen die Antiautoritären Kinderläden von Anfang an ausgesetzt waren resultierten unter anderem aus der negativen Reaktion der konservativen bis liberalen bundesdeutschen Öffentlichkeit, die, dominiert vom Axel-Springe-Verlag, zunehmend zur Polarisierung gegen das linke Milieu als sozialen Außenseiter65 neigte. Diese Ablehnung bestärkte den radikalen Teil der Kinderladen-Bewegung wiederum in ihrer Oppositionsrolle gegen einen gemeinsamen Feind,66 führte sie aber gesellschaftlich in die Isolation, während sich der moderate Flügel den „bürgerlichen Reformisten“ anschloss, ohne den Versuch, „sich politisch zu organisieren.“67
Mit der Auflösung des Zentralrats im Sommer 1969 zogen die Beteiligten die Konsequenz aus dieser Spaltung: Gruppen wie Rotkol (siehe A.48) gingen zur sozialistischen Stadtteilarbeit oder sogenannten K-Gruppen über, für sie waren die praktischen Forderungen an eine proletarische Erziehung seitens der Kinderläden („sozialdemokratische Handwerkelei und bloßer individualistischer Erziehungsutopismus“68 ) nicht mehr einlösbar.
Zu diesen politischen Brüchen addiert sich mit der Zeit die Enttäuschung über mangelhafte Umsetzung der Konzepte. So konstatiert ein Autor69 den GenossInnen „Disziplinlosigkeit“, unterstellt den mitarbeitenden Frauen „Insuffizienz im Hinblick auf antiautoritäre Theorie“ und den Männern, sie hätten „ein Mittel gefunden,“ die „Frauen weiterhin auf die Domäne der Kindererziehung zu beschränken.“ Er kommt zu dem Ergebnis: „Unsere Diskussionsunfähigkeit und unser mangelnder Wille, aus Kritik zu lernen bedeutet praktisch völliges Scheitern.“
Zusammenfassend liegt es nahe, das Spannungsfeld Integration – Isolation in Verbindung mit individuellen Unzulänglichkeiten anzuführen und damit die Schuld für das Scheitern der Bewegung überwiegend auf die Umstände abzuwälzen. Obwohl dieser Aspekt wichtig bleibt, darf das Dilemma der theoretischen Ansätze als eine Hauptursache des Scheiterns nicht unbeachtet bleiben.
3.1. Problemfaktor Psychoanalyse
Mit dem ernsthaften Versuch, psychoanalytsiche Erziehung praktisch umzusetzen und damit theoretische Muster auf lebendige Situationen zu übertragen, ergeben sich für die jeweiligen Pädagogen Interpretationsprobleme, da die jeweils „richtige Anwendung“70 entscheidend für die Untersuchung ist. Diese fatale Relevanz der Auslegung wird von verschiedenen Kinderladen-AutorInnen aus der Praxis reflektiert: „Je vorbelasteter er [der Protokollant] durch die Psychoanalyse ist (!) um so größer ist die Gefahr des hinein- oder überdeutens“71
Der Anspruch, anhand progressiver Literatur aufgestellte Arbeitshypothesen experimentell auf ihre Richtigkeit überprüfen zu können (Kinderladen Schöneberg),72 stößt in der praktischen Arbeit mit kleinen Kindern überall an seine Grenzen. Insbesondere im Umgang mit der kindlichen Aggressivität, die „Anlass zu heftigsten Diskussionen73 “ gab, musste auch der Kinderladen Charlottenburg einräumen: „Die chaotische Freiheit führt zu völliger Ziellosigkeit des Handelns, zu diffusen Aggressionen, für die keine Abfuhrmöglichkeit besteht.“74
Während der psychoanalytische Wahrheitsanspruch teilweise relativiert (s.o.) oder sogar als reaktionär interpretiert wird („Durch das In-Mode-Kommen der Psychoanalyse werden die Verdrängungen der neurotischen Persönlichkeit keineswegs aufgehoben, sondern wird dem Weiterverdrängen gedient.“75 ), geraten andere in Konflikt mit ihrem eigenen neurotischen Charakter und dem Anspruch, eben diesen bei den Kindern zu vermeiden. Oben genannter Autor stellt einen Widerspruch zwischen „unserer autoritären psychischen Struktur und unserem Anspruch auf antiautoritäre Erziehung“ fest.
Der Kinderladen Charlottenburg ist wiederum der Ansicht, mit diesem Antagonismus arbeiten zu können. Wichtig sei es, die Schwierigkeit der Eltern zu überwinden, „ihr eigenes Verhalten soweit unter Kontrolle zu bringen, dass sie nicht neurotisierend auf Verhaltensweisen der Kinder“ reagieren.76
Der Widerspruch des psychoanalytischen Anspruchs, objektive Regeln für subjektives Bewusstsein aus eben diesem heraus zu entwickeln trifft die an diesem Modell orientierte pädagogische Praxis mit der ganzen Destruktivität eines uneinlösbaren Versprechens. Selbstdisziplin und Selbstkontrolle verbinden sich mit der Suche nach neurotisierenden Situationen und dem permanenten Misstrauen der eigenen, eventuell reaktionären, Subjektivität gegenüber.
Auf einem solchen „psychoanalysierten“ Bewusstsein Vertrauen für gemeinsames Agieren mit kleinen Kindern aufzubauen, denen diese Gedankengänge fremd sind, erscheint auch theoretisch nahezu absurd. Mit der Uneinlösbarkeit der Psychoanalyse in der pädagogischen Praxis ergibt sich meines Erachtens außerdem ausreichend Legitimation um ihre Ambition, praktische Wissenschaft zu sein, in Zweifel zu ziehen.
3.2. Problemfaktor Marxismus
Das avantgardistische Konzept der Kinderläden, als „Gegeninstitutionen (...) zur Zertrümmerung der bestehenden repressiven Institutionen“77 zu führen, wurde ebenso wenig eingelöst, wie die „revolutionäre Erziehungsarbeit“78, deren Produkt eine Generation von Revolutionären gewesen wäre, die den „Schulkampf, die Auseinandersetzung mit autoritär erzogenen Schülern und repressiven Lehrern“79 geführt hätten. Schon der relativ pragmatische Anspruch, „von der Selbsthilfe der Linken überzugehen zur Initiierung von Selbsthilfeorganisationen in den lohnabhängigen Massen“80 erwies sich als nicht realisierbar.
Die Einsicht über das Ausbleiben der Revolution seitens der ’68er-Generation geht einher mit der Reflektion über die Widersprüchlichkeit der eigenen Bewegung einer „freischwebenden Intelligenz“81 und dem Bedürfnis, „ihre Revolte als Keimform einer gesamtgesellschaftlich revolutionären Bewegung zu sehen.“82
Das akademisch linke Milieu als Initiativgruppe der Kinderläden zeichnete sich überdies nicht nur durch elitäre, schichtenspezifische Codes aus, sondern auch durch seine „Entfernung vom Produktionsprozess“.83 Marcuses Theorie von der Produktivkraft Wissenschaft und ihrer revolutionären Potenz84 hält der materiellen Realität nicht stand: „Bildung kann wesentlicher Faktor der Aufklärung über den wahren Zustand der entfremdeten Gesellschaft sein, nicht aber eigene revolutionäre Kraft.“85
Während die Arbeiterklasse (nach Marx einziges revolutionäres Subjekt) für die Agitation der akademischen Marxisten nahezu unerreichbar blieb, zerbrachen die linken Organisationen wie Zentralrat und SDS 1969 an internen Machtkämpfen, der Unlösbarkeit der Organisationsfrage und schließlich am „ Widerspruch von antiautoritären und unter Ansätzen von revolutionärer Disziplin kämpfenden Genossen.“86
Dieses vorhersehbare Dilemma der APO überträgt sich auf das „Revolutionäre Erziehungskonzept“ der Kinderläden. Die Kinder sollen zu Klassenkämpfern erzogen werden, obwohl es keine kämpfende Klasse gibt, sondern lediglich eine identitäre, in sich gespaltene „Linke Bewegung“ mit bildungsbürgerlichem Hintergrund.
Die vielfach geforderte Sozialisation im kämpfenden Kollektiv wäre zwar auch in einer solchen Linken Szene denkbar, sofern es konkrete materielle Ziele des Kampfes gäbe. Beschränkt sich dieser jedoch auf einen abstrakten internationalen antiimperialistischen Klassenkampf kann von einem objektiven oder sogar subjektiven Interesse des Kindes keine Rede mehr sein. Ist ein solches Interesse nicht mehr der Fall, macht sich die Theorie verdächtig, Kindersoldaten im Dienst einer selbstbezogenen „Bewegung“ schaffen zu wollen.
3.3. Problemfaktor Philosophie
Das philosophische Gerüst der Kinderladen-Theorie, mit seinen Hauptpfeilern Marxismus und Psychoanalyse, lässt sich als erkenntnistheoretisches Modell mit materialistischer (klassenkämpferischer) und idealistischer (individualistisch-antiautoritärer) Strömung beschreiben. Das Ziel, jeweils kurz- oder langfristiger gefasst, ist die menschbezogene Gesellschaft, für deren Umsetzung ein Neuer Mensch87 benötigt wird, dessen Eigenschaften mal in Richtung „zur Einreihung fähiger Genosse“ (KPD), mal in Richtung „allseitiger Mensch“ (Zentralrat) tendiert.
Aufgabe der Pädagogik ist in diesem Sinne die Menschenformung nach jeweils richtigen, natürlichen, sozialistischen, wissenschaftlichen oder sonstigen Werten. Die Kinderladen-Theorie stellt sich somit in die geistige Tradition von Rousseau, Kant, Hegel, Marx, der Konzepte der preußischen Schulreformer, sowie sozialdemokratischer, kommunistischer bis hin zu faschistischer Jugendorganisationen.
Entscheidend für diese Ansätze ist die Objektivierung der Subjektbildung, mit der das Individuum zum Gegenstand der Humanwissenschaften wird, die in pädagogischen Konzepten praktisch auf dieses angewandt werden. Nach Foucault gewinnt der Mensch diese erkenntnistheoretische Schlüsselposition Ende des 18. Jahrhunderts unter anderem mit dem Aufkommen der Pädagogik. Der sich verselbstständige Diskurs wirkt dabei als Diskurs der Macht, der sich der Subjekte zunehmend bemächtigt und sich etwa in Organisationstechniken niederschlägt.88
Im Gegensatz zu ihrem antiautoritären Anspruch greift die Theorie der Kinderläden tiefer in die menschliche Subjektivität ein, als frühere Konzepte. Die Interpretation der Individuen als „neurotische Persönlichkeiten“ und ihr gleichzeitiges Bedürfnis, „revolutionäre Subjekte“ sein zu müssen, offenbart eine geistige Totalität, die Foucaults Diskurs der Macht historisch weiterführen.
4. Schluss
Die Beantwortung der Frage, ob das Scheitern der antiautoritär-revolutionären Kinderladen-Theorie vorhersehbar war, scheint im Rückblick einfach zu sein, lassen sich die revolutionären Ansätze doch zu leicht als Projektion entlarven. Bleibt die fatalistische Feststellung der Relevanz der Antiautoritären Experimente für liberale Modernisierung: Die spätkapitalistische Gesellschaft brauche „den Anstoß zu notwendigen Reformen durch eine Bewegung, die zumindest ihrem Anspruch nach revolutionär ist,“89 zu nichts anderem nütze, „um von kritischen Angehörigen der privilegierten Klasse verstanden und zu ihrem eigenen Vorteil angewandt zu werden.“90
Diese ernüchternde Erkenntnis des eigenen Scheiterns entspringt dem theoretischen Ansatz, mit der Konstitution der Kinderläden eine revolutionäre Strategie zu verfolgen, also auf ein (fragwürdiges) Ziel zuzusteuern. Die Verfehlung dieses Ziels bedeutet für alle Beteiligten entweder Frustration oder Hinwendung zu neuen Zielen (symptomatisch für das Phänomen der ´68er Generation), ohne die Tatsache in Betracht zu ziehen, dass kollektive Selbstorganisation mitnichten ein Mittel ist, sondern vielmehr Selbstzweck. Erziehung als Einwirkung eines Subjekts auf ein Objekt (Kind), ist aus Sicht der Antiautoritären Theorie zielorientiert, anstatt als selbstzweckhafte Beziehung zweier Subjekte interpretiert zu werden.
Meines Erachtens wäre es dementsprechend die Aufgabe kritischer Pädagogik, die Unterordnung menschlicher Subjektivität unter irgendwelche wie auch immer gearteten Ziele zu vermeiden und in die Richtung zu arbeiten, menschliches Leben als eigenen, gegenwärtigen Wert zu interpretieren. Selbstorganisierte Ansätze wie Kinderläden können dafür eine gute Grundlage bieten, vorausgesetzt, es findet etwas mehr Reflektion statt als zu Zeiten von Triebtheorie und Weltrevolution.
Bibliographie
Breiteneicher, Hille Jan, Mauff, Rolf, Triebe, Manfred, Autorenkollektiv Lankwitz: „Kinderläden – Revolution der Erziehung oder Erziehung zur Revolution“, Reinbek bei Hamburg, 1971
Erhardt, Johannes: „Antiautoritäre Erziehung“, Hannover, 1973
Rotes Kollektiv Proletarische Erziehung (Rotkol): „Soll Erziehung politisch sein?“, Frankfurt, 1970
Sadoun, Katia, Schmidt, Valeria, Schulz, Eberhard: „Berliner Kinderläden – Antiautoritäre Erziehung und sozialistischer Kampf“, Köln, 1970
[...]
1 Sitzung des Arbeitskreises „Erziehung“ im „Aktionsrat zur Befreiung der Frau“ aus dem der erste Charlottenburger Kinderladen hervorging, 2.4.1968. Dokumentiert in: Katia Sadoun, Valeria Schmidt, Eberhard Schulz: „Berliner Kinderläden – Antiautoritäre Erziehung und sozialistischer Kampf“, Köln, 1970, S.65
2 vgl.: Johannes Erhardt: „Antiautoritäre Erziehung“, Hannover, 1973, S.7 ff.
3 vgl. Georg Picht: „Die Deutsche Bildungskatastrophe“, Freiburg, 1964
4 Kindergartenplätze 1969 für 8% der 0-3 jährigen und 25% der 3-6 jährigen in West-Berlin (vgl.: Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.20)
5 vgl.: Erhardt: „Antiautoritäre Erziehung“, S.7 f.
6 Erhardt: „Antiautoritäre Erziehung“, S.17
7 vgl.: Erhardt: „Antiautoritäre Erziehung“, S.17
8 ebd. S.22
9 vgl.: Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.15 ff.
10 Vera Schmidt: „Psychoanalytische Erziehung in Sowjetrussland“, Berlin, 1924
11 zitiert wird v.a.: Wilhelm Reich: „Die Funktion des Orgasmus“, Köln, 1969, „Die sexuelle Revolution“, „Einbruch der Sexualmoral“, Kopenhagen, 1935
12 Schmidt: „Psychoanalytische Erziehung“
13 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.123
14 Hille Jan Breiteneicher, Rolf Mauff, Manfred Triebe, Autorenkollektiv Lankwitz: „Kinderläden – Revolution der Erziehung oder Erziehung zur Revolution“, Reinbek bei Hamburg, 1971, S.51
15 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.90
16 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.85
17 Breiteneicher, Mauff, Triebe: „Kinderläden“, S.53
18 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.85
19 ebd.
20 ebd.
21 Breiteneicher, Mauff, Triebe: „Kinderläden“, S.53
22 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.86
23 ebd., S.98
24 vgl. ebd. S.87 ff.
25 ebd. S.111
26 Wilhelm Reich, zit. ebd. S.89
27 ebd. S.90
28 Breiteneicher, Mauff, Triebe: „Kinderläden“, S.56
29 vgl. ebd. S.55
30 vgl. H. Marcuse: „Der eindimensionale Mensch“, Neuwied, 1966, S.91 ff.
31 vgl. Breiteneicher, Mauff, Triebe: „Kinderläden“, S.55 f.
32 Wilhelm Reich: „Der Einbruch der Sexualmoral“, Kopenhagen, 1935, S.6
33 vgl. Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.103
34 ebd. S.104
35 ebd.
36 Wilhelm Reich: „Die Funktion des Orgasmus, Köln, 1969, S.137
37 Wilhelm Reich: „Die sexuelle Revolution“, S.112 f.
38 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.128
39 ebd. S.100
40 zur weiteren Debatte um den Umgang mit Aggressivität, sowie Beispiele aus der pädagogischen Praxis vgl. Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.99 f., S.127 ff.
41 ebd. S.18
42 Rudi Dutschke, zit. ebd. S.44
43 Herbert Marcuse: „Ende der Utopie“, Berlin, 1967
44 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.43
45 ebd. S.132
46 ebd. S.221
47 Breiteneicher, Mauff, Triebe: „Kinderläden“, S.44
48 Rotes Kollektiv Proletarische Erziehung (Rotkol): „Soll Erziehung politisch sein?“, Frankfurt, 1970, S.7 („Das ROTE KOLLEKTIV PROLETARISCHE ERZIEHUNG versteht sich als Organisation, die in Westberlin die Überführung der bisherigen antiautoritären Erziehungsversuche in eine sozialistische Kampferziehung selbst organisieren, unterstützen und vorantreiben will.“ ebd. S.187)
49 vgl. Max Adler: „Neue Menschen“, Berlin, 1926
50 Johannes Schult: „Aufbruch einer Jugend, Bonn, 1956, S.247
51 Otto Rühle: „Der autoritäre Mensch und die Revolution“ in „Zur Psychologie des proletarischen Kindes“, Darmstadt, 1969, S.139
52 Rotkol: „Soll Erziehung politisch sein?“, S.57
53 ebd. S.13
54 ebd. S.93
55 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.23
56 ebd. S.221
57 ebd.
58 Gründungsprotokoll Kinderladen Schöneberg, ebd. S.52
59 ebd. S.221
60 Edwin Hoernle: „Das proletarische Kind. Zur Schulpolitik und Pädagogik der KPD in den Jahren der Weimarer Republik“, Berlin, 1958. zit in: Rotkol: „Soll Erziehung politisch sein?“, S.166
61 ebd. S.167
62 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.135
63 ebd. S.134
64 ebd.
65 vgl. Erhardt: „Antiautoritäre Erziehung“, S.11
66 Zu Dokumenten der Presseöffentlichkeit, sowie der Reaktion der Kinderläden vgl. Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.149 ff.
67 vgl. ebd. S.234
68 Rotkol: „Soll Erziehung politisch sein?“, S.10
69 Zwischenbilanz vom 7.9.1969, Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.54 f.
70 vgl.: Breiteneicher, Mauff, Triebe: „Kinderläden“, S.49
71 ebd.
72 Programm Kinderladen Schöneberg , vgl. Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.52
73 ebd. S.125
74 ebd. S.96
75 Breiteneicher, Mauff, Triebe: „Kinderläden“, S.49
76 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.122 f.
77 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.34
78 ebd. S.18
79 ebd. S.225
80 Zentralrats-Broschüre Nr.1, Berlin, 1969, S.6
81 Rote Presse Korrespondenz Nr.41, S.11, zit.: Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.41
82 ebd. S.42
83 Erhardt: „Antiautoritäre Erziehung“, S.11
84 vgl.: Marcuse: „Ende der Utopie“
85 Karl Marx: „Grundrisse der politischen Ökonomie“ (1857/58), in: H.E. Wittig: „Karl Marx, Bildung und Erziehung“, Paderborn, 1968, S.108
86 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.223
87 vgl.: Max Adler: „Neue Menschen“, Berlin, 1926
88 vgl.: Franz-Peter Burkard, Peter Kunzmann, Franz Wiedmann: dtv-Atlas Philosophie, 9, München 2001, S.239
89 Sadoun, Schmidt, Schulz: „Berliner Kinderläden“, S.16
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Kinderladen-Bewegung?
Der Text analysiert die theoretischen Grundlagen, Probleme und das Scheitern der antiautoritären Kinderladen-Bewegung in der BRD ab 1968. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Versuch, praktische Arbeit aus Theorien wie Psychoanalyse und Marxismus zu entwickeln.
Welche theoretischen Ansätze werden in Bezug auf die Kinderladen-Bewegung untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf psychoanalytische und marxistische Ansätze. Innerhalb der Psychoanalyse werden die anale Phase, Sexualität und Aggressivität als entscheidende Faktoren für die Charakterformung betrachtet. Im Bereich des Marxismus wird der Gegensatz zwischen antiautoritärer und revolutionärer Erziehung sowie die Verbindung der Kinderläden zum Antiimperialismus analysiert.
Welche praktischen Schwierigkeiten traten bei der Umsetzung der Kinderladen-Theorie auf?
Es gab Probleme mit der Umsetzung psychoanalytischer Erziehung, Interpretationsschwierigkeiten, den Umgang mit kindlicher Aggressivität und Widersprüche zwischen den eigenen neurotischen Charakteren der Pädagogen und dem Anspruch antiautoritärer Erziehung. Im marxistischen Bereich gab es Enttäuschungen über das Ausbleiben der Revolution, interne Machtkämpfe in linken Organisationen und die Schwierigkeit, die Arbeiterklasse zu erreichen.
Was waren die philosophischen Grundlagen der Kinderladen-Theorie?
Die Kinderladen-Theorie basierte auf einem philosophischen Gerüst aus Marxismus und Psychoanalyse, mit dem Ziel einer menschbezogenen Gesellschaft. Die Pädagogik sollte die Menschenformung nach bestimmten Werten vornehmen, was zu einer Objektivierung der Subjektbildung führte.
Was waren die Schlussfolgerungen über das Scheitern der Kinderladen-Bewegung?
Das Scheitern der Kinderladen-Theorie war vorhersehbar, da die revolutionären Ansätze als Projektion entlarvt wurden. Die Antiautoritären Experimente dienten letztendlich der liberalen Modernisierung. Die Theorie war zu stark auf ein Ziel ausgerichtet, anstatt die kollektive Selbstorganisation als Selbstzweck zu betrachten.
Welche Rolle spielte der SDS in der Kinderladen-Bewegung?
Die Kinderladen-Bewegung war eng mit dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) verbunden, der ein starkes politisches Identifikationsangebot bot. Der "Zentralrat der sozialistischen Kinderläden Berlin" entwickelte sich aus dem "Aktionsrat zur Befreiung der Frau", der während des vom SDS organisierten antiimperialistischen Vietnam-Kongresses eine kollektive Kindertagesstätte organisierte.
Welche Kritik wurde an der marxistischen Ausrichtung der Kinderläden geübt?
Kritiker bemängelten, dass die Kinderläden Gefahr liefen, zum Instrument liberaler bürgerlicher Reformisten zu werden, da sie die Klassengesellschaft nicht ausreichend angriffen. Die Erziehung zum Klassenkampf wurde als idealistisch-humanistisch kritisiert, da sie die sozialen Grundlagen der Unterdrückung nicht ausreichend aufklärte und keine kindgemäßen Ansätze des Angriffs gegen diese Grundlagen entwickelte.
Welche Rolle spielte Aggressivität in der psychoanalytischen Theorie der Kinderläden?
Aggressivität wurde einerseits als positiv-schöpferisch aufgefasst (revolutionäre Triebkraft), andererseits wurde der Versuch unternommen, ihre Ursachen zu beseitigen. Es gab eine Ambivalenz im Umgang mit Aggressivität, da einerseits ein Ausleben befürwortet wurde, andererseits die Ursachen erkannt und behandelt werden sollten.
Was waren die Einflüsse von Wilhelm Reich und Vera Schmidt auf die Kinderladen-Theorie?
Die Theorien von Wilhelm Reich und Vera Schmidt wurden intensiv von den Kinderladen-Theoretikern bearbeitet. Reich betonte die Bedeutung des Orgasmus und die sexuelle Revolution, während Schmidt die psychoanalytische Erziehung in Sowjetrussland untersuchte. Beide trugen zur Kritik an bürgerlicher Sexualmoral und repressiver Persönlichkeitsformung bei.
Was war die Bedeutung der "repressiven Entsublimierung" im Kontext der Kinderladen-Theorie?
Die "repressive Entsublimierung" beschreibt, wie Sexualität im fortgeschrittenen Kapitalismus nicht ausschließlich verdrängt wird, sondern einen Warencharakter annimmt. Durch Anknüpfung an verdrängte subjektive Triebansprüche (sexualisierte Werbung, etc.) wird die beim Übergang zum Postfordismus unerlässliche Konsumsteigerung errreicht, der Übergang selbst als „Befreiung“ verkauft.
- Quote paper
- Jo Bredemeyer (Author), 2005, Klassenkampf und Anale Phase - Die Antiautoritären Kinderläden und ihr theoretisches Dilemma, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111144