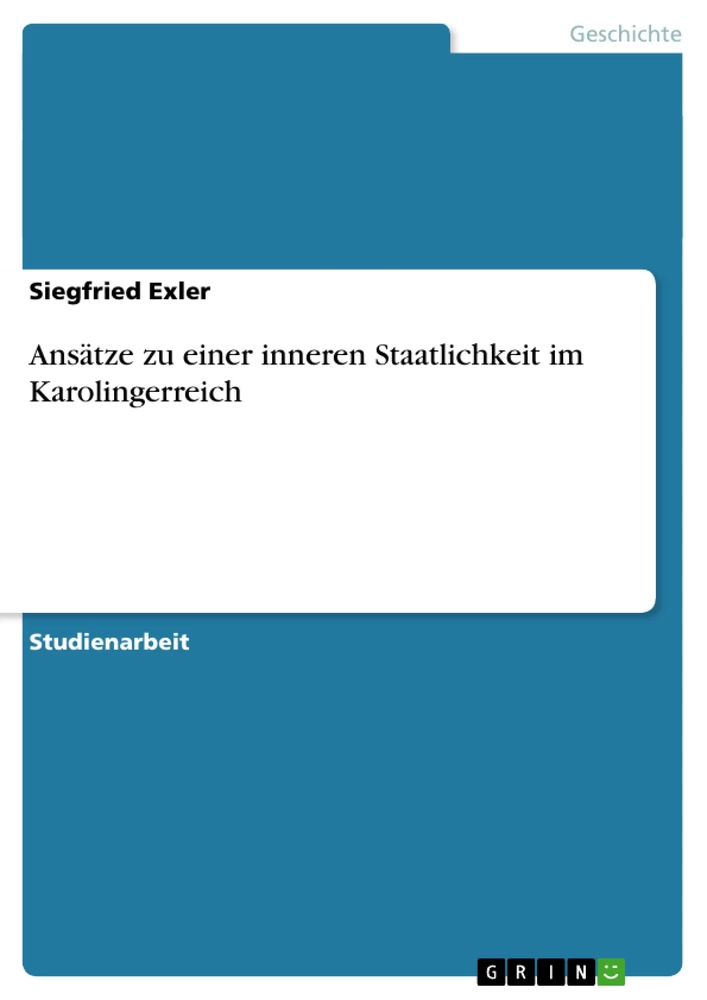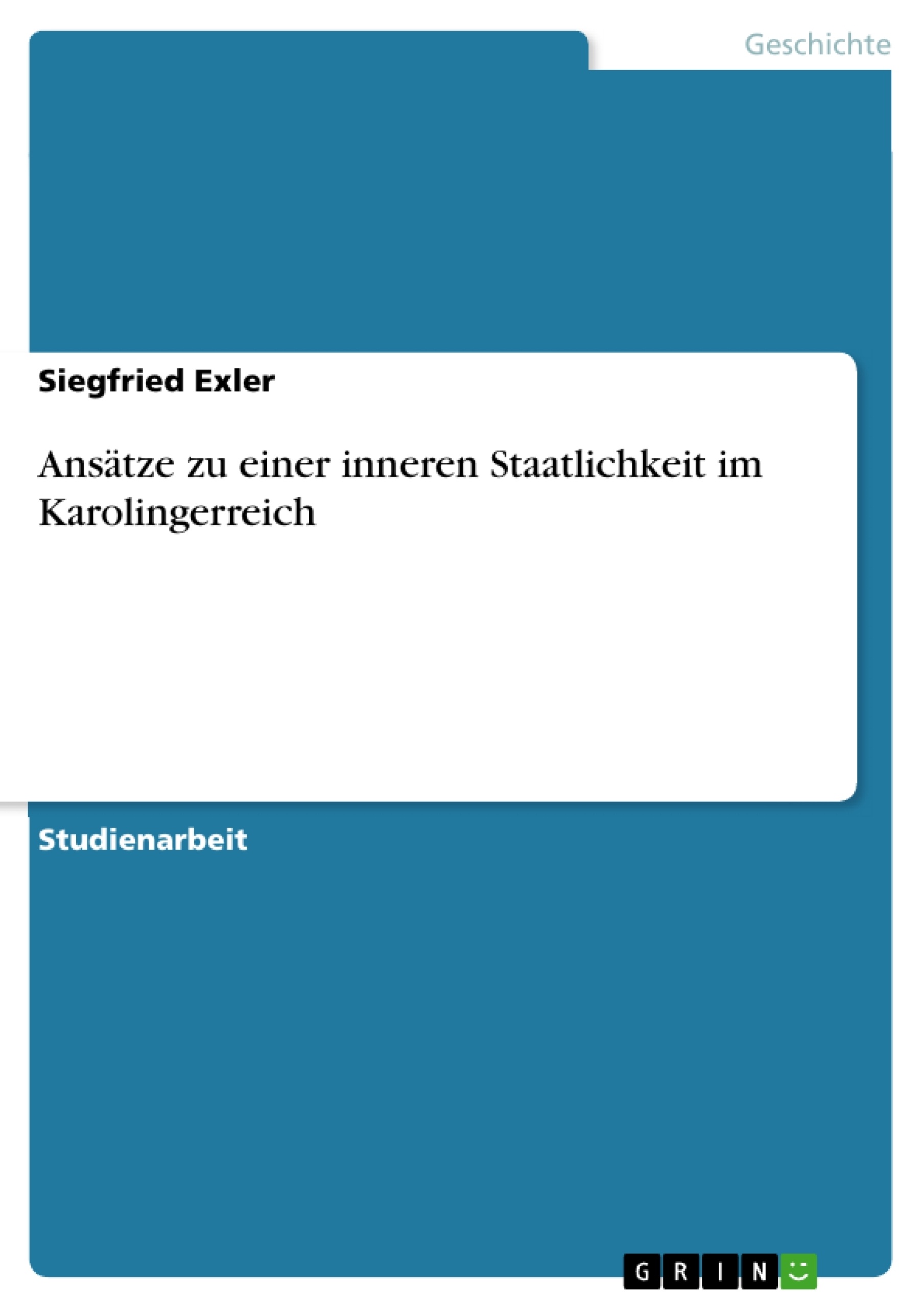Im Zuge eines engeren Zusammenrückens der Länder im heutigen europäischen Subkontinent wird gerne die Gestalt Karls des Großen als Vater eines einigen Europas beschworen. Sein Frankenreich bildete dabei nicht nur die Keimzelle des mittelalterlichen Universalkaisertums und der modernen Staaten Deutschland und Frankreich, sondern wird auch gerne als Ursprung einer zukunftsweisenden europäischen Staatlichkeit herangezogen. Nicht nur die geographische Ausdehnung des Frankenreiches und seine Einheit im römisch-katholischen Christentum sollen dies dokumentieren, sondern auch das Zusammenleben verschiedener germanischer und romanischer Völker innerhalb seiner Grenzen.
Ob dieser Vergleich des frühen Mittelalters mit den heutigen Zuständen zulässig ist, ist zu hinterfragen. Bereits der Begriff der Staatlichkeit wäre hierbei problematisch. Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist daher darzustellen, welche Elemente des Frankenreiches diesem Begriff zuzuordnen sind und wie anhaltend diese waren. Grundsätzlich finden wir hier den Gegensatz von zentraler und persönlicher Herrschaftsgestaltung durch eine machttragende Familie mit vielen auseinanderstrebenden Kräften sowie eines gottgegebenen Königtums mit historisch vorgegebenen Mitspracherechten bestimmter Volksteile.
Den Beginn macht eine Erörterung des fränkischen Königshofes, des Palatiums, als Kristallisationspunkt der königlichen Herrschaft. Im zweiten Abschnitt erfolgt eine Darstellung der Grafschaften, der wesentlichen Verwaltungsstrukturen des Karolingerreiches in ihrem Zusammenwirken sowie ihrem Gegensatz zum König. Das dritte Kapitel ist den Königsboten gewidmet, einer zeitgenössischen Einrichtung zur Kontrolle der gräflichen Verwaltung. Der vierte Abschnitt dann gilt dem Teil des fränkischen Volkes, das, wenn auch sehr begrenzten, Anteil an der Machtausübung besaß. So hatten zumindest die Wehrpflichtigen auf den Volks- oder Reichversammlungen die Möglichkeit, Einfluss auf die königlichen Beschlüsse zu nehmen. Im fünften Kapitel schließt sich daher eine Betrachtung des fränkischen Heerwesens an.
In einer abschließenden Zusammenfassung ist zu erörtern, ob dieses Frankenreich schon als Staat anzusehen ist und inwieweit seine Strukturen dauerhaft in die Zukunft hinein wirkten.
Inhaltsverzeichnis
0) Einleitung
1) Das Palatium - Die Zentrale der Königsherrschaft
2) Die Grafschaften - ein Versuch, das Riesenreich zu verwalten
3) Die Königsboten - die zentrale Kontrolle der Provinzen
4) Die Reichsversammlungen - Von der Akklamation zum Adelsrat
5) Das Heerwesen - Vom Bauernkrieger zum Reiter“soldaten“
6) Zusammenfassung
7) Zitatverweise
8) Verwendete Literatur
0) Einleitung
Im Zuge eines engeren Zusammenrückens der Länder im heutigen europäischen Subkontinent wird gerne die Gestalt Karls des Großen als Vater eines einigen Europas beschworen. Sein Frankenreich bildete dabei nicht nur die Keimzelle des mittelalterlichen Universalkaisertums und der modernen Staaten Deutschland und Frankreich, sondern wird auch gerne als Ursprung einer zukunftsweisenden europäischen Staatlichkeit herangezogen. Nicht nur die geographische Ausdehnung des Frankenreiches und seine Einheit im römisch-katholischen Christentum sollen dies dokumentieren, sondern auch das Zusammenleben verschiedener germanischer und romanischer Völker innerhalb seiner Grenzen.
Ob dieser Vergleich des frühen Mittelalters mit den heutigen Zuständen zulässig ist, ist zu hinterfragen. Bereits der Begriff der Staatlichkeit wäre hierbei problematisch. Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist daher darzustellen, welche Elemente des Frankenreiches diesem Begriff zuzuordnen sind und wie anhaltend diese waren. Grundsätzlich finden wir hier den Gegensatz von zentraler und persönlicher Herrschaftsgestaltung durch eine machttragende Familie mit vielen auseinanderstrebenden Kräften sowie eines gottgegebenen Königtums mit historisch vorgegebenen Mitspracherechten bestimmter Volksteile.
Den Beginn macht eine Erörterung des fränkischen Königshofes, des Palatiums, als Kristallisationspunkt der königlichen Herrschaft. Im zweiten Abschnitt erfolgt eine Darstellung der Grafschaften, der wesentlichen Verwaltungsstrukturen des Karolingerreiches in ihrem Zusammenwirken sowie ihrem Gegensatz zum König. Das dritte Kapitel ist den Königsboten gewidmet, einer zeitgenössischen Einrichtung zur Kontrolle der gräflichen Verwaltung. Der vierte Abschnitt dann gilt dem Teil des fränkischen Volkes, das, wenn auch sehr begrenzten, Anteil an der Machtausübung besaß. So hatten zumindest die Wehrpflichtigen auf den Volks- oder Reichversammlungen die Möglichkeit, Einfluss auf die königlichen Beschlüsse zu nehmen. Im fünften Kapitel schließt sich daher eine Betrachtung des fränkischen Heerwesens an.
In einer abschließenden Zusammenfassung ist zu erörtern, ob dieses Frankenreich schon als Staat anzusehen ist und inwieweit seine Strukturen dauerhaft in die Zukunft hinein wirkten.
1) Das Palatium - Die Zentrale der Königsherrschaft
Den Mittelpunkt der fränkischen Königsherrschaft bildete, besonders in karolingischer Zeit, der in den Quellen meist als 'palatium' bezeichnete königliche Hof mit dem Hofgericht und der Kanzlei. 1.1) Der Begriff palatium leitet sich hierbei von einem der Hügel Roms, dem ‘mons palatin‘ ab, auf dem sich in frühkaiserlicher Zeit die Paläste der Cäsaren befanden. In späteren Zeiten wurde damit nicht nur eine Reihe von abendländischen Residenzen bezeichnet, sondern auch die deutschen Fremd- und Lehnworte Palas und Palast bzw. Pfalz haben hier ihren Ursprung. 1.2)
Im Früh- und Hochmittelalter dann hatte der Begriff 'Hof' oder 'palatium' zwei unterschiedliche Bedeutungen; er konnte nämlich sowohl auf Örtlichkeiten als auch auf Personengruppen angewandt werden. Der örtliche Aspekt bezog sich hierbei einerseits auf die Gebäude die eine Pfalz bildeten, hier wurde auch von 'villa' oder 'curtis' gesprochen, andererseits auf die Gesamtheit der über das fränkische Reich verstreuten Pfalzorte, an denen jeweils 'Hof' gehalten wurde. 1.3)
Diese Pfalzen waren zugleich Versorgungsstationen, Unterkünfte und jeweilige Amtssitze für den König und seinen 'Regierungsapparat'. Hier wurden Hof- und Gerichtstage, Synoden, Reichs- und Heeresversammlungen abgehalten sowie Staatsgäste empfangen und Feste gefeiert. Der Gebäudekomplex einer typischen Pfalz bestand aus dem palas, als 'aula regia' ein herrschaftlicher Repräsentationsbau, einem Torgebäude, der Pfalzkapelle- oder Kirche sowie Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Seine Herkunft aus (königlichen) Gehöften nicht verleugnend, gehörte zur Pfalz auch der zur Versorgung nötige Gutshof. 1.4)
Bezeichnend für die fränkische Herrschaftsgestaltung, und auch noch für die-jenige der deutschen Könige im Hochmittelalter, war der Begriff des Reise-königtums. Nicht nur wegen der vielen Kriegszüge Karls, sondern auch wegen der mangelnden Kontrollmöglichkeiten der damaligen Zeit, die eine zentrale Verwal-tung erschwerten, war die Anwesenheit des Herrschers ‚vor Ort‘ in einer Reihe von Fällen geboten. Die jeweiligen Aufenthaltsorte und damit Machtzentren waren hierbei die Pfalzen. 1.5)
So richtete sich der Reiseweg, das 'itinerar', vielfach nach deren geographischer Lage, aber auch nach jener der Königshöfe und Kron-domänen, die ebenfalls aufgesucht wurden. Wichtige und oft frequentierte Pfalzen der karolingischen Zeit waren: Quierzy, Herstal, Diedenhofen, Worms, Ingelheim, Düren und Nijmwegen im altfränkischen Gebiet, sowie in den später eroberten oder erworbenen Gebieten Paderborn und Regensburg. 1.6)
Immer wichtiger und später bevorzugt benutzt wurde allerdings Aachen, wohl weil es unter anderem im Zuge der Reichsvergrößerung immer schwieriger wurde, die umfangreichen 'Realien' zu transportieren. 1.7)
Der personelle Aspekt von 'palatium' umfasste nun den Herrscher selbst mit seinem Gefolge sowie diejenigen Personen und Gruppen die, ständig oder zeitweise bei Hofe anwesend, die Reichsverwaltung ausmachten. 1.8)
Zeitweilige Mitglieder waren vor allem jene Großen des Reiches, Herzöge, Grafen und hohe Kleriker, die aus dienstlichen Gründen jeweils in der Nähe des Königs weilten. Ständig dem Hofe zugehörig dagegen war, neben den Dienstboten und dem Hofgesinde, eine besondere Gruppe von Großen, die, fest mit dem Palatium verbunden, zum engsten Kreis um den König gehörte. Sie bildete einen wesentlichen Teil des Rates, des 'consiliums', und unter ihr ragten besonders die Träger der so genannten 'Hofämter' hervor. 1.9) Diese, von den Merowingern übernommen, wurden von den Karolingern mit Modifikationen weitergeführt. Ihre Bezeichnungen deuten dabei noch auf die alte Vorstellung hin, dass das Reich wie ein großer Bauernhof verwaltet werden könnte. 1.10)
Die wichtigsten Hofämter, die auch Hinkmar von Reims in seiner Pfalzordnung erwähnt, waren: der Kämmerer, der Marschall, der Mundschenk und der Truchsess sowie der Pfalzgraf und der Kanzler. 1.11)
Der Kämmerer (camerarius), zuständig für die allgemeine Hofhaltung, trug außerdem die Verantwortung für die Schatzkammer und stellte so den königlichen Schatz- und Vermögensverwalter dar. 1.12) Seine Tätigkeit war insbesondere der Königin unterstellt: "Die innere Verwaltung des Palastes oblag [...] der Königin und dem unter ihr stehenden Kämmerer. Sie hatten vor allem dafür zu sorgen, dass die gesamte Hofhaltung der Würde und dem Glanze eines königlichen Palastes entsprach, und außerdem die jährlichen Geschenke der Vasallen aufzubewahren"
führt Hinkmar hierzu aus. 1.13)
Der Marschall (marescalcus oder comes stabuli), ursprünglich ein Pferdeknecht, war verantwortlich für den Marstall, die Rüstkammer und die Reisetätigkeit des Hofes. Unter Karl wuchsen ihm auch immer größere militärische Befugnisse bis hin zum Heerführer zu. Der Mundschenk oder Schenk (princeps oder buticularius) hatte neben anderen Aufgaben besonders die Getränkeverwaltung unter sich, und dem Truchsess oder Senneschall (senescalcus), früher der Oberaufseher des Hof-gesindes, oblag die Verpflegung des Hofes mit den weiteren Lebensmitteln. 1.14)
Diese letzteren drei Hofämter sind in einem gewissen Zusammenhang zu sehen. So erwähnt insbesondere Hinkmar in der Pfalzordnung, dass sie ihre Tätigkeiten im Sinne eines reibungslosen Ablaufs abzustimmen hätten. 1.15)
Von besonderer Bedeutung war auch noch das Amt des Pfalzgrafen (comes stabuli), der in der jeweiligen Pfalz den König während dessen Abwesenheit vertrat und dort auch die Stellung des obersten Richters innehatte. 1.16) Das Amt des Hausmeiers (major domus) führten die Karolinger nicht zuletzt aufgrund der Erfahrung des Jahres 751 allerdings nicht mehr weiter. 1.17)
Der im Laufe der Zeit immer wichtiger werdende Kanzler fällt aus dem Rahmen der anderen Hofämter heraus, denn er entstammte einer originär karolingischen Einrichtung des Palatiums, der 'Hofkapelle'. Dieser Begriff symbolisierte den geistlichen Aspekt der zweigeteilten fränkischen “Herrschaftsideologie“ und bezog sich sowohl auf den Ort des königlichen Gottesdienstes als auch auf die Gesamtheit der sich am Hofe befindlichen Kleriker. 1.18) Der Name 'Hofkapelle' gründete sich hierbei auf eine im Frankenreich besonders verehrte Reliquie, den Mantel (cappa) des heiligen Martin von Tours. Diese 'capella sancti martini' wurde auf den Reisen des Königs stets im Gefolge mitgeführt und in der jeweilig besuchten Pfalz aufbewahrt. Die Wächter dieses Kleinods waren die Kapellane, und die Leitung der gesamten Hofkapelle oblag dem obersten Kapellan, einem Bischof oder Abt, der den Titel Erzkaplan führte. 1.19)
Auch die wichtige Einrichtung der königlichen Kanzlei, in welcher die Kapitularien und andere Urkunden erstellt wurden, lag in den Händen des Personals dieser Hofkapelle. Die damit befassten Schreiber, die Notare, unterstanden einem besonderen Leiter, der unter Ludwig dem Frommen den Titel 'summus cancellarius' trug und ursprünglich dem Erzkaplan unterstellt war. Bald stieg er aber neben diesem zu einem der wichtigsten Berater des Königs auf und überragte später unter der Bezeichnung Erzkanzler alle anderen Hofämter an Bedeutung. 1.20) Weitere Angehörige der Hofkapelle waren darüber hinaus nicht nur mit Kanzleiarbeiten und ihren geistlichen Obliegenheiten, sondern auch mit weltlichen Aufgaben in Verwaltung und Diplomatie befasst. Sie erreichten damit eine Schlüsselstellung in der Reichsverwaltung, welche in der Nachfolge der Karolinger bis ins hohe Mittelalter fortwirkte. 1.21)
Nicht zu vergessen in der Rolle des Palatiums ist auch die von Karl gegründete und zeitweilig von Alkuin von York geleitete 'Hofschule', der zu großen Teilen die 'Karolingische Renaissance' zu verdanken ist und die in der Aachener Pfalz einen Teil der dortigen Hofkapelle ausmachte. 1.22)
2) Die Grafschaften - ein Versuch, das Riesenreich
zu verwalten
Das Frankenreich war noch kein staatlich organisiertes Gebilde im modernen Sinne. Da aber die Möglichkeiten des Mittelalters eine straffe und zentrale Organisation nicht erlaubten, gab es ein Problem bei der Verwaltung des Reiches mit seinen vielen Stämmen und deren eigenen Traditionen und Volksrechten. 2.1) Als nun unter Karl alte Herzogtümer, vorwiegend im östlichen Teil, mit den sie repräsentierenden Herzögen aus machtpolitischen Gründen verschwanden, mussten für den Zusammenhalt des heterogenen Gebildes neue Wege gefunden werden. So kam es zu einer neuen Provinzialaufteilung auf Grundlage der schon seit merowingischer Zeit existierenden Grafen. Diese wurden jetzt unmittelbare königliche Amtsträger mit persönlichen Bindungen zum Herrscher. 2.2) Deren Rechte und Pflichten wurden von Karl so genau festgelegt, dass Fleckenstein und andere sogar von einer 'fränkischen- bzw. karolingischen Grafschaftsverfassung' sprechen, auch wenn diese sich nie vollständig durchsetzen ließ. 2.3)
Das ideelle und rechtliche Fundament dieser Grafschaften, wie übrigens auch das des gesamten fränkischen Herrschaftssystems, war das Lehnswesen, welches auf dem Begriff der Vasallität (von kelt. gwas, mittellat. vassus = Knecht, unfreier Diener) basierte. Im Frankenreich entsprang dies aus zwei Quellen:
- dem germanischen Gefolgschaftsbegriff, der die gegenseitige Treue von Führer und Gefolgsmann erforderte. In fränkischer Zeit besaß ursprünglich nur der König das Treuemonopol, das heißt, jegliche Gefolgschaft war direkt auf ihn bezogen.
- der 'commendatio', der aus der römischen Antike stammenden Gehorsamspflicht dem Herren, dem 'Senior', gegenüber, die aber eher eine Unterwerfung als einen gegenseitigen Vertrag darstellte. 2.4)
Im Frankenreich büßte der Vasall seine Freiheit in der Regel jedoch nicht ein, sondern unterlag einem Verhältnis auf Gegenseitigkeit von 'Dienst' und 'Lehen'. Die materielle Grundlage hierbei war eben das 'Lehen', das 'benificium' oder 'feudum', das nicht nur aus Land und Einkünften, sondern auch aus öffentlichen Ämtern, Rechten und Herrschaften bestand. 2.5)
Wie schon angedeutet, war die verfassungsgeschichtliche Wurzel der Graf-schaftsverfassung ebenfalls älteren Datums und ging auf die Zeit der Merowinger zurück. In deren Reich gab es zwei unterschiedliche Rechtsprechungsbereiche, die im nordöstlichen Siedlungsgebiet von den Gauen, in den westlichen gallischen Reichsteilen von den alten römischen 'civitates' gebildet wurden. Die Literatur spricht hier von einer Pagus- bzw. einer Civitaszone. 2.6)
Die Statthalter der einzelnen Bezirke trugen in der westlich-romanischen Zone den Titel 'comes' oder 'comes civitatis', im germanisch-östlichen Bereich 'grafio' oder 'centenarius'. Außer in den noch existierenden Herzogtümern, denen in der Regel weiterhin der 'dux' vorstand, waren die Comites und Grafiones direkt dem König unterstellt und für Herrschaftsaufgaben zuständig, so im Militär-, Polizei- und Gerichtswesen. Besonders in den germanischen Gauen wurde so mit der Zeit immer mehr die alte Volks- und Adelsgerichtsbarkeit verdrängt. 2.7) Waren unter den Merowingern der Comes und der Dux noch tragende, aber auch konkurrierende Elemente der herrschaftlichen Ordnung, verschob sich dieses Verhältnis durch den Wegfall der Herzogtümer und Bildung der aus 'comitatus' und 'pagi' gebildeten Grafschaften zugunsten der 'Comites'. Sie wurden jetzt zu einer Zentralfigur der königlichen Einheitspolitik und bildeten eine neue Reichsaristokratie, die Stammesübergreifend war. 2.8)
Die Bezeichnung comes oder grafio beinhaltete bei den Karolingern aber nicht automatisch einen höheren Adelsrang. Es war grundsätzlich nur ein Amt, wobei der Graf als königlicher Beamter vom Herrscher ernannt wurde, aber ebenso wieder abgesetzt werden konnte. In der Regel bedeutete eine solche Ernennung jedoch den Eintritt in den Kreis der Großen des Reiches, selbst wenn die Rekrutierung aus niederen Kreisen der Freien erfolgte. 2.9 ) Vielfach wurden aber doch direkte Vasallen des Königs, also Adelige aus den großen fränkischen Familien mit diesem Amt betraut, und mit dem ihnen zugemessen Gebiet sowie den dazugehörigen Rechten gemäß Lehnrecht ausgestattet. Dieser aus Boden, Pflichten und Rechtstiteln bestehende Komplex bildete die Grafschaft, wobei sich, entgegen dem Amtsgedanken, schon zu Karls Zeiten Tendenzen zur Erblichkeit ausprägten. 2.10)
Das Netz der so gebildeten Grafschaften deckte sich, besonders im Osten des Reiches, nicht immer mit den 'comitatus' oder 'pagi', aus denen sie räumlich her-
hervorgegangen waren. So konnte ein Gau mehrere Grafschaften, eine Grafschaft aber auch mehrere Gaue umfassen. Daneben gab es noch Gebiete, die aus ideologischen Gründen zu keiner Grafschaft gehörten, wie fest verwurzelte Adelsherrschaften oder kirchliche Immunitätsbezirke. 2.11)
Das Amt des Grafen war Teil eines Herrschaftsinstruments, das gemäß dem Prinzip der 'Bannleihe' konzipiert war. Der Amtsträger führte seine Tätigkeit im Auftrag und in Stellvertretung des Königs aus und war diesem gegenüber voll verantwortlich. Er repräsentierte den Herrscher in allen militärischen, gerichtlichen und fiskalischen Funktionen und besaß in seinem Amtsbezirk die Gewalt über alle Menschen, ausgenommen in königlichen Immunitätsbezirken wie kirchlichen Institutionen. Als Beamter der Regionalverwaltung war er jedoch weitgehend weisungsgebunden, war berichts- und rechenschaftspflichtig, empfing seine Befehle vom König und hatte dessen Erlasse zu verkünden. 2.12)
Die Aufgaben der Grafen waren vielfältig und bezogen sich auf so gut wie alle Bereiche der damaligen Staatlichkeit. Hans K. Schulze bezeichnet sie daher auch als 'Multi-funktionäre' und führt hierzu an ihren Pflichten im Einzelnen an:
- die Abhaltung des Grafschaftsgerichts in regelmäßigen Zeitabständen,
- die generelle Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung,
- den Einzug der Abgaben für den König,
- die Unterhaltung von Befestigungen, Wegen und Brücken,
- die Beherbergung von Königsboten und Gesandtschaften,
- den Schutz von Kirche, Witwen und Waisen, aber auch
- das Aufgebot der Wehrpflichtigen, da die Grafschaft zugleich Aushebungsbezirk
war. 2.13)
In bestimmten Fällen hatten sie auch den Herrscher bei der Königs- oder Blut-gerichtsbarkeit zu vertreten, hatten den Treueid auf den König abzunehmen und darüber ein Register zu führen, sowie über alle Vorgänge genau Buch zu führen. Bei den Königsabgaben waren insbesondere die zu erhebenden Zölle von Bedeutung. 2.14)
Ein Teil dieser Zölle und anderer Abgaben sowie ein Teil der Gerichtsgelder und Geldstrafen verblieben den Grafen als notwendige Einnahmen, da sie für ihre Amtsführung selbst aufzukommen hatten.
Weitere Einnahmen erzielten sie wie andere Vasallen auch aus dem Nießbrauch ihres Lehens. 2.15)
In bestimmten problematischen Gebieten wie den Grenzmarken wurden herausgehobene Amtsträger, die Markgrafen, eingesetzt. Diese besaßen eine größere Selbständigkeit und verfügten über weit reichende eigene militärische Vollmachten. Auch gab es am Hofe eigene Gruppen von Grafen, die mit ministerialen Aufgaben betraut waren. Besonders hervorgetan hat sich hier im Laufe der Zeit der schon erwähnte 'comes palatii', der Hofpfalzgraf. 2.16)
Die Funktionsfähigkeit und damit zusammenhängend die Stabilität des Reiches hingen damit wesentlich von der Stellung des Königs und dem Interessenausgleich zwischen ihm und der (adeligen) Schicht der Grafen ab. 2.17) Da diese aufgrund ihrer Herkunft und als Vertrauensmänner des Herrschers keine reinen Verwaltungsbeamten waren, konnten sich ihre Befugnisse als auch ihre Machtfülle unterschiedlich gestalten. So konnten sie eigene Kapitularien erlassen, und in einigen Reichsteilen standen ihnen 'vicecomites' (frz. vicomte) sowie deren Untergebene zur Seite. Dies führte zum Teil zu weiterer Lehens- und Unterlehensvergabe und damit zur Ausbildung eines niederen Adels mit entsprechenden Eigenrechten. Darüber hinaus waren Macht und Autorität derart gestaltet, dass Amt und ererbte Herrschaft, wie bereits vorher angedeutet, leicht miteinander verschmolzen werden konnten. 2.18)
So brachte dieses System schließlich große Gefahren für die königliche Zentralgewalt mit sich. So wenig der König auf die Dienste der meist adeligen Amtsträger verzichten konnte und somit Rücksicht auf lokale Besitz- und Machtverhältnisse mit entsprechenden Machkonzentrationen nehmen musste, sowenig waren diese bereit, auf einmal erworbene Ansprüche zu verzichten. Unter den Karolingern erwies es sich auch als zunehmend schwieriger, verschiedene Vasallen in der Betreuung abwechseln zu lassen oder sie von Fall zu Fall einzusetzen. Ein reiner Amtsadel war damals noch nicht durchsetzbar. 2.19)
Festzustehen scheint, dass sich selbst unter Karl das Grafschaftssystem im Reich nicht vollständig durchsetzen konnte, auch wenn die Literatur den Umfang unterschiedlich beurteilt.
Es entstanden vielfach eine Reihe von Macht-schwerpunkten, die zwar in Rahmen der königlichen Zentralgewalt agierten, aber dennoch eigene Interessen verfolgten. Unter schwachen Herrschern trug dies dann mit zum Verfall des Reiches bei. Besonders deutlich wurde dies in Ostfranken, wo sich im Laufe des neunten Jahrhunderts erneut starke Stam-mesherzogtümer bilden konnten. 2.20)
3) Die Königsboten - die zentrale Kontrolle der Provinzen
Ein weiteres Mittel, die vielen auseinanderstrebenden Kräfte und Interessen im Frankenreich zusammenzuhalten und an die Person des Königs zu binden, war die Schaffung der Institution des "missus", des herrschaftlichen Boten. 3.1) Im Verlauf der Geschichte ist dies keine grundsätzlich neue Erscheinung. Man denke nur an die "Augen und Ohren des Großkönigs" im Perserreich der Achämeniden. Im Reich der Franken seit spätmerowingischer Zeit eingeführt war der Einsatz ursprünglich jedoch auf Einzelfälle (missi ad hoc) beschränkt. Auch Herzöge, Grafen und Bischöfe nutzten damals eigene Gesandte in ihrem Herrschaftsgebiet. 3.2)
In karolingischer Zeit wurde diese Einrichtung dann zentralisiert, reglementiert, mit Vollmachten des Königs ausgestattet (ex nostris nominis auctoritate) und erweiterten Funktionen versehen. Im Gegensatz zu den anderen Beauftragten wurden sie nun als missi dominici, missi fiscale, missi regale oder als missi regni, als Königsboten bezeichnet und regelmäßig jedes Jahr ausgesandt. 3.3) Als die ursprüngliche Besetzung dieses Amtes mit niedrigen Vasallen immer mehr zu Problemen führte, sei es wegen Bestechlichkeit, sei es wegen Ängsten vor den Großen (timore potentum) im bereisten Gebiet, reorganisierte Karl der Große diese Intitution im Jahre 802. 3.4)
Nun wurden Angehörige des hohen Adels berufen, ein Herzog oder ein Graf als weltlicher und ein Bischof oder ein Abt als geistlicher Vertreter der fränkischen Königsmacht, wobei als zusätzliche Neuerung beide jetzt gemeinsam die Aufgabe des missus wahrnahmen. Möglicherweise diente diese Konstellation auch der gegenseitigen Kontrolle. Der Plural missi dominici bezog sich nun auf ihr paarweises Auftreten. Auch führten die Gesandten jetzt vier Mal im Jahr (im Januar, April, Juli und Oktober) ihre Missionen durch. 3.5)
Die mit der Aufgabe eines missus befassten Personen mussten das besondere Vertrauen des Königs genießen. Im Gegensatz zu den Gaugrafen sollten sie nicht dem heimischen Adel entstammen, sondern ohne Bindung an die bereisten Provinzen sein und im jährlichen Wechsel ihre Aufgaben versehen. Ihre Berichte waren ohne Rücksicht auf verwandtschaftliche oder freundschaftliche Bindungen zu erstellen. 3.6) So war zumindest die Theorie. Da diese missi mit weit reichenden Vollmachten für alle Bereiche der Verwaltung, Wirtschaft, Recht, Abgaben- und Wehrwesen, Eigentums- Personenstands und kirchlichen Angelegenheiten ausgestattet wurden, waren sie ein zu fürchtendendes und wohl auch manchmal gefürchtetes Instrument der königlichen Kontrolle des Reiches. Ihre Vollmachten, aber auch ihre Aufträge sowie die Anweisungen, welche sie zu verkünden hatten, waren in den Kapitularien, den königlichen (später kaiserlichen) Erlassen festgelegt, welche mit dem königlichen Siegel versehen waren. Spezielle Aufgaben wie die Abnahme des Treueeides für den König wurden ihnen in besonderen 'capitularia missorum' erteilt. 3.7)
Die missi bereisten nun bei jedem Auftrag das ihnen zugeteilte Gebiet eines Bischofs oder einer Grafschaft und pflegten auf diese Weise nicht nur die Kontakte zwischen Herrscher und Vasallen, sondern kontrollierten auch deren Amtsführung, setzten königliche Anordnungen unmittelbar durch und sprachen, wo nötig, im Namen des Königs Recht. 3.8)
Als Beispiel seien hier einige Gerichtsvollmachten der missi während ihrer Mission genannt:
- der Vorsitz am Grafschaftsgericht
- die Einberufung eines außerordentlichen Geschworenengerichts
- die Rechtssprechung über alle Vertreter des Königs in dem ihnen zugewiesenen Gebiet
- die Aufhebung der gräflichen Urteilssprüche sowie Entscheidung von Berufungsfällen
- die alleinigen Urteile in Erbfolgestreitigkeiten
- bei Fällen von besonderer Bedeutung oder bei Verwicklung von Großen des Reiches (den potentes) Überweisung an das königliche Gericht. 3.9)
Im Zusammenhang mit ihren vornehmsten Aufgaben, dem Schutz der Armen und Schwachen sowie der Aufrechterhaltung von Recht und Frieden deckten sie im Rahmen ihrer Untersuchungen wohl manche Unregelmäßigkeiten auf; letztlich aber doch ohne dauerhaften Erfolg gegen die Eigenmächtigkeiten der Grafen und kirchlichen Würdenträger. Heinrich Mitteis vergleicht sie in manchen Punkten mit den späteren Reiserichtern (den judices itinerate) der englischen Könige. 3.10)
Neuere Forschungen über die 'missi dominici' ergaben nun, daß es sich bei ihnen entgegen der Idealvorstellung weitgehend doch um Würdenträger aus zumindest der Region des jeweilig visitierten gräflichen oder bischöflichen Gebietes handelte. Außerdem versahen sie hier ihr Amt in der Regel über einen längeren Zeitraum als ein Jahr. Dies führte besonders unter Ludwig dem Frommen immer mehr zu einer persönlichen Verzahnung von missi und kontrollierten Amtsträgern. 3.11) Als die Großen des Reiches dann ihre Herrschaft ausbauten, war eine objektive Arbeit nicht mehr möglich (und wohl auch nicht mehr gewollt). Im Zuge der Dezentralisierung der Herzogtümer wurden sie vielfach sesshafte Statthalter in herzoglicher Stellung. Ende des 9. Jh. verschwand die Institution daher zusehends, und im 10. Jh. tritt sie nicht mehr in Erscheinung. 3.12)
Trotzdem ist das Institut des "missus dominicus" als ein zeitgemäßer Versuch anzusehen, dem riesigen Frankenreich einen Hauch Staatlichkeit im modernen Sinne zu verleihen. In zentralistischer Manier wurde hier versucht, das Land informationsmässig zu erfassen sowie gleichartige Verwaltungsgrundsätze und gleiches Recht überall durchzusetzen. Aufgrund der damaligen mangelhaften Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten sowie der Machtverhältnisse war jedoch langfristig nur ein mäßiger Erfolg zu erzielen.
4) Die Reichsversammlungen - Von der Akklamation zum Adelsrat
Die dritte Säule, auf welcher sich die karolingische Herrschaft gründete, waren die Volks- oder Reichsversammlungen, ursprünglich auch immer zugleich Heeresversammlungen. Auf der schon diskutierten Vorstellung von Führer und Gefolgschaft basierend, hatten sie im Frankenreich seit langem eine große Bedeutung. 4.1) Besonders auf der alljährlichen großen Heeresversammlung hatte das Volk, d.h. die freien Bauernkrieger, einen gewissen Einfluss auf die Entscheidungen der Reichsführung. Ohne förmlich geregelte Mitsprache gab es hier die Möglichkeit zu politischen Abstimmungen, welche durch das 'Vollbort', den Beifall des versammelten Heervolkes zu den vorgelegten Gesetzen und Verordnungen, Ausdruck fanden. 4.2)
Diese große Zusammenkunft, in Anlehnung an den altrömischen campus martius 'Märzfeld' genannt, fand im Frühjahr statt und war gemäß altgermanischem Brauch die allgemeine Heeresversammlung der Franken und Langobarden. Ab Ende des 7. Jahrhunderts wurde ihre Wirkung auf das gesamte Reich ausgedehnt. 4.3) Unter Pippin im Jahre 775 in den Frühsommer verlegt, erhielt sie dann den Namen 'Maifeld'. Die Maßnahme fand hauptsächlich aus militärischen Gründen statt, da sich durch die bedeutende Verstärkung der Reiterei im fränkischen Heer die Zahl der Pferde entsprechend erhöht hatte. Für diese musste nun frisches Futter in genügender Menge zur Verfügung stehen. 4.4) Unter Karl erfolgte dann eine erneute Verlegung der Versammlung in den Hochsommer. Damit war gewährleist, dass die Kämpfer für die im direkten Anschluss stattfindenden Heerzüge bereits aufgeboten waren. Versammlungsorte wie Düren oder Paderborn während der Sachsenkriege unterstreichen dies deutlich. Der Name wurde jedoch beibehalten, ebenso wie die Funktion als Beratungs- und Entscheidungsgremium von König und stimmberechtigtem (Heer-) Volk. 4.5)
Eine feste Geschäftsordnung besaßen die großen Reichsversammlungen nicht, auch wenn der König immer den Vorsitz führte und Beratungen der Großen des Reiches in der Regel den Auftakt bildeten.
Die hierbei gefassten Beschlüsse wurden dann dem versammelten Volk verkündet, das seine Zustimmung durch Zusammenschlagen der Waffen kundtat. Ebenso wenig gab es einen festen Ort für die jeweiligen Zusammenkünfte. Entsprechend dem Reisekönigtum der Karolinger wechselten die Plätze meist, wobei Pfalzorte die Regel waren. Unter Karl wurde Aachen jedoch immer mehr zum bevorzugten Austragungsort. Sofern das Wetter dies gestattete, fanden die Versammlungen nach altem Brauch im Freien statt. 4.6)
Neben der Behandlung von akut anstehenden Fragen wurden auf ihnen aber auch weit reichende politische Entscheidungen getroffen. So ließ sich Pippin 751 nicht nur die Absetzung des letzten Merowingerkönigs auf dem damaligen Märzfeld bestätigen, sondern sich dort auch 'nach der Sitte der Franken' zum König wählen. 4.7) Seine Usurpation des Thrones wurde so von den abstimmungsberechtigtem Männern abgesegnet. Staatliche Symbolhandlungen, wie die Übergabe der 'dona annualia', der Königsabgaben, rundeten den Aufgabenbereich der großen Reichs- und Heeresversammlungen ab. 4.8)
Unter den Karolingern ging die Rolle der großen allgemeinen Reichsversammlungen immer mehr zurück, auch wenn das Recht aller Freien an der Teilnahme weiterhin bestand. Räumliche und zeitliche Gegebenheiten sowie die zunehmende Rolle des Hofes bei politischen Entscheidungen ließen deren Zustimmung zu einer reinen Förmlichkeit werden. Auf den Hoftagen wurde jetzt nicht mehr nur beraten und Vorlagen zur Entscheidung vorbereitet, sondern es wurden auch bereits endgültige Beschlüsse gefasst. 4.9) Die Großen des Reiches, die diese 'engeren Reichstage' beschickten, übernahmen in immer stärkerem Maße die Rolle eines Stellvertreters; der Adel repräsentierte das Volk bei seinen Entscheidungen. Deutlich wird diese Entwicklung auch darin, dass das Heeresaufgebot, ursprünglich hervorragende Aufgabe des Maifeldes, im jeweiligen gräflichen Amtsbezirk verkündet und durchgeführt wurde. 4.10) In den wirren Verhältnissen unter Ludwig dem Frommen verschwand das Maifeld dann ganz. Heeresversammlungen, die im Anschluss an 'ad hoc' einberufene Hoftage stattfanden übernahmen dessen Funktion. 4.11)
5) Das Heerwesen - Vom Bauernkrieger zum Reiter“soldaten“
Ebenso wie Grafschaft und Reichsversammlung fußte auch das fränkische Heerwesen wesentlich auf dem Prinzip von Treue und Gefolgschaft. Dies führte schon unter den Merowingern dazu, dass alle freien Männer im Alter von über 12 Jahren, und hier besonders die Franken, das Recht aber auch die Pflicht zum 'Heerbann', dem Aufgebot zum Heere besaßen und mit dem König in den Kampf ziehen mussten. 5.1) Ebenso wie das Ablegen des Treueides und die Teilnahme am Gerichtswesen entsprach diese Verpflichtung germanischer Tradition, war selbstverständlicher Teil des Lehensgedankens und führte im Laufe der Zeit zur Vorstellung eines kollektiv kämpfenden Volkes. Krieger- und Herrschaftsfunktion standen dabei gleichberechtigt nebeneinander. 5.2)
Bestand die Pflicht zum Waffendienst während der gesamten Dauer des Frankenreiches, so ver-schwand das 'Volk in Waffen' unter der Karolingern jedoch zusehends. Wie schon im Abschnitt 'Reichsversammlungen' angedeutet, wandelte sich die Struktur des Heeres seit Karl Martell von einer Masse schwerbewaffneter bäuerlicher Fußtruppen hin zu einem Reiterheer. Aufgrund des dazu notwendigen Trainings von Kämpfer und Tier sowie der teuren Ausrüstung wurden die Bauernkrieger dabei zusehends durch die schwere Kavallerie, Vorläufer der späteren Ritterheere, ergänzt und ersetzt. 5.3)
Besonders wegen der häufigen Kriegszüge Karls des Großen mit ihren zum Teil recht schnellen Ortswechseln war ein Aufgebot aller waffenfähiger Männer nicht mehr angemessen. Obwohl für den Notfall eine Art 'Landwehr' existierte, wurde nun der Reiterkampf von Gestellungsverbänden, welche die Vasallen aufzubieten hatten und die von ihnen auch kommandiert wurden, immer mehr zur Norm. 5.4) In den 'castra', 'castellae' und grenznahen 'oppida' stationierte ständige Garnisonen ergänzten diese Konstruktion. 5.5)
Der Umfang der beweglichen Verbände war von einer Mindestbesitzgröße der jeweiligen Vasallen abhängig. Da diese aber ihre Truppen nicht nur anführten sondern sie zum Teil auch ausrüsteten, nahm ihre Stellung im Lehnswesen des Frankenreiches immer mehr zu. Auch wurde versucht, die so entstehenden Machtbefugnisse über die Untergebenen zu erweitern. 5.6)
Die Wehrpflicht jedes einzelnen Freien gründete auf dessen Vermögen in der Weise, dass sich jeder, der mehr als fünf karolingische Schillinge besaß, mit Pferd, Waffenausrüstung und Verpflegung für drei Monate einzufinden hatte. Für die Kosten seiner gesamten Ausrüstung hatte er in der Regel selber aufzukommen. Bei geringerem Vermögen des einzelnen wurden Gruppen gebildet, die unter Zuzahlung einer 'Beisteuer' einen oder mehrere aus ihrer Mitte zum Heerzug entsandten. 5.7) Grundsätzlich musste sich auch hier der einzelne selbst ausrüsten, wobei die Waffen eventuell vom Lehnsherren gestellt und weitere Kosten von ihm gedeckt wurden. Darüber hinaus gab es generelle Anordnungen zur Ausrüstung mit Waffen, dem mitzuführenden Vorrat sowie der Ausrüstung des Trosses. 5.8)
Um verschieden Problemen, die bei diesem System auftraten, zu begegnen, reglementierte Karl in einem Kapitular von 802 die Wehrpflicht und machte sie vom Besitz an Grund und Boden abhängig. Jetzt hatte jeder, der vier Hufen (und mehr) sein Eigen nannte, selbst ins Feld zu ziehen. Bei geringeren Flächen wurden die Gruppen dermaßen gebildet, dass ein Gesamtbesitz von vier Hufen entstand und einer aus ihrer Mitte zum Heer entsandt wurde. 5.9)
Trotz detaillierter Regeln funktionierte das fränkische Heerwesen aber auch unter Karl nicht reibungslos. So musste der Einzug der Heeresteuer von besonderen Aufsichtsbeamten kontrolliert werden, und auch die Folge zum Aufgebot ließ zu wünschen übrig. Viele Wehrpflichtige versuchten, sich ganz oder teilweise ohne Berechtigung vom Dienst zu befreien, obwohl darauf hohe Strafen standen. So verfiel derjenige, der dem Aufruf nicht folgte, einer 'Heerbannbuße' von 60 Schillingen. Auf Desertion, der 'herisliz', stand sogar die Todesstrafe. 5.10) Die Kosten der fast jährlichen Kriegszüge Karls waren auf Dauer jedoch so hoch, dass eine Reihe von Heerpflichtigen dem zu entgehen versuchten. Sie zogen eine freiwillige Abhängigkeit in kirchlichen Diensten einer erzwungenen Unfreiheit durch Überschuldung vor, denn Kleriker waren in der Regel vom Heerdienst ausgenommen. Wohl nicht zuletzt deshalb wurden zu Beginn des 9. Jahrhunderts auch geistliche Würdenträger zur Heerfolge verpflichtet. 5.11)
6) Zusammenfassung
Die dargestellten Institutionen des Frankenreiches bieten ein doch eher heterogenes Bild karolingischer 'Staatlichkeit'. Ihre historischen Grundlagen, römische und germanische, ließen sich nur ansatzweise zusammenfügen. So verschwand die politische Mitwirkung ganzer Volksteile, ebenfalls beiden Quellen entstammend, zusehends zugunsten einer oligarchischen Konstruktion. Kristallisationspunkte waren schließlich nur noch der Herrscher mit seiner Familie sowie die römisch-katholische Kirche, wobei letztere manchen Volksteilen doch recht lange noch eher fremd blieb. Auch war eine Identifikation mit Herrscher und Reich nicht durchgehend gegeben, so wie sie für das alte römische Imperium als selbstverständlich erscheint.
Die Vorstellung Theoderichs des Großen von einer Einheit der germanischen Stämme erscheint daher rückblickend gesehen eher zukunftsweisend. So verliefen die späteren Teilungen des Frankenreiches im Großen und Ganzen entlang der Volkstumsgrenzen, obwohl sie rein formell nach dem Erbfolgerecht der fränkischen Herrscher erfolgten, und auch das heilige römische Reich des Hoch- und Spätmittelalters war, obwohl direkt auf das universale fränkische Kaisertum bezogen, von seinen grundlegenden Machtstrukturen her volkstumsmässig geprägt.
Die realen Machtmöglichkeiten des späten Frankenreiches standen so auf recht tönernen Füßen, wie seine Unfähigkeit zeigte, den Normanneneinfällen mit militärischen Mitteln zu begegnen. Der Vorstellung der Karolinger von einen universellen 'Staat' mangelte es an den dafür notwendigen Mitteln und Vorstellungen. Das Frankenreich blieb bis zum Schluss das, was es von Anfang an war: das persönliche Eigentum des Herrschers ohne wirkliche Ansätze zu moderner 'Staatlichkeit'.
7) Zitatverweise
1.1) dtv-Atlas B1, S.123; Fleckenstein, S. 79 und Schieffer, S. 91.
1.2) Proske, 51 und Fleckensten, S. 79.
1.3) Pleticha, 65; Fleckenstein, S. 80 und Schneider, 52 f.
1.4) Proske, S. 51.
1.5) Schneider, S. 52 und Schulze, S. 220.
1.6) Schulze, S. 220 f.
1.7) Paillet, S. 294.
1.8) Fleckenstein, S. 80.
1.9) Ebd., S. 80 und Schneider, S. 53.
1.10) Schneider, S. 54 f. und Schulze, S. 218.
1.11) Lautemann, S. 79 ff.
1.12) Fleckenstein, S. 81; Schneider, S. 55 und Schulze, S. 218.
1.13) Lautemann, S. 80.
1.14) Fleckenstein, S. 81; Schneider, S. 55 und Schulze, S. 218.
1.15) Schneider, S. 55 und Lautemann, S. 80 f.
1.16) Pleticha, S. 65 und Lautemann, S. 80.
1.17) Fleckenstein, S. 81 und Schneider, S. 56.
1.18) Fleckenstein, S. 83; Schneider, S. 56 und Pleticha, S. 67.
1.19) Fleckenstein, S. 83; Schneider, S. 56 und Pleticha, S. 70.
1.20) Fleckenstein, S. 84 und Schneider, S. 56
1.21) Fleckenstein, S. 82 f. und Pleticha, S. 70.
1.22) Proske, S. 52 und Schieffer, S. 92.
2.1) Pleticha, S. 54; Mitteis, S. 56 und Mühlbacher, S. 270.
2.2) Paillet, S.295; Mitteis, S. 55 und Schulze, S. 214.
2.3) Fleckenstein, S. 90 f.; Schulze, S. 214 f. und Borgolte. M: Grafschaft, Grafschaftsverfassung, in: Bautier B4, Sp. 1635.
2.4) Pleticha, S. 54; Mitteis, S. 57 f. und Mühlbacher, S. 308.
2.5) Pleticha, S. 61; Mitteis, S. 60 ff. und Mühlbacher, S. 308.
2.6) Fleckenstein, S. 89; Schneider, S. 43 und Schulze, S. 215.
2.7) Fleckenstein, S. 89f; Schneider, S. 43 und Borgolte, M.: Comes (II.
Vorkarolingische Zeit), in: Bautier B3, Sp. 72.
2.8) Pleticha, S. 55; Fleckenstein, S. 90; Schneider, S. 53 und Borgolte, M.,Comes (II.
Vorkarolingische Zeit), in: Bautier B3, Sp. 71.
2.9) Mühlbacher, S. 278.
2.10) Paillet, S.295 und Borgolte, M.:Grafschaft, Grafschaftsverfassung, in: Bautier B4, Sp. 1633.
2.11) Schneider, S. 53 und Borgolte, M., Grafschaft, Grafschaftsverfassung, in: Bautier B4, Sp. 1635.
2.12) Schneider, S. 53; Schieffer, S. 95 und Schulze, S. 216 f.
2.13) Schulze, S. 215.
2.14) Schneider, S. 54 und Mühlbacher, S. 275.
2.15) Paillet, S.295 und Mühlbacher, S. 278.
2.16) Schulze, S. 216 und Borgolte, M., Comes (II. Vorkarolingische Zeit), in: Bautier B3, Sp. 72f.
2.17) Schulze, S. 217 und Borgolte, M.,Grafschaft, Grafschaftsverfassung, in: Bautier B4, Sp. 1635.
2.18) Paillet, S.295; Fleckenstein, S. 91 und Schulze, S. 217.
2.19) Fleckenstein, S. 92.f und Schieffer, S. 95
2.20) Fleckenstein, S. 91; Schieffer, S. 95; Schulze, S. 215 und Borgolte, M., Grafschaft, Grafschaftsverfassung, in: Bautier B4, Sp. 1633.
3.1) Pleticha, S. 55; Schieffer, S. 95 und Schulze, S. 217.
3.2) Proske, S. 53 und Fleckenstein, Josef.: Missus, missicatum in: Angermann B6, Sp. 679.
3.3) Mitteis, S. 77; Mühlbacher, S. 275 und Fleckenstein, Josef.: Missus, missicatum in: Angermann B6, Sp. 679.
3.4) Schulze, S. 218; Fleckenstein, Josef.: Missus, missicatum in: Angermann B6, Sp. 679 und Hartmann, S. 59.
3.5) Schulze, S. 218; Mühlbacher, S. 275 und Fleckenstein, Josef.: Missus, missicatum in: Angermann B6, Sp. 680.
3.6) Zierer, S. 150.
3.7) Paillet, S.296 und Mühlbacher, S. 276.
3.8) Pleticha, S.55; Zierer, S. 149 f.; Paillet, S296; Schieffer, S. 95 und Schulze, S. 217 f.
3.9) Paillet, S.304 f.
3.10) Pleticha, S. 55 f. und Mitteis, S. 70 f.
3.11) Schieffer, S. 95; Mühlbacher, S. 277 und Fleckenstein, Josef.: Missus, missicatum in: Angermann B6, Sp. 680.
3.12) Mühlbacher, S. 277 f. und Fleckenstein, Josef.: Missus, missicatum in: Angermann B6, Sp. 680.
4.1) Fleckenstein, S. 75 und Schneider, S. 53.
4.2) Schieffer, S. 94 und Schulze, S. 219 f.
4.3) Paillet, S.299 und Fleckenstein, Josef.: Märzfeld in: Angermann B6, Sp. 361.
4.4) Paillet, S.299; Fleckenstein, Josef.: Märzfeld in: Angermann B6, Sp. 361 und Fleckenstein, Josef.: Maifeld in: Angermann B6, Sp. 113.
4.5) Mühlbacher, S. 261 und Fleckenstein, Josef.: Maifeld in: Angermann B6, Sp. 113.
4.6) Mühlbacher, S. 261.
4.7) Fleckenstein, S. 75.
4.8) Fleckenstein, Josef.: Maifeld in: Angermann B6, Sp. 113.
4.9) Fleckenstein, S. 85 und Mühlbacher, S. 261 f.
4.10) Fleckenstein, S. 85; Mühlbacher, S. 261 u. S. 311
4.11) Fleckenstein, Josef.: Maifeld in: Angermann B6, Sp. 113.
5.1) Paillet, S.299; Contamine, Ph.: Heer, Heerwesen (II. Frankenreich und Frankreich), in: Bautier B4, Sp. 1990f. und Hartmann, S. 70.
5.2) Paillet, S.299 und Contamine, Ph.: Heer, Heerwesen (II. Frankenreich und Frankreich), in: Bautier B4, Sp. 1990f.
5.3) Mitteis, S. 68 und Mühlbacher, S. 309.
5.4) Mitteis, S. 69 und Schieffer, S. 96.
5.5) Contamine, Ph.: Heer, Heerwesen (II. Frankenreich und Frankreich), in: Bautier B4, Sp. 1991.
5.6) Pleticha, S. 59 ff; Mühlbacher, S. 308 und Contamine, Ph.: Heer, Heerwesen (II. Frankenreich und Frankreich), in: Bautier B4, Sp. 1991.
5.7) Paillet, S.299.
5.8) Mühlbacher, S. 312 f.
5.9) Hartmann, S. 70 f.
5.10) Pleticha, S. 61; Paillet, S.299 f. und Mühlbacher, S. 314 f.
5.11) Pleticha, S. 61 und Hartmann, S. 70.
8) Verwendete Literatur
a) Quellen
Hartmann: Hartmann, Wilfried: Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellungen,
Band 1: Frühes und Hohes Mittelalter 750 - 1250, Stuttgart, 1995.
Lautemann: Lautemann, V.W. (Bearb.): Geschichte in Quellen Band II: Mittelalter, München, 1970.
b) Darstellungen
Angermann B6: Angermann, Norbert et.al. (Hg.): Lexikon des Mittelalters, Band 6,
München 1993.
Angermann B8: Angermann, Norbert et.al. (Hg.): Lexikon des Mittelalters, Band 8,
München 1997.
Bautier B3: Bautier, Robert-Henri et.al. (Hg.): Lexikon des Mittelalters, Band 3,
München 1986.
Bautier B4: Bautier, Robert-Henri et.al. (Hg.): Lexikon des Mittelalters, Band 4,
München 1989.
Fleckenstein: Fleckenstein, Josef: Grundlagen und Beginn der deutschen Geschichte,
Göttingen 1974.
dtv-Atlas B1: Kinder, Herrmann, Hilgemann, Werner: dtv-Atlas zur Weltgeschichte,
Band 1, München 61970.
Mitteis: Mitteis, Heinrich: Der Staat des hohen Mittelalters, Weimar 81968.
Mühlbacher: Mühlbacher, Engelbert: Deutsche Geschichte unter den Karolingern,
Darmstadt 1959.
Paillet: Paillet, Marc: Im Zeichen des Neumondes, Frankfurt a.M. 1998
Pleticha: Pleticha, Heinrich: Deutsche Geschichte - Vom Frankenreich zum
Deutschen Reich, Gütersloh 1993.
Proske: Proske, Rüdiger (Hg.): Die Deutsche Geschichte (2), Das Reich der Franken,
Braunschweig 1989.
Schieffer: Schieffer, Rudolf: Die Karolinger, Stuttgart-Berlin-Köln 1997.
Schneider: Schneider, Reinhard: Das Frankenreich, München 1995.
Schulze: Schulze, Hans K.: Vom Reich der Franken zum Land der Deutschen -
Merowinger und Karolinger, Berlin 1987.
Tellenbach: Tellenbach, Gerd: Vom Karolingischen Reichsadel zum deutschen
Reichsfürstenstand, in Mayer, T. (Hg.): Adel und Bauern im Staat des Mittelalters,
Darmstadt 1967
Häufig gestellte Fragen zu "Language Preview"
Was ist der Inhalt der Einleitung?
Die Einleitung stellt Karl den Großen als potentiellen "Vater Europas" vor und hinterfragt die Zulässigkeit eines Vergleichs des frühen Mittelalters mit modernen Staatsvorstellungen. Sie umreißt die zentralen Themen der Arbeit: zentrale versus persönliche Herrschaft, göttliches Königtum versus Mitspracherechte.
Was behandelt Kapitel 1 über das Palatium?
Kapitel 1 beschreibt das Palatium (den Königshof) als Zentrum der fränkischen Königsherrschaft. Es erklärt den Ursprung des Begriffs "Palatium", seine örtliche und personelle Bedeutung, die Rolle der Pfalzen als Versorgungsstationen und Amtssitze, das Reisekönigtum, und die Hofämter (Kämmerer, Marschall, Mundschenk, Truchsess, Pfalzgraf, Kanzler) sowie die Hofkapelle und Hofschule.
Was sind die Grafschaften (Kapitel 2)?
Kapitel 2 behandelt die Grafschaften als wesentliche Verwaltungsstrukturen des Karolingerreiches. Es erklärt das Lehnswesen als Grundlage der Grafschaftsverfassung, die Rolle der Grafen als königliche Amtsträger, ihre Rechte und Pflichten (Gerichtsbarkeit, Aufrechterhaltung der Ordnung, Einzug von Abgaben, Militär), die Aufgaben der Markgrafen, sowie die Gefahren der Machkonzentration für die königliche Zentralgewalt.
Was waren die Aufgaben der Königsboten (Kapitel 3)?
Kapitel 3 widmet sich den Königsboten (missi dominici) als Instrument zur zentralen Kontrolle der Provinzen. Es beschreibt ihre Ernennung, Vollmachten (Verwaltung, Wirtschaft, Recht, Abgaben, Militär, Kirche), Aufgaben (Kontrolle der gräflichen Amtsführung, Durchsetzung königlicher Anordnungen, Rechtsprechung), und den Rückgang der Institution im 9. Jahrhundert.
Welche Bedeutung hatten die Reichsversammlungen (Kapitel 4)?
Kapitel 4 behandelt die Reichsversammlungen als dritte Säule der karolingischen Herrschaft. Es beschreibt die Entwicklung vom Märzfeld zum Maifeld, die Rolle des Volkes bei der Akklamation, die zunehmende Bedeutung des Hofes bei politischen Entscheidungen, und den Rückgang der allgemeinen Reichsversammlungen.
Wie war das Heerwesen im Frankenreich organisiert (Kapitel 5)?
Kapitel 5 behandelt das Heerwesen im Frankenreich. Es beschreibt die Pflicht zum Heerbann, die Entwicklung von Bauernkriegern zu einem Reiterheer, die Rolle der Vasallen bei der Aufbietung von Truppen, die Wehrpflicht, und die Regelungen zur Ausrüstung und Verpflegung.
Was ist die Zusammenfassung (Kapitel 6)?
Die Zusammenfassung bewertet das Frankenreich als heterogenes Gebilde ohne wirkliche Ansätze zu moderner Staatlichkeit. Sie betont die Bedeutung des Herrschers und der Kirche, die fehlende Identifikation mit Reich und Herrscher und die Machtstrukturen nach Volkstumsgebieten, und die Unfähigkeit, den Normanneneinfällen zu begegnen.
Was beinhalten die Zitatverweise (Kapitel 7)?
Kapitel 7 beinhaltet die vollständige Liste aller Zitatverweise in Bezug auf die anderen Kapitel.
Welche Literatur wurde verwendet (Kapitel 8)?
Kapitel 8 listet die verwendete Literatur auf, unterteilt in Quellen und Darstellungen.
- Quote paper
- Siegfried Exler (Author), 2003, Ansätze zu einer inneren Staatlichkeit im Karolingerreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111195