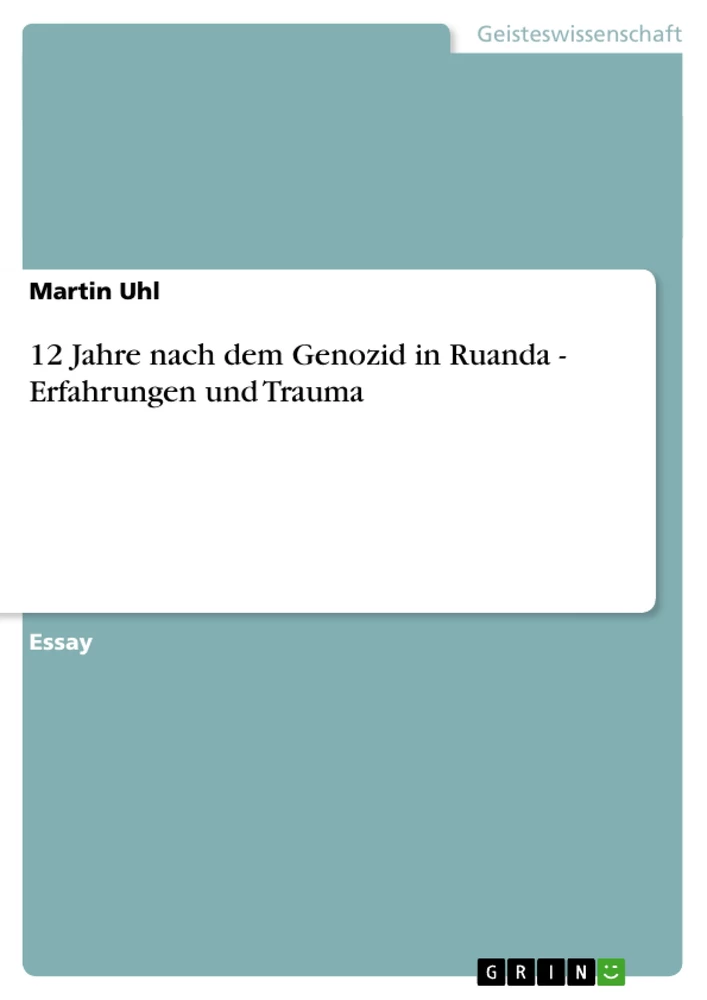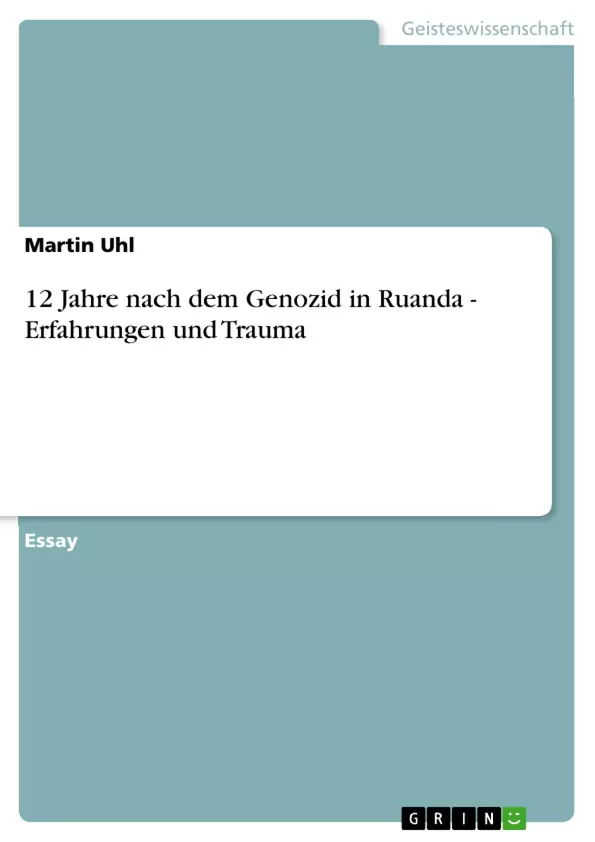Von Ende August 2006 bis Februar 2007, verbrachte ich 6 Monate in Ostafrika. Während der ersten drei Monate war ich im Rahmen eines Stipendiums, des Programms Arbeits- und Studienaufenthalte in Übersee (ASA) der Inwent GmbH, in der Stadt Butare im Süden Ruandas tätig. In erster Linie arbeitete ich dort mit dem Village Concept Project (VCP), einem Projekt von Studenten der Universität Butare, im Bereich Aidsprävention und Hygieneverbesserung mit. Später arbeitete ich für die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) im Projekt „Nahrungssicherheit und strukturelle Stabilität im Süden Ruandas“ in Gikongoro mit. Innerhalb dieser Tätigkeit erstellte ich eine Studie zur aktuellen Situation der Traumaberatung in Ruanda im Allgemeinen und im Bezirk Nyamagabe im Speziellen. Die Studie diente als Basis zum Start eines neuen Infrastrukturprojekts in Nyamagabe.
n der folgenden Hausarbeit gehe ich auf verschiedene Formen von Traumata in Ruanda ein und zeige Möglichkeiten zu deren Bewältigung auf. In diesem Prozess spielen die politischen Rahmenbedingungen eine ganz besondere Rolle, deswegen werde ich einführend die Geschichte Ruandas darstellen.
Inhalt
1. Einführung
1.1. Vorbereitung auf den Aufenthalt in Ruanda
1.2. Geschichte Ruandas
1.3. Der Genozid
2. Nach dem Genozid
2.1. Gemeinsam im gleichen Dorf
2.2. Trauma
2.3. Juristische Aufarbeitung
2.4. Tätertrauma
3. Traumastudie
3.1. Ausgangslage
3.2. Traumaberater
3.3. Vernetzung und Supervision
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
1. Einführung
Von Ende August 2006 bis Februar 2007, verbrachte ich 6 Monate in Ostafrika. Während der ersten drei Monate war ich im Rahmen eines Stipendiums, des Programms Arbeits- und Studienaufenthalte in Übersee (ASA) der Inwent GmbH, in der Stadt Butare im Süden Ruandas tätig. In erster Linie arbeitete ich dort mit dem Village Concept Project (VCP), einem Projekt von Studenten der Universität Butare, im Bereich Aidsprävention und Hygieneverbesserung mit. Später arbeitete ich für die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) im Projekt „Nahrungssicherheit und strukturelle Stabilität im Süden Ruandas“ in Gikongoro mit. Innerhalb dieser Tätigkeit erstellte ich eine Studie zur aktuellen Situation der Traumaberatung in Ruanda im Allgemeinen und im Bezirk Nyamagabe im Speziellen. Die Studie diente als Basis zum Start eines neuen Infrastrukturprojekts in Nyamagabe.
In der folgenden Hausarbeit gehe ich auf verschiedene Formen von Traumata in Ruanda ein und zeige Möglichkeiten zu deren Bewältigung auf. In diesem Prozess spielen die politischen Rahmenbedingungen eine ganz besondere Rolle, deswegen werde ich einführend die Geschichte Ruandas darstellen.
1.1. Vorbereitung auf den Aufenthalt in Ruanda
Von Seiten des ASA-Programms wurde ich durch zwei einwöchige Seminare auf meine Aufgabe in Ruanda vorbereitet. Dort hatte ich unter anderem Gelegenheit ins persönliche Gespräch mit einem in Deutschland lebenden Überlebenden des Genozids und einem Mitarbeiter der ruandischen Botschaft zu kommen. Besonders interessant war dabei die unterschiedliche Wahrnehmung der aktuellen Lage in Ruanda. War es für den Flüchtling, aufgrund traumatischer Erfahrungen während des Genozids, nicht vorstellbar wieder dorthin zurückzukehren, zeichnete der Diplomat das Bild eines sicheren, friedlichen und touristisch interessanten Landes.
Durch die, seit 1982 bestehende Partnerschaft mit Ruanda gibt es in Rheinland-Pfalz zahlreiche persönliche Kontakte zu diesem Land. Das Ziel der Partnerschaft ist ein von Basisorganisationen (z.B. Schulen, Gemeinden, Kreisen) getragener kultureller Austausch und finanzielle Unterstützung bei verschiedenen Projekten. Mit einigen Aktiven dieser Initiative konnte ich mich treffen und über Ruanda informieren. In Zusammenhang mit der Partnerschaft wird die Zeitschrift Ruanda-Revue herausgegeben, die mir weitere gute Anhaltspunkte zur aktuellen Lage gegeben hat.
Um mich speziell auf das Thema Genozid vorzubereiten las ich das Buch „Shake hands with the devil“ von Romeo Daillare und sah die Filme: „Hotel Ruanda“, „Somedays in April“ und „Shooting dogs“. Zusätzlich beschäftigte ich mich mit wissenschaftlicher Fachliteratur zum Thema Trauma.
Bereits diese vorbereitende Beschäftigung mit den Themen Genozid, Trauma und aktuelle Lage in Ruanda machte mir deutlich, dass die Tätigkeit vor Ort mich vor große Herausforderungen stellen würde. Mir wurde klar, dass Völkermord von einem Außenstehenden nur schwer zu erfassen ist und dass eine intensive Beschäftigung damit auch Belastungen für die eigen Psyche mit sich bringen kann. Deswegen war es wichtig bei der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit Ruandas und den daraus resultierenden Belastungen für die aktuelle Gesellschaft eine gewisse Distanz zu wahren, um nicht selbst zu stark belastet zu werden.
1.2. Geschichte Ruandas
Bis zum Beginn der Kolonialzeit lebten in Ruanda drei verschiedene Volksgruppen friedlich miteinander. Die größte Gruppe waren die Hutus, die zu den Bantuvölkern gehören und sich traditionell auf Landbau verstanden (Smith,1998). Die zweitgrößte Gruppe stellten die Tutsi, die Smith (1998) zufolge aus dem Norden in die Region eingewandert waren und sich vor allem mit Viehzucht ihren Lebensunterhalt verdienten. Die kleinste Gruppe waren die Twa, ein Pygmäenvolk, das sich vor allem als Jäger und Töpfer betätigte. Aufgrund der unterschiedlichen Herkunft der drei Gruppen, ließen sich auch anatomische Unterschiede ausmachen. Die Hutus waren eher klein, stämmig und relativ dunkelhäutig. Im Vergleich dazu sahen Tutsis eher groß, schlank und hellhäutiger aus. Die Twa waren kleinwüchsig und unterschieden sich in ihrer Gesichtsform.
Allerdings kam es im Laufe der Jahrhunderte zu zahlreichen Hochzeiten und Vermischungen zwischen den Gruppen, so dass von drei verschiedenen Ethnien nicht mehr die Rede sein konnte, zumal auch Kultur und Sprache in hohem Grad identisch waren.
Mit Beginn der Kolonialzeit durch die Deutschen 1894 und später mit der Übernahme der Belgier 1916 wurden jedoch diese alten Kategorien wiederbelebt und mit einer sozialökonomischen Komponente vermischt.
Den Tutsis wurde eine rassische Höherwertigkeit zugesprochen und wer mehr wie zehn Kühe besaß, gehörte dazu. Mit Hilfe der Tutsi Minderheit festigte die belgische Besatzungsmacht ihre kolonialen Ansprüche und beherrschte Hutus und Twa. Smith (1998) betont, dass fortan die Kategorien Hutu und Tutsi folglich nicht nur als ethnische Kategorie, sondern auch als sozioökonomische Statusbezeichnung angesehen wurden. In Abhängigkeit von dem eigenen ökonomischen Erfolg war es für Tutsis und Hutus möglich, möglich, zwischen den beiden Klassen auf- und abzusteigen. Die Klassenzugehörigkeit wurde im Pass dokumentiert. Auch wenn die eingangs beschriebenen anatomischen Merkmale, schon längst nicht mehr deckungsgleich mit der sozialen Realität waren, wurden sie weiterhin, als Stereotype und zur Verfestigung von Vorurteilen, genutzt.
Nach der Unabhängigkeit 1962 kam eine Hutu Regierung an die Macht. Diese Regierung war nicht besonders gut auf die Tutsis zu sprechen, die zuvor eine wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung der kolonialen Ordnung gespielt hatten. Es kam in den folgenden Jahren immer wieder zu lokalen Gewaltausbrüchen, Vertreibungen und Fluchtwellen von Tutsis, vor allem nach Uganda und Burundi. Über Jahre hinweg wurde Ruanda von einem autoritären Einparteiensystem, das sich vor allem auf die Hutu Mehrheit stützte, regiert.
Gourevitch (1998) zeigt, dass zu Beginn der 1990er ein Paradigmenwechsel in der Europäischen Afrikapolitik einsetzte. Nach Beendigung des kalten Krieges, sahen es die Westmächte nicht mehr als notwendig an, aufgrund der Angst ein afrikanisches Land könne an die Kommunisten fallen, autoritäre Regime und Diktatoren zu unterstützen. Man begann, gemäß dem Zeitgeist, demokratische Strukturen einzufordern. Deswegen forcierten Belgien und Frankreich die Einführung eines Mehrparteiensystems in Ruanda.
Diese Entwicklung beflügelte die ins Exil geflohenen Tutsis. Sie hofften auf eine Rückkehr in ihre Heimat und eine Beteiligung an der neuen Regierung. Da ihre Teilhabe an der Regierung auf diplomatischem Wege nicht zu erreichen war, bildeten sie eine Rebellenarmee (Ruandische Patriotische Front, RPF) und begannen eine Militäroffensive im Norden des Landes, um ihre Anwartschaft auf einen Platz im Mehrparteiensystem militärisch zu unterstützen. Diese Entwicklung, einhergehend mit einer ökonomischen Krise (Weilenmann,2002 und Smith,1998) und zunehmender Unzufriedenheit des ruandischen Volkes mit der politischen Führung , führte zu einer Legitimationskrise, die gelöst werden musste.
1.3. Der Genozid
Im Januar 1993 wurde in Arusha (Tansania) ein Friedensvertrag ausgehandelt, der die Bedingungen einer Übergangsregierung festlegte, die die militärische Offensive im Norden beenden und den Weg zu einer gemeinsamen Machtbeteiligung ebnen sollte. Die Unterschrift unter diesen Vertrag wurde von einem radikalen Teil der Hutus, als Verrat aufgefasst und die Lösung der Machtfrage auf einem anderen Weg vorangetrieben.
Am 6. April 1994 wurde das Flugzeug des ruandischen Präsidenten Habyarimana, im Landeanflug auf die Hauptstadt Kigali, abgeschossen. Dieses Ereignis markierte den Anfangspunkt des systematischen Genozids, in dessen Verlauf eine Million Menschen ihr Leben verloren (Wirth,2005). Aufgestachelt durch propagandistische Medienkampagnen versuchten reguläre Truppen von Polizei und Militär, der ruandischen Hutu-Regierung, in Zusammenarbeit mit Milizen die Frage der politischen Teilhabe der Tutsis ein für allemal zu lösen.
Die Durchführung des Genozids erfolgte den Darstellungen von Gourevitch (1998) zufolge in nicht vorstellbarer Grausamkeit. Viele Opfer wurden an Straßensperren angehalten und anhand ihres Ausweises, der einen Vermerk zur ethnischen Zugehörigkeit enthielt, ausgesondert und mit der Machete exekutiert. In zahlreichen Fällen flüchteten sich Menschen in Kirchen, weil sie glaubten dort der Gewalt entgehen zu können. Doch auch dort ereilte sie ihr Schicksal.
Smith (1998) weist darauf hin, dass auch mehr und mehr unpolitische Ruander in die Greultaten involviert wurden, zum Teil aus eigenem Antrieb und zum Teil durch Milizen erzwungen, kam es vielerorts zu Morden zwischen Bekannten und Nachbarn. Dadurch stieg laut Smith (1998) die Zahl der Gewalttäter auf über 100 000 .
Eine besondere Rolle spielte sexuelle Gewalt gegen Frauen. Es kam in großem Stil zu Vergewaltigungen (Smith,1998) und Mordritualen mit eindeutig sexuell geladenem Inhalt.
Ein Eingehen auf die besondere Rolle der UNO während des Genozids würde hier den Rahmen sprengen. Die Aufzeichnungen des Oberkommandierenden der UN-Streitkräfte in Ruanda Dallaire (2005) zeigen jedoch eindeutig und eindringlich, dass es sich hierbei um das schlimmste, politisch verhinderbare Versagen einer internationalen Organisation in der jüngsten Vergangenheit handelte.
Der Genozid wurde letztlich im Juni 1994 beendet, indem die vom Norden her eingedrungene Militäroffensive der RPF Ruanda eroberte. Das Besondere an dieser Konstellation war, dass die militärischen Sieger, die Tutis, der Gruppe angehören, an denen zum Großteil der Genozid verübt wurde.
Abschließend muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Kategorisierung Täter und Opfer bzw. Hutu und Tutsi völlig unzureichend ist. Sie erleichtert uns zwar in gewisser Weise das Verständnis für die komplexen Vorgänge, ist aber bei genauem Betrachten hochgradig unscharf und kann zum Teil zu einer Aufrechterhaltung von Stereotypen dienen. Schließlich war diese Aufteilung, wie Weilenmann (2002) betont, nur eine künstliche Abgrenzungslinie an der entlang, der Konflikt um politische Legitimation und sozioökonomische Vorherrschaft ausgetragen wurde.
Die Opfer des Genozids waren nicht nur Tutsis, sondern alle, die sich der Gewalt der berauschten Milizen in den Weg stellten. Vielfach wurden auch Hutus, die sich mit ihren Nachbarn solidarisierten zu Opfern.
Die Frage nach Tätern und Opfern ist ebenso vielschichtig. Kann ein Gewalttäter, der zu seiner Tat, durch Gewaltandrohung gezwungen wurde, mehr als Täter oder mehr als Opfer angesehen werden?
2. Nach dem Genozid
Inzwischen ist in Ruanda eine Regierung an der Macht, die vom ehemaligen Kommandanten der siegreichen Militäroffensive der RPF, Paul Kagame, geführt wird. Viele Personen aus seinem näheren Umfeld und Sympathisanten, die im Zuge der Beendigung des Genozids wieder ins Land zurückgekehrt sind, haben laut Moreno (2005) wichtige Rollen in der Administration und Wirtschaft des Landes übernommen. Es steht allerdings in Frage, inwieweit ein Präsident, der aufgrund seiner eigenen Biografie sehr stark mit einer bestimmten Konfliktpartei verbunden ist, einen ausgleichenden, tief greifenden Versöhnungsprozess moderieren kann bzw. inwieweit ihm diese Fähigkeit von den Einwohnern des Landes zugeschrieben wird.
Zurzeit wird die Frage nach Hutus und Tutsis so beantwortet, dass man die Unterschiede komplett negiert und auf die gemeinsame ruandische Tradition des einen, ruandischen Volkes verweist. Auch wenn es für die Beantwortung dieser Frage sicherlich keine einfache Antwort gibt, so ist es doch interessant auf das Nachbarland Burundi zu blicken. Dort findet man eine ganz ähnliche Problematik, die gelöst wird, indem man eine strenge Quotierung nach Hutus und Tutsis zur Besetzung öffentlicher Ämter vorgenommen hat. Dieses Modell ist nicht unbedingt erfolgreicher, zeigt aber auf, dass der Umgang mit solch komplexen sozialen Konstrukten nicht einfach ist und zu unterschiedlichen Lösungen führen kann.
2.1. Gemeinsam im gleichen Dorf
Traditionell wohnen die Menschen in Ruanda weit verstreut auf den Hügeln des Landes. Nach dem Genozid, bedingt durch die Notwendigkeit einer Neuordnung und eines erhöhten Sicherheitsbedürfnisses der Bevölkerung, nach Vertreibung und Zerstörung, führte man die Politik des „Imidugudu“ ein. Dies bedeutete, dass man Witwen, Waise, Vertriebe, Ehemalige, Soldaten und Heimatlose in neuen Dörfern ansiedelte. Dadurch wurde auch der Zugang zur Infrastruktur erheblich erleichtert, da es wesentlich einfacher ist, Strom, Wasser und Gesundheitsversorgung an zentralen Punkten zur Verfügung zu stellen. Viele Dörfer sind in ihrer heutigen Zusammensetzung der Bewohner erst nach dem Genozid entstanden und beherbergen Menschen die den verschiedenen Kategorien Hutu/Tutsi und Opfer/Täter zuzuordnen sind. In einem solchen Dorf war ich mit VCP, einer Studenteninitiative, im Bereich der Aidsprävention tätig. Wöchentlich traf sich die Dorfjugend und nahm, im Rahmen eines Anti-Aids-Jugendclubs, an Veranstaltungen zur Thematik teil.
Natürlich ist es sehr schwer für einen Ausländer, der noch dazu der Landessprache Kyniarwanda nicht mächtig ist, das komplexe Beziehungsgeflecht innerhalb der dörflichen Strukturen zu durchschauen. Dennoch spürte ich, dass vieles noch unausgesprochen im Raum steht und der ruandische Alltag, gerade im Vergleich zu den Nachbarländern Uganda und Tansania, von einer gewissen Schwermut geprägt ist, die erahnen lässt, wie schwer die Geschehnisse nach wie vor auf der Volksseele lasten.
Auch die Frage der ethnischen Kategorien ist noch nicht abschließend geklärt. Wie bereits erwähnt werden sie zwar in der aktuellen staatlichen Politik negiert, aber es kommt z.B. nicht von ungefähr, wenn ein Dorfchef keinen Hehl daraus macht, dass er den ersten Kommandanten der Befreiungsarmee (RPF) sehr verehrt. Indirekt drückt er damit seine Ablehnung des Genozids und seine Sympathie für die neuen Machtstrukturen aus. Diese Verknüpfung ist insofern tückisch, da die Ablehnung des Genozids ein berechtigtes Anliegen ist, das aber nicht als ethnische Legitimation des aktuellen Präsidenten dienen sollte. Wie Weilenmann (2002) zeigt, darf es nicht dazu kommen, dass Sachfragen mit ethnischen Erklärungsmustern erklärt werden und umgekehrt. Beides verhindert langfristige Konfliktlösungen und kann leicht politisch instrumentalisiert werden.
2.2. Trauma
Neben den unterschwelligen Botschaften im Alltag, gibt es auch ganz handfeste Hinweise auf traumatische Belastungsstörungen.
Der Studie von Pham, Weinstein & Longman (2004) zufolge kann man davon ausgehen, dass 73% der ruandischen Bevölkerung einen nahen Familienangehörigen verloren das 24,8% unter einer Posttraumatischenbelastungsstörung leiden.
Nach wie vor kommt es häufig vor, dass in ganzen Schulklassen akute Krisen ausbrechen. Besonders zu Beginn der Regenfälle im April, wirkt diese saisonale Besonderheit als Trigger für Flashbacks.
Zum Teil kommt es auch bei Jugendlichen zu Flashbacks, die erst nach dem Genozid geboren wurden. Oftmals handelt es sich dann um Kinder, die bei Vergewaltigungen gezeugt wurden. Erstaunlich ist, dass das Trauma selbst dann über die Generationen hinweg weitergegeben wird, wenn es nie explizit verbalisiert wurde.
Das bekannteste Beispiel für eine Traumatisierung, ohne direkt Opfer einer Gewalttat geworden sein, ist der bereits erwähnte kandadische Oberbefehlshaber der UN-Soldaten, Romeo Dallaire. Bei ihm hat seine exponierte Beobachterstellung in Verbindung mit einer verordneten Untätigkeit ausgereicht, um eine schwere PTBS hervorzurufen.
Ein besonders interessanter Ansatz der Traumaverarbeitung begegnete mir in einem Wohnhaus in Butare. Dort hat ein junger Mann, der als einziger seiner Familie den Genozid überlebte, in seiner Wohnung ein Museum eingerichtet. Das Museum zeigt Bilder mit französischem Text, die den Holocaust während des 2.Weltkriegs dokumentieren. Auf diese Art rückt er das erlebte in einen Kontext und lässt es nicht als singuläres Ereignis der Weltgeschichte stehen.
2.3. Juristische Aufarbeitung
Wie Kraemer (2003) und Pham, Weinstein & Longman (2004) zeigen spielt die juristische Aufarbeitung von Unrecht eine ganz wesentliche Rolle bei der Verarbeitung von Traumata. Wobei Kraemer (2003) betont, dass es beim Prozess nicht zu einer Retraumatisierung kommen darf, die durch das wiederholte Ohnmachtsempfinden ausgelöst werden kann.
Die riesige Anzahl der Täter machte es unmöglich, alle Täter im regulären Rechtssystem abzuurteilen. Deshalb hat man sich entschlossen, eine alte ruandische Gerichtstradition, das „Gacaca“ wieder zu beleben. Es handelt sich hierbei um eine Dorfgerichtsbarkeit, bei der alle Dorfbewohner zu Wort kommen können und Laienrichter die Rechtssprechung übernehmen. Jede Gemeinde hat einen speziellen Tag in der Woche, an dem die Arbeit ruht und alle zum Gacaca zusammenkommen. Bis Herbst 2006 hat man vor allem Zeugenaussagen aufgenommen, ab dann wurden auch die ersten Urteile gefällt. Je nach Schwere des Falls, fällt er in die Zuständigkeit eines Gacaca oder in die eines regulären Gerichts.
Zusätzlich haben die Vereinten Nationen in Arusha (Tansania) den „Internationalen Gerichtshof für die Menschenrechtsverletzungen in Ruanda“ ins Leben gerufen. Dort werden mit hohem finanziellem Aufwand die Drahtzieher des Genozids verurteilt. Die Arbeit wird dadurch erschwert, dass verschiedene Staaten, wie z.B. Kenia und die USA, die Auslieferung Angeschuldigter an diesen Gerichtshof verweigern. Auch die Wahl des Ortes ist sehr unglücklich. Im fernen Arusha finden die Prozesse weitestgehend unbeachtet von der ruandischen Bevölkerung, statt. Dementsprechend betonen Pham, Weinstein & Longman (2004), dass in der öffentlichen Unterstützung das Gacaca mit 90,8% und die nationalen Gerichte mit 67,8% eine weit größere Rolle spielen, als der internationale Gerichtshof mit 42,1%.
2.4. Tätertrauma
Die Frage nach der Traumatisierung der Täter ist erst erst seit kurzem ins Auge der Öffentlichkeit gerückt. In Butare kam es im November 2006 zu einem Amoklauf eines vom Gacaca-Gericht Verurteilten, der mehreren Menschen das Leben kostete und einige verwundete. Wirth (2005) verweist darauf, dass auch Täterschaft traumatisierende Wirkung entfalten kann und zwar unabhängig davon, ob der Täter zu seiner Tat gezwungen wurde oder sie später bereut.
Auch politisch ist das Thema hochbrisant. Bisher hatte man aus staatlicher Sicht mehr die Opfer im Blick und fast alle Hilfestellungen für Traumatisierte wurden von Organisationen angeboten, die sich als Unterstützungsorganisationen für Opfer verstehen.
Abgesehen von der Frage nach der psychischen Gesundheit war bislang auch das physische Wohlbefinden der Täter ein untergeordnetes Thema. Zum Beispiel betont Moreno (2005) die schlechte Lage von Angeklagten. Oft warteten sie lange in Gefängnissen auf ihre Prozesse oder sind dort sogar aufgrund mangelnder Hygiene und damit einhergehenden Cholera- und Tuberkuloseepidemien gestorben. Die Fürsorge für diese Menschen war in der staatlichen Prioritätensetzung eher zweitrangig.
3. Traumastudie
Durch einen persönlichen Kontakt lernte ich die Leiterin des GTZ-Projekts „Nahrungssicherheit und strukturelle Stabilität im Süden Ruandas“ in der Stadt Gikongoro, im Distrikt Nyamagabe, kennen. Die Region Nyamagabe war eine der ärmsten Regionen Ruandas. Die relativ unfruchtbaren Böden in diesem Teil Ruandas wirkten sich negativ auf die Nahrungsmittelversorgung der ganzen Region aus. Unter- und Mangelernährung waren an der Tagesordnung. Bisher hatte sich das Projekt deshalb vor allem in den Bereichen Dorfplanung und „Essen gegen Arbeit“ engagiert.
Da die Region besonders stark unter den Auswirkungen des Genozids zu leiden hatte (Ullmann,1997), entschloss man sich , eine Initiative zur Verbesserung der Traumabewältigung ins Leben zu rufen. Meine Aufgabe war es, eine Studie anzufertigen, die eine inhaltliche Basis für die neue Initiative bildete. Zum einen sollte die aktuelle Lage der Hilfen zur Traumaverarbeitung in Nyamagabe dokumentiert und zudem Beispiele aus anderen Distrikten aufgeführt werden, an denen man sich zur Verbesserung der lokalen Strukturen orientieren konnte.
An der Initiative war die GTZ in Zusammenarbeit mit der lokalen Gesundheitsbehörde beteiligt.
3.1. Ausgangslage
Es gab bereits vier Traumaberater in Nyamagabe. Alle waren ehemalige Krankenschwestern, die in einer einjährigen Weiterbildung zum Traumaberater ausgebildet wurden. Es gab eine monatliche Supervision mit einem in Supervision ausgebildeten Traumaberater aus einem Nachbardistrikt. Alle vier Berater arbeiteten hauptsächlich im städtischen Umfeld. Die Therapien wurden in Einzelgesprächen und Gruppen durchgeführt.
Eine große Herausforderung stellte die Versorgung der ländlichen Bevölkerung dar. Etwa 80% Prozent der Bevölkerung Ruandas lebte auf dem Land. Je weiter man sich von der Städten entfernt umso schlechter wurden die Straßen und desto stärker nahm der Besitz von Fortbewegungsmitteln ab. Zu vielen Dörfern verkehrten nur selten Motorrad- oder Fahrradtaxis. Es gab in den Dörfern nur geringes Wissen über Traumta und keine Anlaufstellen für Fälle von akuten Krisen.
In den Jahren 2001 und 2005 hatte man deshalb versucht, verschiedene Personen, die auf dem Dorf lebten und dort über Autorität verfügten, zu Ansprechpartnern für psychosoziale Fragen auszubilden. Diese psychosozialen Ansprechpartner sollten in der Lage sein Begleiterscheinungen einer Posttraumatischenbelastungsstörung zu erkennen und bei Notwendigkeit eine entsprechende Weiterversorgung im nächstgelegenen Gesundheitszentrum sicherzustellen. Auf diese Aufgabe wurden sie in einem Workshop vorbereitet.
Leider gab es keine Nachverfolgung dieser Aktivität. Die Ansprechpartner bekamen weder weiterführende oder wiederholende Schulungen, noch erhielten sie eine Supervision, in der sie sich über ihre Erfahrungen hätten austauschen können. Zwischenzeitlich verlor sich der Kontakt und die Initiative verlief im Sand.
3.2. Traumaberater
Besonders interessant ist der Aspekt der Traumaberater. Dieses Konzept wurde aus der Notwendigkeit von qualifizierten Fachkräften in der Traumatherapie heraus geboren. Es gab fast keine an der Universität ausgebildeten Psychologen, aber der Bedarf war groß. Die Idee war, Personen, die bereits in einem sozial-medizinischen Beruf arbeiten (z.B. Krankenschwestern) durch eine Weiterbildung Instrumente an die Hand zu geben, die es ihnen ermöglichen, Interventionsansätze zu verfolgen, die zwischen Erstversorgung und Therapie liegen. Insbesondere beruhten diese Techniken auf den Methoden aktives Zuhören, Entspannung, Reflexion, Schreibtechniken und kreatives Gestalten.
Hinzu kamen vielfältige Aufgaben der psychosozialen Beratung. Man durfte nicht vernachlässigen, dass eine unsichere materielle Lage in Verbindung mit Nahrungsmittelknappheit einen enormen Stressor darstellt, der sich gerade bei traumatisierten Menschen negativ auf den Genesungsprozess auswirkte. Die Gewährung materieller Hilfen drückte außerdem aus, dass das erlittene Unrecht anerkannt wird, was ebenfalls einen wichtigen Faktor in der Verarbeitung des Traumas darstellte. Es gab zwar zahlreiche Angebote von verschiedenen staatlichen und internationalen Hilfsorganisationen für verschiedenste Gruppen Benachteiligter (z.B. Waise, Traumapatienten, Aidspatienten), doch oftmals war es gerade für Menschen, die vom Land kamen und nicht oder nur schlecht Lesen und Schreiben konnten, nicht einfach, entsprechende Hilfen in Anspruch zu nehmen. Der Berater half in diesem Fall Kontakte herzustellen und eine Verbesserung der unmittelbaren Lebensverhältnisse zu erreichen.
3.3. Vernetzung und Supervision
In anderen Distrikten Ruandas wurde unter Mithilfe des Deutschen Entwicklungsdienstes, eine Struktur eingeführt, die es zum Ziel hatte, Traumaberater und psychosoziale Ansprechpartner in den Dörfern auszubilden und besser miteinander zu vernetzen.
Zu Beginn wurden zwölf neue Traumaberater ausgebildet. Nach der Beendigung der Grundausbildung von einem Jahr, wurde für diese Absolventen ein zusätzliches Training zum „Ausbilder von psychosozialen Ansprechpartnern“ veranstaltet. Zur Vorbereitung des Trainings wurden verschiedene Themen verteilt, die bei der Ausbildung von psychosozialen Ansprechpartnern eine Rolle spielten. Jeder Trainingsteilnehmer bereitete ein Thema zu Hause vor.
Nach der Vorbereitungszeit trafen sich die Teilnehmer zur Durchführung des Trainings. Innerhalb einer Woche präsentierten sie sich ihre Themen. Auf diese Weise wurde nicht nur Faktenwissen vermittelt, sondern mit der Durchführung der Präsentation auch eine gewisse Methodenkompetenz aufgebaut, die bei der eigenen Tätigkeit als Multiplikator, hilfreich war.
Nach dieser Vorbereitung begannen die zwölf Traumaberater ihre neue Zusatzqualifikation in der Praxis anzuwenden. Die Ausbildung der psychosozialen Ansprechpartner begann. Jeweils zwei Traumaberater bildeten ein Ausbilderteam, das in einem einwöchigen Seminar eine Gruppe von 12 Personen, zu psychosozialen Ansprechpartnern ausbildete. Dieses Seminar wurde insgesamt dreimal wiederholt, so dass zwei Traumaberater insgesamt 36 Personen zu psychosozialen Ansprechpartnern ausbildeten (bzw. alle zwölf Traumaberater bildeten insgesamt 216 Personen aus).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung1: Ein Ausbilderteam bildet in drei Seminaren je zwölf psychosoziale Ansprechpartner aus
Danach kehrten die psychosozialen Ansprechpartner in ihre Dörfer zurück. Die Traumaberater begannen ab dann einen regelmäßigen Supervisionsprozess mit genau der Hälfte, der im Ausbilderteam ausgebildeten Personen, also mit 18 psychosozialen Ansprechpartnern. Diese 18 psychosozialen Ansprechpartner teilte der Traumaberater in Gruppen von 6 Personen ein, mit denen er jeweils einmal im Monat eine Supervisionssitzung abhielt. Dieses System gewährleistete, dass jeder psychosoziale Ansprechpartner eine monatliche Supervision, in einer Kleingruppe, von einem Traumaberater, den er bereits aus der Ausbildung kennt, erhielt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung2: Supervision zwischen Traumaberatern und psychosozialen Ansprechpartnern
4. Fazit
Da ich nur drei Monate insgesamt in Ruanda war und davon lediglich einen Monat intensiv im Bereich Trauma gearbeitet habe, konnte ich nur einen kleinen Ausschnitt der Problematik erfassen. Insbesondere ist meiner Meinung nach die Kenntnis der Landessprache Kinyarwanda notwendig, um einen tieferen Einblick in die lokale Methodik und Befindlichkeit zu bekommen.
Trotzdem war die Beschäftigung mit dem Thema sehr interessant und es beeindruckten mich vor allem die pragmatischen Lösungsansätze in vielen Bereichen, wie z.B. die aus der Not geborene Ausbildung zum Traumaberater und die Ausbildung Ehrenamtlicher zu psychosozialen Ansprechpartnern.
Ein interessanter Punkt, den ich in dieser Arbeit nicht vertiefen konnte, ist die Frage, inwieweit die in einer individualistischen Kultur geprägten psychologischen Werkzeuge zur Therapie traumatisierter Menschen in einer stark kollektiv geprägten Kultur, wie der ruandischen überhaupt greifen bzw. inwieweit die Anwendung psychologischer Methoden generell kulturabhängig ist.
Auch die politische Weiterentwicklung Ruandas bleibt spannend. Der Verlauf des Verarbeitungs- und Versöhnungsprozesses nach dem Genozid kann noch lange nicht abschließend beurteilt werden. Selbst wenn Ruanda im Moment friedlich erscheint, so müssen doch noch viele Jahre des Zusammenlebens und der fortlaufenden Versöhnung gestaltet werden, bevor die Narben des Genozids verheilen können.
5. Literaturverzeichnis
Dallaire, R. (2004). Shake hands with the devil. New York: Avalon Publishing Group.
Gourevitch, P. (1998). We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our
families. New York: Picador.
Kraemer, H. (2003). Das Trauma der Gewalt. München: Kösel-Verlag.
Moreno, M. S. (2005). El papel de la justicia en los procesos de reconciliacion.
Universitas. Revista de Filosofia, Derecho y Politica, 2, 37-62
Pham, P., Weinstein, H. & Longman T. (2004). Trauma and PTSD symptoms in
Rwanda: implications for attitudes toward justice and reconciliation. Journal of
the American medical association, 292(5), 602-612
Smith, D. N. (1998). The Psychocultural Roots of Genocide – Lecitimacy and Crisis
in Rwanda. American Psychologist, 53(7), 743-753
Ullmann, E. (1997). Verlorene Kinderträume. Kriegstraumatisierte Kinder in Ruanda.
in Hilweg, W. & Ullmann, E. (Hrsg.), Kindheit und Trauma. (S. 196-205).
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Weilenmann, M. (2002). Reaktive Ethnizität: Gedanken zur politischen Psychologie
anhand der Entwicklungen in Burundi, Rwanda und dem Süd-Kivu. in
Ottomeyer, K. & Peltzer, K. (Hrsg.), Überleben am Abgrund – Psychotrauma
und Menschenrechte. (S. 245-274). Klagenfurt: Drava-Verlag.
Wirth, H.-J. (2005). Genozid und seelischer Schmerz. Psychoanalytische
Überlegungen zum Völkermord in Ruanda. in Karger, A. & Heinz, R. (Hrsg.),
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine Einführung in die Thematik Trauma und Aufarbeitung nach dem Genozid in Ruanda. Er basiert auf einem Studienaufenthalt des Autors in Ruanda und einer dort erstellten Studie zur aktuellen Situation der Traumaberatung.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind die Geschichte Ruandas, insbesondere der Genozid, die juristische Aufarbeitung des Genozids, die verschiedenen Formen von Traumata (Opfer- und Tätertrauma) und die Möglichkeiten zur Traumabewältigung in Ruanda.
Wie bereitete sich der Autor auf seinen Aufenthalt in Ruanda vor?
Der Autor bereitete sich durch Seminare, Gespräche mit Ruanda-Experten und Überlebenden des Genozids, das Lesen von Fachliteratur und das Ansehen von Filmen vor.
Wie beschreibt der Text die Situation in Ruanda nach dem Genozid?
Der Text beschreibt die schwierige Situation in Ruanda nach dem Genozid, die von der Notwendigkeit der Versöhnung, der Bewältigung von Traumata und der juristischen Aufarbeitung der Verbrechen geprägt ist. Er geht auch auf die Problematik des Zusammenlebens von Tätern und Opfern in den gleichen Dörfern ein.
Was ist das "Gacaca"?
Das "Gacaca" ist eine traditionelle ruandische Gerichtsbarkeit, die nach dem Genozid wiederbelebt wurde, um die riesige Anzahl von Tätern abzuurteilen. Es handelt sich um eine Dorfgerichtsbarkeit, bei der alle Dorfbewohner zu Wort kommen können und Laienrichter die Rechtssprechung übernehmen.
Was ist ein Tätertrauma?
Ein Tätertrauma beschreibt die Traumatisierung von Personen, die selbst Gewalttaten begangen haben, entweder weil sie dazu gezwungen wurden oder weil sie ihre Taten später bereuen.
Worum ging es in der Traumastudie des Autors?
Die Traumastudie des Autors hatte das Ziel, die aktuelle Lage der Hilfen zur Traumaverarbeitung im Distrikt Nyamagabe zu dokumentieren und Beispiele aus anderen Distrikten aufzuführen, an denen man sich zur Verbesserung der lokalen Strukturen orientieren konnte.
Was sind psychosoziale Ansprechpartner?
Psychosoziale Ansprechpartner sind Personen, die auf dem Dorf leben und dort über Autorität verfügen. Sie werden ausgebildet, um Begleiterscheinungen einer Posttraumatischenbelastungsstörung zu erkennen und bei Notwendigkeit eine entsprechende Weiterversorgung im nächstgelegenen Gesundheitszentrum sicherzustellen.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Traumabewältigung in Ruanda?
Zu den Herausforderungen gehören die Versorgung der ländlichen Bevölkerung, die hohe Anzahl traumatisierter Menschen, die Armut, die mangelnde Kenntnis der Landessprache durch ausländische Helfer und die Frage, inwieweit individualistische Therapieansätze in einer kollektiv geprägten Kultur greifen.
Welche Rolle spielt die politische Weiterentwicklung Ruandas bei der Traumabewältigung?
Die politische Weiterentwicklung spielt eine wichtige Rolle, da der Verlauf des Verarbeitungs- und Versöhnungsprozesses nach dem Genozid noch lange nicht abschließend beurteilt werden kann und viele Jahre des Zusammenlebens und der fortlaufenden Versöhnung gestaltet werden müssen.
- Quote paper
- Martin Uhl (Author), 2007, 12 Jahre nach dem Genozid in Ruanda - Erfahrungen und Trauma, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111201