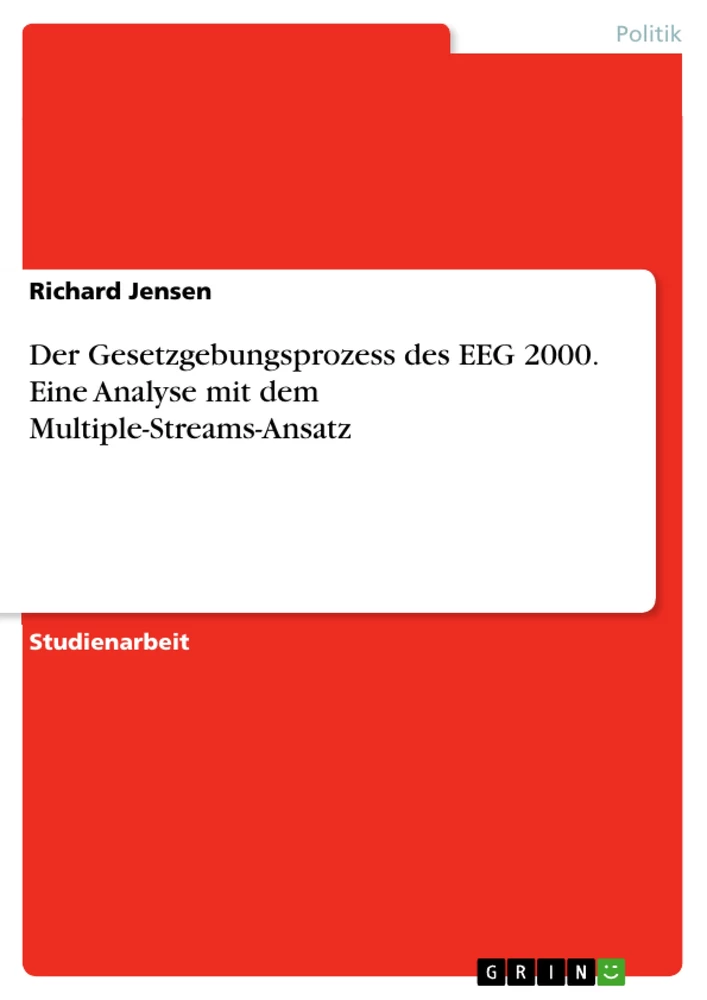Wissenschaftler sind sich einig: Der Klimawandel ist real und muss zum Wohle der Umwelt gestoppt werden. Was jedoch wird durch die Politik unternommen, um diesen zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen? Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Umstieg von fossiler Energieerzeugung zu der Nutzung von erneuerbaren Energieformen. Um den Gebrauch dieser Energie voranzubringen, hat das am ersten April 2000 in Kraft getretene Erneuerbare-Energie-
Gesetz (EEG) einen bedeutsamen Schritt geleistet. Im Groben soll es den Ausbau von Anlagen, die Strom auf Basis erneuerbarer Energien produzieren und ins öffentliche Netz einspeisen, fördern. Mithilfe der im Gesetz enthaltenen EEG-Umlagebestimmung sollen die Anlagen, die Energie aus erneuerbaren Quellen fördern und dem öffentlichen Netz zur Verfügung stellen, mit einem Geldbetrag vergütet werden. Dadurch sollen fossile Ressourcen, die der Energiegewinnung dienen, geschont und die Nachhaltigkeit gefördert werden.
Unter näherer Betrachtung der Regierungen, vor Beschluss des EEG ist jedoch zu erkennen, dass die Regierungskoalition bestehend aus CDU/CSU und FDP, die nicht den Fokus auf Umweltschutzmaßnahmen legte, mehr als 10 Jahre an der Macht war. Wie kam demzufolge das EEG im Jahr 2000 nach dem Regierungswechsel der SPD und Bündnis90/Die Grünen zustande? Diese Untersuchung wird unter besonderer Betrachtung der Bündnis90/Die Grünen durchgeführt. Die Relevanz dieser Fragestellung erweist sich auch daran, dass zukünftige Prozesse, die in ähnlicher Konstellation
stattfinden, unter Einbeziehung der hier getroffenen Ergebnisse erklärt werden können.
Diese Frage soll anhand des Multiple Streams Ansatz (MSA) von Kingdon erörtert werden. Daher wird der Ansatz im 2. Kapitel vorgestellt. Nach der Vorstellung der Theorie folgt im 3. Kapitel die Erläuterung der Methodik. Es wird beschrieben, welche Literatur vorrangig genutzt und wie diese recherchiert wird. Im Anschluss daran folgt im 4. Kapitel der Hauptteil, in dem die Thematik der Fragestellung in Bezug zu dem MSA gesetzt und sich damit auseinandergesetzt wird, ob die gestellte These belegbar ist. Im 5. Kapitel wird ein knappes Fazit gezogen, das die erhobenen Ergebnisse
zusammenfasst und diese auf die Fragestellung und These reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie
- 3. Methodik
- 4. Anwendung des Multiple Streams Ansatzes
- 4.1 Problemstrom
- 4.1.1 Policy-Entrepreneure
- 4.1.2 Focusing Events
- 4.2 Policy-Strom
- 4.2.1 Policy-Communities
- 4.2.2 Softening up
- 4.2.3 Bewerbung
- 4.3 Politics-Strom
- 4.3.1 Nationale Stimmung
- 4.3.2 Interessengruppen
- 4.3.3 Öffnung des Policy-Fensters
- 4.1 Problemstrom
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Entstehung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000 unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Bündnis 90/Die Grünen. Ziel ist es, das Zustandekommen des EEG anhand des Multiple Streams Ansatzes (MSA) von John W. Kingdon zu erklären.
- Der Einfluss von Policy-Entrepreneuren und Focusing Events auf den Problemstrom.
- Die Rolle von Policy-Communities und dem Prozess des Softening Up im Policy-Strom.
- Die Bedeutung der nationalen Stimmung, Interessengruppen und politischer Konstellationen im Politics-Strom.
- Die Relevanz der Öffnung des Policy-Fensters für einen Agenda-Wandel.
- Die Bedeutung des EEG als Instrument zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Bekämpfung des Klimawandels.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Klimawandels und der Bedeutung des EEG 2000 ein. Dabei wird die politische Situation vor dem Inkrafttreten des Gesetzes beleuchtet und die Fragestellung der Untersuchung formuliert. Das zweite Kapitel stellt den Multiple Streams Ansatz (MSA) als theoretisches Framework vor, der die Analyse des Agenda-Setting-Prozesses ermöglicht. Die einzelnen Ströme des MSA (Problem-, Policy- und Politics-Strom) werden im Detail erläutert.
Das dritte Kapitel behandelt die Methodik der Hausarbeit, die Literaturrecherche und die angewendeten analytischen Methoden. Im vierten Kapitel wird der MSA auf die Entstehung des EEG angewendet, wobei die drei Ströme und deren Interaktion mit dem Policy-Fenster analysiert werden. Es werden insbesondere die Rolle von Policy-Entrepreneuren, Policy-Communities und Interessengruppen untersucht, sowie der Einfluss der nationalen Stimmung auf den Agenda-Setting-Prozess.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Entstehung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000 mithilfe des Multiple Streams Ansatzes (MSA). Schlüsselbegriffe sind: Klimawandel, erneuerbare Energien, Policy-Entrepreneure, Focusing Events, Policy-Communities, Softening Up, Politics-Strom, nationale Stimmung, Interessengruppen, Öffnung des Policy-Fensters, Agenda-Setting, Politikfeldanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von 2000?
Das EEG sollte den Ausbau von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen fördern, um fossile Ressourcen zu schonen und den Klimawandel zu bremsen.
Was erklärt der Multiple-Streams-Ansatz (MSA)?
Der MSA nach Kingdon erklärt Politikwandel durch das Zusammentreffen von drei „Strömen“: dem Problemstrom, dem Policy-Strom (Lösungsvorschläge) und dem Politics-Strom (politische Stimmung).
Welche Rolle spielten Bündnis 90/Die Grünen beim EEG 2000?
Die Partei fungierte als zentraler Akteur, der Umweltthemen auf die Agenda setzte und nach dem Regierungswechsel 1998 die politische Gelegenheit zur Umsetzung nutzte.
Was ist ein „Policy-Window“?
Ein Policy-Window ist ein kurzes Zeitfenster, in dem sich die drei Ströme des MSA verbinden und so tiefgreifende gesetzliche Änderungen ermöglichen.
Wie funktionierte die ursprüngliche EEG-Umlage?
Anlagenbetreiber erhielten eine feste Vergütung für den eingespeisten Strom, deren Kosten über eine Umlage auf die Stromverbraucher verteilt wurden.
- Citation du texte
- Richard Jensen (Auteur), 2020, Der Gesetzgebungsprozess des EEG 2000. Eine Analyse mit dem Multiple-Streams-Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1112060