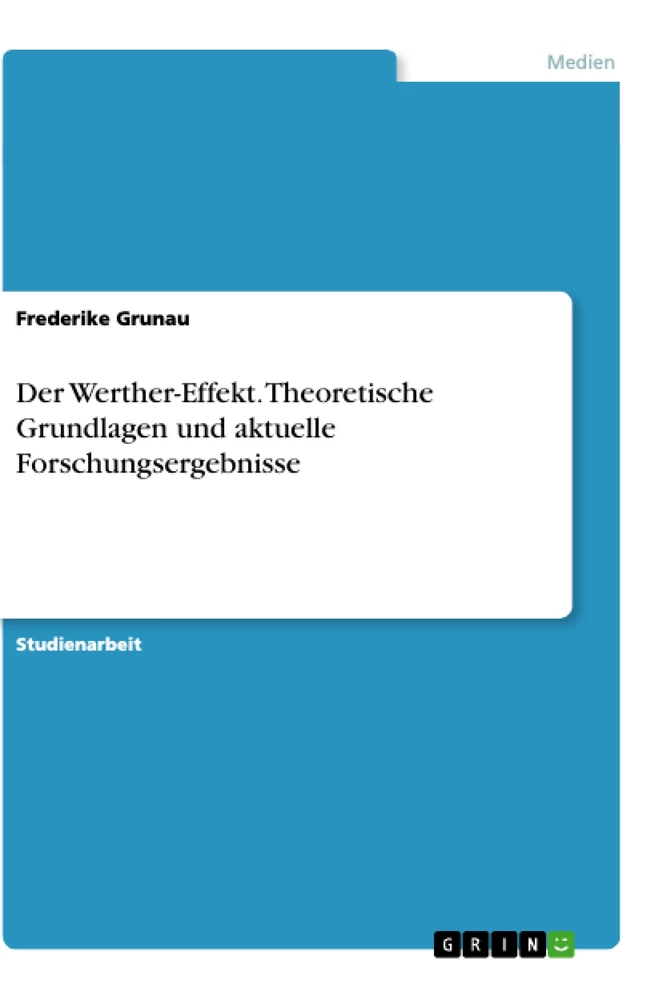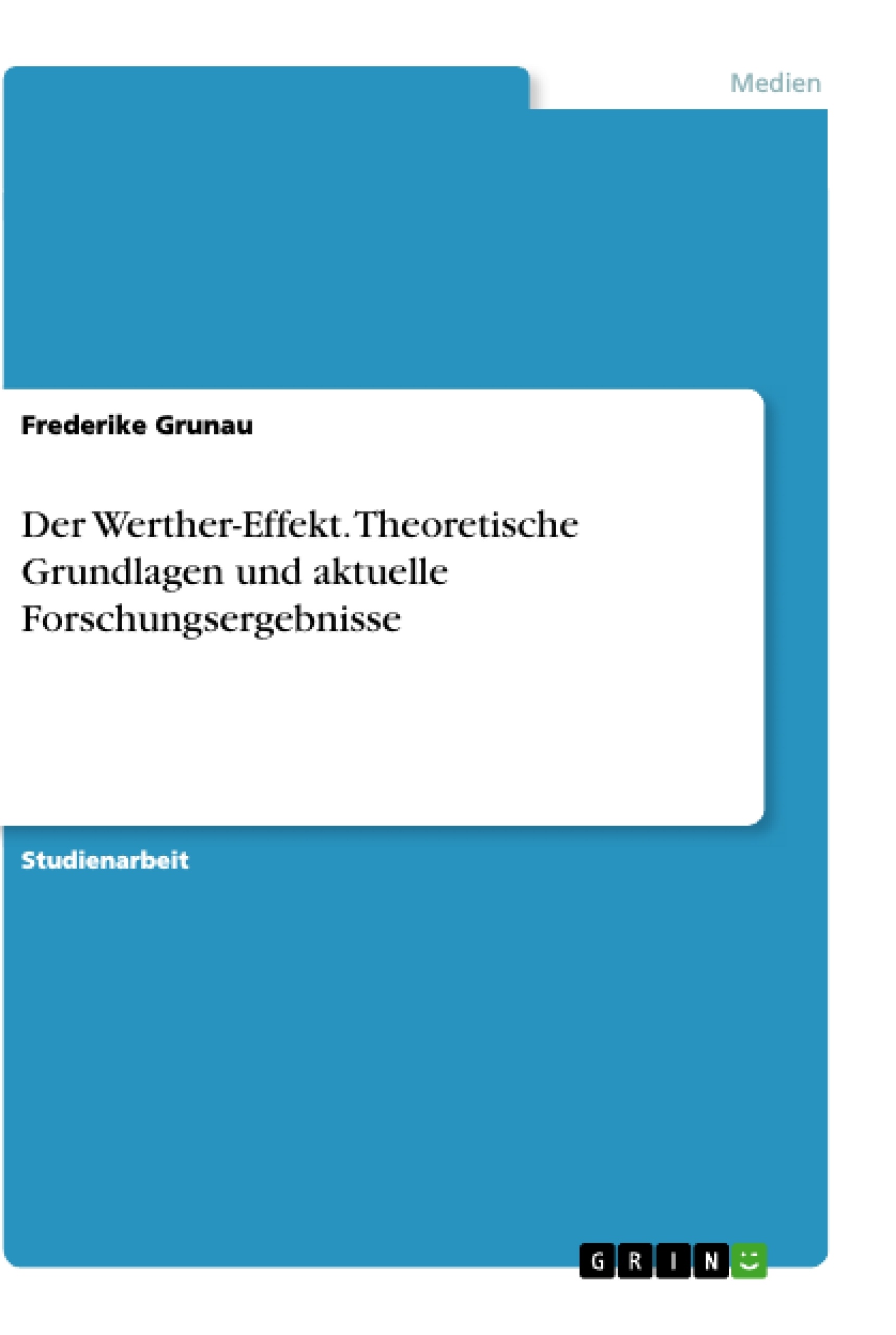Im Jahr 1774 erschien der Roman "Die Leiden des jungen Werther" von Johann Wolfgang von Goethe. In dem Briefroman schildert der junge Werther seine Gefühle und Erlebnisse in einzelnen Briefen und schickt diese an seinen Freund Wilhelm. Dabei verliebt er sich in Lotte, die bereits mit einem anderen Mann verlobt ist. Doch diese Liebe scheint für ihn hoffnungslos, da seine Gefühle nicht erwidert werden können. Dadurch sieht Werther keinen anderen Ausweg mehr und begeht aus Verzweiflung Selbstmord.
Nachdem Goethe den Roman veröffentlicht hat, löste der darin beschriebene Selbstmord der Hauptperson eine ganze Reihe von Suiziden in Europa aus. Es wurde sogar festgestellt, dass sich einige Nachahmer/innen genauso kleideten wie die Hauptfigur oder den Roman beim Selbstmord dabeihatten. Ein bekanntes Beispiel ist das Mädchen Christine von Lassberg, die sich vier Jahre nach der Veröffentlichung des Buches das Leben nahm. Sie hatte Goethes Werk währenddessen in ihrer Tasche. Doch dieses Phänomen war nicht zeitgenössisch, sondern existiert bis heute. Es handelt sich hierbei um den Werther-Effekt.
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit diesem Thema und untersucht die Wirkungen des Werther-Effekts. Zuerst werden die theoretischen Grundlagen mithilfe der sozial-kognitiven Lerntheorie erklärt und auf das Presseparadox eingegangen. Anschließend werden vier aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt und zum Schluss wird ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Werther-Effekt - theoretische Grundlagen
- Die sozial-kognitive Lerntheorie
- Zusammenhang der Suizidberichterstattung und des Werther-Effekts
- Aktuelle Forschungsergebnisse
- Presseberichterstattung über den Suizid von Robert Enke und Entwicklung der Suizidzahlen
- Stellenwert suizidpräventiver Medieneffekte in der deutschen Journalistenausbildung
- Zug-Suizid von Robert Enke und Auswirkung auf spätere Häufigkeit von Zug-Suiziden
- Untersuchung von Suizidberichterstattung und deutscher Suizidrate
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Werther-Effekt, das Phänomen der Suizidnachahmung, das durch die Medienberichterstattung über Suizide ausgelöst wird. Die Zielsetzung ist es, die theoretischen Grundlagen des Effekts zu erläutern und aktuelle Forschungsergebnisse zu präsentieren.
- Theoretische Grundlagen des Werther-Effekts anhand der sozial-kognitiven Lerntheorie
- Zusammenhang zwischen Medienberichterstattung und Suizidraten
- Analyse aktueller Forschungsbefunde zum Werther-Effekt
- Die Rolle der Medien im Kontext von Suizidprävention
- Auswirkungen von Suizidberichterstattung auf die deutsche Suizidrate
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Werther-Effekts ein, beginnend mit Goethes Roman "Die Leiden des jungen Werther" und dessen historischer und aktueller Relevanz im Zusammenhang mit Suizidnachahmung. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit: die Untersuchung der theoretischen Grundlagen und die Präsentation aktueller Forschungsergebnisse zum Werther-Effekt. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und ihre methodische Vorgehensweise.
Der Werther-Effekt – theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Werther-Effekts. Es erklärt den Begriff der Nachahmung im Kontext der Medienwirkungsforschung und verweist auf David Phillips' Studie von 1974, die den Zusammenhang zwischen Suizidberichterstattung und dem Anstieg der Suizidrate aufdeckte. Es werden die Ergebnisse von Phillips' Untersuchung detailliert dargestellt, einschließlich der Berücksichtigung von Jahreszeiten, Kriegen und Wirtschaftszyklen, die die Signifikanz der Ergebnisse unterstreichen.
Aktuelle Forschungsergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse zum Werther-Effekt. Es untersucht verschiedene Aspekte der Medienberichterstattung über Suizide und deren Auswirkungen auf die Suizidraten. Die Forschungsergebnisse bieten eine vielschichtige Perspektive auf das Thema und berücksichtigen verschiedene Faktoren wie die Art der Berichterstattung, die Prominenz der betroffenen Person und die regionale Verteilung der Medienwirkung. Die einzelnen Unterkapitel betrachten spezifische Fälle und Analysen, die zum Verständnis des Werther-Effekts beitragen.
Schlüsselwörter
Werther-Effekt, Suizidnachahmung, Medienwirkung, sozial-kognitive Lerntheorie, Suizidprävention, Medienberichterstattung, Suizidrate, Modelllernen, Presseberichterstattung, Robert Enke.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Der Werther-Effekt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Werther-Effekt, also das Phänomen der Suizidnachahmung, die durch Medienberichterstattung über Suizide ausgelöst werden kann. Sie beleuchtet sowohl die theoretischen Grundlagen als auch aktuelle Forschungsergebnisse zu diesem Thema.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit erläutert den Werther-Effekt anhand der sozial-kognitiven Lerntheorie und untersucht den Zusammenhang zwischen Medienberichterstattung und Suizidraten. Ein wichtiger Bezugspunkt ist die Studie von David Phillips aus dem Jahr 1974, die den Zusammenhang zwischen Suizidberichterstattung und dem Anstieg der Suizidrate aufdeckte.
Welche aktuellen Forschungsergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert aktuelle Forschungsbefunde zum Werther-Effekt. Hierzu gehören Analysen der Presseberichterstattung über den Suizid von Robert Enke und deren Auswirkungen auf die Suizidzahlen. Weitere Forschungsergebnisse untersuchen den Stellenwert suizidpräventiver Medieneffekte in der deutschen Journalistenausbildung und die Auswirkung von Suizidberichten auf die Häufigkeit von Zug-Suiziden. Die Arbeit betrachtet verschiedene Faktoren wie die Art der Berichterstattung, die Prominenz der betroffenen Person und die regionale Verteilung der Medienwirkung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen des Werther-Effekts, ein Kapitel zu aktuellen Forschungsergebnissen und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Aufbau und die methodische Vorgehensweise. Das Kapitel zu den theoretischen Grundlagen erklärt den Werther-Effekt und die sozial-kognitive Lerntheorie. Das Kapitel zu den aktuellen Forschungsergebnissen präsentiert verschiedene Studien und Analysen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Werther-Effekt, Suizidnachahmung, Medienwirkung, sozial-kognitive Lerntheorie, Suizidprävention, Medienberichterstattung, Suizidrate, Modelllernen, Presseberichterstattung, Robert Enke.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die theoretischen Grundlagen des Werther-Effekts zu erläutern und aktuelle Forschungsergebnisse zu präsentieren, um ein umfassendes Verständnis des Phänomens zu vermitteln und die Rolle der Medien im Kontext von Suizidprävention zu beleuchten.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von einem Kapitel über die theoretischen Grundlagen des Werther-Effekts. Ein weiteres Kapitel widmet sich den aktuellen Forschungsergebnissen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab. Der Aufbau ist logisch und systematisch, um den Leser durch die Thematik zu führen.
- Citation du texte
- Frederike Grunau (Auteur), 2021, Der Werther-Effekt. Theoretische Grundlagen und aktuelle Forschungsergebnisse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1112068