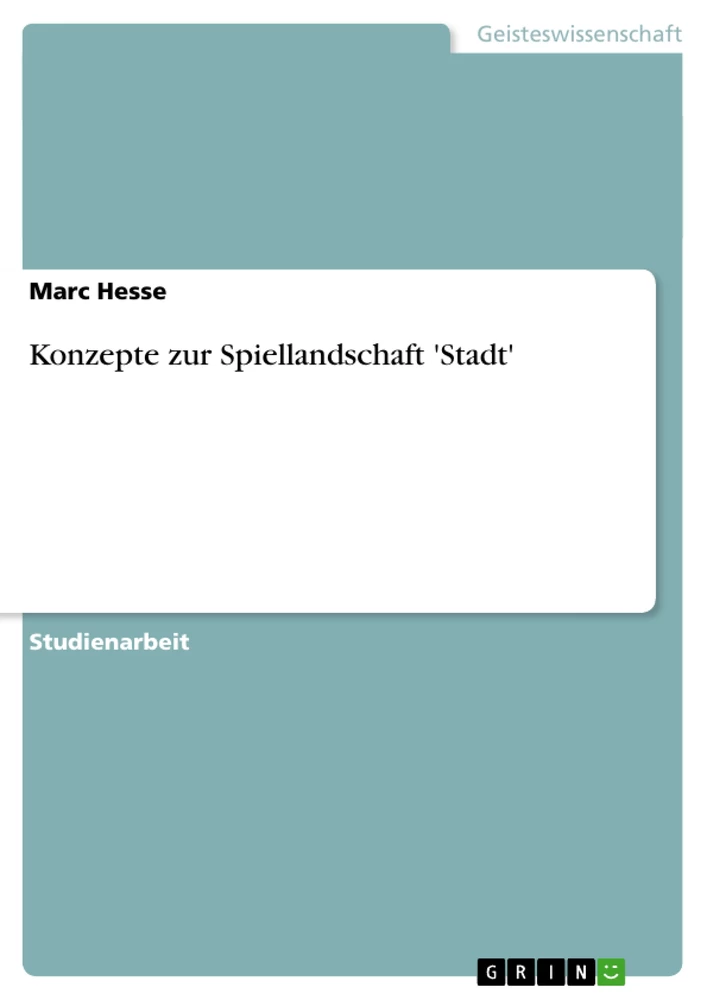Gliederung:
1. Einleitung
2. Umzäunung und Sicherung des Kinderspiels
3. Kinderfreundlichkeit und -spiel außerhalb des Spielplatzes
4. Der Modellversuch “Stadt für Kinder – Stadt für alle”
4.1. Wesen und Ziele des Programms
4.2. Durchführung und veranlasste Maßnahmen
4.3. Ergebnisse
5. Die Arbeitsgemeinschaft “Spiellandschaft Stadt” in München
5.1. Die Entstehung der Arbeitsgemeinschaft
5.2. Ziele der Arbeitsgemeinschaft
5.3. Rückblick: Ergebnisse des Vorhabens
6. Zusammenfassende Schlussbetrachtungen
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Inmitten meines Heimatortes wurde unlängst ein Spielplatz errichtet. Es handelt sich hierbei um eine Spielfläche mit zahlreichen TÜV-geprüften Geräten – Wippe, Schaukel, Klettergerüst und Rutsche, um nur einige zu nennen. In den Augen vieler Eltern schien das Kinderspiel in der Wohngegend fortan abgesichert zu sein und seine Ortsbestimmung erhalten zu haben.
Der Sicherheitsgrad auf dem Spielplatz wird scheinbar verstärkt durch den Holzzaun, der den “modernen Sozialisationsraum” umgibt. Doch schützen solche Palisaden, oder dienen sie eher der Eingrenzung?
Mit dem vorliegenden Text soll dargestellt werden, wie bedeutsam es sein kann, dem Versuch der ausschließlichen Verlagerung des Außenspiels auf das künstliche und räumlich eingeschränkte Aktionsfeld “Spielplatz” entgegenzuwirken. Es sollen Möglichkeiten aufgezeigt und Maßnahmen vorgestellt werden, die einen wesentlicheren Beitrag zur Kinderfreundlichkeit des Spiel- und Lebensraumes Stadt leisten.
2. Umzäunung und Sicherung des Kinderspiels
Rechtsgrundlage für die Errichtung von Kinderspielsplätzen in Thüringen ist § 9 der Thüringer Bauordnung (ThürBO). Art und Anzahl der Wohnungen auf dem Baugrundstück bestimmen die Größe der Spielflächen, die auf dem Baugrundstück oder in geeigneter Entfernung vorgehalten werden müssen. Für die Errichtung kindgerechter Spielorte in Wohnungsbaugebieten existiert demnach eine Rechtsnorm. Während allerdings der Versuch, fachliche Standards zu setzen, beispielsweise Bestandteil der Intentionen des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) ist, begnügt sich der Gesetzgeber bei der Spielflächenerrichtungspflicht im Wesentlichen mit der Lokalisierung des Kinderspiels im Außenbereich.
Andere Maßnahmen, wie z.B. die Schaffung von Tempo-30-Zonen in Wohngebieten finden in der Gesetzgebung kaum Berücksichtigung. Baldo BLINKERT (1996, S. 22) bemerkt im Zusammenhang mit der Auswertung einer Untersuchung, dass das “Vorhandensein oder Fehlen von Spielplätzen (..) zwar eine gewisse Bedeutung” einnimmt, sich aber auf die “Spielchancen” (ebd.) nur wenig auswirkt. Der Autor betont die viel größere Auswirkung der Beschaffenheit des näheren Raumes um die Wohnung auf Spielmöglichkeiten und Spielqualität. Als ebenso bedeutsam wird im Ergebnis der Untersuchung BLINKERTS die Belastung durch den ruhenden und fließenden Verkehr eingestuft.
Inge THOMAS (vgl. 1979, S. 441 ff.), erklärte Gegnerin des offensiven Spielplatzbaus, macht auf die Gefahr aufmerksam, auf die kindliche Sozialisation isoliert von der realen und Erwachsenenwelt Einfluss zu nehmen. Sie beschreibt den “künstlich geschaffenen Lernraum” Schule, das Elternhaus, das einengt und bevormundet, die Kinderkulturwaren, die das Kind von der Realität fernhalten, den “beengte(n) Entwicklungsraum” Wohnung und die derzeit (1979) vorgehaltenen Spielmöglichkeiten im Freien.
Die Spielmöglichkeiten im Freien werden im Wesentlichen durch die vorhandenen Kinderspielplätze bestimmt (vgl. ebd.). Die oben aufgezählten Sozialisationsorte bzw. -faktoren geben dem Kind jedoch gar nicht die Möglichkeit, an der Erwachsenenwelt zu partizipieren und darin zu lernen. Sie sind speziell für Kinder geschaffen und dienen aus der Sicht der Erwachsenen dazu, die Kindheit vom Ernst und von den Gefahren des (Erwachsenen-) Lebens fernzuhalten, sie davor schützen zu können. Doch wie soll sich das Kind mit der späteren Lebenswelt vertraut machen, sich auf sie vorbereiten?
In die Kritik der Autorin gerät der offensive Spielplatzbau: “Die Frage, ob die Einrichtung ‚Kinderspielplatz’ in der Lage ist, das zu ersetzen und zu kompensieren, was Kindern an anderer Stelle genommen wird, muß verneint werden” (THOMAS 1979, S. 443). Die spielerischen Aktivitäten auf dem Kinderspielplatz sind, so THOMAS, eher kurzfristig und wenig kreativ, es sind fast nur monotone Funktionspiele (Schaukel, Wippe) möglich. Auf Sozialisationsziele, wie Wahrnehmungs- oder Orientierungsfähigkeit, Konzentrations- oder Kommunikationsfähigkeit, Kreativität oder soziale Sensibilität, wird auf diese Weise nicht hingearbeitet. Hinzu kommt m.E., dass ein zwangloses Kinderspiel kaum stattfindet, wenn die Kinder durch die ständige Möglichkeit der “Aufsicht” durch Eltern oder andere Erwachsene beobachtet werden und sich den Augen der Öffentlichkeit nicht entziehen können.
Spiel-Verbotsschilder in der näheren Wohnumgebung oder aber der alibi-artige Ausspruch “Geht doch auf den Spielplatz!” weisen dem Kind seinen Aktionsraum pauschal zu und schließen die Möglichkeit aus, das Wohnumfeld gemeinsam mit anderen Kindern zu erkunden, sich darin zu orientieren und sich damit zu identifizieren.
Sichtbare oder symbolische Eingrenzungen von Spielplätzen, etwa durch Zäune, bestenfalls durch Hecken oder Sträucher, schränken das Kinderspiel auf eine kleine Fläche ein und nehmen den Besuchern jedwede Chance, sich auf erlaubte Weise außerhalb des zugewiesenen Ortes zu entfalten. Eine Umzäunung, die Sicherheit bieten soll, erfüllt ihre Funktion jedoch nur so lange, wie jemand da ist, der geschützt werden könnte. Doch Untersuchungen (vgl. unten) zeigen, dass konventionelle Kinderspielplätze weniger frequentiert werden als dies bei ihrer Errichtung erwartet wird.
Die nach der politischen Wende erfolgte Umgestaltung eines vernachlässigten Spielplatzes zum Abenteuerspielplatz mitten im Stadtpark der Stadt Nordhausen verursachte Kosten in 6-stelliger Höhe: Allein die Gerätekosten beliefen sich auf 127.000,- DM. Hinzu kamen noch die Kosten für Planungs- und Tiefbauleistungen, Bepflanzung, Montage, Wartung, Bänke, etc. Nach einigen Monaten stellte sich heraus, dass dennoch mehr Kinder an anderen Orten im Stadtpark herumtollten als auf dem erneuerten Spielplatz. Ungeklärt bleibt an dieser Stelle die Effizienz, also das Aufwand-Nutzen-Verhältnis der Maßnahme.
Der in der Einleitung angeführte Spielplatz im Zentrum meines Heimatortes wird derzeit fast ausschließlich und nur in den Abendstunden als informeller Kommunikationstreffpunkt für Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren genutzt, viel weniger als Spielfläche für Kinder am Tage.
Baldo BLINKERT (1996, S. 24ff.) berichtet über eine Freiburger Erfahrung: Im Ergebnis einer aufwändigen Untersuchung zur Aktionsraumqualität im Zusammenhang mit den Spielmöglichkeiten und -gewohnheiten von Kindern wurde festgestellt, dass im Durchschnitt nur ungefähr fünf Prozent des wachen Kinderalltags für unkontrolliertes und freies Kinderspiel außerhalb der Wohnung genutzt werden. Als ein Kausalfaktor dafür konnte die Aktionsraumqualität im Umfeld der Wohnungen ermittelt werden.
Aus den Erkenntnissen der Untersuchung schöpfend schlug BLINKERT dem zuständigen Freiburger Gartenbauamt den Rückbau einiger konventioneller Spielplätze vor. Statt funktionaler Spielmöbel charakterisierten nach der Umgestaltung Hügel, Vertiefungen, Matsch, Wasser, Holz und Steine die ausgewählten Spielplätze. Die Attraktivität der Spielplätze wurde so sehr gesteigert, dass sich Bürgerinitiativen gründeten, die sich vom zunehmenden Kinderlärm beeinträchtigt fühlten.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Er untersucht die Bedeutung der Kinderfreundlichkeit in städtischen Räumen, wobei der Fokus auf Spielplätzen, ihrer Umzäunung und alternativen Ansätzen für das Kinderspiel liegt.
Welche Themen werden in der Einleitung angesprochen?
Die Einleitung beschreibt die Errichtung eines TÜV-geprüften Spielplatzes und hinterfragt die Notwendigkeit und den Nutzen von Umzäunungen. Es wird die Verlagerung des Kinderspiels auf künstliche Spielplätze kritisch betrachtet und die Notwendigkeit eines kinderfreundlicheren Lebensraums Stadt betont.
Was wird im Kapitel "Umzäunung und Sicherung des Kinderspiels" diskutiert?
Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen für die Errichtung von Spielplätzen in Thüringen. Es wird kritisiert, dass die Gesetzgebung sich hauptsächlich auf die Lokalisierung des Kinderspiels konzentriert und andere Maßnahmen, wie z.B. Tempo-30-Zonen, vernachlässigt. Außerdem wird die Gefahr der Isolierung kindlicher Sozialisation durch künstliche Spielumgebungen angesprochen.
Welche Kritikpunkte an konventionellen Spielplätzen werden geäußert?
Es wird argumentiert, dass konventionelle Spielplätze oft monotone Aktivitäten bieten und nicht ausreichend zur Entwicklung von Wahrnehmungs-, Orientierungs-, Konzentrations- oder Kommunikationsfähigkeit beitragen. Die ständige Beobachtung durch Erwachsene kann zudem zwangloses Kinderspiel verhindern.
Welche Alternativen zum reinen Spielplatzbau werden vorgeschlagen?
Der Text plädiert dafür, Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Umgebung ungestört zu entdecken und zu erkunden. Verkehrberuhigung in Wohngebieten, die Zulassung des Spiels in Vorgärten und Hinterhöfen sowie kreative und gestalterische Betätigung werden als wirksamere Maßnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit angesehen.
Was wird am Beispiel des Abenteuerspielplatzes in Nordhausen kritisiert?
Die hohen Kosten für die Umgestaltung eines Spielplatzes zum Abenteuerspielplatz stehen im Missverhältnis zum tatsächlichen Nutzen, da Kinder weiterhin andere Orte im Stadtpark bevorzugten. Die Effizienz solcher Maßnahmen wird somit in Frage gestellt.
Welche Ergebnisse liefert die Freiburger Untersuchung?
Die Freiburger Untersuchung ergab, dass Kinder im Durchschnitt nur wenig Zeit für unkontrolliertes Spiel außerhalb der Wohnung verbringen, was auf die Aktionsraumqualität im Wohnumfeld zurückzuführen ist. Der Rückbau konventioneller Spielplätze und die Gestaltung naturnaher Spielplätze führten zu einer erhöhten Attraktivität, aber auch zu Beschwerden wegen Lärmbelästigung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass die Förderung der Kinderfreundlichkeit in Städten mehr erfordert als nur den Bau von Spielplätzen. Es werden umfassendere Maßnahmen gefordert, die die Stadt- und Verkehrsplanung einbeziehen und Kindern die Möglichkeit geben, sich in ihrer Umgebung frei zu entfalten.
- Quote paper
- Marc Hesse (Author), 1999, Konzepte zur Spiellandschaft 'Stadt', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111211