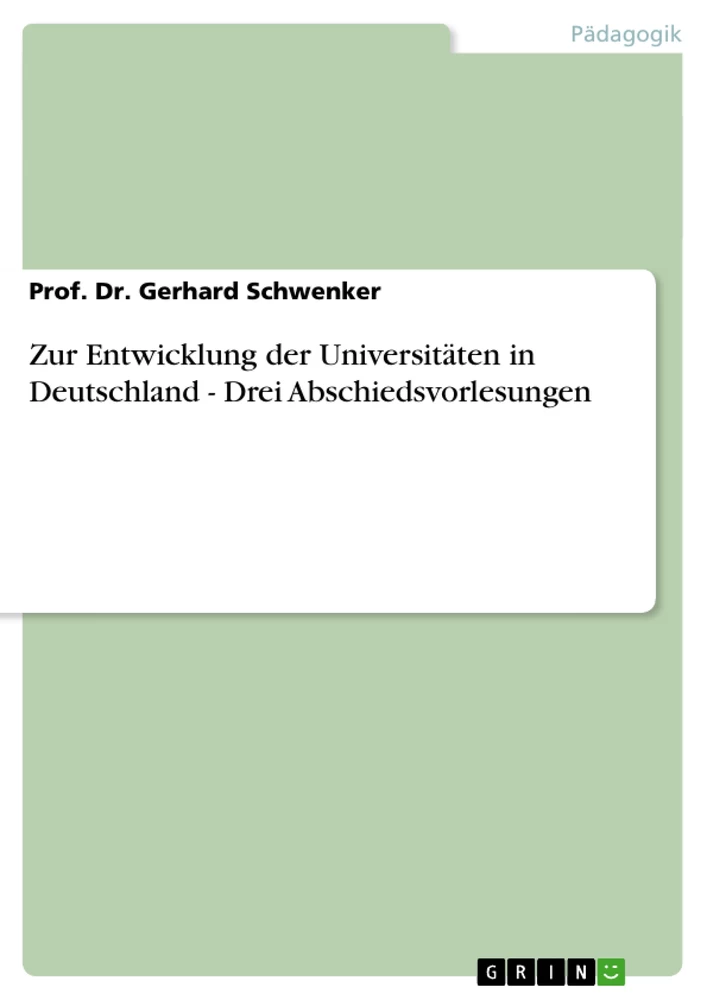Neben ideellen Beweggründen, zum Beispiel die Verbesserung der Reputation, waren es vor allem materielle Gründe, die zur Errichtung einer Universität führten. So sollten die Herrschaft des Landesherren gefestigt, fremde Studenten angezogen und die eigenen jungen Leute im Lande gehalten werden, die dem Staat die benötigten Geistlichen und Juristen sicherten. Dafür mußte der Gründer seiner Universität geeignete Baulichkeiten und Grundstücke geben und sie mit gesicherten Einkünften und mit Privilegien versehen, um sie wirtschaftlich lebensfähig und für die zu berufenden Professoren und auswärtigen Studenten attraktiv zu machen. Zu den Privilegien zählten vor allem das Prüfungsprivileg für alle akademischen Grade, die Befreiung von Steuern und Abgaben, von Einquartierung und Ziehung zum Militärdienst, sowie eine eigene Gerichtsbarkeit für alle akademischen Bürger. Das waren nicht nur Professoren und ihre Familien und die Studenten, sondern auch die Bediensteten, wie Pedell, Fecht-, Reit-, Tanz-, Sing- und Sprachlehrer, der Organist und zum Beispiel der Universitätsapotheker. Über die von ihm gewährten Privilegien hinaus war der Gründer auch um päpstliche oder kaiserliche Stiftungsbriefe bemüht.
Inhaltsverzeichnis
1. Vom Beginn der Entwicklung bis zum 19. Jahrhundert
2. Die Universität nach der Humboldt'schen Reform
Die Technischen Hochschulen
3. Die Entwicklung im 20. Jahrhundert
1. Vom Beginn der Entwicklung bis zum 19. Jahrhundert
Universitäten sind Schulen. Die Idee der Universität als Universitas Magistrorum et Scholarium und als Universitas Litterarum (Korporative Einheit der Lehrer und Schüler bzw. der Wissenschaften) entstammt dem Mittelalter. Hervorgegangen ist die Universität aus gelehrten Schulen (Kloster- und Domschulen). Als Kaiser Karl IV. im Jahre 1348 in Prag die erste Universität auf deutschem Boden gründete, bestanden im übrigen Europa bereits mehr als ein Dutzend deutlich älterer Universitäten. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wurden danach durch die weltlichen und geistlichen Landesherren (selten auch durch Städte: Köln 1388, Erfurt 1392, Altdorf 1622) weitere Universitäten gegründet, so daß bis zum großen Universitätssterben im Zusammenhang mit den Napoleonischen Kriegen und der Neuverteilung der Macht in den Ländern des früheren Deutschen Reiches 50 Universitäten entstanden. Die Gründungen verliefen in Wellen, die durch neue geistige Strömungen ausgelöst wurden: Humanismus (z.B. Freiburg 1456, Frankfurt/Oder 1507), Reformation und Gegenreformation (z.B. Marburg 1527, Würzburg 1582), Aufklärung (z.B. Halle 1694, Göttingen 1737).
Neben ideellen Beweggründen, z.B. die Verbesserung der Reputation, waren es vor allem materielle Gründe, die zur Errichtung einer Universität führten. So sollten die Herrschaft des Landesherren gefestigt, fremde Studenten angezogen und die eigenen jungen Leute im Lande gehalten werden, die dem Staat die benötigten Geistlichen und Juristen sicherten. Dafür mußte der Gründer seiner Universität geeignete Baulichkeiten und Grundstücke geben und sie mit gesicherten Einkünften und mit Privilegien versehen, um sie wirtschaftlich lebensfähig und für die zu berufenden Professoren und auswärtigen Studenten attraktiv zu machen. Zu den Privilegien zählten vor allem das Prüfungsprivileg für alle akademischen Grade, die Befreiung von Steuern und Abgaben, von Einquartierung und Ziehung zum Militärdienst, sowie eine eigene Gerichtsbarkeit für alle akademischen Bürger. Das waren nicht nur Professoren und ihre Familien und die Studenten, sondern auch die Bediensteten, wie Pedell, Fecht-, Reit-, Tanz-, Sing- und Sprachlehrer, der Organist und z.B. der Universitätsapotheker. Über die von ihm gewährten Privilegien hinaus war der Gründer auch um päpstliche oder kaiserliche Stiftungsbriefe bemüht.
Die Universitäten waren klein und überschaubar, sie umfaßten einen Lehrkörper von 15-20 Professoren und bestenfalls einige hundert Studenten. Frauen studierten nicht. Die Größenordnungen änderten sich für Jahrhunderte kaum, auch die Organisation der Universitäten blieb lange unverändert: an ihrer Spitze stand jeweils ein Rektor oder Prorektor (wenn der Landesherr sich den Rektorentitel vorbehielt). Ein Kanzler als Vertreter der Kirche oder als Bevollmächtigter des Landesherrn oder der Regierung, in dieser Eigenschaft häufig auch ein Kurator, waren jeweils von großer Bedeutung. Die Universitäten bestanden in der Regel aus vier Fakultäten, eine besondere Zugangsvoraussetzung zum Studium bestand nicht. Allerdings war zuerst ein propädeutisches Studium der sieben freien Künste an der Artistenfakultät erforderlich, bei der im "Trivium" mit Grammatik, Rhetorik und Dialektik die lateinische Sprache in Wort und Schrift und die Fähigkeit zur Disputation erlernt wurde. Im Quadrivium der mathematischen Fächer wurde wenigstens mit den grundlegenden Kenntnissen von Arithmetik, Geometrie, Musik (!) und Astronomie vertraut gemacht. Als Voraussetzung für ein Studium in den drei "oberen" Fakultäten wurde der Grad eines Baccalaureus verliehen, auch der akademische Grad eines Magister Artium konnte erworben werden. In dem Maße, wie langsam die Lateinschulen die Vorbereitung auf das Universitätsstudium übernahmen, veränderte sich der Charakter der Artistenfakultät und sie wurde zur philosophischen Fakultät. Ursprünglich war sie die größte unter den vier Fakultäten und die meisten Studenten begnügten sich mit einem Studium an ihr. Mit dem sich vermindernden Zwang zu ihrem Besuch am Anfang des Studiums entstand dann das Problem einer häufig unzureichenden Vorbildung der Studenten. Die uns heute geläufige Voraussetzung der Hochschulreife durch das bestandene Abitur setzte sich erst im Verlauf der Schul- und Hochschulreform in Preußen durch W. v. Humboldt im 19. Jh. durch. Eine faktische Voraussetzung war allerdings die ausreichende Kenntnis der lateinischen Sprache als jahrhundertelang alleinige Unterrichtssprache. Unter den oberen Fakultäten war die theologische die bedeutendste. Aus ihr gingen nicht nur die Geistlichen hervor, nach der Reformation je nach der Konfession des Landesherrn, sondern auch die Lehrer der Lateinschulen. Die im Range nächst niedrigere Fakultät war die juristische, an der nicht nur die künftigen Richter und Advokaten studierten, sondern häufig auch die Söhne des Adels und einflußreicher Familien. Mit Abstand die kleinste Fakultät war die medizinische, die auch die geringste gesellschaftliche Reputation hatte. Allerdings finden sich in ihrem Fächerkanon die später so wichtigen Naturwissenschaften bereits angelegt. Die vorgesehene Dauer des Studiums betrug für die Theologie und Jurisprudenz je drei Jahre, für die Medizin vier Jahre. Die Professoren mußten in ihrer Fakultät die gesamte Breite des Faches abdecken, es bestanden aber innerhalb der Universität Absprachen über die Verteilung des Stoffes nach der Anciennität (Kollegialprinzip). In jeder der drei Fakultäten konnte der Doktorgrad erworben werden, ursprünglich bedeutete dieser die Erlaubnis, an jeder Universität in der entsprechenden Fakultät lehren zu dürfen. Im Laufe der Entwicklung etablierte sich dann, zwingend ebenfalls erst im 19. Jh., die Einrichtung der Habilitation und die daraufhin erteilte "Venia Legendi" für ein bestimmtes Fach, die dem Privatdozenten und späteren "außerordentlichen" Professor das Recht zur Lehre in diesem Fach einräumte.
Die Studenten lebten ursprünglich in Kollegienhäusern und "Bursen" in klösterlicher Ordnung unter der Aufsicht von Magistern oder Professoren. Die Sorge um genügend Freitische war ein Anliegen des Universitätsgründers. Die Wohnung zur Miete in privaten Quartieren bürgerte sich erst später ein, es kam dann aber auch zur Aufweichung der ursprünglich strengen Disziplin, zu Raufereien und grobem Unfug. Durch die Privilegien wurden natürlich auch junge Leute zur Immatrikulation angeregt, die weder willens noch in der Lage waren zu studieren und lediglich ein parasitäres Leben in der betreffenden Universitätsstadt führten. Es blieb schließlich nichts anderes übrig, als auf die akademischen Sonderrechte, vor allem die völlig überforderte akademische Gerichtsbarkeit zu verzichten.
Charakteristisch für die mittelalterliche Universität ist das Bewahren und Tradieren überkommenen Wissens und zur Beweisführung einer wissenschaftlichen These die Bezugnahme auf Autoritäten. Die Gesamtheit des Wissens der einzelnen Fakultäten wurde in Lehrbüchern, den Summen, oder später in Enzyklopädien zusammengestellt, auf die im Unterricht Bezug genommen werden konnte. Unter den Unterrichtsformen findet sich von Anfang an die Vorlesung. Diese hielt sich an einen vorgeschriebenen Text und brachte nach allgemeinen Erläuterungen zu Titel, Autor und Absicht des Buches zunächst den Text, dann Abschnitt für Abschnitt hierzu Erläuterungen und Kommentare. Die Vorlesungen waren inhaltlich (einschließlich der Kommentare) und zeitlich genau festgelegt. Die Texte wurden von den Studenten abgeschrieben, denn Bücher waren auch nach der Erfindung des Buchdrucks sehr teuer und kaum in ihrem Besitz. Auch die Bibliotheken der Universitäten waren klein und kärglich ausgestattet.
Neben der Vorlesung spielte im Mittelalter, vor allem in der Artistenfakultät, die Disputation eine große Rolle, ein wissenschaftliches Streitgespräch, in dem von einem Magister eine These aufgestellt oder in Frage gestellt wurde, die dann durch Opponenten zu widerlegen und durch Defendenten zu verteidigen versucht wurde. Diese wohlinszenierten Veranstaltungen beruhten auf den strengen Regeln der Dialektik, die von der herrschenden Scholastik als Methode der Philosophie gepflegt wurde. Sie dienten dem Zweck, die Studenten in der Präsenz ihres Wissens und in der Schlagfertigkeit ihrer Argumentation zu üben. Das Lehrangebot der Artistenfakultät umfaßte das gesamte bekannte literarische Erbe der klassischen griechischen und römischen Autoren, soweit es inhaltlich nicht der Theologie, der Jurisprudenz oder der Medizin zuzurechnen war. Die Philosophie war von der Theologie beherrscht. Die Theologische Fakultät war in die geistigen und politischen Auseinandersetzungen ihrer Zeit einbezogen. Wissenschaftlich stand sie unter dem Eindruck großer Philosophen wie Albertus Magnus oder dessen Schüler Thomas von Aquin. Berühmt und für lange Zeit wissenschaftlicher Standard war dessen "Summa Theologica". Die Lehre der juristischen Fakultät befaßte sich mit dem von Kaiser Justinian im 6. Jh. verfaßten und unter Irnerius im 12. Jh. in Bologna wieder aufgegriffenen Corpus juris civilis sowie dem Corpus juris canonici und den Lehrmeinungen zeitgenössischer Kommentatoren (Glossatoren). In der Medizin spielten die damals bekannten Werke von Hippokrates, Dioskurides, Plinius, Galen sowie Avicenna eine große Rolle. Von Letzerem stammte der "Medizinische Kanon", der im 12. Jh. von Gerhard von Cremona in Toledo aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt wurde und bis ins 15. Jh. ein Standardwerk der scholastischen Medizin blieb. Avicenna war einer der arabisch sprechenden Arzt-Philosophen der Blütezeit der arabischen Medizin vom 9. bis 12. Jh., der das von Galen in vielen Einzelschriften veröffentlichte medizinische Wissen aus dem Griechischen ins Arabische übersetzte und zusammenfaßte. Daß in den mittelalterlichen Universitäten auch in der Medizin auf Autoren Bezug genommen wurde, ohne die Richtigkeit von deren Aussagen zu überprüfen, ist sehr bezeichnend für jene Zeit. So wurden offenbar unrichtige Darstellungen weiter gelehrt, bis schließlich im Laufe des 16. Jh. zunächst Andreas Vesal und dann weitere Anatomen zahlreiche falsche Vorstellungen ausräumen konnten. Der Blutkreislauf z.B. wurde von William Harvey erst 1627 zutreffend dargestellt.
Die den Übergang zur Neuzeit markierende Renaissance (15./16. Jh.) brachte Europa eine Fülle von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, von wichtigen Erfindungen und Entdeckungen. Der Siegeszug des Humanismus mit der Wiederbelebung der klassischen Sprachen und der Wiederentdeckung der alten Literaturen drängte die als spitzfindig und erfahrungsfremd empfundene Scholastik stark zurück. Die Erfindung des Buchdrucks (J. Gutenberg, um 1450) erleichterte die Verbreitung wissenschaftlicher Texte. Zu den frühen Drucken gehörten auch die Ephemeriden, in denen Regiomontanus (1436 - 1476) die von ihm berechneten Orte der Gestirne für die Jahre 1475 - 1506 verzeichnet hatte. Sie wurden u.a. auch von Kolumbus, Vasco da Gama und A. Vespucci bei ihren Entdeckungsreisen benutzt, die die Hochseeschiffahrt begründeten. Diese Seereisen, ursprünglich zur Entdeckung des Seeweges nach Indien gedacht und alle in den letzten Jahrzehnten des 15. und ersten Jahrzehnten des 16. Jh. durchgeführt, führten zur Entdeckung des amerikanischen Kontinents, die Weltumsegelung Magellans darüber hinaus zu einer Bestätigung der Kugelgestalt der Erde. Kopernikus (1473 - 1543) stellte dem geozentrischen Weltbild des Ptolemäus das heliozentrische an die Seite. Er berechnete die Umlaufzeiten der Planeten um die Sonne. Von ihm führte der Weg der Erkenntnis über Galilei zu Kepler, der die Gesetze der Planetenbahnen exakt beschrieb, und schließlich zu Newton, der die Gravitation als Ursache für diese erkannte. Georg Agricola (1494 - 1555) begründete die Mineralogie und beschrieb das erzgebirgische Berg- und Hüttenwesen. Th. v. Hohenheim, gen. Paracelsus (1493 - 1541) vertrat in der Medizin neue und z.T. revolutionäre Standpunkte, die er in umfangreichen philosophischen Schriften niederlegte. Durchweg ist die wachsende Bedeutung von Beobachtung, Erfahrung und Experiment und die Mathematisierung der Ergebnisse für den Fortschritt der Wissenschaften auffallend. Man hätte daher erwartet, daß der Übergang in die Neuzeit auch für die Universitäten deutliche, wenn nicht abrupte Änderungen ihres Fächerkanons und des Inhaltes der an ihnen gelehrten Wissenschaften gebracht hat. Hinzu kommt nun noch die überragende Bedeutung, die die von Luther 1517 ausgelöste Reformation für die kulturelle und politische Entwicklung in Deutschland hatte.
Nun hat zwar Ph. Melanchthon bereits in seiner Antrittsvorlesung 1518 in Wittenberg "de corrigendis adolescentiae studiis" Studienreformen gefordert, und tatsächlich sind auch fünf neue Universitäten unter dem Eindruck des Humanismus gegründet worden. Die Glaubensauseinandersetzungen hatten die Gründung von acht Universitäten zur Folge. Man kann auch annehmen, daß die wissenschaftlichen Fortschritte mit gewisser zeitlicher Verzögerung Änderungen an den bestehenden Universitäten erzwungen haben, die theologischen Fakultäten wurden durch die Folgen der Reformation notwendigerweise betroffen. Insgesamt entsteht aber der Eindruck der Schwerbeweglichkeit der Universitäten. Man erkennt unschwer, daß sie nicht im Hauptstrom der sich entwickelnden Wissenschaften lagen. Von Nikolaus von Kues über Rene Descartes und G. W. Leibnitz bis zu l. Newton verlief die Entwicklung großer neuer Philosophien fern der Universitäten. Es entwickelte sich auch in der Zeit der Aufklärung im ausgehenden 17. und im 18. Jh. zunehmende Kritik an der "im Zunftwesen erstarrten Universität", die sich mit "gelehrten Grillen" beschäftige. Man dachte an eine Arbeitsteilung mit den Akademien, die nach dem Vorbild der Platonischen Akademien Norditaliens auch in Deutschland entstanden waren. Hierbei sollte letzteren die "Pflege der Wissenschaften", also die Forschung, den Universitäten aber die Ausbildung des akademischen Nachwuchses überlassen bleiben. Bereits 1652 war die spätere Kaiserliche Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher in Schweinfurt gegründet worden. Im Jahre 1700 wurde die von Leibniz angestrebte Akademie als "Societät der Wissenschaften" durch Kurfürst Friedrich IM. gegründet. Im Jahre 1740 machte sie Friedrich der Große zur königlichen Akademie. Im Laufe des 18. Jh. entstanden dann weitere "gelehrte Gesellschaften", die sich später als Akademien etablierten: 1751 die Göttingische, 1759 die churfürstlich Baierische und 1768 die Fürstlich Jablonowskische, die spätere kgl. sächsische Akademie. Im Laufe der Jahre war die Universität immer ausdrücklicher als Staatsdienerschule dargestellt worden. Der Staat hatte durch die Einführung des Staatsexamens für die Juristen und die Mediziner die Festlegung der Ausbildungsnormen übernommen, ebenso ließ das kirchliche Eintrittsexamen die Bedeutung der akademischen Prüfung zurücktreten. Es paßt auch gut ins Bild, daß Friedrich Wilhelm l. von Preußen 1723 in Halle und 1727 in Frankfurt/Oder die ersten Professuren für Kameralistik und Ökonomie einrichten ließ. Die Kameralistik kann als die deutsche Ausprägung des westeuropäischen Merkantilismus angesehen werden. Die in den Universitäten eingeführten Kameral- oder auch Staatswissenschaften umfaßten ein breites Spektrum von Verwaltungs- und Wirtschaftsfächern für Land- und Forstwirtschaft und Gewerbe. Man kann sie als Beginn der Wirtschafts- und Finanzwissenschaftsfächer an den deutschen Universitäten bezeichnen. Interessanterweise befanden sich unter den angebotenen Fächern auch Naturwissenschaften wie Chemie und Botanik, sowie "Technologie", eine allgemeine Beschreibung technischer Verfahren, z.B. auch chemischer oder pharmazeutischer. Gedacht waren alle diese Fächer zur Ausbildung der Verwaltungsbeamten der staatlichen Güter und Forsten und der Manufakturen, es läßt sich aber denken, daß diese auch auf das Interesse privater Grund- und Forstbesitzer und gut situierter Gewerbetreibender zur Ausbildung ihrer Söhne stießen.
Nur ein logischer weiterer Schritt war die Gründung von fachbezogenen Hochschulen in Preußen während des 18. Jh.. Bereits 1724 war in Berlin, das ja bis 1810 keine Universität hatte, das Collegium Medico-Chirurgicum gegründet worden, das bald zu einer blühenden medizinisch-naturwissenschaftlichen Hochschule heranreifte, an der insbesondere die Chirurgen studierten, es folgten die drei Bergakademien in Berlin, Clausthal-Zellerfeld und Freiberg/Sachsen (1770 - 1776), die Tierarzneischule, die Pepiniere (militärärztliche Akademie), die Akademie der Künste, die Bauakademie und das Ackerbauinstitut, alle in bzw. bei Berlin. Man sollte vielleicht bemerken, daß der berühmte Arzt Hufeland der letzte Direktor des Collegium Medico-Chirurgicum bis 1810 war, daß der Begründer der Geologie, A.G. Werner (1749 - 1817) in Freiberg wirkte, und daß der Begründer der Agronomie, A.D. Thaer (1752 - 1828) das Ackerbauinstitut auf Gut Möglin bei Wriezen im Oderbruch gründete. Es ist daher kein Zweifel an dem großen Erfolg der neuen Fachhochschulen möglich. Gegenüber der Universität wurde im letzten Drittel des 18. Jh. außerdem vernichtende Kritik von Seiten der Pädagogen des auf Basedow zurückgehenden Philanthropismus geäußert, die eine völlig verfehlte Lehr- und vor allem das Fehlen einer Erziehungsmethode beklagten. J.H. Campe z.B. forderte in seiner "Allgemeinen Revision des gesamten Schul- und Erziehungswesens..." eine Erziehung "zu Kenntnissen und Geschicklichkeiten, die zur Vorbereitung auf... künftige Berufsgeschäfte erforderlich sind" und beklagte die entstandene sittliche Verwilderung der Studenten. Er schlug vor, die Universitäten "je eher, je lieber aufzuheben". In der Zeit der Aufklärung war stets die Rede von "nützlichen Wissenschaften" und die an den Universitäten gepflegten wurden offensichtlich mindestens zum Teil nicht dazugerechnet. Die Gründung einer Reihe von modernen Universitäten, wie Halle (1694) und Göttingen (1736), die für sich die Freiheit des Philosophierens beanspruchten, die sich dem neuen Wissenschaftsbegriff öffneten und sich dem Postulat von Descartes verpflichtet wußten, nichts für wahr zu halten ohne zureichenden Grund, interferierte dann aber mit den Folgen der französischen Revolution. Die militärischen und politischen Erfolge Napoleons, die 1803 mit dem Reichsdeputationshauptschluß zu einer Neuverteilung der Macht in den deutschen Ländern und 1806 mit der Gründung des Rheinbundes zur Auflösung des Deutschen Reiches führten, hatten die Schließung von 25 Universitäten zur Folge. Den Anfang hatte bereits 1792 Straßburg gemacht, es folgten zwischen 1796 und 1798 die linksrheinischen Universitäten Köln, Mainz, Bonn und Trier, von denen Bonn erst 1786 gegründet worden war. Schon 1803/04 schlossen Bamberg, Dillingen und Fulda, nach dem Frieden von Schönbrunn 1810 Innsbruck und Salzburg. Im Frieden von Tilsit 1807 verlor Preußen seine westelbischen Gebiete an das neugebildete Königreich Westfalen, das 1809 Helmstedt und Rinteln schloß. Preußen legte 1811 seine Universität Frankfurt/Oder mit Breslau zusammen und löste nach dem Wiener Kongreß seine wiedergewonnenen Universitäten Duisburg, Münster, Erfurt, Herbom und Paderborn 1816/18 auf. 1818 vereinigte es Wittenberg mit Halle und gründete Bonn neu. Damit hatte eine im einzelnen nicht immer gelungene Flurbereinigung zum Ausscheiden einiger alter und nicht entwicklungsfähiger Universitäten geführt.
2. Die Universität nach der Humboldt'schen Reform
Die Technischen Hochschulen
Die Berliner Universität, eine Neugründung von beispielhafter Bedeutung für die deutschen Universitäten des 19. Jh., war 1810 unter dem Eindruck des Verlustes der bisherigen preußischen Hauptuniversität Halle nach der Niederlage Preußens 1807 entstanden, in bewußtem Gegensatz zur Entwicklung des Hochschulwesens in Frankreich und als Beitrag zu einer umfassenden Bildungsreform in Preußen. Ihre Entstehung ist mit den Namen von Wilhelm v. Humboldt und seiner Mitstreiter verknüpft, Philosophen des Deutschen Idealismus. Hier müssen vor allem F.W.J. Schelling, F.E.D. Schleiermacher, J.G. Fichte und H. Steffens genannt werden, von denen wesentliche Darlegungen zur Methode und Organisation des akademischen Studiums allgemein, und besonders in Berlin, stammen. In Abkehr von den Anschauungen der Aufklärung war eine "Bildungsanstalt" entstanden, in der der Philosophie eine zentrale Stellung eingeräumt wurde, in der "reine" Wissenschaften zweckfrei betrieben wurden und "angewandte" und technische Wissenschaften keinen Raum haben sollten. Es galt der Grundsatz der Einheit von Forschung und Lehre. Die Anstalt diente der Bildung der Staatsdiener, worunter Theologen, Juristen, Mediziner und nun, nach den Vorstellungen des Beraters von W.v. Humboldt, des in Halle lehrenden Altphilologen F.A. Wolf, auch Philologen verstanden wurden, denen der Gymnasialunterricht anvertraut wurde. Alle Studien wurden mit einem Staatsexamen abgeschlossen, erst danach erfolgte in einem staatlichen (oder kirchlichen) Vorbereitungsdienst die eigentliche berufliche Ausbildung. Daß an der Bildungsanstalt reine Wissenschaften zweckfrei betrieben werden sollten und daß die Anstalt gleichwohl der Bildung der genannten Staatsdiener diente, wurde nicht als Widerspruch aufgefaßt, da nach Fichtes Ansicht diese die allgemeine Gelehrtengemeinde darstellten, die gesellschaftstragende akademische Führungsschicht, im Gegensatz zum nicht gebildeten Volk. Es war ursprünglich durchaus unsicher, unter welchem Namen man diese Bildungsanstalt gründen sollte, pragmatische Überlegungen sprachen schließlich dafür, die traditionelle Form der Universität, auch unter diesem Namen, aufrechtzuerhalten und mit vier Fakultäten auszustatten. Gewisse Bestimmungen sowohl der„Humboldt'schen Schulreform als auch der Statuten der Universität hatten wegen deren Vorbildfunktion für die Universitäten in den anderen deutschen Ländern einschneidende, weitreichende und dauerhafte Konsequenzen:
1. Das "Abiturientenedikt" von 1812 legte das Niveau der für die Zulassung zur Universität erforderlichen Maturitätsprüfung fest. Dabei wurde dem neugeschaffenen humanistischen Gymnasium eine für Jahrzehnte privilegierende Stellung geschaffen, mit einer Überbetonung der Humaniora Studia im Unterricht. Schultypen mit einer stärkeren Betonung der Realia Studia (Realgymnasium und Realschule) entstanden erst wesentlich später, ihre Abschlußexamen berechtigten bestenfalls mit zusätzlichen Prüfungen zum Universitätsstudium. Es kam so zu einem "Immaturenproblem" in bestimmten Studienfächern, z.B. in Nationalökonomie, Chirurgie oder Pharmazie, wo die am Studium Interssierten in der Regel eine gewerbliche Berufsausbildung aufwiesen, aber kein Abitur hatten. Hier mußten von den Einzeluniversitäten in den deutschen Ländern jeweils praktikable Lösungen gesucht werden, die sehr unterschiedlich sein konnten. In Preußen hat man den Pharmazeuten lange Jahre eine besondere Studiendirektion zugemutet, die mit einem detaillierten Stundenplan die Studierfreiheit völlig unterband.
2. In den Statuten der Berliner Universität wurde das Institut der Habilitation eingeführt, einer formellen Qualifikation für selbständige Forschung und Lehre in einem bestimmten Fach. Damit wurde der Status des Privatdozenten geschaffen, die fachliche Festlegung begründete die zunehmende Spezialisierung und damit die starke Zunahme der Anzahl der verschiedenen Fächer in einer Fakultät.
3. Die Statuten stellten die Gleichrangigkeit der Fakultäten fest und beseitigten damit die frühere Position der Artistenfakultät, die sich damit endgültig als philosophische Fakultät emanzipierte. Gleichwohl übertrug man ihr endgültig Funktionen entsprechend den Vorstellungen der Neuhumanisten über die Bedeutung der philosophischen Studien für die allgemeine Bildung. Die philosophische Fakultät erhielt zunächst schon durch die Fülle der ihr zugewiesenen Fächer ein Übergewicht über die anderen Fakultäten. Neben der sich als von der Theologie unabhängigen Fachwissenschaft etablierenden Philosophie sollten ihr auch die Philologie (klassische Sprachen und Altertumswissenschaften), die Staatswissenschaften (Kameralistik), die Mathematik und die Naturwissenschaften angehören. Mit der Anerkennung des Wirtschaftsliberalismus von A. Smith beschränkte sich die bisherige Kameralistik auf die ökonomischen Fächer. Unter den Naturwissenschaften waren die Chemie und die Botanik bisher in der medizinischen Fakultät beheimatet. Es kam daher lange Jahre zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fakultäten um die Zugehörigkeit der beiden Fächer. Viele Chemiker und Botaniker hatten ursprünglich Medizin studiert und legten Wert auf die Zugehörigkeit zur medizinischen Fakultät. Die heute übliche naturwissenschaftliche Fakultät wurde erstmals 1863 in Tübingen verwirklicht und von anderen Universitäten nur zögernd übernommen.
4. Festgeschrieben wurde auch eine zuvor als Entwicklung bereits erkennbare Änderung des Berufungsverfahrens der ordentlichen Professoren: Diese wurden nun nicht mehr für die gesamte Fächerbreite einer Fakultät berufen (und hatten dann je nach Anciennität einen unterschiedlichen Status als Professor primus, secundus oder tertius), sondern als gleichberechtigte Mitglieder des Kollegiums und für bestimmte Fächer. Diese Nominal- oder Hauptfächer waren durch jeweils einen Ordinarius zu besetzen, der dadurch am Ort ohne Konkurrenz war. Es galt das "Nahrungsprinzip", nach dem die Einkünfte einer Fakultät aus Hörgeldern und Prüfungsgebühren, letztere von ganz erstaunlicher Höhe, auf die Professoren dieser Fakultät verteilt wurden. Diese Gelder stellten einen ganz erheblichen Anteil der Einkünfte dieser Professoren dar, so daß keine Tendenz bestand, die Fakultäten durch Erhöhung der Zahl der Nominalfächer auszuweiten. Die fortschreitende Ausdifferenzierung der Wissenschaften führte jedoch zu einer stetig anwachsenden Zahl außerordentlicher Professoren mit geringeren akademischen Mitwirkungsrechten, die aber zusammen mit den Privatdozenten (ohne akademische Mitwirkungsrechte) einen erheblichen Teil der Leistung in Forschung und Lehre beisteuerten. Hier ist die Quelle des "Nichtordinarienproblems", das im 19. Jh. nicht gelöst wurde und das im Prinzip trotz vielfältiger Änderungen im Detail bis in unsere Tage weiterbesteht. Wenn die außerordentliche Professur nicht ohnehin nur ein Titel war und im Universitätsetat nicht erschien, so war sie doch erheblich geringer vergütet als eine ordentliche. Dazu kam, daß sich die Ordinarien das akademische Prüfungsrecht und in den experimentellen Fächern die Laboratorien, das Hilfspersonal und die Sachmittel selbst vorbehielten. Man muß sich vergegenwärtigen, daß sich die Universität des 19. Jh. allmählich zum Großbetrieb mit Instituten, Laboratorien und Kliniken entwickelte, und daß der wissenschaftliche Fortschritt in vielen Fächern immer stärker von der materiellen Ausstattung abhing.
Von 1386 (Gründung der Universität Heidelberg) bis 1500 (Übergang zur Neuzeit) entwickelten sich die Studentenzahlen in Deutschland von einigen hundert bis zu knapp 3000, bis zum Dreißigjährigen Krieg waren dann immerhin 8000 erreicht. Für die Mitte des 18. Jh. wird mit 8500 gerechnet. Für 1796 kann man bei 39 Universitäten in den deutschen Ländern eine Durchschnittsuniversität mit 20 ordentlichen (o.) und 3-4 außerordentlichen (ao.) Professoren und mit etwa zwei sonstigen Dozenten sowie etwa 200 Studenten errechnen. Es gab aber viel kleinere Universitäten: Rostock, Greifswald, Erfurt, Paderborn, Altdorf, Duisburg und Fulda hatten weniger als 100 Studenten (und nur die beiden ersten überlebten das große Universitätssterben). Größere Universitäten waren Leipzig (720 Studenten), Jena (561), Göttingen (874) und Halle (1076). Im Jahre 1860, als es nur noch 19 Universitäten im Deutschen Bund gab, hatte die Durchschnittsuniversität 29 o. Professoren und 20 - 21 ao. Professoren, daneben 22 Privatdozenten und etwa 600 Studenten. Tatsächlich studierte jedoch die Hälfte aller Studenten an den fünf Universitäten Berlin, München, Breslau, Leipzig und Bonn. Als Beispiel für eine große Universität seien die Verhältnisse in Berlin im Wintersemester 1886/87 genannt. Bei 73 o. Professoren und 81 ao. Professoren sowie 123 Privatdozenten betrug die Studentenzahl 5242 (plus 1550 immature "Gasthörer"). Etwa 1700 Studienabschlüsse durch kirchliches oder Staatsexamen im gesamten Studienjahr waren zu erwarten, daneben wurden an Promotionen verzeichnet: eine theologische, fünf juristische, 70 philosophische und 127 medizinische. Der philosophischen Fakultät gehörten 40 o. Professoren (55 % aller o. Professoren der Universität) und 1921 Studenten (37 % aller Studenten der Universität), der medizinischen Fakultät 15 o. Professoren (21 %) und 1274 Studenten (24 %), der juristischen Fakultät 10 o. Professoren (14 %) und 1262 Studenten (24 %) und der ev. theologischen Fakultät 8 o. Professoren (11 %) und 785 Studenten (15%) an.
Für 1907 wurden in Deutschland an 21 Universitäten 1437 o. Professoren, 862 ao. Professoren, 1324 Privatdozenten und 41235 Studenten gezählt, eine Durchschnittsuniversität hätte damals 68 o. und 41 ao. Professoren, 63 Privatdozenten und 1964 Studenten gehabt. Insgesamt gesehen, wuchs die Studentenfrequenz im Laufe des 19. Jh. und darüber hinaus bis zur Mitte des 20. Jh. langsam und recht unstetig, aber etwas rascher als die Bevölkerungszahl. Im Studienjahr 1950/51 lag sie bei 80000, entsprechend 0,16 % der Bevölkerung. Der sich in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts anschließende zunehmende Anstieg bis zuletzt auf weit mehr als 1 Mio. Studierende ist dagegen etwas qualitativ Neues und läßt sich nicht ohne weiteres im Zusammenhang mit den früheren Zahlen diskutieren.
Nachdem in der Schweiz bereits seit 1840, in den angelsächsischen Ländern seit 1850 und in den skandinavischen Ländern seit 1870 Frauen zum Studium zugelassen wurden, konnten in Preußen Frauen mit Zustimmung des Dozenten ab 1896 als Gasthörerinnen und in den anderen deutschen Ländern erst ab 1908 allgemein zum Universitätsstudium zugelassen werden.
Die in den Statuten der Berliner Universität zum Ausdruck kommende preußische Universitätsreform fand in den deutschen Ländern große Zustimmung sowohl bei den Kultusministern, als auch bei den Universitäten, die alsbald mit ihrer Neuorganisation begannen. Die hierbei allgemein deutlich werdende Geringschätzung der angewandten, sogenannten Brotwissenschaften und die Hinwendung zu zweckfrei betriebenen "reinen" Wissenschaften ließ jedoch gerade am Beginn der industriellen Entwicklung in Deutschland die Notwendigkeit erkennen, geeignete höhere Lehranstalten für technische Wissenschaften zu schaffen. Dies sollten nun aber nicht fachgebundene "Specialschulen" sein, wie sie Humboldt in seinem Königsberger und Litauischen Schulplan wenigstens für Handwerker vorgesehen hatte, sondern polytechnische Schulen, die auf einem breiten, streng mathematischnaturwissenschaftlichen Grundstudium den eigentlichen höheren technischen Fachunterricht aufbauten, wobei man von einem inneren organischen Zusammenhang aller technischen Fächer ausging, die damit in einer Schule zu integrieren waren.
Das Vorbild war die Ecole Polytechnique, die 1794 durch L.N. Camot, G. Monge und andere in Paris gegründet worden war. An dieser in wenigen Jahren weltberühmt gewordenen Schule sollte den Studierenden die mathematisch-naturwissenschaftliche Vorbildung für die anschließenden technischen Studien an ecoles speciales gegeben werden. Leitprinzip war die Anwendbarkeit der wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnisse auf praktische Probleme. Der theoretische und praktische Unterricht fand nicht nur in Hörsälen, sondern auch in Übungsräumen und Laboratorien statt, wo sich Forschung und Lehre verbanden. Im deutschsprachigen Raum begann die Entwicklung in einer merkwürdigen Wiederholung der ersten Universitätsgründungen im Mittelalter in Prag, wo 1806 das Ständische Polytechnische Institut gegründet wurde, und in Wien, wo 1815 das Polytechnische Institut eröffnet wurde. Die erste polytechnische Schule in den Ländern des späteren Deutschen Reiches wurde 1825 in Karlsruhe gegründet, danach entstanden im Jahrzehnt zwischen 1827 (München) und 1836 (Darmstadt) in den übrigen Ländern weitere Institute. Lediglich Aachen (1870) bildete einen späten Nachkömmling. Allen Schulen gemeinsam war der Anspruch auf einen der Universität vergleichbaren Hochschulrang und die Überzeugung, daß die durch die innere Einheit aller technischen Fächer bedingte Organisation der polytechnischen Schulen weder in einzelne Fachhochschulen aufgelöst, noch in die Universitäten als technische Fakultät integriert werden könne. Allerdings war der Anspruch auf einen Hochschulrang einstweilen nur für die Wiener und, nach deren Reorganisation durch K.F. Nebenius, für die Karlsruher Anstalt gerechtfertigt. Die allgemeine Durchsetzung erforderte dann jahrzehntelange Auseinandersetzungen mit den Ministern, vor allem aber mit den Universitäten, die ihre Privilegien natürlich nicht kampflos aufgaben. Sie betonten den Charakter der polytechnischen Schulen als reine Unterrichtsanstalten, die in Preußen nicht einmal dem Kultus-, sondern dem Handelsministerium unterstanden, und die einen gebundenen Schulunterricht durchzuführen hätten. Die dennoch unaufhaltsame Entwicklung dieser Schulen in Richtung auf technische Hochschulen muß neben der außerordentlichen Entwicklung der Technik im 19. Jh. in Deutschland vor allem auf die zwingende Argumentation eines Kreises führender Köpfe zurückgeführt werden, deren geistige Bedeutung dem des Kreises um W.v. Humboldt nicht nachsteht. Neben J.J. Prechtl und K.F. Nebenius sind dabei vor allem F. Redtenbacher, F. Reuleaux und F. Grashof zu nennen, Pioniere des wissenschaftlichen Maschinenbaus. Auf diese gehen grundlegende und programmatische Publikationen zurück, die die Entwicklung der technischen Hochschulen betrafen. Nicht übersehen darf man in diesem Zusammenhang auch die außerordentliche Durchsetzungskraft des 1856 gegründeten "Verein Deutscher Ingenieure", hinter dem nicht nur die Professoren der polytechnischen Schulen, sondern auch die deutsche Industrie standen, deren Interesse natürlich die Entwicklung der polytechnischen Schulen sein mußte. Auch die Gründung der großzügig zugeschnittenen Eidgenössischen Polytechnischen Schule in Zürich 1855 bedeutete einen erheblichen Schub für die Entwicklung der deutschen Polytechnika zu Hochschulen. Durch die Berufung von ganz hervorragenden Fachgelehrten auf ihre Lehrstühle konnte sie sehr klarmachen, welch hohen Rang sie einzunehmen willens war und auch einnahm. Ihre große philosophisch-staatswissenschaftliche Abteilung mit Persönlichkeiten wie dem Ästhetiker F.Th. Vischer oder dem Kunsthistoriker J. Burckhardt zeigt sehr deutlich, daß man den Studierenden über ihre technischen Fächer hinaus eine gediegene "allgemeine" Bildung zukommen lassen wollte. Solche Auffassungen hatten bereits Nebenius und Redtenbacher vertreten, so daß Zürich hier ein willkommenes Beispiel bot.
Die angestrebte und zwischen 1865 (Karlsruhe) und 1879 (Berlin, Hannover, Aachen) erreichte Hochschulverfassung aller polytechnischen Schulen - die offizielle Bezeichnung "Technische Hochschule" wurde ihnen z.T. erst wesentlich später verliehen - umfaßte die Gleichstellung der Professoren mit Universitätsprofessoren, das Berufungsverfahren und das Vorschlagsrecht, die Assistenz, die Habilitation und die Privatdozentur, die Rektoratsverfassung mit akademischem Senat, die Gliederung in Sektionen oder Abteilungen, entsprechend den Fakultäten, das Abitur als Zugangsvoraussetzung, Studien- und Lehrfreiheit, sowie das Recht der Professoren auf Forschung. Die Verleihung des Promotionsrechtes als Schlußstein erfolgte allerdings erst 1899. Gerade hierum war jahrzehntelang mit den Universitäten gerungen worden. Die Promotion hatte aber für die verschiedenen Fächer eine sehr unterschiedliche Bedeutung. Während zuvor sehr viele Chemiker im Anschluß an ihr Studium an der Technischen Hochschule eine Promotionsarbeit an einer Universität durchgeführt hatten, wodurch den Professoren an den Technischen Hochschulen ein ständiger Verlust an Forschungskapazität entstand, war die Häufigkeit einer Promotion z.B. im Maschinenbau kleiner als 10 % der Studienabschlüsse. Offenbar war der Schwierigkeitsgrad für den Doktor-Ingenieur unverhältnismäßig hoch. Viel wichtiger war das ebenfalls zur Jahrhundertwende eingeführte Diplomexamen, das den Technikern den (geschützten) Titel des Diplom-Ingenieurs verschaffte. Worum ebenfalls gerungen wurde, war die Zulassung der Absolventen der Technischen Hochschulen zum höheren Staatsdienst, je nach Studiengang zum höheren Lehramt oder zu den technischen Beamtenlaufbahnen, etwa bei der Reichsbahn.
Von Auseinandersetzungen war die Entwicklung der Technischen Hochschulen aber stets begleitet. Neben der Auseinandersetzung mit Bestrebungen, Teile mit der Universität zu vereinigen, z.B. von F. Klein und seiner "Göttinger Vereinigung zur Förderung der angewandten Physik und Mathematik", waren es vor allem Auseinandersetzungen zwischen "Theoretikern" und "Praktikern" innerhalb der Technischen Hochschule. Hier ging es um die Bedeutung der Naturwissenschaften und vor allem der Mathematik an diesen Hochschulen als zweckfrei betriebene Grundlagenwissenschaften oder als Hilfswissenschaften, die die praktischen Belange der Ingenieure zu berücksichtigen haben, und um den Stellenwert empirisch betriebener technischer Forschung, besonders im Maschinenbau. Die hieraus resultierende Unruhe gab der Entwicklung der Methoden technischer Forschung und dem Ausbau technischer Unterrichts- und Forschungslaboratorien starke Impulse. Es entstand hieraus erst die Technische Hochschule, wie wir sie kennen, als Vielzahl von Instituten, Laboratorien, Versuchs- und Prüfungseinrichtungen.
Im Verlauf des 19. Jh. war damit neben der Universität ein weiterer Zweig des tertiären Bildungsbereiches entstanden, der, im Gegensatz zu jener, ausdrücklich die Wissenschaften nicht "um ihrer selbst willen und zweckfrei", sondern unmittelbar auf einen Anwendungszweck, "auf ihre Anwendung im Leben" gerichtet betrieb. Für das Wiener Institut hatte Prechtl 1810 eine Systematik von drei unterschiedlichen technischen Richtungen entwickelt, Nebenius hatte 1832 für Karlsruhe nach einer zwei-klassigen mathematischen Vorbereitungsschule fünf Fachabteilungen vorgesehen. Zum Ende des 19. Jh. war eine typische Technische Hochschule aus sechs Abteilungen aufgebaut:
1. Allgemeine Wissenschaften: Philosophie, Mathematik, Physik, Bio- und Geowissenschaften
2. Chemie und Hüttenwesen
3. Architektur und Kunstgeschichte
4. Bauingenieur- und Vermessungswesen
5. Maschinenbau
6. Elektrotechnik
Auch hinsichtlich der Studentenzahlen stellten die Technischen Hochschulen beachtliche Gegenspieler der Universitäten dar. Tatsächlich bestand eine negative Korrelation der Zu- und Abnahme der Frequenzen in bestimmten Studienfächern zwischen Universität und Technischer Hochschule. Das Wiener Institut hatte bereits 1818 eine Frequenz von 500 Studenten, 1848 waren es 2000 geworden. Die neun deutschen Institute hatten seit 1870/71 stark steigende Frequenzen, 1871/72 waren es insgesamt 4710 Studenten, 1891/92 über 6000 nach einem vorübergehenden Rückgang auf die Hälfte, was kleinere Institute wie Darmstadt oder Aachen mit der Schließung bedroht hatte. Für 1886/87 werden für die drei preußischen Technischen Hochschulen Aachen, Berlin und Hannover folgende Zahlen von Professoren und Studenten in den verschiedenen Abteilungen genannt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1901/02 studierten dann mit 16590 halbsoviele Studenten wie an den Universitäten, 1920/21 waren es etwa 23000 (26 % der Universitätsstudenten), 1933 etwa 13000 (19 %), 1936 etwa 11000 (23 %) und im Studienjahr 1970/71 an den acht in der Bundesrepublik liegenden Technischen Hochschulen 67215 Studierende, entsprechend 25 % der an den Universitäten Studierenden. Seit 1919 waren auch die Rektoren der Technischen Hochschulen Mitglieder der Deutschen Rektorenkonferenz (nach 1945 der Westdeutschen Rektoren Konferenz). Nach 1967 wurden die Technischen Hochschulen mit Ausnahme der RWTH Aachen in Universitäten oder technische Universitäten umbenannt. Berlin und München hatten schon zuvor die Bezeichnung "Technische Universität" getragen.
Diese Umbenennung von Technischen Hochschulen zu Universitäten zeigt vielleicht besonders deutlich, daß die Vorstellungen der Berliner Universitätsgründer um W. v. Humboldt von der zweckfreien Beschäftigung mit reinen Wissenschaften in Forschung und Lehre entweder von Anfang an eine Fiktion gewesen sind oder im Laufe der Entwicklung im 19. Jh. zur Fiktion wurden. Sie war aber keineswegs das erste Zeichen dafür. Schon zuvor wurden einige Heilberufe, die traditionell eine handwerkliche Ausbildung hatten und deren Grundlagen sehr zweckbezogene angewandte Wissenschaften darstellten, durch Einführung entsprechender Lehrstühle und Studiengänge in den Kreis der akademischen Berufe aufgenommen. Schon von Humboldt selbst wurde mit C.F. v. Graefe ein hervorragender Chirurg an die Berliner Universität geholt, der dieses Fach innerhalb der medizinischen Fakultät etablierte und seiner Bedeutung entsprechend ausbaute. Dies bedeutete einen grundsätzlichen Bruch mit der bisherigen sorgfältigen Unterscheidung der Ausbildung und Zuständigkeit von Medizinern und Wundärzten und die Begründung einer einheitlichen und umfassenden Medizin unter Einschluß der Chirurgie. Konsequenterweise wurde das Collegium Medico-Chirurgicum, an dem die Wundärzte vorher studiert hatten, geschlossen. Für eine Übergangszeit konnten diese dann, sofern sie die Hochschulreife nicht hatten, als Immature, an der Universität studieren. Andere Universitäten verhielten sich entsprechend.
Neben den Chirurgen waren im 19. Jh. die Pharmazeuten eine weitere große Gruppe von Immaturen, seit die pharmazeutischen Prüfungsordnungen die Möglichkeit eines Studiums zur Verkürzung der Gesellenzeit einräumten. Zur Vorbereitung auf das schwierige Staatsexamen wurde hiervon zunehmend Gebrauch gemacht. Nach 1875 wurde dann reichseinheitlich ein Pharmaziestudium obligat. Das Studium umfaßte neben den Naturwissenschaften Chemie, Physik und Botanik auch einige medizinische Fächer sowie eine spezielle pharmazeutische Chemie und eine später als Pharmakognosie bezeichnete Drogenkunde. Lehrstühle für Pharmazie oder Pharmazeutische Chemie waren seltene Ausnahmen. Erst 1920 wurden im Zuge größerer Reformen in Preußen und im Reich Lehrstühle und eigene pharmazeutische Institute eingerichtet und auch für das Pharmaziestudium das Abitur als Eingangsvoraussetzung eingeführt. Interessant ist allerdings, daß die berufsspezifische pharmazeutische Technologie als "angewandte" Wissenschaft stets sorgfältig aus dem Universitätsstudium ausgegliedert blieb und erst in der Approbationsordnung von 1971 als Lehrfach auftauchte.
Auch die Tierheilkunde ist als angewandte Wissenschaft zu bezeichnen. Die gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jh. entstandenen Tierarzneischulen in Hannover, Dresden, Berlin, München, Stuttgart und Gießen hatten sich zu Beginn unseres Jahrhunderts zu tierärztlichen Hochschulen mit Promotionsrecht entwickelt und wurden bis auf Hannover, das selbständig blieb, und Stuttgart, das geschlossen wurde, zwischen 1914 und 1923 zu veterinärmedizinischen Fakultäten der jeweiligen Universitäten, die Tierärztliche Hochschule Dresden wurde nach Leipzig verlegt.
Die Zahnmedizin, die zuvor und bis in unser Jahrhundert von handwerklich ausgebildeten Dentisten ausgeübt wurde, entsproß als Universitätsfach der Chirurgie. Vor etwa 100 Jahren entstanden innerhalb der chirurgischen Polikliniken - zunächst private -Anstalten, die zu Beginn des 20. Jh. in die medizinischen Fakultäten eingegliedert wurden. 1909 wurde reichseinheitlich eine Studienordnung für Zahnmedizin erlassen, 1919 erhielt dieses Fach das Promotionsrecht und 1952 wurde schließlich ein einheitlicher Berufsstand der Zahnärzte errichtet. Die bisherigen Dentisten bekamen die Approbation, wenn sie bestimmten Bedingungen genügten, die existierenden Dentistenschulen wurden geschlossen.
Diese Beispiele, die durch weitere aus anderen Fakultäten, etwa aus den Sozial- und aus den Wirtschaftswissenschaften, vermehrt werden könnten, zeigen die deutsche Universität in einem Entwicklungsprozeß von der ursprünglichen Bildungsanstalt für Staatsdiener zu einem vielgestaltigen tertiären Bildungssystem.
3.Die Entwicklung im 20. Jahrhundert
Nach der überaus erfolgreichen Reform der Universität durch W. v. Humboldt und den Kreis der Neuhumanisten und Deutschen Idealisten zu Beginn des 19. Jh. sind bis in unsere Tage Reformen im Sinne einer Verwirklichung von neuen Ideen hinsichtlich Gestalt und Zielen der Institution Universität rar geblieben. Diskussionswürdige Ideen wurden zahlreich produziert, publiziert und auch diskutiert, aber zu einer erfolgreichen Verwirklichung sind wohl stets außergewöhnliche Umstände erforderlich und ein breiter Konsens aller beteiligten Gruppen. Jedenfalls lassen sich Reformen nicht entgegen dem Machtgefälle erzwingen. So blieben die im Zusammenhang mit der bürgerlichen Revolution 1848 in zahlreichen Versammlungen und Sitzungen diskutierten Entwürfe völlig wirkungslos und wurden von den restaurativen Kräften "ausgesessen". Sie betrafen eine zu verstärkende Autonomie der Universitäten gegenüber dem Staat (was diesem nicht paßte) und neben strukturellen Veränderungen z.B. eine Aufnahme der Extraordinarien in die Fakultäten. Diese forderten Mitwirkungsrechte und die Beteiligung an den Einnahmen der Fakultäten entsprechend dem Anteil ihrer Unterrichtslasten (was den Ordinarien nicht paßte).
Unter günstigeren Auspizien standen die Reformvorhaben von C.H. Becker nach dem Ende des ersten Weltkrieges. Becker war von 1919 bis 1930 in den verschiedenen Regierungskoalitionen entweder preußischer Kultusminister oder Staatssekretär in diesem Ministerium und widmete einen großen Teil seiner Kraft und Zeit der Universitätsreform. Er konnte den strukturellen Teil seiner Pläne durchsetzen und beispielsweise die Extraordinarien in die bisher den Ordinarien vorbehaltenen Fakultätsgremien eingliedern. Dies führte allerdings dazu, daß der "außerplanmäßige Professor" als neuer Titularprofessor eingeführt wurde, weshalb sich am Nichtordinarienproblem eigentlich nichts änderte. Er richtete die Studentenschaften als Körperschaften ein und führte Studienreformen für verschiedene Studiengänge durch. Da Preußen für die anderen deutschen Länder seine Vorbildfunktion behalten hatte, fanden die Neuerungen auch dort rasch Eingang. Der ideelle Teil seiner Reformpläne wurde dagegen nicht realisiert. Er betraf insbesondere eine "pädagogische Reform" der Universität, eine Straffung und Systematisierung der akademischen Lehre. Hierzu wurde von ihm ein mittleres Lehrpersonal für erforderlich gehalten, das ja als "Mittelbau" erst in den Sechzigerjahren verwirklicht wurde. Obwohl sich Becker, noch ganz im Sinne v. Humboldts, gegen jede Neugründung von Spezialschulen wandte, ist doch andererseits er der Schöpfer der preußischen Pädagogischen Akademien zur Ausbildung der Volksschullehrer. Hier allerdings folgten ihm die anderen Länder des Reiches nicht geschlossen, so daß bis heute das Pädagogikstudium in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich an Universitäten oder an Pädagogischen Hochschulen beheimatet ist, wobei letztere neben den Universitäten die einzigen "Wissenschaftlichen Hochschulen" sind. Allerdings hat sich die universitäre Ausbildung weitgehend durchgesetzt, so daß von den zahlreichen Gründungen von Pädagogischen Hochschulen seit 1926 und besonders nach 1945 nur die acht aus Baden-Württemberg übriggeblieben sind.
Grundlegende Gedanken zur Bildung und Erziehung des Kindes in der Schule sind bereits von J.A. Comenius im 17. Jh., von J.B. Basedow, J.H. Campe und den anderen Philanthropisten sowie von J.H. Pestalozzi im 18. Jh. geäußert worden, doch ist der Beruf des Volksschullehrers erst seit Ende des 18. Jh. anerkannt und Lehrerseminare sind erst im 19. Jh. in steigender Zahl errichtet worden. J.J. Heckers Kurmärkisches Landschullehrerseminar von 1753 war wohl ein früher Vorläufer. Die Lehrerseminare waren auf einen Volksschulabschluß und ein Lehrverhältnis der Seminaristen vor Beginn ihres Studiums aufgebaut und begannen dementsprechend mit einem zwei bis vierjährigen Vorkurs, auf den sich dann der dreijährige Hauptkurs aufbaute. Erst nach 1919 wurde im Deutschen Reich eine akademische Ausbildung an Universitäten oder pädagogischen Akademien eingerichtet, nach 1945 wurde dann die Hochschulreife vorausgesetzt.
Nach dem Kriegsende 1945 wäre eine Gelegenheit gewesen, dringend notwendige Reformen der Universität durchzuführen. Das Dritte Reich hatte an den deutschen Universitäten riesige Zerstörungen und den Verlust zahlreicher Gelehrter durch deren Emigration oder Ermordung in den Konzentrationslagern zur Folge gehabt. Nicht verwirklichte Pläne aus der Zeit vor 1933 waren noch vorhanden. Nun war aber Deutschland geteilt und die beiden Teile gehörten unterschiedlichen politisch-ideologischen Lagern an. Die sich 1949 konstituierende DDR führte im Laufe ihrer Existenz bis 1989 eine ganze Zahl von Reformen durch, die aber aus den Universitäten und anderen Hochschulen anders konzipierte Institutionen machten, die den gesellschaftlichen Vorstellungen des sozialistischen Staates entsprachen. Bemerkenswert ist für uns die Trennung von Lehre und Forschung, welch letztere an die Institute der Akademie der Wissenschaften der DDR abwanderte. In der Bundesrepublik, die sich ebenfalls 1949 konstituierte, wurden Planungen, Gutachten und Studien von Arbeitskreisen bekannt, die lange und intensiv diskutiert, aber schließlich doch nicht in die Tat umgesetzt wurden. Vielleicht, weil die Kulturhoheit auch nun bei den Ländern lag und ein Vorreiter wie Preußen fehlte, das in der Weimarer Republik eine faktische Führungsrolle übernommen hatte.
Ein großes Anliegen der Reformer war es, bei der steigenden Zahl von Studierenden und der unaufhaltsamen weiteren Differenzierung der wissenschaftlichen Fächer einen Kern der Humboldt'schen Universitätsidee, ein Mindestmaß an Gemeinsamkeit und Allgemeinbildung am Leben zu erhalten. Die von den Reformern angesprochenen Problemkreise betrafen z.B. die Einheit von Forschung und Lehre angesichts der notwendigerweise immer spezieller werdenden Forschung und der ebenso immer umfassender werdenden Lehre. Die Forschung hatte neben ihrer Spezialisierung zuerst in den Naturwissenschaften, dann auch in den Sozialwissenschaften zu einem arbeitsteiligen, betriebsähnlichen Institutssystem geführt, in dem den Ordinarien die Rolle der unabhängigen "Chefs" zukam, die als Forschungsmanager füngierten, während unter ihnen in völlig abhängiger Position Assistenten tätig waren, ohne berufliche Entwicklungschancen in einem "interimistischen" Zustand und, sofern habilitiert, mit der einzigen Hoffnung, auf einen Lehrstuhl an einer anderen Universität berufen zu werden.
In der Lehre, die von den gleichen Professoren in didaktischer Hinsicht ohne besondere Unterweisung oder Qualifikation angeboten wurde, war längst der Übergang von den wenigen klassischen Fächern zu einer ständig wachsenden Zahl von Studiengängen erfolgt, die zur Ausbildung für bestimmte Berufe konzipiert wurden.
Der durchschnittliche Studierende hatte zunehmend Schwierigkeiten, die Studierfreiheit sinnvoll zu nutzen und verlangte einen konkreten Studienplan mit abgestimmten Stundenplänen, während er gleichzeitig die zunehmende Verschulung des Studiums beklagte. Diese Entwicklung bedeutete, insbesondere bei der ständig und kräftig ansteigenden Zahl der Studierenden, auch eine steigende Zahl von Klausuren, Zwischen- und Abschlußprüfungen und -arbeiten als zusätzliche Belastung der Professoren und ihrer Assistenten. Die Studierenden mußten bei der sehr unterschiedlichen Begabung und Begeisterung der Professoren für die Lehre den Eindruck gewinnen, daß diese Aufgaben gegenüber der Forschung von nachgeordneter Bedeutung seien und weniger gepflegt würden. Professoren, Dozenten und Assistenten andererseits war klar, daß sie sich im Wettbewerb um Mittel und Stellen nur mit ihren Forschungsergebnissen und nicht mit der Qualität ihrer Lehre profilieren konnten. Nicht übersehen werden darf in diesem Zusammenhang, daß in den Instituten der theoretischen Medizin neben der ähnlich arbeitsteiligen Forschung auch eine z.T. sehr umfangreiche diagnostische und gutachterliche Routine zu bewältigen war und im klinischen Bereich ganz entsprechend die Krankenversorgung, die einen Gutteil der Arbeitszeit in Anspruch nahmen.
Als überaus wirkungsvoll stellte sich die Tätigkeit des Wissenschaftsrates heraus, der 1957 aufgrund eines Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern berufen worden war und ab 1960 begründete und detaillierte Empfehlungen zur Struktur und zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen machte. Der personelle Ausbau führte zu einer wesentlichen Vermehrung der Zahl der Lehrstühle und zu so wichtigen Neuerungen wie Parallel-Lehrstühlen an einem Institut oder dem schon von H.C. Becker gewünschten Mittelbau, den Akademischen und Wissenschaftlichen Räten als mittlerem Lehrpersonal in beamteten Dauerstellungen. Vor allem führten die Empfehlungen aber zum Ausbau bestehender Universitäten, vielfach auch zum Neubau außerhalb der Stadtkerne, nach 1965 aber auch zur Neugründung einer ganzen Reihe von Universitäten, vielfach durch Erweiterung von pädagogischen Hochschulen. Unter den 20 Neugründungen waren auch 5 Gesamthochschulen, ein später nicht mehr weitergeführter Typ neuartiger integrierter Hochschulen mit Durchlässigkeit zwischen Fachhochschul- und Universitätsstudiengängen, sowie zwei medizinische Akademien. Die Verbesserung der Studiensituation läßt sich am einfachsten aus der Änderung des Betreuungsverhältnisses ablesen: entfielen noch 1960 auf jede Wissenschaftlerstelle an der Universität 15 Studierende, so waren es 1970 nur noch neun.
In gewissem Sinne kontraproduktiv war dagegen die Tätigkeit eines anderen Beratungsgremiums. Der Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen (Vorläufer des Deutschen Bildungsrates bis zu dessen Gründung 1965), der 1959 einen Rahmenplan zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des allgemeinen öffentlichen Schulwesens verabschiedet hatte, wies ebenso wie Veröffentlichungen aus dem Max-Planck-lnstitut für Bildungsökonomie und internationale Studien der OECD sowie schließlich die Bedarfsfeststellung 1961 - 1970 der Ständigen Konferenz der Kultusminister von 1963 auf die Rückständigkeit des deutschen Bildungswesens im Vergleich zu seinen künftigen Aufgaben hin. Dies wurde 1962 als "Bildungsnotstand" bekannt. 1964 wurde von G. Picht die "Bildungskatastrophe" verkündet und von R. Dahrendorf "Bildung als Bürgerrecht" propagiert. Die Argumente betrafen einen dauernd zunehmenden Mangel an Lehrern und Schulraum für alle Schularten, einen Mangel an Abiturienten und Absolventen mit mittleren Abschlüssen, die geringeren Bildungschancen der Landbevölkerung und der Arbeiter und eine unterschiedliche Bildungsmöglichkeit in verschiedenen Bundesländern. Eine intensive Bildungswerbung nach dem Motto: "Schickt eure Kinder länger auf bessere Schulen", die fast zur Austrocknung der Hauptschulen führte, ließ nach wenigen Jahren den Strom der Studienanfänger an den Universitäten ins Ungeahnte anschwellen. Während 1950/51 noch 79770 Studierende gezählt wurden, waren es 1960/61 bereits 161792, 1970/71 dann 273228, 1980/81 schon 586452 und 1991/92 schließlich 1780000. Für diese Zahl an Studierenden standen aber nur 900000 Studienplätze zur Verfügung und das Betreuungsverhältnis war wieder auf den Stand von 1960 (s.o.) gesunken.
Es war allerdings nicht nur der anschwellende Strom der Erstsemester, der diese gewaltige Zunahme der Zahl der Immatrikulierten verursachte (die Zahl der Studienanfänger lag 1991 um 65 % über der Zahl von 1977), sondern auch eine deutlich erhöhte Verweildauer von etwa 7 Jahren an der Universität (die Zahl der Absolventen stieg im gleichen Zeitraum nur um 41 %), die auch durch Wechseln des Studienganges oder ein anschließendes Zweitstudium verursacht wurde. Die Gründe für den Entschluß, nach dem Abitur zu studieren, den mittlerweile etwa 50 % eines Jahrganges fassen, sind vielfältig und haben nicht nur mit den persönlichen Interessen und den Vorstellungen über die Chancen am Arbeitsmarkt zu tun. Sie betreffen auch die Vorstellungen über die Gestaltung des mit dem Studium beginnenden Lebensabschnitts. Die Gründe für die Dauer der Studienzeit liegen z.T. in unklaren Vorstellungen über den Inhalt der gewählten Studienfächer und den erforderlichen intellektuellen Einsatz für das Studium, aber auch an den durch den Massenbetrieb verursachten Studienbedingungen.
In den letzten Jahren wurde mit großem Aufwand, jedoch bisher ohne sichtbaren Erfolg untersucht, wie den Universitäten, die unter der Überlast zusammenzubrechen drohen, nachhaltig zu helfen wäre. Jeder Ansatz muß jedoch von dem verfassungsmäßigen Recht jedes Bürgers ausgehen, sofern er die Voraussetzungen erfüllt, ein Studium seiner Wahl zu betreiben. Eine Steuerung nach ökonomischen oder auch nur bildungsökonomischen Gesichtspunkten ist daher in der Bundesrepublik ausgeschlossen. Die Begrenzung der Zahl der Studierenden für ein Fach und für bestimmte Universitäten als Numerus Clausus ist nur unter strengen Kriterien zulässig, wie das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen ab 1972 feststellte. Danach sind Zulassungsbeschränkungen nur in den Grenzen des unbedingt Erforderlichen und unter erschöpfender Nutzung der Ausbildungskapazitäten zulässig. Zulassungen und Ablehnungen müssen für die Betroffenen transparent und nachvollziehbar sein, weshalb der Gesetzgeber objektivierte und nachvollziehbare Kriterien für die Kapazitätsermittlung festlegen muß. Im Rahmen eines Staatsvertrages wurde daraufhin 1973 die Zentralstelle zur Vergabe von Studienplätzen (ZVS) in Dortmund gegründet, die bis heute existiert und die Studienplätze für die begehrten Studiengänge auf Antrag zentral vergibt. Die Grundlage zur Festlegung der Höchstzahl zuzulassender Studierender für ein Studienfach ist die von der ZVS erarbeitete und mehrfach verbesserte Kapazitätsverordnung, die seit 1975 die Berechnung der personellen Kapazität einer Lehreinheit zuläßt. Hierfür mußte erstmals die Lehrverpflichtung der Professoren und anderer Mitglieder des Lehrkörpers als "Lehrdeputat" zahlenmäßig festgelegt werden. Für Professoren, aber auch für die meisten anderen Aufgeführten beträgt diese 8 Wochenstunden während des Semesters. Natürlich hat diese Möglichkeit, über die Rechenformel der Kapazitätsverordnung die Zahl der Studienplätze in einem bestimmten Studienfach an einer bestimmten Universität auszurechnen, zu einer großen Zahl von Prozessen geführt, in denen sich vermeintlich zu unrecht abgewiesene Studienbewerber in begehrte Studiengänge, vor allem Medizin, in nicht wenigen Fällen mit Erfolg hineinzuklagen versuchten. Ende der Siebzigerjahre zeichnete sich ab, daß an allen deutschen Universitäten für alle Studiengänge ein Numerus Clausus verhängt werden müßte. Ein weiterer Ausbau der Universitäten in erforderlichem Umfang war nicht bezahlbar und vor allem waren keine personellen Reserven für den Lehrkörper mit der erforderlichen wissenschaftlichen Reputation mehr vorhanden. Um diese Aushöhlung des Grundgesetzes nicht offensichtlich werden zu lassen, beschlossen die Ministerpräsidenten der Länder 1977, auf einen Numerus Clausus in den geisteswissenschaftlichen Fächern zu verzichten. Sie bürdeten mit diesem "Öffnungsbeschluß" jenen Fächern eine jahrelange Überlast von bis zu 200 % ihrer eigentlichen Kapazität auf.
Die positive Entscheidung einer wachsenden Zahl von Abiturienten für ein Universitätsstudium wurde sicherlich auch durch die staatliche Ausbildungsförderung beeinflußt. Schon ab 1955 war durch ein Verwaltungsabkommen zwischen der Bundes- und den Landesregierungen eine Studienförderung nach dem "Honnefer Modell" möglich geworden. 1957 betrug das Finanzvolumen noch 40 Mio. DM und wuchs bis 1969 auf 193,4 Mio. DM an. Es erreichte 20 % aller Studierenden und war in den ersten beiden Semestern ein Zuschuß, dann zu 40 % ein (zinsloses) Darlehen. Die Kosten teilten sich Bund und Länder zu je 50 %. Eine derartige Mischfinanzierung war nach der Einfügung des Artikels 104a ins Grundgesetz bei der Finanzverfassungsreform 1969 nicht mehr möglich. Eine große politische Mehrheit in Bund und Ländern hielt andererseits eine breitangelegte individuelle Ausbildungsförderung für alle weiterführenden Schulen, Berufsausbildungen und Studien an Akademien und Hochschulen nach dem Sozialstaatsgebot Art. 20 (1) GG für erforderlich. Hierzu war 1969 nach Ergänzung des Art. 74 GG in Nr. 13 die Kompetenz für die Regelung von Ausbildungsbeihilfen in der konkurrierenden Gesetzgebung auch an den Bund übergegangen.
Im Jahre 1971 wurde dann vom Bundestag das "Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAföG)" beschlossen, das jedem jungen Deutschen einen Rechtsanspruch auf finanzielle Förderung seiner Berufsausbildung einräumt. Ebenso werden auch bestimmte Gruppen von Ausländern gefördert. Dem Grundgedanken des Gesetzes entsprechend ist die Förderung nicht auf überdurchschnittlich Begabte beschränkt, die Begabung muß für die angestrebte Ausbildung nur ausreichen. Das Gesetz enthält sich jeden Einflusses auf die Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte, insbesondere herrscht völlige Unabhängigkeit von arbeitsmarktpolitischen Erwägungen. Wegen der begrenzten Mittel ist nur eine planvoll angelegte und zielstrebig durchgeführte Ausbildung zu einem berufsqualifizierenden wissenschaftlichen Abschluß zu fördern. Dementsprechend ist für jedes Studienfach eine Förderungshöchstdauer festgelegt und es wird während der Laufzeit der Förderung kontrolliert, ob das Studium ordnungsgemäß durchgeführt wird. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es eine zusätzliche Studienabschlußförderung.
Die Ausbildungsförderung ist subsidiär, sie wird geleistet, nachdem zunächst die finanzielle Leistungskraft des Auszubildenden und seiner Eltern in zumutbarer Höhe eingesetzt wurden, aber nicht hinreichen, um den Bedarf zu decken. In die Berechnung der dem einzelnen Studierenden zustehenden Förderungsbeträge gehen u.a. die um bestimmte Freibeträge bereinigten Einkommen des Studierenden, seines Ehegatten oder der Eltern ein. Die Förderung war ursprünglich als Zuschuß konzipiert, wurde aber bereits 1974 teilweise auf zinslose Darlehen umgestellt. Ab 1983 gab es im tertiären Bildungsbereich nur noch Darlehen, seit 1990 ist BAföG je zur Hälfte Zuschuß und Darlehen. Die Rückzahlung der Darlehen beginnt fünf Jahre nach dem Ende der Förderungshöchstdauer und ist auf kleine Raten begrenzt. Es gibt außerdem eine ganze Reihe von Möglichkeiten, den Erlaß eines Teiles der Darlehensschuld zu erwirken, z.B. bei vorzeitiger Ablegung des Examens oder bei vorzeitiger Rückzahlung. Um einen Eindruck vom Umfang der Förderung im tertiären Bildungsbereich zu geben, seien im folgenden einige Zahlen zusammengestellt.
1. Zahl der Studierenden und Geförderten
(alte Länder, in Tausend)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Finanzaufwand
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Durchschnittlicher monatlicher Förderungsbetrag (DM)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Neben diesem staatlichen Förderungssystem gibt es noch eine ganze Reihe von Stipendiengebern, wie z.B. die Studienstiftung des Deutschen Volkes, oder die Stiftungen aller großen Parteien und des Deutschen Gewerkschaftsbundes sowie das Cusanuswerk für katholische und das Evangelische Studienwerk für evangelische Studierende. Diese Stipendien sind an die Erwartung überdurchschnittlicher Studienleistungen geknüpft.
Der Anstoß für die eigentliche, die ideelle Universitätsreform kam von studentischer Seite, und zwar von der "Neuen Linken", einer vor allem Studierende und Intellektuelle erfassenden neomarxistischen Bewegung, die um 1960 in den hochindustrialisierten Staaten Nordamerikas und Europas entstanden war und die versuchte, die herrschende Gesellschaftsordnung des "Spätkapitalismus" zu beseitigen. In Deutschland war hieran vor allem der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) beteiligt unter Führung von U. Bergmann, R. Dutschke, W. Lefebvre und B. Rabehl. Seine Ideen fußten auf H. Marcuse und der Frankfurter Schule von Th.W. Adorno und M. Horkheimer, seine Vorbilder waren F. Castro, Che Guevara und Mao Tsedung. In Deutschland fühlte sich die Neue Linke als Außerparlamentarische Opposition (APO) gegenüber der regierenden großen Koalition und wußte ihre gegensätzliche Meinung durch Demonstrationen in der Öffentlichkeit bekanntzumachen. Den Höhepunkt erreichten die Demonstrationen und auch gewaltsamen Unruhen 1967 und 1968, vor allem nach dem Attentat auf Dutschke. Eines der Ziele der studentischen Protestbewegung war eine umfassende Reform der deutschen Universität zur "Kritischen Universität". Hierzu strebte sie eine Radikalisierung der Studierenden an, eine Politisierung der Wissenschaft und eine weitgehende Beteiligung der Studierenden an der akademischen Selbstverwaltung. Diesem Ziel sollten Vorlesungsrezensionen und Parallelseminare zu den offiziellen Hochschulveranstaltungen dienen, sowie eigene studentische Wissenschafts- und gesellschaftskritische Seminare, Vorträge und Hearings. Mit "sit ins" und "teach ins", also Sitz-und Redeblockaden errang sie das Interesse einer breiten Universitätsöffentlichkeit und erzwang mit Instituts- und Rektoratsbesetzungen die rasche Bildung von verfassungsgebenden Versammlungen durch Wahlen an den einzelnen Universitäten. Neben der Fraktion der SDS gelangten auch Gruppen anderer studentischer Vereinigungen, die teilweise deutlich andere Ansichten vertraten, in diese "Grundordnungsversammlungen". Gemeinsames studentisches Anliegen war die Verbesserung der Situtation in der Lehre, die Beteiligung der Studierenden am Berufungsprozeß, eine öffentliche Ausschreibung der zu besetzenden Professuren und die Auswahl nach Probevorlesungen. Angestrebt wurde auch die "Drittelparität", also die Stimmengleichheit von Professoren, Studierenden und übrigem Personal sowohl in verfassungsgebenden, als auch in allen beschließenden Gremien der Universität.
Die Assistenten als weitere Gruppe mit sehr konkreten Zielvorstellungen hatten ihre Reformziele im Bad Kreuznacher Hochschulkonzept der Bundesassistentenkonferenz vom 11.10.1968 dargelegt, etwa ihre Anerkennung als Mitglieder des Lehrkörpers in Form von Assistenzprofessuren und die Weiterentwicklung der Universität zur "Differenzierten Gesamthochschule", die im Hochschulgesamtplan für Baden-Württemberg genannt wurde, den R. Dahrendorf und andere 1967 vorlegten. Die habilitierten Mitglieder des erst seit kurzem existierenden Mittelbaus, also die Nichtordinarien, verlangten eine Teilhabe an den materiellen Ressourcen der Institute und ein Mitspracherecht in der Leitung entsprechend ihrem Anteil an Forschung und Lehre, sowie eine angemessene Vertretung in den Fakultäten und im Senat.
Die Lehrstuhlinhaber dagegen, deren Standpunkte z.B. durch das Marburger Manifest der Achtzehn vom 17.4.1968 dargelegt wurden, und von denen sich viele durch den Bund Freiheit der Wissenschaft vertreten sahen, mußten ihre grundgesetzlich geschützte Freiheit in Forschung und Lehre durch die Mitsprache anderer, insbesondere der Studierenden bedroht sehen, die auf die Forschungsthemen und -finanzierung sowie auf Inhalt und Form der Lehre Einfluß nehmen konnten. Insbesondere wiesen sie darauf hin, daß die studentischen Vertreter in den Gremien zwar an den Beschlüssen beteiligt werden sollten, diese aber von den Professoren allein durchgeführt und verantwortet werden müßten.
In den Sitzungen der verfassungsgebenden Versammlungen wurden in den darauffolgenden Monaten lange Geschäftsordnungsdebatten und schier endlose Diskusssionen zur Neuorganisation der Universität, zur Verteilung der Zuständigkeiten auf die einzelnen Gremien, zu deren Zusammensetzung, Verfahrensgrundsätzen und über die Abstimmungsmodi geführt. Es entstand ein noch diffuses, rechtlich z.T. fragwürdiges und von Universität zu Universität unterschiedliches Modell einer "Gruppenuniversität". Recht schnell reagierte die Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) als übergeordnetes Gremium. Bereits am 6.1.1968 wurde die Godesberger Rektorenerklärung zur Hochschulreform abgegeben, am 22.5.1968 folgte die Entschließung der WRK zur qualitativen Repräsentation der Mitglieder der Universität in den Organen der akademischen Selbstverwaltung und am 17.12.1968 die Empfehlungen der WRK zur Neuordnung der Universitätsorganisation.
Auch der Staat, der sich bisher betont zurückhaltend gegenüber Angelegenheiten der Universitäten verhalten hatte, - eine Hochschulgesetzgebung bestand weithin nicht - erkannte die Notwendigkeit und auch die Chance, die Universitäten am kürzeren Zügel zu führen. Die Länder, denen verfassungsgemäß die Kulturhoheit zufällt, konnten direkt tätig werden. Am 10.4.1968 faßte die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder die "Grundsätze für ein modernes Hochschulrecht und die strukturelle Neuordnung des Hochschulwesens", am 27.3.1969 folgte der "Staatsvertrag der Ministerpräsidenten der Länder über Grundsätze der Hochschulreform und die Vereinheitlichung des Hochschulrechts an allen Hochschulen". Ein erstes Hochschulgesetz wurde bereits 1968 in Baden-Württemberg erlassen, die anderen Bundesländer folgten. Die günstige politische Situation der großen Koalition in Bonn ließ es bereits 1968 zu, daß durch entsprechende Verfassungsänderung die Grundlage für die Rahmengesetzgebung des Bundes in Bildungs- und Hochschulfragen geschaffen werden konnte. Nach längerer Diskussion wurde schließlich 1976 das Hochschulrahmengesetz durch die inzwischen regierende Sozialliberale Koalition im Bundestag und die CDU/CSU-Mehrheit im Bundesrat verabschiedet, nach dessen Richtlinien in den Ländern für den Erlaß von Landeshochschulgesetzen zu verfahren ist. Das Gesetz, das 1985 nochmals durch drei Änderungsgesetze novelliert wurde, vermittelt den Eindruck, daß der Gesetzgeber unter allen Umständen verhindern wollte, daß noch einmal versucht werden könnte, die Universitäten, oder allgemeiner die Hochschulen, für ideologische Zwecke zu mißbrauchen. Das Gesetz regelt daher mit großer Sorgfalt und umfassend alle Einzelfragen, die hierzu als Ansatzpunkt dienen könnten. Hierher gehört z.B. die abschließende Aufzählung der Aufgaben der Hochschulen, die Sicherstellung der verfassungsgemäßen Grundrechte der Freiheit von Forschung, Lehre und Studium, aber auch das staatliche Einspruchsrecht gegen Studienordnungen und die Genehmigungspflicht für Prüfungsordnungen. Vor allem gibt das Gesetz den Hochschulen die Möglichkeit, bei Androhung oder Anwendung von Gewalt, bei Behinderung des bestimmungsgemäßen Betriebes der Hochschule oder beim Versuch, Hochschulmitglieder von der Ausübung ihrer Rechte und Pflichten abzuhalten, die Einschreibung der betreffenden Studierenden zu widerrufen, d.h., sie zu relegieren.
Das Hochschulrahmengesetz brachte aber auch einige längst überfällige Reformen. Am spektakulärsten waren die Grundsätze der Mitwirkung der Mitglieder der Hochschulen an der akademischen Selbstverwaltung, die die Verwirklichung der "Gruppenuniversität" brachten, für die die Studierenden in den Unruhen ja gekämpft hatten. Für die zentralen Kollegialorgane, etwa Senat und Konzil, und den Fachbereichsrat, Nachfolger der früheren Fakultät, werden aus den Gruppen der Professoren, der Studierenden, des wissenschaftlichen Personals und der sonstigen Mitarbeiter Repräsentanten gewählt, die stimmberechtigt an den Entscheidungen dieser Gremien mitwirken. In diesen Gremien haben die Professoren, auch durch höchstrichterliche Urteile gesichert, die absolute Mehrheit und in bestimmten Fragen ist außer der Mehrheit der Mitglieder der Gremien auch die Mehrheit der Gruppe der Professoren erforderlich.
Von großer Bedeutung war aber auch die Neuordnung der Personalstruktur, die nun nur noch Professoren (mit unterschiedlicher Besoldungsgruppe) aufführt, neben Hochschuldozenten, Wissenschaftlichen bzw. Künstlerischen Assistenten, Oberassistenten und Oberingenieuren und Wissenschaftlichen und Künstlerischen Mitarbeitern, die beamtet oder angestellt sein können, Lehrbeauftragten und Lehrkräften für besondere Aufgaben. Mit Ausnahme der Professuren und der Wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen sind die übrigen Stellen zeitlich befristet, die Wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen können es unter bestimmten Bedingungen sein.
Die Organisation der Hochschulen ist so festgelegt worden, daß sich für Universitäten hinsichtlich der Institute eine neue Rechtssituation ergibt. Sie sind nun unter der Verantwortung eines Fachbereichs gebildete "Wissenschaftliche Einrichtungen" geworden, die in der Regel durch eine kollegiale und befristete Leitung verwaltet werden, an der die Professoren der betreffenden Einrichtung beteiligt sind. Die Fachbereiche entsprechen den früheren Fakultäten und heißen mittlerweile auch häufig so. Sie waren ursprünglich für engere Fächergruppen konzipiert und daher kleiner und zahlreicher in einer Universität. Man kann aber einen Trend zur Agglomeration kleiner Fachbereiche zu größeren Fakultäten feststellen.
Am tiefsten geht aber das Hochschulrahmengesetz, das ja für alle Hochschularten gleichermaßen und neben den Universitäten auch für Pädagogische Hochschulen, Kunst- und Fachhochschulen gilt, mit der für alle Hochschularten gleichen Beschreibung des Studienzieles, das auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten soll, was in mehreren Paragraphen nochmals aufgegriffen wird. Damit ist auch offiziell das Humboldt'sche Bildungsideal, die zweckfreie Beschäftigung mit reiner Wissenschaft als Ziel des Universitätsstudiums verlassen worden. Die Universität ist Teil eines differenzierten Hochschulwesens und hat, wie jede Hochschulart, ihren eigenen Stellenwert, ohne daß ihr eine herausgehobene Position zugeteilt wäre. Konsequenterweise haben ihre Absolventen keine besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt als die Absolventen anderer Schulen des tertiären Bildungsbereiches. Zu erwarten ist daher wohl auch eine Reform des öffentlichen Dienstrechtes in bezug auf den Zugang zum höheren Dienst.
Schlußwort
Die vorstehenden drei "Vorlesungen" zeigen die riesige Themenvielfalt, die mit der Entwicklung der Universitäten verknüpft ist und die immer erneut dazu einlädt, speziellen Verhältnissen und Entwicklungen nachzuspüren. Vieles konnte hier allenfalls kurz erwähnt werden, manches andere wurde dagegen völlig ausgespart. Für die frühe Entwicklung, d.h., vor der Humboldt'schen Reform, hätte man z.B. den Versuch der Jesuiten in der Zeit der Gegenreformation erwähnen können, an den von ihnen beherrschten Universitäten ein striktes System eines Studienganges mit Zwischenprüfungen und Klausuren zu etablieren. Im 19. Jh. fehlt ein Hinweis auf die sich vielfältig bildenden speziellen Hochschulen, z.B. Handelshochschulen, landwirtschaftliche Hochschulen und Kunstakademien. Praktisch ausgespart blieb auch die Entwicklung der Hochschulen in der DDR, mitsamt dem dortigen Stipendiensystem. Ich bitte den Leser daher um Nachsicht und möchte ihn auffordern, seinerseits auf Entdeckungsreise in der Literatur zu gehen. Was diese anbelangt, habe ich nur wenige Titel ausdrücklich genannt, ich möchte vielleicht nochmals das Buch von Th. Ellwein hervorheben, dessen Fülle an Informationen besonders lebendig und anschaulich dargeboten wird. Sehr dankbar bin ich auch für die Überlassung von Kopien spezieller Texte, z.B. des Kommentars von Rothe und Blanke zum BAföG, den ich Herrn Motzkau vom Amt für Ausbildungsförderung des Studentenwerks Heidelberg verdanke, oder den internen Text "Zehn Jahre ZVS" nebst einigen ergänzenden Hinweisen, den ich vom Pressesprecher der ZVS, Herrn Scheer, erhielt. Ansonsten habe ich an den verschiedensten Stellen einzelne Literatur gefunden, ob das nun "Hochschule im Umbruch" von H. Schramm (Hrsg.), Basisdruck, war oder die Politischen Studien, Sonderheft 2/1993 der Hanns Seidel Stiftung "Die Hochschulen vor dem Kollaps?". Interessant war auch Kursbuch 97 vom September 1989 "Uni-Not", Kursbuch Verlag Berlin, sowie Hermann Rohrs (Hrsg.): Tradition und Reform der Universität unter internationalem Aspekt, Verlag Peter Lang, Frankfurt 1987.
Zusammenstellung der Literatur:
K.-H. MANEGOLD:
Universität, Technische Hochschule und Industrie,
Duncker und Humblot, Berlin 1970
H. SCHELSKY:
Einsamkeit und Freiheit, 2. Aufl.,
Bertelsmann Univ.-Verlag, Düsseldorf 1971
H.W. PRAHL:
Sozialgeschichte des Hochschulwesens,
Kösel-Verlag, München 1978
TH. ELLWEIN:
Die deutsche Universität vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2.
Aufl. Athenäum/Anton Hain Verlag, Frankfurt 1992
Dr. Gerhard Schwenker
Professor für Pharmaz. Chemie
an der Universität Heidelberg
Am Eichhof 20
Häufig gestellte Fragen zum Text über die Entwicklung der Universität
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Der Text behandelt die Entwicklung der Universität vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Schwerpunkte liegen auf den Gründungsbedingungen, der Organisation und Struktur, dem Lehrkörper, den Studenten, dem Lehrangebot, der Rolle der Universitäten in der Gesellschaft, der Humboldtschen Reform und der Entwicklung der Technischen Hochschulen.
Wie haben sich die Universitäten im Laufe der Zeit verändert?
Ursprünglich waren Universitäten kleine, überschaubare Einrichtungen mit einem Fokus auf die Bewahrung und Tradierung überkommenen Wissens. Die Humboldt'sche Reform im 19. Jahrhundert führte zu einer Betonung der Einheit von Forschung und Lehre und der zweckfreien Wissenschaft. Im 20. Jahrhundert kam es zu einer stärkeren Spezialisierung, einer Zunahme der Studentenzahlen und einer stärkeren Ausrichtung auf berufliche Tätigkeitsfelder.
Welche Rolle spielten die Gelehrten im Mittelalter bei der Vermittlung von Wissen?
Autoritäten spielten im Mittelalter eine große Rolle bei der Wissensvermittlung. Unter den Unterrichtsformen war von Anfang an die Vorlesung von Bedeutung. Diese hielt sich an einen vorgeschriebenen Text und brachte nach allgemeinen Erläuterungen zu Titel, Autor und Absicht des Buches zunächst den Text, dann Abschnitt für Abschnitt hierzu Erläuterungen und Kommentare. Die Vorlesungen waren inhaltlich (einschließlich der Kommentare) und zeitlich genau festgelegt.
Was waren die materiellen Gründe zur Errichtung einer Universität?
Materielle Gründe, die zur Errichtung einer Universität führten, waren die Festigung der Herrschaft des Landesherren, die Anziehung fremder Studenten und die Bindung der eigenen jungen Leute im Lande, die dem Staat die benötigten Geistlichen und Juristen sicherten.
Was waren die Privilegien der Studenten und Professoren?
Zu den Privilegien zählten vor allem das Prüfungsprivileg für alle akademischen Grade, die Befreiung von Steuern und Abgaben, von Einquartierung und Ziehung zum Militärdienst, sowie eine eigene Gerichtsbarkeit für alle akademischen Bürger.
Welche Bedeutung hatte die Humboldt'sche Reform?
Die Humboldt'sche Reform führte zu einer Neugründung der Berliner Universität und beeinflusste die deutschen Universitäten des 19. Jahrhunderts maßgeblich. Sie betonte die Einheit von Forschung und Lehre, die zweckfreie Wissenschaft und die Bildung der Staatsdiener.
Was waren die Ziele der Studenten nach dem Kriegsende 1945?
Eines der Ziele der studentischen Protestbewegung war eine umfassende Reform der deutschen Universität zur "Kritischen Universität". Hierzu strebte sie eine Radikalisierung der Studierenden an, eine Politisierung der Wissenschaft und eine weitgehende Beteiligung der Studierenden an der akademischen Selbstverwaltung.
Was ist das BAföG?
Das BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) ist ein Bundesgesetz in Deutschland, das jedem jungen Deutschen einen Rechtsanspruch auf finanzielle Förderung seiner Berufsausbildung einräumt, sofern er die Voraussetzungen erfüllt.
Wie wurden die Studiengebühren gefördert?
Schon ab 1955 war durch ein Verwaltungsabkommen zwischen der Bundes- und den Landesregierungen eine Studienförderung nach dem "Honnefer Modell" möglich geworden. Die Kosten teilten sich Bund und Länder zu je 50 %.
Welche Rolle spielten die Technischen Hochschulen?
Technische Hochschulen entstanden als Reaktion auf die Geringschätzung der angewandten Wissenschaften an den Universitäten. Sie boten eine breite, mathematisch-naturwissenschaftliche Grundausbildung und höheren technischen Fachunterricht.
Was waren die wichtigsten Folgen des Hochschulrahmengesetz?
Das Hochschulrahmengesetz brachte die Einführung der "Gruppenuniversität" mit Mitwirkung der verschiedenen Gruppen an der akademischen Selbstverwaltung. Es regelte die Personalstruktur und definierte das Studienziel als Vorbereitung auf ein berufliches Tätigkeitsfeld.
Welche Herausforderungen gab es bei der Reformierung der Universitäten?
Die Reformierung der Universitäten war von Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Interessengruppen geprägt, darunter Professoren, Assistenten und Studenten. Es gab auch Widerstände gegen die Einschränkung der Autonomie der Universitäten durch den Staat.
Was ist die Grundaussage des Textes?
Der Text zeigt die komplexe und vielschichtige Entwicklung der Universitäten von ihren mittelalterlichen Anfängen bis zum modernen tertiären Bildungssystem, geprägt von Reformen, Konflikten und gesellschaftlichen Einflüssen.
- Quote paper
- Prof. Dr. Gerhard Schwenker (Author), 1996, Zur Entwicklung der Universitäten in Deutschland - Drei Abschiedsvorlesungen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111278