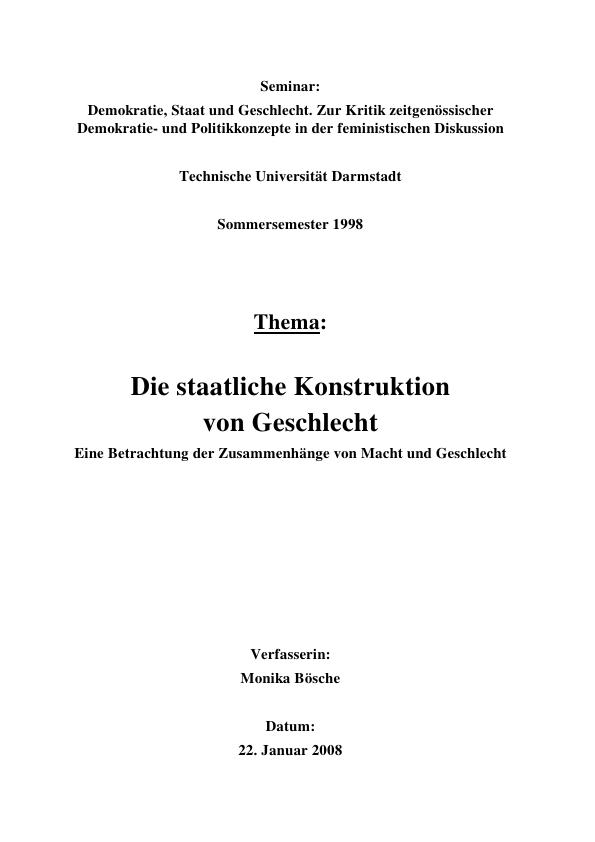Gliederung
1. Einleitung
2. Definitionen
2.1 Staat
2.2 Macht
2.3 Geschlecht (sex versus gender)
3. Der Staat in der Theorie - und Geschlecht?
3.1 Der dem Gesellschaftsvertrag implizite Geschlechtervertrag
3.2 Die vermeintliche Dichotomie von Öffentlichkeit und Privatheit
3.3 Zum universellen Staatsbürgerstatus
3.4 Die vermeintliche Unparteilichkeit der Öffentlichkeit
4. Geschlechtsrelevante Staatspraxis und -politiken
4.1 Macht- und Legitimationspolitik des Staates
4.2 Mutterschafts- und Reproduktionspolitik
5. Fazit und Schlußbemerkung
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der staatlichen Konstruktion von Geschlecht. Da dies ein sehr weites Thema ist, werde ich einige Einschränkungen vornehmen, die insbesondere im konkreten Teil der Beispiele höchst selektiv ist. Ziel der Hausarbeit ist nicht, eine umfassende und vollständige Darstellung der staatlichen Konstruktion von Geschlecht zu geben, sondern ein Verständnis für die komplexe Problematik mit ihren theoretischen und praktischen Problemen zu erarbeiten und darauf aufbauend Veränderungsvorschläge aufzuzeigen.
Dazu werde ich vorab einen bestimmten theoretischen Standpunkt und eine theoretisch eingeschränkte Perspektive einnehmen, welche meiner Meinung nach am besten geeignet sind, um diesen Anspruch zu erfüllen.
Geschlechtlichkeit nehme ich nur als Konstruktion an. Die Differenzposition, die auch von vielen Feministinnen vertreten wird, lehne ich ab, da damit der Weg zu einer umfassenden Analyse von Macht (im Foucault'schen Sinne, siehe Kapitel 2.2 b)) und Staat (Definition siehe Kapitel 2.1, insbesondere c)) sowie der staatlichen Konstruktion von Geschlecht von vornherein unmöglich gemacht wird. Wichtige Aspekte werden durch die Annahme einer weiblichen Identität der Analyse entzogen. [vgl. Brown 1995: 166; Carrigan/Connell/Lee 1996: 45-49]
Zur Betrachtung der staatlichen Konstruktion von Geschlecht verwende ich das, was Foucault "Genealogie" nennt.
"Als Genealogie bezeichnen wir also diese Verbindung zwischen gelehrten Kenntnissen und lokalen Erinnerungen, die die Konstituierung eines historischen Wissens der Kämpfe ermöglicht sowie die Verwendung dieses Wissens in den gegenwärtigen Taktiken." [Foucault 1976: 62]
Die genealogische Methode betrachtet also die Entstehung, den gesellschaftlichen und historischen Kontext eines gesellschaftlichen Phänomens sowie dessen spezifische Vermittlung durch Sprache und Handlungen. Dabei ist aber darauf hinzuweisen, daß es sich nicht um einen historischen Determinismus handelt. Zwar gibt es bestimmte Vorbedingungen, die nicht außer acht gelassen werden dürfen, aber dies bedeutet nur eine minimale Einschränkung des riesigen Handlungsfeldes und nicht etwa die klare Determinierung des historischen Prozesses.
Bei den Staatstheorien werde ich mich auf die Betrachtung der Staatstheorie beschränken, die in der westlichen Welt den größten Einfluß hatte und immer noch vorherrschend ist, nämlich auf die Gesellschaftsvertragstheorie und den Liberalismus.
Trotz der plausiblen These, die z.B. Connell vertritt, nämlich daß die Konstruktion von Staat und die Konstruktion von Geschlecht sich wechselseitig beeinflussen und miteinander interagieren [1992: 523], werde ich in dieser Arbeit nur die staatliche Konstruktion von Geschlecht betrachten. Damit wird natürlich ein Teil der Problematik Geschlecht und Staat ausgeblendet. Dies geschieht bewußt, damit die staatliche Konstruktion von Geschlecht und diese Wirkungsrichtung genauer betrachtet werden kann.
Die Leitfrage dieser Hausarbeit lautet:
Wie konstruiert der Staat Geschlecht?
Diese Frage läßt sich nun weiter konkretisieren und ausdifferenzieren:
Wie konstruiert der Staat Geschlecht theoretisch?
Wie behandelt oder integriert die vorherrschende Staatstheorie, nämlich die Gesellschaftsvertragstheorie und der Liberalismus, Geschlecht?
An welchen Stellen und warum gibt es "blinde Flecken" in der Staatstheorie?
Welche Folgen und Implikationen ergeben sich aus diesen "blinden Flecken"?
Welche feministischen Antworten gibt es auf diese "blinden Flecken" der Staatstheorie?
Diese Frage wird nur teilweise und schematisch beantwortet werden können, da es viele verschiedene Vorschläge und Konzepte für eine feministische Staats- oder Demokratietheorie gibt, die aber alle unvollständig, nur skizzenhaft oder an einigen Stellen recht problematisch sind.
Diese Fragen werde ich durch eine Darstellung des liberalen Staatskonzepts und insbesondere der feministischen Kritik daran beantworten. Natürlich sind auch hier einige Beispiele zur Veranschaulichung der Problematik unumgänglich. Ich beschränke sie in diesem Teil jedoch auf das Nötigste, da sich der zweite Fragenkomplex mit der beispielhaften Darstellung der Geschlechterproblematik beschäftigt.
Wie sieht die staatliche Geschlechterkonstruktion in der Praxis aus?
Wie legitimiert der Staat sich und die Geschlechterunterschiede?
Wie unterscheidet oder - stärker gesagt - diskriminiert der Staat männliche und weibliche Subjekte?
Wie reagiert der Staat auf neue Entwicklungen, die seine Position hinsichtlich Geschlecht verändern oder sogar in Frage stellen (z.B. Reproduktionsmedizin und Problematik des Wohlfahrtsstaates)?
Ich versuche, diese Fragen anhand von unterschiedlichen Politikbereichen beispielhaft zu beantworten. Damit kann jedoch nur eine Skizze und die prinzipielle Struktur der Antwort auf diese Fragen dargestellt werden.
Im nächsten Kapitel werde ich einige Definitionen klären, die sich aus der theoretischen Perspektive ergeben und für die restliche Hausarbeit von großer Wichtigkeit sind.
2. Definitionen
2.1 Staat
Es werden im Kapitel 3 zwei Staatsverständnisse (das kontraktualistische und ein feministisches) gegeneinander gestellt. An dieser Stelle sollen nur eine recht allgemeine Staatsdefinition und jeweils eine vorläufige Definition von Staat der beiden unterschiedlichen Sichtweisen (kontraktualistisch und feministisch) dargestellt werden.
a) Der Staat als Nationalstaat [vgl. hierzu Sauer 1997: 38]
Der Staat definiert sich über sein Territorium (Staatsgebiet), seine Mittel (Staatsgewalt) und seine Untergebenen (Staatsvolk). Damit definiert der Staat ein Innen und ein Außen. Er übernimmt die Funktion im Inneren, politisch zu regeln und nach außen hin souverän aufzutreten. "Der Staat wird definiert als gesamtgesellschaftliche Idee, als Abstraktum, als Instrument (der herrschenden Klasse) oder als gesellschaftliches Verhältnis." (Hervorhebung im Original) [Sauer 1997: 38]
b) Kontraktualistische Staatsdefinition: der Staat bzw. die staatliche und gesellschaftliche Ordnung als das Ergebnis des (hypothetischen) Gesellschaftsvertrags
Grundlage des kontraktualistischen Ansatzes ist die Idee einer gesellschaftlichen Ordnung auf einer Vertragsgrundlage unter Freien und Gleichen. Die Individuen selbst müssen ihren Zusammenhalt normativ begründen. Eine Ordnung ist nur dann legitim begründet und gerechtfertigt, wenn sie auf einen Vertrag zurückgeführt werden kann, auf den sich alle unter bestimmten, klar definierten Bedingungen einigen oder einigen könnten [vgl. Kersting 1996: 21-32]. Zu beachten ist hierbei, daß der Vertrag nur als Gedankenexperiment, also als hypothetischer Vertrag gedacht ist [vgl. Kersting 1996: 32-38]. Es geht um einen Gesellschaftsvertrag, den die Menschen qua Vernunftquelle und aufgrund ihrer Rationalität schließen [vgl. Kersting 1996: 46-48]. Wie die staatliche Ordnung konkret aussieht, ist bei den Vertragstheoretikern (z.B. Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jaques Rousseau, Immanuel Kant, John Rawls, Robert Nozick oder James Buchanan) sehr unterschiedlich und auch die obige Definition des Nationalstaates ließe sich hier einordnen. Was jedoch allen Vertragstheorien gemein ist, ist eine spezifische Trennung von Öffentlichkeit (polis) und Privatheit (oikos), die schon im politischen Aristotelismus vorhanden war [Kersting 1996: 3]. Die öffentliche Sphäre ist die politisch relevante, in der über die konkrete Form des Staates entschieden wird.
c) Eine feministische Staatsdefinition: Staat als "Set von diskursiven Arenen" [Sauer 1997: 34]
Wendy Brown versteht den Staat weder als Struktur noch als Akteur, sondern als "Set von diskursiven Arenen, die eine zentrale Rolle für die Organisation von vergeschlechtlichten Machtverhältnissen spielen" [Sauer 1997: 34]. Brown sieht den Staat als "significantly unbounded terrain of powers and techniques, an ensemble of discourses, rules, and practices" [Brown 1995: 174]. Der Staat ist kein einheitliches Gebilde, sondern ein Gebiet, auf dem Macht, Handlungen, Diskurse, Regeln und Praktiken in sehr komplexer Weise miteinander interagieren. Connell weist auf die besondere Prozeßhaftigkeit des Staates hin [1992: 521]. Die gesellschaftlichen Verhältnisse und letztlich auch die konkrete Gestaltung des Staates sind in dieser Definition nur Kompromisse, die sich aus dem jeweiligen gesellschaftlichen Kräfteverhältnis und den gesellschaftlich vorhandenen Gruppenidentitäten ergeben, und damit sind sie veränderbar [Connell 1992: 527-529; Demirovic/Pühl 1997: 234f]. Der Staat ist "das Ergebnis von Diskursen und politischen Aktivitäten" [Demirovic/Pühl 1997: 234]. Dieser Staatsdefinition liegt eine ganz bestimmte Definition von Macht zugrunde, die auf der Foucault'schen Machttheorie basiert. Diese wird im nächsten Abschnitt dargestellt.
2.2 Macht
Hier werden zwei Machtdefinitionen miteinander kontrastiert, wobei der Schwerpunkt auf der Foucault'schen Machtdefinition liegt, da sie entscheidend sein wird für die weiteren Ausführungen.
a) Macht des Souveräns (klassische, kontraktualistische Machtdefinition)
Macht wird als das verstanden, was der Staat ausübt. Nach dieser Definition von Macht gehören dazu die drei Staatsgewalten, nämlich Judikative, Exekutive und Legislative. Die Staatsmacht entsteht dadurch, daß sich alle Individuen darauf einigen, ihre natürliche Macht einem Souverän zu übertragen, der diese Macht dann gebündelt ausübt. Die Individuen verpflichten sich selbst und gegenseitig, diese neu geschaffene Macht anzuerkennen. [vgl. Kersting 1996: 19-58]
b) Macht im Foucault'schen Sinne
Macht ist für Foucault nicht etwas Statisches, das an sich besteht, sondern Macht ist dadurch gekennzeichnet, "daß sie Verhältnisse zwischen Individuen oder Gruppen ins Spiel bringt" [Foucault 1996b: 30]. Bei Macht muß zwischen Machtverhältnissen, Kommunikationsbeziehungen und sachlichen Fähigkeiten unterschieden werden [Foucault 1996b: 31]. Macht als sachliche Fähigkeit bezeichnet die Möglichkeit, körperlich oder direkt über einen Gegenstand oder eine Person Macht auszuüben. Die Kommunikationsbeziehungen sind ein sprachliches Informationssystem, über das Menschen miteinander in Beziehung treten und eventuell aufeinander einwirken können. Doch Foucault betrachtet mit seinem Machtbegriff insbesondere den dritten Aspekt von Macht, nämlich die Machtbeziehungen. Foucault selbst weist aber darauf hin, daß es "um drei Typen von Verhältnissen" geht, "die allerdings immer ineinander verschachtelt sind, sich gegenseitig stützen und als Werkzeuge benutzen" [Foucault 1996b: 31]. Das menschliche Subjekt steht "in sehr komplexen Machtverhältnissen" [Foucault 1996a: 15]. Macht kann nur "in actu" existieren [Foucault 1996b: 34f]. Das Machtverhältnis wird durch eine Handlungsweise jeglicher Art definiert, "die nicht direkt und unmittelbar auf die anderen einwirkt, sondern eben auf deren Handeln" [Foucault 1996b: 35]. Machtausübung ist für Foucault ein "Ensemble von Handlungen in Hinsicht auf mögliche Handlungen; sie operiert auf dem Möglichkeitsfeld, in das sich das Verhalten der handelnden Subjekte eingeschrieben hat" [Foucault 1996b: 36]. An dieser Stelle wird auch die Parallelität zur obigen feministischen Staatsdefinition sehr deutlich. Macht und Freiheit stehen bei Foucault nicht unvereinbar gegenüber, sondern sie bilden ein besonderes Verhältnis: "(T)here is an intimate relationship between power and liberty" [Hindess 1996: 99]. Für Foucault ist die Freiheit die Existenzbedingung von Macht. "Das Machtverhältnis und das Aufbegehren der Freiheit sind also nicht zu trennen" [Foucault 1996b: 38]. Macht ist nach Foucault überall und wird von jedem in der einen oder anderen Weise ausgeübt [Hindess 1996: 100]. Macht ist nicht nur negativ, sie kann auch produktiv wirken. Außerdem können sich Machtverhältnisse verschieben und verändern. Sie sind nicht statisch. "Machtverhältnisse wurzeln in der Gesamtheit des gesellschaftlichen Netzes" [Foucault 1996b: 43]. Foucault weist bei der Staatsmacht darauf hin, daß sie eine "zugleich individualisierende und totalisierende Form der Macht ist" [Foucault 1996a: 23]. Für Foucault entspricht der moderne Staat keiner Einheit, sondern er ist "eine sehr raffinierte Struktur, in die Individuen durchaus integrierbar sind" [Foucault 1996a: 25]. Der Staat ist für Foucault eine "Individualisierungs-Matrix" [Foucault 1996a: 25].
2.3 Geschlecht (sex versus gender)
Die hier dargestellte Definition von Geschlecht stellt die von Linda Nicholson [1994] dar. Es werden dazu die englischen Ausdrücke sex und gender verwandt, da sie trennscharf sind im Gegensatz zum deutschen Wort Geschlecht, das beide hier vorgestellten Definitionen in sich vereinigt.
a) sex (= biologisches Geschlecht)
Sex beschreibt das biologische Geschlecht, das an sich noch keine Auswirkungen auf Status, Ansehen, intellektuelle Fähigkeiten u.ä. hat. Es beschreibt einfach den körperlichen Unterschied zwischen Mann und Frau. [Nicholson 1994: 188-191]
b) gender (= historisches, politisches, kulturelles und gesellschaftliches Geschlecht)
Gender ist ein sehr umfassender und damit auch schwer zu fassender Begriff. Er beinhaltet alle historischen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Konstruktionen, die am Geschlechtsunterschied festgemacht werden. Wird gender mit sex gleichgesetzt, so hat das zur Folge, daß der konstruierte Unterschied als naturgegeben und unveränderlich wahrgenommen wird [Nicholson 1994: 189].
Wird von Feministinnen eine explizite Unterscheidung zwischen sex und gender getroffen, so vertreten sie meist die Ansicht, daß die Geschlechter gleich sind und die gesellschaftlichen Unterschiede allesamt konstruiert sind. Wird die Grenze zwischen gender und sex verwischt, handelt es sich meist um eine Differenz-Position, die Nicholson mit der "biologischen Fundierung" umschreibt [1994: 190, 202].
Nachdem nun die Definitionen zumindest ansatzweise geklärt sind, werde ich mich im nächsten Abschnitt mit der kontraktualistischen bzw. liberalen Staatstheorie und ihrer feministischen Kritik auseinandersetzen, um zu verdeutlichen, wie schon in der Theorie die staatliche Konstruktion von Geschlecht wirksam ist.
3. Der Staat in der Theorie - und Geschlecht?
In diesem Abschnitt werden anhand von feministischer Kritik an der kontraktualistischen bzw. liberalen Staatstheorie Bereiche dargestellt, in denen Geschlecht bei der theoretischen Konstruktion des Staates von Bedeutung ist, obwohl die Vertreter der liberalen und kontraktualistischen Staatstheorie dies jedoch zumeist verneinen. Zu beachten ist hierbei, daß es sich beim Gesellschaftsvertrag nur um eine Metapher handelt. Entscheidend ist aber, daß diese Metapher wirkmächtig ist. Sie hat bestimmte Implikationen und Folgen, die eben insbesondere auch das Geschlecht (= gender) betreffen. In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels werde ich diese möglichst umfassend darstellen. Problematisch ist dabei, daß die einzelnen Bereiche nicht trennscharf nebeneinander stehen, sondern komplex ineinander verschränkt sind. Daher lassen sich Verweise auf die anderen Bereiche kaum vermeiden. Dennoch habe ich diese Trennung vorgenommen, da durch sie die Staats-Geschlechts-Problematik von verschiedenen Perspektiven aus betrachtet werden kann und so transparenter und anschaulicher wird.
3.1 Der dem Gesellschaftsvertrag implizite Geschlechtervertrag
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Kritik von Carol Pateman an der Theorie bzw. der Geschichte des Gesellschaftsvertrags. Pateman stellt in ihrem Aufsatz "Der Geschlechtervertrag" die These auf, daß im Gesellschaftsvertrag implizit auch ein Geschlechtervertrag vorhanden ist, der aber sorgsam verschwiegen wird und die Herrschaft der Männer über die Frauen zu begründen und zu legitimieren versucht [1994]. Bei der Geschichte des Gesellschaftsvertrags, dessen Ziel der Ausgang aus dem unsicheren Naturzustand und die Schaffung einer legitimen Ordnung ist, einigen sich alle Freien und Gleichen darauf, miteinander einen Vertrag abzuschließen. Die wichtige Frage ist hier: Wer sind eigentlich diese Freien und Gleichen? Der Annahme nach sind alle Menschen im Naturzustand frei geboren. Diese Annahme verschleiert aber, daß gerade Frauen als nicht frei geboren angesehen werden [Pateman 1994: 79]. Ihnen wird die Vernunftfähigkeit nicht zuerkannt, die aber Voraussetzung für den Vertragsschluß ist. "Nur männliche Wesen verfügen danach über die Eigenschaften und Fähigkeiten, die notwendig sind, um vertragsfähig zu sein, [...] nur Männer sind 'Individuen'." [Pateman 1994: 78]. Durch diesen Ausschluß werden Frauen nicht zu Vertragsschließenden, sondern sie werden zum Gegenstand des Vertrages, da die Männer einerseits die Frauen nicht im Naturzustand zurücklassen und andererseits ihre schon längst errungene Macht über Frauen nicht verlieren wollen [Pateman 1994: 79, 85]. Begründet wird diese besondere Stellung der Frau auch dadurch, daß sie schutzbedürftig sei. Pateman weist jedoch eindeutig darauf hin, daß Verträge, in denen es um den "Tausch von Gehorsam gegen Schutz" geht, "bürgerliche Herrschaft" und "bürgerliche Unterwerfung" geschaffen wird [1994: 80]. Es ergibt sich für Frauen ein spezifischer Einschluß im Ausschluß, der sowohl beim Staatsbürgerstatus als auch bei der Unparteilichkeit des Staates entscheidend ist (siehe Kapitel 3.3 und 3.4).
Veranschaulichen läßt sich der implizite Geschlechtervertrag durch gewisse Inkonsistenzen und Widersprüche, die sich bei den Vertragstheoretikern finden. Als Beispiele möchte ich hier John Locke und Jean-Jaques Rousseau nennen.
John Lockes Gesellschaftsvertrag führt insbesondere dazu, daß das Eigentum und das Recht auf Eigentum eingeführt und geschützt wird. Eigentum rechtfertigte Locke auf der Grundlage von Arbeit. Dennoch hatten die Frauen zur Zeit Lockes über ihr Eigentum, ganz gleich ob sie es vor oder in der Ehe erworben hatten, keinerlei Verfügungsgewalt. Locke kritisierte diese Konvention nicht, sondern nahm sie einfach hin. Die Arbeit von Frauen erkannte Locke daher nicht als Grundlage für Eigentum an. Weiterhin war er der Ansicht, daß der Mann der "Fähigere und Stärkere"[1] sei. Bei einem Interessenkonflikt zwischen Mann und Frau sollte daher nach Locke in der Regel der Mann entscheiden, obwohl Locke hier eigentlich im Hinblick auf Gleichheit und das Recht auf Selbstbestimmung keine Unterscheidung treffen dürfte [Benhabib/Nicholson 1987: 530-532].
Bei Rousseau ist die Idee der traditionellen Kernfamilie schon im Naturzustand angesiedelt, also noch vor dem eigentlichen Gesellschaftsvertragsschluß[2] [Benhabib/Nicholson 1987: 534f]. Damit bleibt das innere Familienverhältnis für Rousseau außerhalb des Gesellschaftsvertrages bzw. wird implizit in diesen durch die Beibehaltung der Familienform als Geschlechtervertrag übernommen. Rousseau rechtfertigt dies mit seinen Vorurteilen über das weibliche Geschlecht: "Die Erforschung der abstrakten und spekulativen Wahrheiten, die Prinzipien und Axiome der Wissenschaft, alles, was auf die Verallgemeinerung der Begriffe abzielt, ist nicht Sache der Frauen. Ihre Studien müssen sich auf das Praktische beziehen. Ihre Sache ist es, die Prinzipien anzuwenden, die der Mann gefunden hat. [...] Die Frau hat mehr Witz. Der Mann mehr Genie. Die Frau beobachtet, der Mann zieht Schlüsse."[3] [Benhabib/Nicholson 1987: 532-540].
Pateman weist auf eine weitere Inkonsistenz der kontraktualistischen Gesellschaftsvertragskonstruktion hin: Zwar sind Frauen nicht fähig, den Gesellschaftsvertrag zu schließen, wohl aber können und sollen sie den Ehevertrag schließen können [1994: 79]. Diese Inkonsistenz fällt in der Theorie nicht so stark auf, da in der Theorie der Geschlechtervertrag verschwiegen wird. Das Leugnen des Geschlechtervertrages hat zur Folge, daß eine strikte Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit entsteht und begründet wird, wobei in der kontraktualistischen Theorie nur der öffentliche Bereich von Bedeutung ist [Pateman 1994: 76]. Eine genauere Betrachtung der Problematik Öffentlichkeit und Privatheit findet sich im Kapitel 3.2.
Wie könnte nun die wirkmächtige Metapher des Gesellschaftsvertrags ausgehebelt werden?
Eine der wichtigsten feministischen Forderungen ist die nach bürgerlicher Freiheit [Pateman 1994: 88]. Problematisch ist hieran laut Pateman aber, daß schon die liberale und bürgerliche Konstruktion des Individuums in seinem Wesen patriarchal geprägt ist. Doch dies ist kein wirkliches Hindernis, denn die Konstruktion des Individuums ist durch den hypothetischen Gesellschaftsvertrag hergestellt worden [Pateman 1994: 90]. Daher kann die Konstruktion des Individuums auch verändert werden. Dies ist aufgrund der bestehenden und weithin anerkannten Geschichte des Gesellschaftsvertrags allerdings nur langsam möglich und zu erreichen. Der Gesellschaftsvertrag stellt Geschlechtsunterschiede nämlich als natürlich dar und dient darüber hinaus als "spezifisch moderne Methode der Herstellung lokaler Machtbeziehungen" [Pateman 1994: 91].
Die folgenden drei Abschnitte beschäftigen sich mit den theoretischen Folgen, die meiner Meinung nach am bedeutsamsten und gleichzeitig am problematischsten sind.
3.2 Die vermeintliche Dichotomie von Öffentlichkeit und Privatheit
Nach Connell sind insbesondere drei Institutionen für die gegenwärtige Organisation der Geschlechter bedeutsam: "der Staat, der Arbeitsplatz/Arbeitsmarkt und die Familie" [1995: 27]. Diese drei Institutionen sind die, die die Dichotomie von Öffentlichkeit und Privatheit herstellen und/oder begünstigen. In diesem Kapitel werde ich daher anhand dieser Institutionen die vermeintliche Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit darstellen.
Doch zunächst ist zu klären, was eigentlich Öffentlichkeit und Privatheit in der liberalen Staatstheorie ist. Die Betrachtung der drei Institutionen wird jedoch zeigen, daß diese Definitionen nicht mehr aufrecht erhalten werden können.
Privatheit und Öffentlichkeit sind nach dieser Definition komplementäre Begriffe. Der Staat und die Politik bilden die Öffentlichkeit. "Staat bezeichnet den regulierten, institutionalisierten und bürokratischen Aspekt von Gesellschaft, während Privatheit ent-institutionalisierte, deregulierte, subjektive und autonome Handlungszusammenhänge bezeichnet." [Sauer 1997: 35f]. Für die liberale Theorie ist nur die öffentliche Sphäre von Bedeutung, während die private Sphäre politisch unbedeutend ist [Pateman 1994: 76].
Die Familie
"Die bürgerliche Welt errichtete eine moralische Arbeitsteilung zwischen Vernunft und Gefühl, sie setzte Männlichkeit mit Vernunft und Weiblichkeit mit Gefühl, Begehren und Bedürfnissen des Körpers gleich." [Young 1993: 272] Um diese Arbeitsteilung zu festigen wurde die "Privatssphäre der Familie" geschaffen [Young 1993: 272]. Die Familie wird also eindeutig der privaten Sphäre zugeordnet. Sie wird als natürlich oder göttlich, also vorpolitisch, apolitisch oder vorstaatlich gegeben angenommen [Brown 1995: 180; Rosenberger 1997: 123]. Dadurch wird die der Frau zugewiesene Rolle in der Familie nicht weiter problematisiert, sondern stattdessen individualisiert und entpolitisiert [vgl. z.B. Brown 1995: 182; Rosenberger 1997: 121f]. Die Frau als unbezahlte Arbeitskraft, als die, die die Reproduktionsarbeit, nämlich Kindererziehung und -aufzucht, erfüllt, und als die, die dem Mann einen Schonplatz in der Privatheit bietet, wird einfach in die private Sphäre abgeschoben und dort politisch ausgeblendet. Begründet wird diese Abschiebung der Frau in die Privatheit mit ihrer fehlenden Rationalität, ihrer natürlichen Bestimmtheit für die Familie, ihrer Schutzbedürftigkeit und ihrer wesenseigenen Begehrlichkeit und Affektivität [vgl. z.B. Pateman 1994: 80; Benhabib/Nicholson 1987: 515, 529; Young, Iris Marion 1995: 255f]. "Die Familie erfüllte das Bedürfnis nach Intimität, Zuneigung, Aufzucht von Kindern, gegenseitiger Unterstützung und Hilfe, und der Staat das Bedürfnis nach Schutz vor den Angriffen anderer Familien." [Benhabib/Nicholson 1987: 529]. Schon hier ist zu erkennen, daß der Staat und die Familie nicht voneinander zu trennen sind und eine Einheit bilden. Der Staat schützt die Familie in ihrer Privatheit, d.h. er greift hier nicht ein. Dieses Nicht-Eingreifen beinhaltet auch, daß innerhalb der Familie keine liberalen Rechte gelten, sondern dieser Bereich durch Tradition, Liebe, Normen und die Natur geregelt wird [Brown 1995: 181]. Dieses Nicht-Eingreifen war und ist teilweise immer noch ein Schutz und eine Privilegierung der männlichen Dominanz in der Familie. Dennoch darf nicht übersehen werden, daß die Familie auch von staatlichen Normen durchdrungen ist [Rosenberger 1997: 125]. Der Staat greift indirekt auch in die Organisation der privaten Sphäre ein: So gibt es z.B. immer noch sozial- und familienpolitische Regelungen, die die Rolle der Frau in der Familie bevorzugen (steuerliche Begünstigung der Alleinverdiener, Witwenpensionen u.ä.) [Rosenberger 1997: 127]. Für Frauen besteht heutzutage zwar nicht mehr eine so direkt bestimmte Einbindung in die Familie, wie dies noch zu Zeit der ersten Vertragstheoretiker bestand, wohl aber hat sie immer noch eine andere Stellung in bezug auf Familie, also Privatheit, und Beruf, also Öffentlichkeit. So werden Frauen heutzutage vor die Wahl gestellt, ob sie Beruf und Karriere oder Familie haben wollen. Doch diese vermeintliche Wahlfreiheit für Frauen übersieht vollkommen, daß für Männer Beruf und Familie als möglich offengehalten wird und weiterhin anstrebenswert ist. Die geschlechtsspezifische Trennung besteht also weiterhin [Rosenberger 1997: 127]. Diese unterschiedliche Stellung für Männer und Frauen durch die Familie zeigt auch das, was andere Feministinnen kritisieren: Männern wird die Begehrlichkeit und Affektivität nicht abgesprochen, sondern nur auf die private Sphäre beschränkt [Young, Iris Marion 1995: 261]. Die Frauen selbst haben in der Familie keine Privatheit, keinen Schonraum und keine Intimität. Sie sind nur die, die den Männern dieses bieten sollen [Rosenberger 1997: 126]. Hauptgrund für diese Kritiken ist, daß Privatheit in Europa als das Recht auf Familie definiert wird und nicht als ein individuelles Freiheitsrecht [Rosenberger 1997: 121].
Wie könnte nun das Problem der Privatheit als Familie verändert oder gelöst werden?
Feministinnen schlagen hier mehr oder weniger radikale Lösungen vor. Der Slogan der Frauenbewegung "Das Private ist politisch." [vgl. z.B. Rosenberger 1997: 122] fordert einen radikalen Bruch mit der vermeintlichen Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit. Iris Marion Young bleibt dagegen bei einem Modell Öffentlichkeit - Privatheit, will aber eine Neudefinition dieser beiden erreichen: "Anstatt Privatheit als etwas zu definieren, das von der Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, sollte Privatheit [...] als der Aspekt des menschlichen Lebens definiert werden, von dem jedes Individuum mit Fug und Recht andere ausschließen kann." [Young, Iris Marion 1995: 272]. Diese definitorische Grenzverschiebung der Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit greift daran an, daß die Trennung dieser beiden Sphären eben nicht, wie oft dargestellt wird, fest vorgegeben ist, sondern veränderlich. "Privatheit bezeichnet weniger eine Sphäre, als vielmehr eine Relation, die einerseits stets auf das Öffentlich-Staatliche bezogen ist, andererseits als Qualität menschlicher Beziehungen verstanden werden muß." [Sauer 1997: 37] Der Staat ist historisch "einerseits Produkt der Spaltung in öffentlich und privat, er ist andererseits auch ihr Produzent und Reproduzent" [Sauer 1997: 36]. Aufgrund dieser Rolle des Staates wird er nun im nächsten Teil und in den Kapiteln 3.3 und 3.4 näher betrachtet.
Der Staat
In diesem Abschnitt werden einige Punkte angesprochen, die den Staat in bezug auf Öffentlichkeit und Privatheit betreffen. Ausgenommen werden hier die beiden Problematiken des Staatsbürgerstatus und der Unparteilichkeit, die in den Kapiteln 3.3 und 3.4 behandelt werden und meines Erachtens die theoretisch wichtigsten Probleme darstellen.
Iris Marion Young weist auf das Problem hin, daß im Staat manche Gruppen privilegiert und andere unterdrückt sind. Den Begriff der Unterdrückung konkretisiert sie durch folgende Sachverhalte: "Ausbeutung", "Marginalisierung", "Machtlosigkeit", "Kulturimperialismus" und die Tatsache, daß die Gruppenmitglieder "willkürliche Gewalt und Schikane" erleiden [Young 1993: 282f]. Die "Ausgrenzung der Frauen aus dem modernen öffentlichen und politischen Leben" widerspricht "dem liberaldemokratischen Versprechen einer allgemeinen Emanzipation und Gleichheit" [Young, Iris Marion 1995: 246]. Daß dies so ist, wird meist durch zwei theoretische Annahmen abgesichert: Die eine betrifft den Staatsbürgerstatus und die andere die Unparteilichkeit des Staates (siehe dazu Kapitel 3.3 und 3.4). "Staatstheorien dethematisieren private Beziehungsmuster innerhalb staatlicher Institutionen und suggerieren die Scheidbarkeit staatlicher und privater Bereiche bzw. Handlungslogiken." [Sauer 1997: 32]. Damit bleiben Staatstheorien "geschlechtslos, weil sie sexualisierte Annahmen über Staat und Institutionen sowie über 'Männlichkeit' und 'Weiblichkeit' nicht explizieren." [Sauer 1997: 32]. Damit wird eine Einheitlichkeit und Universalität der bürgerlichen Öffentlichkeit vorgetäuscht, die nicht vorhanden ist [vgl. Young 1993: 267 und 1995: 248].
Wie könnte nun diese spezifische Unterdrückung und Benachteiligung der Frauen im Staat aufgehoben oder abgebaut werden?
Iris Marion Young schlägt hierzu drei institutionelle Mechanismen vor: die "Selbstorganisation der Gruppenmitglieder", das "Öffentlichmachen einer von der Gruppe erstellten Analyse" und die "Vetomacht im Hinblick auf ganz bestimmte politische Maßnahmen" [1993: 283]. Eine solche "Gruppenvertretung" sieht Young als "die beste Institutionalisierung von Fairneß" an [1993: 286]. Die Problematik dieser Strategie erkennt Young schon selbst und nennt sie das "Dilemma der Differenz" [1993: 292]. Einerseits muß die Differenz geleugnet werden, um einen Ausschluß aufgrund dieser zu verhindern. Und andererseits muß die Differenz betont werden, um (schon längst) vorhandene Nachteile zu kompensieren. Young selbst nennt keine Lösung dieses Dilemmas, doch die von mir oben eingenommene Perspektive eröffnet einen Ausweg: Wenn Geschlecht (= gender) nur als Konstruktion angenommen wird, jedoch als eine wirksame, weil historische und kulturelle, dann kann sie vom biologischen Geschlecht (= sex) abgetrennt werden. Das Dilemma läßt sich dadurch auflösen, daß die biologische Differenz, aufgrund der ausgeschlossen wird, verleugnet wird, die kulturelle und historische Geschlechtskonstruktion (= gender) aber betont wird. Das Dilemma, vor dem Young steht, entsteht also daraus, daß sex und gender nicht eindeutig unterschieden werden.
Der nächste Abschnitt beschäftigt sich damit, wie Frauen auf dem Arbeitsmarkt handeln und behandelt werden. Dies ist in einem engen Zusammenhang damit zu sehen, wie Familie und Staat als Institutionen definiert oder (aus meiner theoretischen Perspektive) konstruiert werden.
Der Arbeitsplatz/Arbeitsmarkt
Die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt umschreibt Wendy Brown sehr treffend: "First, women supply unremunerated reproductive labor, and because it is both unremunerated and sequestered from wage work, most women are dependent upon men or the state for survival when they are engaged in it. Second, women serve as a reserve army of low-wage labor and are easily retained as such because of reproductive work that interrupts their prospects for a more competitive status in the labor force." [Brown 1995: 185].
Frauen vollbringen also die nicht entlohnte, reproduktive Arbeit und sind so von der Lohnarbeit ausgeschlossen. Dabei sind sie meist noch von Männern oder dem Staat abhängig, um überhaupt überleben zu können. Weiterhin dienen sie als billige Arbeitsreserve und können so leicht aus der reproduktiven Arbeit herausgeholt oder in diese abgeschoben werden. Frauen können aufgrund dieser Tatsache kaum die gleiche Wettbewerbsposition auf dem Arbeitsmarkt erreichen wie Männer.
Die Situation von Frauen zeigt, daß die politische Ökonomie blind ist für Begriffe wie "(g)eschlechtshierarchische Arbeitsteilung, weibliche Produktivität und unentgeltliche Hausarbeit" [Young, Brigitte 1995: 255]. Diese Gleichgültigkeit und Blindheit der Theorie entsteht einerseits aus der Trennung in die private und öffentliche Sphäre, andererseits wird diese dadurch wiederholt und gefestigt: Frauen werden nicht als gesellschaftliche und ökonomische Subjekte wahrgenommen [Young, Brigitte 1995: 255]. Nur so ist zu erklären, daß die Partizipationsrate von Frauen am Arbeitsmarkt steigt, zugleich dieser aber immer noch geschlechtsspezifisch segmentiert ist. So sind die Löhne immer noch geschlechtsspezifisch differenziert [Young, Brigitte 1995: 257], und Frauen erhalten aufgrund von systematischen Ausschlußmechanismen aus existenzsichernden Erwerbsmöglichkeiten nur "bad jobs" [Young, Brigitte 1995: 268]. Außerdem hob die steigende Zahl erwerbstätiger Frauen die spezifische Arbeitsteilung in der Familie nicht auf, so daß diese Frauen mit einer erheblichen Doppelbelastung konfrontiert werden [Young, Brigitte 1995: 258]. Frauen werden immer noch als Hauptarbeiter innerhalb der Familie konstruiert mit der Begründung, daß sie "natürlich" für die Familie bestimmt seien [Brown 1995: 181]. Dies deutet darauf hin, daß die weibliche Arbeitskraft in der und für die Familie nicht nur aus der Theorie ausgeblendet wird, sondern darüber hinaus auch als "unerschöpfliche Ressource" wie z.B. Luft oder Wasser angesehen wird [Young, Brigitte 1995: 262]. Legitimiert wird die schlechtere Lage von Frauen auf dem Arbeitsmarkt durch die Definition von Qualifikation. Frauen wird diese zumeist abgesprochen. Eine Feministin weist darauf hin, daß der Qualifikationsbegriff in eine "männliche Kultur eingebettet" ist und so die Männer von vornherein einen "Traditionszuschlag" erhalten [Young, Brigitte 1995: 266][4]. Die Diskriminierung der Frau wird in der ökonomischen Theorie jedoch "als eine rationale, selbstgewählte Strategie interpretiert, die eine Folge der Gebärfähigkeit ist" [Young, Brigitte 1995: 259].
Wie kann die Diskriminierung der Frau auf dem Arbeitsmarkt abgebaut oder sogar verhindert werden?
Hier ist zu bedenken, daß "(d)ie geschlechtsspezifische Arbeitsteilung [...] Ausdruck der gesellschaftlichen und staatlichen Macht- und Herrschaftsstrukturen" ist [Young, Brigitte 1995: 260]. Allein beim Arbeitsmarkt anzusetzen, erscheint also zunächst zwecklos. Eine andere, konstruktivistisch orientierte Feministin vertritt jedoch die These, daß "(d)as geschlechtsspezifische Verhältnis am Arbeitsplatz, bedingt durch geringere körperliche und technische Fähigkeiten, durch mangelndes Selbstbewußtsein und durch niedrigeren Lohn", wobei all dies gesellschaftlich geprägt, konstruiert und erzeugt ist, "vielmehr die Ursache der häuslichen Unterdrückung" ist [Young, Brigitte 1995: 267][5]. Diese beiden sich widersprechenden Thesen zeigen, daß auch hier wieder eine komplexe Problematik vorliegt. Die Wirkungsrichtung ist nicht klar erkennbar. Daher ist meines Erachtens eine Doppelstrategie notwendig. Einerseits muß die Konstruktion der Frau als Hausfrau und Mutter überwunden werden, und andererseits müssen Frauen auf dem Arbeitsmarkt eine bessere Wettbewerbsposition erhalten. Diese zu erreichen, ist allerdings aufgrund der zunehmenden Arbeitslosigkeit und den daher entstehenden Schließungsprozessen schwer. Der Staat scheint hier eine entscheidende, wenn auch sehr widersprüchliche Rolle zu spielen: Einerseits sichert und erhält der Staat die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt durch private Eigentumsrechte, kapitalistische Beziehungen bei der Produktion, die Kontrolle weiblicher reproduktiver Arbeit usw. [Brown 1995: 185f], andererseits ist der Staat aufgrund seines Einflusses für die Frauen eine mögliche Arena, um ihre Forderungen durchzusetzen. Die Bewertungen der feministischen Politik, die mit dem Staat Veränderungen erreichen will, ist sehr unterschiedlich: Brown weist auf die Gefahren hin, die entstehen, wenn der Staat als Gleichmacher, Beschützer oder Befreier gesehen wird [1995: 196]. Brown charakterisiert staatszentrierte feministische Politik damit, daß diese immer eher im Verdacht steht, die Bedingungen und Konstruktion von Frauen zu wiederholen, als sie neu zu überarbeiten [1995: 173]. Connell dagegen sieht den Staat anders: "The state thus ist not just a regulatory agency, it is a creative force in the dynamic of gender." [Connell 1992: 530]. Er weist darüber hinaus auf die besondere Attraktivität des Staates als Ansprechpartner für feministische Forderungen hin: Der Staat ist ein sozialer Akteur, der die Macht hat, Gesellschaftliches zu regeln [Connell 1995: 530].
Die nächsten beiden Kapitel beschäftigen sich mit dem universellen Staatsbürger und der vermeintlichen Unparteilichkeit des Staates. Beides hängt eng miteinander zusammen und ist aufeinander bezogen. Es handelt sich bei diesen beiden nämlich um zwei verschiedene Ursachen, die jedoch dieselben Folgen haben; sie bewirken nämlich einerseits einen Ausschluß der Frauen aus dem vollständigen Staatsbürgerstatus und andererseits ihren Einschluß in das Gemeinwesen Staat.
3.3 Zum universellen Staatsbürgerstatus
Der Gesellschaftsvertrag ist ein Vertrag zwischen allen freien und gleichen Individuen. Dabei wird jedoch übersehen, daß Frauen aus der zentralen Kategorie des Individuums von vornherein ausgeschlossen werden [Pateman 1994: 79] (vgl. Kapitel 3.1). Das Individuum wird so konstruiert und plaziert, daß Frauen von diesem Status ausgeschlossen werden [Rosenberger 1997: 124f]. "Die moderne politische Theorie machte den gleichen Staatsbürgerstatus geltend" [Young 1993: 267]. Das "Ideal des universalen Staatsbürgers" wird aber nicht als "Gleichheit", sondern als "Gleichsein" konstruiert [Young 1993: 267]. Es wird also eine "Homogenität der Staatsbürger" angenommen, die sich z.B. in Begriffen wie dem Allgemeinwohl oder Allgemeinwillen niederschlägt [Young 1993: 269]. "Das Ideal eines Gemeinwohls, eines Allgemeinwillens und eines geteilten öffentlichen Lebens drängt auf eine homogene Bürgerschaft." [Young 1993: 271]. Faktisch hat dies zur Folge, daß die Staatsbürgerschaft nicht dazu führt, daß Unterschiede überwunden werden, sondern daß stattdessen eine Homogenität der Staatsbürger durch Ausschluß erreicht wird [Young 1993: 270]. Die "Idee, der Staatsbürgerstatus sei für alle gleich," wurde also in die Forderung übersetzt, "alle Staatsbürger hätten gleich zu sein" [Young 1993: 273]. Die Forderung der Homogenität aller Staatsbürger "schließt aus der Öffentlichkeit all jene Individuen aus, die nicht dem Modell des rationalen Bürgers entsprechen" [Young, Iris Marion 1995: 259]. Dieser Ausschluß kommt dadurch zustande, daß asymmetrische bzw. hierarchische Dichotomien konstruiert [ Young, Iris Marion 1995: 253] und in spezifischer Weise verknüpft werden: So stehen sich einerseits das Natürliche, das Private und die Frauen als Gebärende und andererseits das Gesellschaftliche, das Öffentliche und die Männer als Herrschende scheinbar unvereinbar gegenüber [vgl. Pateman 1994: 85 und Rosenberger 1997: 124]. Pateman weist darauf hin, daß sich aus diesen Dichotomien ein weiterer Aspekt des Individuums ergibt: Zum Individuum gehört auch der Rückhalt in der Privatssphäre, der sich dort aus der Unterwerfung der Frauen ergibt [Pateman 1994: 85]. Iris Marion Young analysiert diese Situation folgendermaßen: "Solange diese Dichotomie[6] in Kraft ist, erzwingt die Aufnahme der zuvor Ausgeschlossenen [...] in die Definition der Staatsbürgerschaft eine Homogenität, die die Unterschiede der Gruppen in der Öffentlichkeit unterdrückt und die zuvor ausgeschlossenen Gruppen praktisch zwingt, sich an Normen messen zu lassen, die von den privilegierten Gruppen stammen und von ihnen definiert wurden" [Young 1993: 274]. "Wenn man in einer Gesellschaft, in der einige Gruppen privilegiert sind, darauf besteht, daß Personen ihre besonderen Zugehörigkeiten und Erfahrungen hinter sich lassen sollen, um einen allgemeinen Standpunkt einzunehmen, so dient das nur der Verstärkung des Privilegs" [Young 1993: 276].
Die Staatsbürgerschaft wird durch eine bestimmte Definition von Universalität als Ausschlußinstrument mißbraucht. Es handelt sich dabei nicht um die Staatsbürgerschaft für jeden, sondern es geht darum, daß alle Bürger "ein gemeinsames Leben mit den anderen Bürgern" haben "und in gleicher Weise wie die anderen Bürger behandelt" werden [Young 1993: 268]. Young schlägt als mögliche Lösung das Konzept des differenzierten Staatsbürgerstatus vor [1993: 268], doch eine nähere Betrachtung der Lösungsmöglichkeiten verschiebe ich an das Ende des nächsten Kapitels, da durch die Annahme der Unparteilichkeit des Staates ähnliche und teilweise sogar dieselben Folgen entstehen.
3.4 Die vermeintliche Unparteilichkeit der Öffentlichkeit
Der Standpunkt des "Ideals einer unparteiischen normativen Vernunft" ist ein "kontrafaktisches Konstrukt" [Young, Iris Marion 1995: 250]. Die Unparteilichkeit, die bei der öffentlichen Entscheidungsfindung gefordert wird, verlangt die Konstruktion eines idealen Ichs. Dieses hat weder Geschichte, noch hat es besondere Ziele, noch ist es Mitglied einer Gemeinschaft, und es besitzt auch keinen Körper [Young, Iris Marion 1995: 250][7]. Das Ideal der Unparteilichkeit führt dazu, daß Differenz, egal wie sie entstanden ist, geleugnet und unterdrückt wird [Young, Iris Marion 1995: 247f]. "Das Ideal einer unparteiischen moralischen Vernunft versucht, die Andersheit auch in Gestalt der Unterschiedlichkeit des moralischen Subjekts zu eliminieren" [Young, Iris Marion 1995: 252]. Die spezifische Konstruktion von Frauen als die, die begehren, Gefühle haben und affektiv sind, schließt sie aus dieser Konstruktion des unparteiischen Standpunkts aus, "(w)eil die Unparteilichkeit nur dann ihre Einheitlichkeit erlangen kann, wenn Begehren, Gefühl und Körper aus der Vernunft verbannt werden" [Young, Iris Marion 1995: 253]. Das "Ideal der bürgerlichen Öffentlichkeit als Ausdruck des Gemeinwillens, der unparteiische Standpunkt der Vernunft," läuft auf die Ausgrenzung von Frauen und anderen Gruppen innerhalb des Staates (z.B. ethnische und religiöse Minderheiten) hinaus [Young, Iris Marion 1995: 259].
Im Ergebnis sind die Folgen der Konstruktion der Unparteilichkeit und des Staatsbürgers die gleichen: Gruppen, die sich von der herrschenden in irgendeiner Form unterscheiden, werden ausgegrenzt. Zu beachten ist hierbei auch, daß die Konstruktion des Staatsbürgers und die des Ideals der Unparteilichkeit auch eng miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig unterstützen und verstärken. So könnte man die Unparteilichkeit, die in der öffentlichen Sphäre eingenommen werden soll, auch als Voraussetzung für das Erreichen des Staatsbürgerstatus sehen. Meiner Meinung nach sind diese beiden Konstruktionen, Staatsbürgerstatus und Unparteilichkeit jedoch getrennt voneinander zu sehen. Der vermeintliche Zusammenhang und der noch weiter gehende Bezug auf die öffentliche und private Sphäre sichert nämlich diese beiden Konstruktionen und ihre Folgen ab. Eine Veränderung dieses komplexen Konstruktionensystems, das durchaus Widersprüche in sich trägt (z.B. alle, aber gemeint sind nur die herrschenden Männer), ist nur möglich, wenn an vielen der einzelnen, aber aufeinander bezogenen Konstruktionen Kritik geübt wird. Wie diese nun in bezug auf Staatsbürgerstatus und Unparteilichkeit aussieht, betrachte ich im folgenden Anschnitt.
Wie kann nun der spezifische Ausschluß von Frauen durch das Konstrukt des universellen Staatsbürger und des unparteilichen Staates verändert werden?
Die Veränderungsvorschläge hier sind unterschiedlich in ihrer Radikalität und zumeist nicht von der Öffentlichkeits-Privatheits-Problematik zu trennen. Der Grund hierfür ist, daß eine möglichst umfassende Veränderung des Konstruktionenkomplexes und nicht nur einzelner Konstrukte erfolgen soll.
Connell bleibt am Begriff des Staatsbürgers und fordert: "If women's situation is defined as a case of imperfect citizenship, the answer is full citizenship." [1992: 512]. Iris Marion Young weist darauf hin, "daß die Ideale des Liberalismus und der Vertragstheorie wie die formelle Gleichheit und die universelle Rationalität, durch männliche Vorurteile über das Wesen des Menschen und die Natur der Gesellschaft auf tiefgreifende Weise verdorben und verunstaltet sind." [1995: 247]. Sowohl Connell als auch Iris Marion Young vertreten weiterhin liberale Werte und die Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit, wollen diese aber neu interpretiert sehen. "Die alte Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatem muß völlig neu gefaßt werden, so daß sie nicht mehr einem Gegensatz zwischen Vernunft einerseits und Affektivität und Begehren andererseits, zwischen Allgemeinem und Besonderem entspricht." [Young, Iris Marion 1995: 271]. Iris Marion Young schlägt das Konzept des "differenzierten Staatsbürgerstatus" [1993: 268] und die "Idee einer heterogenen Öffentlichkeit" [1993: 287 und 1995: 275] als Lösung vor. "Als allgemeines Prinzip betrachtet besagt diese Idee einer heterogenen Öffentlichkeit, daß es nur einen Weg gibt, um sicherzustellen, daß das öffentliche Leben nicht die Personen oder Gruppen ausgrenzt, die es in der Vergangenheit ausgegrenzt hat: Man muß den Benachteiligungen, die diese Gruppen erfahren, eine besondere Aufmerksamkeit schenken und ihre besondere Geschichte zu einem öffentlichen Thema machen." [Young 1993: 275f]. Young konkretisiert ihren Lösungsvorschlag durch die "Gruppenvertretung" [1993: 286f], die in Kapitel 3.2 unter dem Teilabschnitt Staat schon kurz vorgestellt worden ist. "Obgleich weit davon entfernt, mit Sicherheit realisiert zu werden, drückt das Ideal einer 'Regenbogen-Koalition' eine solche heterogene Öffentlichkeit mit den Formen der Gruppenvertretung aus." [Young 1993: 287].
Einen weiteren Vorschlag der feministischen Wissenschaft, der die Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit aufrecht erhält, wird bei Rosenberger genannt [1997: 133f]. "Die Trennlinie zwischen öffentlich und privat" soll "verschoben und entlang geänderter Aufgabenstellungen und gewünschter Entwürfe neu gezogen" werden [Rosenberger 1997: 133]. Dazu soll Privatheit enthierarchisiert werden, indem nicht mehr die Familie, sondern individuelle Freiheitsrechte als Grundlage für die Privatheit genommen werden. Privatheit soll zu einem Freiheitsrecht für alle, also auch für Frauen, werden [Rosenberger 1993: 133].
Andere radikalere Vorschläge, die von Holland-Cunz im Hinblick auf eine feministische Demokratietheorie [1998] vorgestellt werden, wollen die Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit ganz auflösen. Auf diese Vorschläge möchte ich aufgrund ihrer Heterogenität und ihrem meines Erachtens nach noch utopischen Charakter hier nicht näher eingehen.
Das nächste Kapitel beschäftigt sich beispielhaft damit, wie der Staat das Geschlecht konstruiert bzw. die Geschlechterkonstruktion stützt oder begünstigt.
4. Geschlechtsrelevante Staatspraxis und -politiken
Dieses Kapitel ist in zwei Teile gegliedert: Im ersten wird die Macht- und Legitimationspolitik und im zweiten die Mutterschafts- und Reproduktionspolitik näher betrachtet. Zu bedenken ist hier, daß politische Maßnahmen nicht einfach etwas rein Staatliches sind oder zufällig entstehen, sondern daß sie in ein institutionelles Geflecht eingebettet sind. Dieses institutionelle Netzwerk besteht nicht nur aus staatlichen Institutionen, sondern auch aus weiteren staatlichen und privaten Akteuren sowie privaten Institutionen, die einen Einfluß nehmen auf das, was als staatliche Politik oder Entscheidung entsteht [Kulawik/Sauer 1996: 26]. Es wird in diesem Kapitel also die feministische Staatsdefinition aus Kapitel 2.1, c) zugrunde gelegt. Der Staat wird also als "Set von diskursiven Arenen" verstanden [Sauer 1997: 34]. Daher wird auch in diesem Kapitel der Blick z.B. auf Familie, Arbeitsmarkt und die dort herrschenden Machtverhältnisse gerichtet sein, wobei ich allerdings auch teilweise nur kurz auf den theoretischen Teil verweisen werde.
4.1 Macht- und Legitimationspolitik des Staates
Der Themenbereich, den dieses Kapitel umfassen könnte, ist immens groß. Daher beschränke ich mich auf drei, meiner Meinung nach zentrale Punkte: Zulassen und Fördern der hegemonialen Männlichkeit, die rechtliche Verregelung von sprachlicher Diskriminierung und den Wohlfahrtsstaat. Die ersten beiden Punkte werden nur skizziert, da schon im theoretischen Teil hierfür viele Beispiele genannt wurden. Den dritten Punkt, nämlich den Wohlfahrtsstaat, werde ich genauer betrachten, da dieser meines Erachtens nach heute einen entscheidenden Faktor für die spezifische Geschlechterordnung hat.
Ein weiterer, entscheidender Punkt für die Legitimation des Staates, der aber schon im theoretischen Teil ausführlich angesprochen wurde, ist seine scheinbare Geschlechtsneutralität, die sich in den Konzepten des Individuums, des Staatsbürgers, der Universalität usw. wiederfindet.
Zulassen und Fördern der hegemonialen Männlichkeit
Zunächst stelle ich hier kurz das Konzept der hegemonialen Männlichkeit dar, das von Robert W. Connell stammt [1992, 1995, Carrigan/Connell/Lee 1996]. " 'Hegemonie' bezieht sich [..] immer auf eine historische Situation, eine Reihe von Umständen, in denen Macht gewonnen und bewahrt wird" [Carrigan/Connell/Lee 1996: 64]. Hegemonie ist also keineswegs irgendwie natürlichen oder göttlichen Ursprungs, sondern Hegemonie entsteht aus den historischen und kulturellen Entwicklungen. Es gibt keine feststehenden Gruppierungen, sondern es geht bei Hegemonie um die Bildung von Gruppierungen [Carrigan/Connell/Lee 1996: 64]. Worin besteht jetzt konkret die hegemoniale Männlichkeit? Welche Charakteristika weist sie auf? Es handelt sich hierbei weitgehend um das Männlichkeitskonzept, gegen das im theoretischen Teil argumentiert wurde. Plakativ und kurz gesagt: Bei der hegemonialen Männlichkeit handelt es sich um den heterosexuellen Mann, der der Ernährer seiner Familie ist und eine liebende, fürsorgende Frau sowie ein paar Kinder hat. An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß auch das Konstrukt der hegemonialen Männlichkeit Wandlungen und inneren Spannungen unterliegt [siehe dazu Connell 1995: 38-40]. Das kennzeichnende Element der hegemonialen Männlichkeit ist aber, daß es sich um "eine erfolgreiche Strategie" in bezug auf die Unterordnung der Frauen handelt [Carrigan/Connell/Lee 1996: 63]. Wie diese aber konkret erreicht wird oder erreicht werden soll, sieht unterschiedlich aus: So weist Connell auf den Konkurrenzkampf innerhalb der hegemonialen Männlichkeit hin: Zwei Männlichkeiten, wovon die eine sich "um interpersonale Dominanz" und die andere sich "um Wissen und Sachverstand" organisiert, konkurrieren miteinander [Connell 1995: 37]. Carrigan, Connell und Lee betonen, daß es nicht nur das hegemoniale Männlichkeitskonzept, sondern auch andere Formen der Männlichkeit gibt, die aber unterdrückt werden [1996: 56, 62]. Dennoch wird das Bild der hegemonialen Männlichkeit auch von Männern anderer Männlichkeitsformen mitgetragen, da die meisten Männer von der Unterordnung der Frau profitieren [Carrigan/Connell/Lee 1996: 63]. Weiterhin "kann Männlichkeit als persönliche Praxis nicht von ihrem institutionellen Kontext getrennt werden" [Connell 1995: 27]. Die oben betrachteten Institutionen - Staat, Arbeitsplatz/Arbeitsmarkt und Familie - sind an der Geschlechterorganisation beteiligt. Connell weist darauf hin, daß auch der Staat ein "bearer of gender" (= Träger von Geschlecht) ist [1992: 523]. Daher unterscheidet Connell zwischen gender regime und gender order. Gender regime ist ein eingrenzbarer, enger Bereich, der die staatlichen Geschlechterbeziehungen betrifft bzw. umfaßt. Gender order dagegen ist ein weiter Begriff, der auch die Gesellschaft und die sozialen Verhältnisse umfaßt. Dieser Bereich umfaßt bzw. betrifft also die staatlichen, politischen, gesellschaftlichen und sozialen Geschlechterbeziehungen [Connell 1992: 523]. Als Hauptstrukturen des gender regime identifiziert Connell die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung [1992: 523; vgl. Carrigan/Connell/Lee 1996: 59, 65], die geschlechtsspezifischen Machtstrukturen [1992: 525; vgl. Carrigan/Connell/Lee 1996: 58] und "the structure of cathexis" [1992: 526; vgl. Carrigan/Connell/Lee 1996: 60]. Damit meint Connell die geschlechtsspezifische Strukturierung der Gefühlswelt, die sich darin äußert, daß bestimmte Gefühle an ein bestimmtes Geschlecht gebunden werden [1992: 526].
Wie kann nun die hegemoniale Männlichkeit dekonstruiert werden?
Zahlreiche Ideen und Vorschläge hierzu finden sich schon im Kapitel 3. Doch an dieser Stelle sei noch einmal explizit darauf hingewiesen, daß die Geschlechterverhältnisse zur Zeit das Konstrukt der hegemonialen Männlichkeit immer wieder herstellen und reproduzieren. "Man könnte hegemoniale Männlichkeit, ihren strategischen Erfolg vorausgesetzt, als etwas begreifen, das automatisch funktioniert. Sie funktioniert aber niemals automatisch." (Hervorhebung nicht im Original) [Carrigan/Connell/Lee 1996: 70]. Allerdings existiert kein einfacher "Weg zu einer nachhaltigen Rekonstruktion von Männlichkeit" [Carrigan/Connell/Lee 1996: 72]. Dies liegt daran, daß das Konstrukt der hegemonialen Männlichkeit in ein komplexes Theorienkonstrukt inzwischen eingebettet ist, so daß eine Dekonstruktion schwierig, aber dennoch nicht unmöglich ist.
Im nächsten Abschnitt werde ich mich kurz mit der rechtlichen Regulierung von sprachlicher Diskriminierung beschäftigen.
Rechtliche Verregelung von sprachlicher Diskriminierung
Sprachliche Diskriminierung möchte ich hier näher betrachten, da die "sprachliche Äußerung [...] als modus vivendi von Macht selbst" erscheint (Hervorhebung im Original) [Butler 1998: 106f]. Bei dieser Betrachtung liegt der Foucault'sche Machtbegriff zugrunde. Sprache ist, da mit ihr das Handeln anderer beeinflußt, beschränkt oder manipuliert werden kann, selbst quasi eine Lebensform von Macht. Und als solche muß auch die Sprache in bezug auf die Geschlechterdifferenzierung betrachtet werden.
In diesem Abschnitt stelle ich das Konzept der hate speech von Judith Butler vor [1998]. Hate speech ist zunächst nur ein rechtlicher Terminus technicus in Amerika. Das Konzept der hate speech, wie es sich in Amerika findet, ist nicht direkt auf die Bundesrepublik Deutschland übertragbar, dennoch lassen sich einige Punkte auf Deutschland und andere westliche Länder verallgemeinern. Spezifisch für Amerika ist bei der hate speech insbesondere die Verquickung der Themen Sexismus und Rassismus. Diese findet sich nicht in dieser Art in Deutschland. Allerdings läßt sich in bezug auf die spezifische Regulierung von hate speech Parallelen finden. Die entscheidende Frage ist nämlich, ab wann hate speech, also diskriminierende und abwertende Sprache, erst zu hate speech wird. Es ist festzuhalten, daß durch die verfassungsrechtlich geschützte Redefreiheit zunächst einmal alle Aussagen, gleich welcher Art, zulässig sind. "Die sprachliche Äußerung hat damit gerade deswegen die Macht, die Unterwerfung, die sie beschreibt oder betreibt, auch durchzuführen, weil sie im öffentlichen Raum frei operieren kann, ohne durch den Staat gehindert zu werden." [Butler 1998: 105]. Wer entscheidet aber nun, ab wann es sich um hate speech handelt? "Als diskriminierende Handlung betrachtet, ist hate speech etwas, worüber die Gerichte entscheiden müssen. und so gilt hate speech nicht als haßerfüllt oder diskriminierend, solange die Gerichte nicht entscheiden, daß sie es ist. [...] Obwohl diejenige hate speech, die noch nicht hate speech ist, zeitlich vor der gerichtlichen Bewertung der Äußerung liegt, wird doch das betreffende Sprechen erst durch ein bestätigendes Urteil des Gerichts zu hate speech. Die rechtliche Entscheidung über hate speech ist somit eine Angelegenheit des Staates, oder genauer, seines juridischen Zweiges." (Hervorhebung im Original) [Butler 1998: 138f]. Damit hat der Staat eine ganz bestimmte und weitreichende Definitionsmacht: "Tatsächlich produziert der Staat aktiv den Bereich der öffentlich akzeptablen Sprache, indem er die folgenschwere Grenze zwischen dem Bereich des Sagbaren und des Unsagbaren zieht und damit auch die Macht behält, sie zu ziehen und aufrechtzuerhalten." [Butler 1998: 111].
Wie könnte dem männlich geprägten Staat die spezifische Definitionsmacht bei diskriminierender Sprache entzogen werden?
Butler lehnt den einfachen Täter-Opfer-Dualismus ab. Sie verweist auf die Machttheorie von Foucault und weist darauf hin, daß "(d)ie komplexen institutionellen Strukturen von Rassismus und Sexismus" so unzulässig reduziert werden [Butler 1998: 115]. Bei der einfachen Dualismus-Annahme wird nämlich das Subjekt vorschnell als Ursache des Problems des Rassimus oder Sexismus identifiziert. Daher ist für Butler die rechtliche Verregelung des Problems nur ein vermeintliches Instrument gegen hate speech [Butler 1998: 115]. Sie weist außerdem darauf hin, daß ein Subjekt nicht alle Wirkungen seiner Sprache beeinflussen kann. Je nach institutionellem Kontext und der spezifischen Situation kann ein- und dieselbe Äußerung unterschiedliche Wirkungen haben [Butler 1998: 116f]. Für Butler liegt die Lösung des Problems der sprachlichen Diskriminierung in der Eröffnung eines diskursiven Raumes, da die "politische Neutralität der Rechtssprache mehr als zweifelhaft" ist, "(s)olange der Staat die Macht behält, bestimmte eigene Formen verletzenden Sprechens zu schaffen und aufrechtzuerhalten" [Butler 1998: 146]. Butler will eine nicht staatszentrierte Regulierung von hate speech [Butler 1998: 146]. Butler übersieht meiner Meinung nach aber das Problem, das auch die Eröffnung eines diskursiven Raumes allein noch keine bessere Regulierung von hate speech garantiert. Solange z.B. die Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit bestehen bleibt, können Frauen von dem öffentlichen Diskurs zur Regulierung von hate speech ferngehalten werden. Die von Butler vorgeschlagene Strategie hat nur den Effekt des Abbaus von Diskriminierung, wenn gleichzeitig andere differenz-abbauende Strategien verfolgt werden, wie sie im Kapitel 3 schon vorgestellt wurden.
Der Wohlfahrtsstaat
Der Wohlfahrtsstaat selbst ist in bezug auf Frauen und feministischen Forderungen nach Geschlechtergleichheit eine sehr widersprüchliche und kontrovers bewertete Institution. So stellt Connell z.B. fest: "(T)he welfare state [..] has generally undermines domestic patriarchy" [1992: 528]. Während Connell der Ansicht ist, daß der Wohlfahrtsstaat im allgemeinen das häusliche Patriarchat untergräbt, sieht Brigitte Young im keynesianischen Wohlfahrtsstaat keine Gefährdung der traditionellen Familie [1995: 258]. Fraser konstatiert, daß die bestehenden Wohlfahrtsstaaten "keinen angemessenen Schutz, insbesondere nicht für Frauen und Kinder" bieten [1996: 469]. Und recht differenziert bemerkt Sauer: "Der Wohlfahrtsstaat schwächte männliche Dominanz in der Familie, vergrößerte dort aber den Einfluß seiner Institutionen, verengte gleichsam den Raum staatsfreier Privatheit, so daß Frauen leichter Zugang zum öffentlichen Raum erhielten. Er stärkte darüber hinaus korporatistische Netzwerke, in denen Gleichstellungspolitiken nicht greifen, wo Männer nach wie vor dominieren, und er produzierte apparateigene Antifeminismen (Abtreibungsregelung)." [1997: 47]. Weiterhin darf jedoch nicht vergessen werden, daß der jetzige "Rückbau sozialstaatlicher Leistungen unter der Maßgabe des Sparens" gerade die Gruppe der Frauen trifft [Sauer 1997: 31].
Die Problematik, die aus dem Wohlfahrtsstaat oder allgemein aus dem staatlich gewährten Schutz für Frauen entsteht, wird von Wendy Brown klar und eindeutig genannt: "(T)he heavy price of institutionalized protection is always a measure of dependence and agreement to abide by protector's rules" [1995: 169]. "The prerogative of the state [...] is often all that stands between women and rape, women and starvation, women and dependence upon brutal mates" [Brown 1995: 191]. Der instutionalisierte Schutz wird immer mit einem gewissen Maß an Abhängigkeit und der Zustimmung zu den Regeln des Beschützers bezahlt. Die prärogative Staatsmacht ist nämlich meist alles, was Frauen vor Vergewaltigung, Verhungern und der Abhängigkeit von brutalen Ehemännern bewahrt. Diese Staatsmacht aus feministischer Perspektive zu kritisieren, ist schwierig, da der Schutz einerseits wichtig ist für Frauen, sie andererseits aber auch unzulässig einschränkt und vom Staat abhängig macht [Brown 1995: 191].
Eine recht genaue, normative Analyse des Wohlfahrtsstaates nimmt Nancy Fraser vor [1996]. Sie weist darauf hin, daß die derzeitige Krise des Wohlfahrtsstaates unter anderem auch auf den "Zerfall der alten Geschlechterordnung" zurückgeführt werden kann [Fraser 1996: 469; vgl. Brown 1995: 184]. Dies liegt daran, daß der Wohlfahrtsstaat auf dem längst überkommenen "Ideal des 'Familieneinkommens' " basiert [Fraser 1996: 469]. Heutzutage sind Frauen erwerbstätig, wobei sie aber schlechter als Männer bezahlt werden, und die traditionelle Form der Familie wird durch insgesamt weniger Heiraten und eine zunehmende Scheidungsrate weitgehend aufgelöst. Für die neue Situation "mit weniger stabilen Arbeitsplätzen und einer größeren Vielfalt von Familienformen" ist die bisherige Struktur des Wohlfahrtsstaates unangemessen [Fraser 1996: 470]. Fraser identifiziert beim jetzigen Wohlfahrtsstaat eine dreiteilige Struktur: Das Kernstück sind die Sozialversicherungsprogramme; weiterhin gibt es Programme, die Frauen von ihrer reproduktiven Arbeit z.B. durch Einrichtung von Kindertagesstätten oder Ganztagsschulen, entlasten; der dritte Teil besteht aus weiteren Sozialleistungen, wie z.B. der Armenhilfe [Fraser 1996: 469f]. Um dieses bestehende Modell und weitere alternative Modelle des Wohlfahrtsstaates bewerten zu können, stellt Fraser normative Kriterien für die Geschlechtergleichheit auf. Diese sind folgende: Bekämpfung der Armut, Bekämpfung der Ausbeutung, gleiche Einkommen, gleiche Freizeit, gleiche Achtung, Bekämpfung der Marginalisierung und Bekämpfung des Androzentrismus [Fraser 1996: 473-478]. Nur wenn alle Bedingungen gesamthaft erfüllt werden, gewährleistet ein Wohlfahrtsstaatsmodell die Gleichheit der Geschlechter.
Das erste Wohlfahrtsstaatsmodell, das Fraser betrachtet, ist das Modell der allgemeinen Erwerbstätigkeit [1996: 480]. Das Modell versucht, durch eine Generalisierung der Rolle des Verdieners und Sicherung der Chancengleichheit für die Geschlechter die spezifische Benachteiligung von Frauen zu vermeiden [Fraser 1996: 480]. Die Reproduktions- und Betreuungsarbeit wird bei diesem Modell voll auf den Markt verlagert und dort geregelt [Fraser 1996: 486]. Doch dieses Modell hat auch entscheidende Nachteile. So wird der Status des Ernährers und des Arbeitenden zwar für beide Geschlechter zugänglich, aber es findet keine Gleichstellung aller statt. Die Sozialversicherungsleistungen wären also weiterhin vom Erwerbseinkommen abhängig. Weitere Sozialleistungen würden nur als wohlfahrtsstaatliche Leistungen, quasi wie Almosen, an die Bedürftigen abgegeben werden [Fraser 1996: 481; vgl. Pateman 1992: 60]. Dieses Problem besteht in den USA viel deutlicher als in Deutschland. Der Sozialstaat ist zweigeteilt: Es gibt einen "männlichen" Teil, der auf dem System der Sozialversicherung und einem Rechtsanspruch auf Leistungen beruht, und es gibt einen "weiblichen" Teil, der nur aus abgeleiteten und bedarfsgeprüften Leistungen besteht, die nur an Bedürftige verteilt werden, wobei die Bedürftigkeit allerdings vom Staat definiert und kontrolliert wird [Kulawik 1997: 295]. Aufgrund der staatlichen Kontrolle solcher wohlfahrtsstaatlichen Leistungen monieren Kritikerinnen des Wohlfahrtsstaates, "daß bei Leistungsempfängerinnen [...] das Recht der Unantastbarkeit der Privatheit verletzt werde" [Rosenberger 1997: 130]. Beim Modell der allgemeinen Erwerbstätigkeit wird der bisher herrschende männliche Maßstab beibehalten. Gestützt wird dies durch einige Maßnahmen zur Erreichung von Chancengleichheit für beide Geschlechter [Fraser 1996: 491]. Der Androzentrismus und die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die nun nicht mehr direkt an der Grenze Mann-Frau verläuft, werden also nicht aufgehoben. Es bleiben die männlichen Werte weiterhin erhalten und maßgeblich [Fraser 1996: 484]. Weiterhin birgt dieses Modell auch die Gefahr, daß die Betreuungsarbeit auf dem Markt erbracht und bezahlt wird, diese aber weiterhin nicht anerkannt und überwiegend von Frauen erbracht wird [Fraser 1996: 481].
Das zweite Modell, das Fraser vorstellt, ist das Modell der Gleichstellung der Betreuungsarbeit [Fraser 1996: 485]. In diesem Modell geht es nicht darum, Frauen und Männer aneinander anzugleichen, sondern für eine kostenfreie Differenz zu sorgen [Fraser 1996: 485]. Die Betreuungsarbeit verbleibt bei diesem Modell in der privaten Sphäre, wird aber vom Staat unterstützt [Fraser 1996: 486]. Das Hauptproblem dieses Modells wird schnell deutlich: Es würde immense Kosten verursachen, die nur durch ein anderes Steuersystem und eine neue politische Kultur zu bewältigen wären [Fraser 1996: 487]. Bei diesem Modell bliebe die traditionelle Arbeitsteilung mit all ihren diskriminierenden Elementen erhalten und die Frau bliebe weiterhin in der privaten Sphäre ohne politischen Einfluß [Fraser 1996: 488f]. Beide Modelle hält Fraser aufgrund ihrer Nachteile für nicht akzeptabel. Sie weist darüber hinaus darauf hin, daß die beiden Modelle jeweils nur unterschiedliche Typen von Frauen fördern [1996: 485, 490].
Wie kann das Problem des jetzigen, männlich geprägten Wohlfahrtsstaates angemessen gelöst werden? Was gibt es für alternative Modelle?
Problematisch ist hier das schon oben angesprochene Problem des institutionalisierten Schutzes. Brown steht aufgrund der Legitimationsmacht, die von wohlfahrtspolitischen Maßnahmen ausgeht, sowohl dem Wohlfahrtsstaat als auch feministischer Politik, die im Bereich des Staates agiert, eher ablehnend gegenüber [1995: 169f]. Kritik am Wohlfahrtsstaat oder allgemein am institutionalisierten Schutz des Staates zu üben, ist aus feministischer Perspektive schwierig und zwiespältig, da einerseits der institutionalisierte Schutz deutliche Vorteile bringt, andererseits aber auch eine unzulässige Einschränkung der theoretischen bürgerlichen Freiheit vornimmt [Brown 1995: 191]. Die Kritik am Wohlfahrtsstaat wird damit fast zwangsläufig zu einer Gratwanderung.
Dennoch werde ich hier das von Fraser favorisierte Modell der universellen Betreuungsarbeit vorstellen [1996: 490-493], obwohl es auch bei diesem wohlfahrtsstaatlichen Modell einige Probleme gibt.
Das Modell der universellen Betreuung integriert Lohn- und Betreuungsarbeit, so daß für beide Geschlechter neue Möglichkeiten eröffnet werden würden [Fraser 1996: 473]. Konkret sieht das Modell vor, daß alle einen Teil der informellen Betreuungsarbeit übernehmen sollen. "Der Schlüssel zur Verwirklichung der vollen Gleichheit der Geschlechter in einem postindustriellen Wohlfahrtsstaat liegt also darin, die gegenwärtigen Lebensmuster von Frauen zum Standard und zur Norm zu machen. Frauen verbinden heutzutage oft Einkommenserwerb und Betreuungsarbeit, wenngleich unter großen Schwierigkeiten und mit Streß." [Fraser 1996: 492]. Die Folgen, die sich aus diesem Modell ergeben, sind kürzere Wochenarbeitszeiten für alle, keine Spaltung mehr des Arbeitsmarktes und des Wohlfahrtsstaates sowie die Möglichkeit für beide Geschlechter, in gleicher Art und Weise am gesellschaftlichen und politischen Leben teilnehmen zu können [Fraser 1996: 492f]. Fraser stellt sich die Verwirklichung dieses Modells konkret durch die Einrichtung von "staatlich finanzierten, aber lokal organisierten Einrichtungen" vor, in denen auch "kinderlose Erwachsene, ältere Menschen und Menschen ohne verwandtschaftliche Verpflichtungen zusammen mit Eltern und anderen Personen Betreuungstätigkeiten auf einer demokratischen und selbstverwalterischen Basis ausüben" [Fraser 1996: 493]. Fraser konstruiert soziale Bürgerrechte für Erwachsene, "die Erwerbsarbeit, Betreuungsarbeit, Aktivitäten für die Gemeinschaft, Mitwirkung am politischen Leben und Engagement in der Zivilgesellschaft miteinander verbinden - und noch Zeit für vergnügliche Dinge ermöglichen" [Fraser 1996: 493].
Das Modell von Fraser ist in bezug auf die Gleichheit der Geschlechter eine gute Lösung, jedoch ist dieses Modell zur Zeit meines Erachtens nach noch utopisch - Fraser selbst spricht von einer "Vision" [1997: 493] -, da der ganze männliche Konstruktionenkomplex, sowohl privat, als auch politisch und wirtschaftlich bzw. gesellschaftlich, in einem Schritt aufgelöst werden müßte. Die sich an vielen Stellen ergebenden Widerstände wären wohl kaum zu brechen. Auch problematisch ist meiner Meinung nach, daß bei Fraser die sozialen Bürgerrechte auch als soziale Bürgerpflichten ausgelegt werden können. Ich habe hier unter dem Gesichtspunkt der Demokratie und insbesondere der Freiwilligkeit jedes einzelnen starke Bedenken. Im schlimmsten Falle könnte ein staatlich kontrolliertes System entstehen, in dem der Staat, oder anders gesagt die Menschen, die gerade herrschen, eine Gleichheitsdiktatur aufbauen. Im Endeffekt würde dann keine Gleichheit erreicht werden, sondern nur wieder eine neue Spaltung zwischen Herrschenden und Beherrschten entstehen, wobei hier die Differenzierung aber nicht mehr aufgrund des Geschlechts geschehen würde. Ein weiteres Problem besteht darin, "daß der Wohlfahrtsstaat sich nicht allein mit einem Staatsvolk konstituiert, sondern mit komplex angereicherten Gruppenidentitäten von Männern oder Frauen, Klassen, sexuellen Orientierungen, Ethnien" [Demirovic/Pühl 1997: 231f]. Weder bei Frasers Lösungsmodell noch bei den bestehenden Wohlfahrtsstaaten ist meiner Meinung nach gesichert, daß die einzelnen Identitäten, die sich durchaus in ein- und derselben Person befinden können, von den Herrschenden gegeneinander ausgespielt werden [vgl. Benhabib 1997: 60]. Trotz meiner Kritik erscheint mir das Modell der universellen Betreuungsarbeit von Fraser bisher das einzige wohlfahrtsstaatliche Modell zu sein, daß wirklich eine Gleichheit der Geschlechter herstellen könnte. Dieses Modell müßte aber noch um einige Elemente erweitert werden, so daß insbesondere der Mißbrauch durch die Herrschenden vermieden wird.
Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit dem meiner Meinung nach komplexesten und interessantesten Politikfeldern, die die Geschlechterungleichheit betreffen. Mutterschafts- und Reproduktionspolitik sind durch ihre biologische Komponente Politiken, die zunächst nur Frauen betreffen. Dabei werde ich bei diesen Politikbereichen Widersprüche und Elemente näher betrachten, die die Vermutung nahe legen, daß es eben nicht nur um den Schutz der Mutter oder um Reproduktionstechnologien geht, sondern eben auch um Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern, die der Staat durch seine Politik unterstützt und verfestigt.
4.2 Mutterschafts- und Reproduktionspolitik
Mutterschafts- und Reproduktionspolitik sind eng verwandte Bereiche. Die neuen Reproduktionstechniken führen dazu, daß der Status Mutterschaft sich in seiner Bedeutung verändert. Es sind hier mehrere Konstruktionen denkbar: genetische Mutterschaft, Mutterschaft durch Schwangerschaft, Mutterschaft durch Verantwortung, Erziehung und Betreuung [Kontos 1997a: 82]. Durch die zunehmende Technologisierung des Schwangerschaftsprozesses, wie z.B. durch Vorsorgeuntersuchungen mit Ultraschall, wird der Frauenleib zum "öffentlichen Ort"[8], und der Fötus oder Embryo wird zur eigenständigen Person mit eigenen Rechten [Kontos 1997a: 80].
Zunächst werde ich die Mutterschaftspolitik betrachten, da diese zunächst einmal zeitlich vor der Reproduktionspolitik entstanden ist und weil die anschließende Betrachtung der Reproduktionspolitik meiner Meinung nach dann besser mit ihren Widersprüchlichkeiten und Eigenarten erkennbar wird.
Mutterschaftspolitik
"Frauen als Subjekte, als Individuen mit eigener Stimme, als vollberechtigte Menschen fehlen in dieser Tradition. Sie tauchen nur als Erfüller bestimmter grundlegender Funktionen auf. Während ihre Subjektivität ebenso unbekannt wie uninteressant ist, wird ihre Objektivität, ihre Gebärfähigkeit, streng überwacht und gelenkt." (Hervorhebung im Original) [Benhabib/Nicholson 1987: 516]. Ähnlich äußert sich auch Pateman: "Der politische Stellenwert der Frauen beruht auf einem grundlegenden Paradox: Sie sind aus- und eingeschlossen worden aufgrund derselben Fähigkeiten und Eigenschaften." [1992: 56]. Frauen werden einerseits von der Zivilgesellschaft und aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen und andererseits im privaten Bereich in den Staat eingeschlossen. "Aber das bedeutet nicht, daß Frauen keinen politischen Beitrag zu leisten und keine politische Pflicht zu erfüllen hatten. Ihre politische Pflicht (wie ihr Ausschluß vom Staatsbürgerrecht) leitet sich ab von ihrer Differenz gegenüber Männern, bemerkenswerterweise ihrer Fähigkeit zur Mutterschaft." [Pateman 1992: 56f]. Mutterschaft wird "als ein politischer Status" verstanden, der "die Pflicht der Frauen gegenüber dem Staat und ihre Rolle als Staatsbürgerinnen" bestimmt und geprägt hat [Pateman 1992: 60]. Diese politische Pflicht und die Repoduktionsarbeit schulden die Frauen dem Staat nicht als Staatsbürgerinnen, sondern "aufgrund ihres Geschlechts", weshalb diese Arbeit auch nicht zur Sphäre des Staatsbürgerrechts gezählt wird [Pateman 1992: 62][9]. Mutterschaft und der daraus abgeleitete Mutterschutz beruhen im bürgerlichen Geschlechterentwurf auf zwei verschiedenen Verständnissen von Mutterschaft, die eigentlich nicht miteinander vereinbar sind: Mutterschaft wird einerseits als "Quelle von Zivilität und gesellschaftlicher Integration" gesehen, andererseits aber als "Quelle der Schwäche" und der Schutzbedürftigkeit [Kontos 1997b: 362]. Diese Konstruktion von Mutterschaft und die Bedingungen für Mutterschaft sind weitgehend von Männern festgelegt worden [Pateman 1992: 58][10]. Daher wird auch der Bedeutung von Sex und sexueller Beziehung, also dem Zusammenhang, in dem Frauen schwanger werden, keine oder nur wenig Beachtung geschenkt [Pateman 1992: 59].
Mutterschaftspolitik ist ein sehr komplexes Politikfeld, das eigentlich nicht auf der einfachen Differenzannahme, daß Frauen und Männer von Natur aus unterschiedlich sind, beruhen sollte [vgl. Pateman 1992: 55 und Kontos 1997b: 356]. Im Folgenden werde ich daher darauf eingehen, wie Mutterschaftspolitik konkret gehandhabt wird und welche Widersprüche sich dabei ergeben.
Mutterschaftspolitik ist eine staatliche Schutzpolitik. Mit dem staatlich gesicherten Schutz soll die Mutter geschützt werden. Damit wird "ein unmittelbares Verhältnis zwischen Frau und Staat" konstituiert, und Mutter wird zu einem "politischen Status eigener Art" [Kontos 1997b: 356f]. Auch Brown weist auf die Bedeutung von Schutzpolitiken hin: "Protection codes are thus key technologies in regulating privileged women as well as in intensifying the vulnerability and degradation of those on the unprotected side of the constructed divide between light and dark, wives and prostitutes, good girls and bad ones." [1995: 170]. Schutzbestimmungen in Form von Gesetzen sind also Schlüsseltechnologien. Diese können sowohl zur Regulierung von privilegierten Frauen als auch bei der Verstärkung der Verwundbarkeit und Herabsetzung von denen eingesetzt werden, die auf der ungeschützten Seite der konstruierten Unterscheidung zwischen hell und dunkel, Ehefrauen und Prostituierten, guten Mädchen und schlechten stehen.
Frauen werden durch die Mutterschaftspolitik gesellschaftlich als Mütter in Anspruch genommen. So wurde die Mutterschaft immer wieder politisch dazu benutzt, Frauen "von der politischen Bühne und vom Normalarbeitsverhältnis" fernzuhalten [Kontos 1997b: 360]. Die Mutterschutzgesetzgebung besteht aus Arbeitsverboten, Arbeitszeitbeschränkungen und Beschäftigungsbeschränkungen vor und nach der Geburt. Weiterhin sind auch einige Krankenversicherungsregelungen Teil der Mutterschaftspolitik [Kontos 1997b: 363]. Kontos verweist auf Sabine Schmitt[11], die schon bei den ersten Mutterschutzregelungen vier Paradoxien festgestellt hat [Kontos 1997b: 363f]. Erstes Paradox: Die ersten Arbeiterinnenschutzgesetze bezogen sich nur auf Fabrikarbeiterinnen, die nur eine Minderheit unter den erwerbstätigen Frauen darstellten, da die meisten Frauen im häuslichen Bereich oder in der Landwirtschaft arbeiteten. Das entscheidende an den Fabrikarbeiterinnen war jedoch, daß sie dem "bürgerlichen Weiblichkeitsentwurf" widersprachen [Kontos 1997b: 363]. Zweites Paradox: Der Arbeiterinnenschutz bezog sich auf alle Industriearbeiterinnen, ganz unabhängig davon, ob sie Hausfrauen und Mütter waren oder nicht. "(D)ie Schutzbedürftigkeit" wurde "an das Geschlecht gebunden" und "nicht an die tatsächliche Belastung durch Haushalt und Kinder" [Kontos 1997b: 363f]. Das dritte Paradox besteht darin, daß die Arbeiterinnen nicht selbst an der Formulierung der Arbeiterinnenschutzpolitik beteiligt waren und oft diese sogar ablehnten [Kontos 1997b: 364]. Das vierte Paradox beruht darauf, daß die Wirksamkeit der Arbeiterinnenschutzgesetzgebung aufgrund geringer Kontrollen und vieler Ausnahmeregelungen gering war. Der Schutz hatte "eher symbolische Bedeutung" und diente "der 'Inszenierung' des Geschlechterverhältnisses" [Kontos 1997b: 364].
Kontos weist auf einen weiteren Widerspruch hin, nämlich daß die Behandlung der unehelichen Mutterschaft anders aussieht als die der ehelichen. Das einzige, was diese beiden unterscheidet, ist, daß die uneheliche Mutterschaft nicht dem Bild der traditionellen, "familialen Organisation" entspricht [Kontos 1997b: 364]. Darüber hinaus muß auch eine historische Dimension beachtet werden. Mutterschaft und Mutterschutz werden zunehmend vom Körper der Mutter gelöst und als Kompensation für mütterliche Erziehungsleistungen gedacht [Kontos 1997b: 364]. Die beiden letzten Widersprüche entstehen aus und in Zusammenhang mit Reproduktionstechnologien und der Reproduktionspolitik. Daher werde ich diese im nächsten Abschnitt näher betrachten.
Ein weiterer Widerspruch besteht darin, daß Mutterschaft als Krankheit oder Krankheitsrisiko gesehen wird und so in das Krankenversicherungssystem eingegliedert wurde [Kontos 1997b: 364, 366]. Dadurch wird Schwangerschaft und Mutterschaft zum individuellen Lohnarbeitsrisiko weiblicher Arbeitskräfte [Kontos 1997b: 366]. Weiterhin besteht die Mutterschutzpolitik aber auch auf Elementen, die in Richtung einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für die Mutterschaft gehen. Dazu gehören z.B. eine Teilsubventionierung der Mutterschaft durch den Staat, Mütterberatungsstellen, Mütterschutzheime und Mütterschulen. Diese Elemente sind jedoch nur in Einzelgesetzen zu finden [Kontos 1997b: 366f]. Gerade durch diese neuen Elemente aber wird Mutterschaft sozial gestaltet und staatlich überprüft. Mutterschaft wird damit zur "öffentlichen Angelegenheit" [Kontos 1997b: 368]. Wie weit dieses ausarten kann, zeigte die nationalsozialistische Mütterpolitik [Kontos 1997b: 368][12].
Wie könnte der besondere Status der Mutterschaft definiert oder gebraucht werden, damit dadurch einerseits keine geschlechtsspezifischen Diskriminierungen enstehen und andererseits ein ausreichender Schutz für Mütter geboten werden kann?
Pateman weist darauf hin, daß es bei dieser Diskussion nicht um "Gleichheit" und "Differenz", "sondern um die Unterordnung der Frau geht" [Pateman 1992: 67]. Inzwischen gibt es Entwicklungen, die Mutterschaft nicht mehr nur als Pflicht, sondern als ein Recht zu verstehen [Pateman 1992: 66]. Diese Entwicklungen sind die Reproduktionstechnologien, auf die im nächsten Abschnitt näher eingegangen werden wird. Bei dem Streit um Mutterschaftspolitik geht es darum, "daß beide Geschlechter Vollbürger sind und daß für sie als Frauen und Männer ihr Bürgerrecht von gleichem Wert ist. [...] Der springende Punkt beim Problem 'Differenz' ist die Freiheit der Frauen." [Pateman 1992: 67]. Ziel ist nicht, daß alle Bürgerinnen und Bürger gleich behandelt werden, sondern daß sie gleichwertig behandelt werden [Pateman 1992: 67].
An diesem Punkt stellt sich die Frage, wie die Mutterschaft behandelt werden sollte. Eine gute Antwort darauf ist die feministische Forderung nach einer Mutterschaftsversicherung, die schon um die Jahrhundertwende herum entwickelt wurde. Diese wäre eine Versicherung sui generis und würde die Frauen der "fürsorglichen Belagerung" durch den Staat entziehen [Kontos 1997b: 370].
Die Mutterschaftsversicherung basiert auf drei Grundsätzen:
Zunächst einmal ist die Mutterschaft eine gesellschaftliche Funktion, die daher vom Staat geschützt und gesichert werden müßte. Weiterhin ist die Mutterschaft kein Grund für den Ausschluß der Frauen aus dem Staatsbürgerstatus, sondern im Gegenteil die "Grundlage für die Staatsbürgerschaft der Frau" (Hervorhebung in Original). Und drittens ist die Mutterschaft keine Krankheit und kein Defizit, "sondern eine gesellschaftliche Leistung, die anerkannt und honoriert und nicht als 'Schaden' kompensiert werden sollte" [Kontos 1997b: 370f].
Problematisch und umstritten wäre allerdings die Finanzierung der Mutterschaftsversicherung. Sollte sie wie eine weitere Sozialversicherung gehandhabt werden oder als allgemeine Volksversicherung? Als Konsens wäre auch eine weitgehende Finanzierung aus Mitgliedsbeiträgen denkbar, die durch steuerliche Mittel bei Bedarf aufgestockt würde [Kontos 1997b: 371f]. Zur Zeit ist ein kleiner Teil der Mutterschaftsversicherung über die Krankenversicherung abgedeckt. Dies führt aber dazu, daß Schwangerschaft wie eine Krankheit gesehen wird und außerdem vom Grund der Schwangerschaft, nämlich Sexualität, an der beide Geschlechter gleichermaßen beteiligt sind, abgelenkt wird. Dies ist ein Punkt, den die Mutterschaftsversicherung bisher noch unberücksichtigt läßt. Auch bleibt letztlich unklar, wer eigentlich Beitragszahler sein sollen. Wenn dies nur Frauen oder Familien mit Kindern wären, würde Mutterschaft als speziell weibliches Risiko angesehen werden und die alte Trennung zwischen ehelicher und unehelicher Schwangerschaft fortbestehen. Diese Art der Finanzierung mißachtet gerade die Ursache für die Schwangerschaft. Meiner Meinung nach wäre eine "Elternversicherung" die beste Lösung, wobei alle potentiellen Eltern und alle Eltern Versicherte und - soweit möglich - Beitragszahler sind. Dies würde auch den speziellen und geschlechtsspezifischen Status der Mutterschaft durch den Status der potentiellen oder realen Elternschaft ersetzen. Das spezifisch problematische ist, daß der Status der Mutterschaft, wenn er politisch definiert und eingesetzt wird, immer dazu dienen kann, Differenz und Unterordnung zu erzeugen. Der Status der Elternschaft bietet meines Erachtens keinen solchen Ansatzpunkt.
Daß auch gerade über den Status der Eltern-, Vater- und Mutterschaft neu nachgedacht werden muß, zeigt sich bei den Reproduktionstechnologien und der Reproduktionspolitik, die ich im nächsten Abschnitt betrachten werde.
Reproduktionspolitik
In diesem Kapitel beziehe ich mich auf Silvia Kontos, die einen sehr ausführlichen Artikel über Reproduktionstechnologie und den politischen Umgang damit geschrieben hat [1997a]. "Unter der neuen Fortpflanzungstechnologie verstehe ich hier das Ensemble von Wissensbeständen und medizinischen Techniken zur Steuerung der menschlichen Fortpflanzung, die zum großen Teil längst in der Tiermedizin und Tierzucht entwickelt, seit den siebziger Jahren auf Probleme der menschlichen Fortpflanzung übertragen werden." [Kontos 1997a: 80]. Kontos weist darauf hin, daß alles, was den Körper betrifft, wie z.B. Reproduktionsmedizin, Gentechnik und Transplantationsmedizin, komplex ist und nicht vereinfacht werden kann [1997a: 75].
Ihre Grundthese besteht darin, "daß mit der Entwicklung der Reproduktionstechnologie eine tiefgreifende Reorganisation des Geschlechterverhältnisses verbunden ist" [Kontos 1997a: 76]. Alle Körperkonzepte, seien es nun die, die zur weiblichen Unterwerfung der Frauen aufgrund ihrer Natur dienten, oder die, die heute feministische Befreiungsvorstellungen zugrunde liegen, sind "historisch gebunden" [Kontos 1997a: 77]. Durch den Einsatz von Reproduktionstechnologien, Gentechnik und Transplantationsmedizin wird das Körperkonzept auch verändert: Der Körper selbst wird zum "Ersatzteillager", und es gibt völlig neue Möglichkeiten "zur Überschreitung individueller Körpergrenzen" [Kontos 1997a: 83]. Die Reproduktionstechnologie relativiert den Beginn individuellen Lebens [Kontos 1997a: 79]. Fötus und Embryo werden durch diese zu eigenständigen Personen, die von der Mutter und dem mütterlichen Körper abgelöst betrachtet werden [vgl. Kontos 1997b: 376 und 1997a: 89]. "Die soziale Öffnung des Frauenleibs und die parallele Subjektivierung des Fötus haben vielfältige Konsequenzen für die Frau und ihr Verhältnis zu ihrem Körper" [Kontos 1997a: 81]. Schwangere Frauen werden z.B. beim Embryonenschutz nicht zu einer eigenen Akteursgruppe. Der Embryonenschutz wird "zu einer Sache zwischen Staat und Ärzten" [Kontos 1997a: 89f].
Eine weitere Folge der Reproduktionsmedizin ist, nachdem zunächst die Vaterschaft schon ungewiß war, nun auch die Mutterschaft ungewiß wird. Elternschaft allgemein kann nun also auf verschiedenen Definitionsmerkmalen beruhen: Diese sind die genetische und die verantwortliche Elternschaft (vgl. oben). Bei Frauen kommt noch die physische Elternschaft dazu, denn die Schwangerschaft kann durch die neue Reproduktionsmedizin von der genetischen und verantwortlichen Elternschaft abgelöst werden. Mutterschaft muß genau wie Vaterschaft rechtlich neu definiert werden [Kontos 1997a: 82]. Auch die bisher traditionelle Verknüpfung von Geschlecht und Generation kann durch die neuen Reproduktionstechniken aufgelöst werden. Posthum kann man z.B. genetisch durch Einfrierung der Samen- oder Eizellen noch Vater oder Mutter werden [Kontos 1997a: 82f]. Ein weiteres Problem, das sich mit der zunehmenden Entwicklung der Reproduktionstechnologie ergibt, ist das Problem ungewollter Kinderlosigkeit. Dieses wird "medikalisiert und individualisiert" [Kontos 1997a: 82]. Die zunehmende Umweltverschmutzung und -zerstörung als Ursache für Kinderlosigkeit gerät damit völlig aus dem Blick [Kontos 1997a: 82]. Weiterhin darf bei der Reproduktionstechnologie auch nicht vergessen werden, daß ihre Entwicklung auch und gerade aufgrund von ökonomischen Interessen vorangetrieben wird. Die Kommerzialisierung des Körpers bekommt durch die neuen Technologien noch eine andere Qualität (Handel mit Blut, Organen, Samen- und Eizellen, Leihmutterschaft usw.) [Kontos 1997a: 84].
Bei der Regulierung der Reproduktionstechnik werden gleichzeitig zwei Strategien angewandt: De-naturalisierung und Re-naturalisierung [Kontos 1997a: 81]. Die beiden Strategien werden parallel und beliebig eingesetzt, so daß an traditionellen Werten wie z.B. der Familie festgehalten werden kann. Es geht bei diesen Strategien darum, "Abstammung und Geschlecht 'natürlich' erscheinen zu lassen", auch wenn dies nur mit sehr komplizierten Regelungen möglich ist [Kontos 1997a: 97]. Es geht bei der Körperpolitik also um zwei Ebenen, die eng mit einander verwoben sind: Die eine Ebene besteht aus der konkreten Intervention in den Körper, also aus seiner Regulierung und Kontrolle. Die zweite Ebene befaßt sich mit der Konstruktion eines bestimmten Körpers, der kontrolliert werden kann und muß. Obwohl beide Ebenen ineinander verwoben sind, können sie nicht auf eine Ebene reduziert werden, da sie sich vor allem hinsichtlich ihrer politischen Interventionsmöglichkeiten unterscheiden [Kontos 1997a: 85]. Kontos weist darauf hin, daß es bei der Fortpflanzungsmedizin "nicht um diffuse 'neokonservative Ängste' geht, sondern durchaus konkret um die Sicherung eines patriarchalen Arrangements der Geschlechter" [1997a: 86]. Sie kommt zu dieser Ansicht, weil an der "Norm der Kernfamilie als Blutsverwandtschaft" trotz vielfältiger anderer Möglichkeiten der Reproduktionstechniken weiterhin festgehalten wird [Kontos 1997a: 85f].
Durch diese "Doppelbödigkeit der Körperpolitik" [Kontos 1997a: 85] entstehen viele Widersprüche. So wird z.B. die Verwendung von Mischsperma, die eine eindeutige Identifizierung des Vaters praktisch unmöglich macht, nicht zugelassen, weil damit das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung, wie Juristen es formulieren, verletzt werden würde. Doch diese Regelung führt dazu, daß nicht die verantwortliche, sondern die genetische Vaterschaft zur rechtlichen Grundlage gemacht wird. Dadurch wird aber die Komplexität der Elternschaft unzulässig reduziert [Kontos 1997a: 88]. Der nächste Widerspruch besteht darin, daß die Regulierung der Reproduktionstechnologie ohne Frauen erfolgt, obwohl sie die Hauptbetroffenen "als Patientinnen, Klientinnen und Nachfragerinnen" sind [Kontos 1997a: 88]. Stattdessen wird der Einsatz der Reproduktionstechnologien auf Ehepaare beschränkt und damit an die Ehe und die Familie gebunden [Kontos 1997a: 88f]. Der oben schon angesprochene Embryonenschutz dient nur dazu, das ungeborene Leben vor der Mutter zu schützen. So gibt es im ärztlichen Diskurs die Annahme, daß die Eltern und insbesondere die Schwangere ein grundsätzliches Verfügungsrecht haben. Dieses nutzt die Forschergemeinschaft, um damit an rechtmäßig überlassenes Fötalgewebe zu gelangen [Kontos 1997a: 89].
An dieser Stelle ist es wichtig, den Diskurs über Reproduktion näher zu betrachten, um zu verstehen, warum es gerade zu diesen Widersprüchlichkeiten kommt.
Beim Reproduktionsdiskurs läßt sich feststellen, daß gerade Frauen ausgeschlossen werden. Kontos verweist auf das "Kooptationsverfahren", das bei der Besetzung von Ethikkommissionen zu diesem Thema stattfindet. Expertinnen, die in das Gremium gewählt werden, werden in der Regel "als Vertreterinnen ihres Fachs bzw. ihrer Profession koopiert und explizit nicht als Vertreterinnen ihres Geschlechts" [Kontos 1997a: 91]. Außerdem sind die Gremien, die z.B. über die Verwendung von Fötalgewebe entscheiden, "nicht unter Legitimationsdruck gesetzt". Ihre Mitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, und "eine Auskunftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit besteht nicht" [Kontos 1997a: 91, 95]. Durch das Kooptationsverfahren wird sichergestellt, daß die Formulierung der Problem- und Fragestellungen sowie auch deren Erörterung selektiv geschieht. "Die neuen Konflikte werden selektiv aufgegriffen, redefiniert" und solange von den Gremien bearbeitet, bis diese Konflikte mit "den bereits bestehenden Verarbeitungs- und Machtstrukturen kompatibel und damit entschärft sind" [Kontos 1997a: 92]. Die Definitionen dieser Gremien sind und bleiben aber anfällig für konkurrierende Interpretationen. Sie sind und bleiben daher eine Definitions- und Regulationsmacht [Kontos 1997a: 94].
Ein weiterer Schwachpunkt des Reproduktionsdiskurses ist, daß die Kontrolle der Reproduktionstechnologie "weitgehend der 'Selbstbindung' der Ärzteschaft" überlassen wird [Kontos 1997a: 92]. Diese Selbstkontrolle der Ärzte führt z.B. dazu, daß der Embryo zwar vor seiner Mutter, nicht aber vor der Ärzteschaft geschützt ist (vgl. oben). Außerdem entsteht durch die Geheimhaltung in den Gremien und die fehlende Fremdkontrolle z.B. durch die Öffentlichkeit eine "Grauzone [...], die nur von der Selbstreflexivität der Ärzteschaft begrenzt wird" [Kontos 1997a: 93].
Aufgrund dieser Beobachtungen kommt Kontos zu folgendem Ergebnis: "Der patriarchale Charakter der gegenwärtigen Reproduktionspolitik liegt weniger in den aktiven Bemächtigungsversuchen bestimmter Männerbünde sondern in der Individualisierung, Rationalisierung und Kommerzialisierung des Körpers und der Generativität sowie in der parallelen Schließung der Reproduktionspolitik gegenüber Frauen als Gruppe" [Kontos 1997a: 94]. Weitere Politikelemente in diesem Bereich, mit denen der Schließungsprozeß gegenüber Frauen fortgetrieben wird, sind folgende: Kritische Frauen, wenn sie denn einmal in ein solches Gremium aufgenommen werden, müssen sich den Gremien anpassen und sind zu strikter Geheimhaltung verpflichtet. Weiterhin ist eine Auflösung der feministischen Kritik in eine breite Zivilisationskritik zu beobachten. Als drittes ist die Spaltungsstratgie zu nennen. Diese besteht darin, Frauen explizit auf die vielartigen und unterschiedlichen Interessen in ihrer eigenen Gruppe hinzuweisen und somit Frauen als einheitliche Gruppe von vornherein in Frage zu stellen [Kontos 1997a: 95].
Wie kann nun die Reproduktionspolitik so gestaltet werden, daß Fraueninteressen darin beachtet werden und daß ein Schließungsprozeß des Reproduktionsdiskurses gegenüber Frauen unmöglich wird?
Es müßte bei der Wertsetzung und der Vorstellung von Schwangerschaft eine andere Konstruktion angewandt werden. Frauen müßten als Gruppe am Reproduktionsdiskurs beteiligt sein. "Es ist primär ihr Körper, in den die Reproduktionsmedizin eingreift, mehr als die des Mannes ist es ihre gesellschaftliche Identität, die historisch durch die Generativität bestimmt wurde, es sind ihre Erfahrungen mit der Generativität, die bislang nur in sehr gebrochener Form zur Sprache kommen konnten, und schließlich haben Frauen eine lange Tradition von Diskursen über den Körper und haben auch die Auseinandersetzungen über die Reproduktionsmedizin früh aufgenommen. Wer, wenn nicht sie, sollte die öffentliche Debatte über eine Neugestaltung der Generativität führen?" (Hervorhebung im Original) [Kontos 1997a: 90]. Ein wichtiger Schritt, um dies zu erreichen, ist die Herstellung von Öffentlichkeit beim Reproduktionsdiskurs [vgl. Kontos 1997a: 93].
Die Lösung könnte auch in einem frauenspezifischen Menschenrecht nach reproduktiver Selbstbestimmung liegen. Wobei sich hier aber das Problem ergibt, daß der bisherige Reproduktionsdiskurs das Menschenrecht des ungeborenen Kindes vor das Selbstbestimmungsrecht der Mutter setzt. "(D)ie körperliche Integrität als Kernbereich von Individualität" (Hervorhebung im Original) ist für Frauen immer noch nicht durchgesetzt und erscheint zur Zeit auch noch nicht als durchsetzbar [Kontos 1997a: 97]. Kontos weist aber darauf hin, daß "am Selbstbestimmungsrecht als Abwehrrecht gegenüber Übergriffen auf die körperliche Integrität von Frauen festzuhalten" ist, "auch wenn damit bestimmte Kommerzialisierungsphänomene nicht zu verhindern sind" [Kontos 1997a: 98].
Insgesamt läßt sich das Problem der Reproduktionspolitik nur in einem größeren Kontext lösen. Neben einer Erweiterung der Machttheorie und der politischen Theorie, ist es nötig, "das Verhältnis zum Körper, zum Leben, zu Krankheit und Tod, wie auch die Generativität als gesellschaftliches Projekt" (Hervorhebung im Original) zu formulieren und politisch neu zu entwerfen [Kontos 1997a: 100]. Worum es bei diesem Diskurs geht, ist der soziale Teil von Reproduktionstechnik. Dieser erfordert "andere Formen des Sprechens über Politik" (Hervorhebung im Original) [Kontos 1997a: 100]. Kontos stellt sich als eine mögliche Lösung, die dies leisten könnte, die Bildung von Politikprovinzen vor, die netzwerkartig miteinander verknüpft sind [Kontos 1997a: 99].
5. Fazit und Schlußbemerkung
Was Kontos in bezug auf die Reproduktionspolitik genannt hat, ist auch in bezug auf die staatliche Konstruktion von Geschlecht zu sagen: Wenn es eine Möglichkeit gibt, die staatliche Konstruktion von Geschlecht zu verändern, dann ist dies nur als gesellschaftliches Projekt möglich. Dieses Projekt ist jedoch nicht einfach und wird eine lange Zeit in Anspruch nehmen. "Thus, a feminist theory of the state requires simultaneously articulating, deconstructing, and relating the multiple strands of power composing both masculinity and the state. The fact that neither state power nor male dominance is unitary or systematic means that a feminist theory of the state will be less a linear argument than the mapping of an intricate grid of overlapping and conflicting strategies, technologies, and discourses of power." [Brown 1995: 177]. Dieses Projekt kann nur erfolgversprechend sein, wenn der Staat nicht als geschlechtsneutral und machtlos in der Geschlechterproblematik angesehen wird. Das charakteristische Paradoxon des modernen Staates besteht zur Zeit nämlich darin, daß seine Macht und Privilegien zunehmend durch deren Verleugnung, durch die Zurückweisung von Verantwortung und die Diffusion von Orten und Handlungen der Kontrolle funktionieren [Brown 1995: 194].
Die Annahme, daß der liberale Staat an sich männlich ist, ist meines Erachtens nicht haltbar (vgl. hierzu Kapitel 3). Dennoch muß auch hier eine Rekonstruktion von Staatlichkeit vorgenommen werden, damit die liberalen von den männlichen Elementen getrennt werden können. Das Verhältnis von Männlichkeit und Liberalismus ist nämlich nicht eine einfache, kausale Beziehung, sondern besteht in einem komplexen, wechselseitigen Konstituieren [vgl. Brown 1995: 183]. Doch hier darf nicht vergessen werden, was ich zu Anfang ausgeblendet habe, nämlich daß Staats- und Geschlechtskonstruktion sich gegenseitig beeinflussen und verändern [vgl. Connell 1992: 523]. Gesellschaftliche Verhältnisse sind immer nur Kompromisse und daher veränderbar. Staat und Gesellschaft bzw. die gesellschaftliche Konstruktion von Geschlecht beeinflussen sich gegenseitig [Connell 1992: 529f]. Da der Staat sich dauernd verändert, ist auch die Veränderung der staatlichen Konstruktion von Geschlecht denkbar und möglich [Connell 1992: 532].
Die Veränderung des Staates kann nur langsam erfolgen, aber sie kann nicht erfolgen, wenn keine Auseinandersetzung mit und keine Kritik an den bestehenden Verhältnissen stattfindet. Zwar ist der Staat und auch Geschlecht historisch in einer ganz bestimmten Art und Weise konstruiert worden, und diese Konstruktionen können auch nicht einfach übergangen werden, sie sind aber keinesfalls fest oder historisch determiniert. Ich hoffe, mit meiner Arbeit einen Teil der Kritik und Auseinandersetzung mit dieser Problematik verständlich, wenn auch nicht umfassend dargestellt zu haben.
Bei der Betrachtung der staatlichen Konstruktion wurden nämlich einige wichtige Punkte nicht bearbeitet. Dazu gehören insbesondere folgende Fragen, die offen geblieben sind:
Wie beeinflußte der Feminismus und speziell die feministische Politikwissenschaft die staatliche Konstruktion von Geschlecht?[13]
Wie sind Globalisierung und die so oft beklagte Auflösung des Nationalstaates im Kontext der Geschlechterkonstruktion zu bewerten?[14]
Wie stehen kooperativer Staat und Geschlecht zueinander? Welche Konstruktion von Geschlecht legt der kooperative Staat zugrunde?
Wie steht es um die Partizipation von Frauen? Welche strukturellen Schranken wurden und sind immer noch durch die staatliche Geschlechtskonstruktion aufgebaut? Welche Auswirkungen hat die Partizipation von Frauen auf die staatliche Konstruktion von Geschlecht?[15]
In welchem Verhältnis stehen staatliche Geschlechtskonstruktion und Demokratie zueinander?[16]
Gerade der letzte Punkt enthält eine Vielzahl weiterer Fragen, wobei ich hier nur ein paar Beispiele nenne:
- Welche feministischen Demokratietheorien gibt es?
- Wie ist die Repräsentation von Frauen konstruiert?
- Wie geht Demokratie mit der Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit um?
- Wie sieht die Verknüpfung von Demokratie und Liberalismus aus? Welche Auswirkungen hat diese auf die Konstruktion von Geschlecht?
Diese Fragen stehen im Gesamtkomplex der staatlichen Geschlechterkonstruktion ebenso, wie die von mir bearbeiteten. Um ein wirklich umfassendes gesellschaftliches Projekt der Veränderung der staatlichen Geschlechtskonstruktion zu erhalten, ist eine Auseinandersetzung mit und Bearbeitung von diesen Fragen unerläßlich. Meine Arbeit stellt daher nur erste Ansatzpunkte für Veränderungsmöglichkeiten dar und müßte eigentlich um diese Fragen erweitert werden, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
6. Literaturverzeichnis
Benhabib, Seyla/Nicholson, Linda (1987): Politische Philosophie und die Frauenfrage (Kapitel XII). in: Fetscher, Iring/Münkler, Herfried (Hrsg.) (1987): Pipers Handbuch der politischen Ideen. Band 5. München/Zürich, S. 513-562
Benhabib, Seyla (1997): Von der Politik der Identität zum sozialen Feminismus. Ein Plädoyer für die neunziger Jahre. in: Kreisky, Eva/Sauer, Birgit (Hrsg.) (1998): Geschlechterverhältnisse im Kontext politischer Transformation. Politische Vierteljahresschrift, Jg. 38/1997, Sonderheft 28/1997. Opladen/Wiesbaden, S. 50-65
Brown, Wendy (1995): Finding the Man in the State. in: dies.: States of Injury. Power and Freedom in Late Modernity. Princeton/New Jersey, S. 166-196
Butler, Judith (1998): Souveräne performative Äußerungen. in: dies. (1998): Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Berlin, S. 103-148
Carrigan, Tim/Connell, Robert W./Lee, John (1996): Ansätze zu einer neuen Soziologie der Männlichkeit. in: BauSteine Männer (Hrsg.) (1996): Kritische Männerforschung: neue Ansätze in der Geschlechtertheorie. Berlin/Hamburg, S. 38-75
Connell, Robert W. (1992): The State, Gender, and Sexual Politics. Theory and Appraisal. in: Theory and Society, Jg. 1992: 5, S. 507-544
Connell, Robert W. (1995): "The Big Picture". Formen der Männlichkeit in der neueren Weltgeschichte. in: Widersprüche. Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich, Jg. 15/1995: 56/57, S. 23-45
Demirovic, Alex/Pühl, Katharina (1997): Identitätspolitik und die Transformation von Staatlichkeit: Geschlechterverhältnisse und Staat als komplexe Relation. in: Kreisky, Eva/Sauer, Birgit (Hrsg.) (1998): Geschlechterverhältnisse im Kontext politischer Transformation. Politische Vierteljahresschrift, Jg. 38/1997, Sonderheft 28/1997. Opladen/Wiesbaden, S. 220-240
Foucault, Michel (1976): Historisches Wissen der Kämpfe und Macht. Vorlesung vom 7. Januar 1976. in: Foucault, Michel (1978): Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin, S. 55-74
Foucault, Michel (1996a): Warum ich die Macht untersuche: Die Frage des Subjekts. in: Foucault, Michel/Seitter, Walter (1996): Das Spektrum der Genealogie. Bodenheim, S. 14-28
Foucault, Michel (1996b): Wie wird Macht ausgeübt?. in: Foucault, Michel/Seitter, Walter (1996): Das Spektrum der Genealogie. Bodenheim, S. 29-47
Fraser, Nancy (1996): Die Gleichheit der Geschlechter und das Wohlfahrtssystem: Ein postindustrielles Gedankenexperiment. in: Nagl-Docekal, Herta/Pauer-Studer, Herlinde (Hrsg.): Politische Theorie. Differenz und Lebensqualität. Frankfurt, S. 469-498
Hindess, Barry (1996): Discipline and Cherish: Foucault on Power, Domination and Government (Chapter 5). in: ders. (1996): Discourses of Power from Hobbes to Foucault. Oxford/Cambridge, S. 96-136
Holland-Cunz, Barbara (1998): Konturen einer feministischen politischen Theorie (Kapitel 4). in: dies. (1998): Feministische Demokratietheorie. Thesen zu einem Projekt. Opladen, S. 79-179
Kersting, Wolfgang (1996): Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrages. Darmstadt
Kontos, Silvia (1997a): Über einige Folgen der neuen Reproduktionstechniken. in: Widersprüche. Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich, Jg. 17/1997: 66, S. 75-102
Kontos, Silvia (1997b): Vater Staat und "seine" Mütter? Über Entwicklungen und Verwicklungen in der Mutterschutzpolitik. in: Kreisky, Eva/Sauer, Birgit (Hrsg.) (1998): Geschlechterverhältnisse im Kontext politischer Transformation. Politische Vierteljahresschrift, Jg. 38/1997, Sonderheft 28/1997. Opladen/Wiesbaden, S. 356-377
Kulawik, Teresa/Sauer, Birgit (1996): Staatstätigkeit und Geschlechterverhältnisse. Eine Einführung. in: dies. (Hrsg.) (1996): Der halbierte Staat. Grundlagen feministischer Politikwissenschaft. Frankfurt/New York, S. 9-44
Kulawik, Teresa (1997): Jenseits des - androzentrischen - Wohlfahrtsstaates? Theorien und Entwicklungen im internationalen Vergleich. in: Kreisky, Eva/Sauer, Birgit (Hrsg.) (1998): Geschlechterverhältnisse im Kontext politischer Transformation. Politische Vierteljahresschrift, Jg. 38/1997, Sonderheft 28/1997. Opladen/Wiesbaden, S. 293-310
Nicholson, Linda (1994): Was heißt "gender"?. in: Institut für Sozialforschung Frankfurt (Hrsg.): Geschlechterverhältnisse und Politik. Frankfurt, S. 188-220
Pateman, Carole (1992): Gleichheit, Differenz, Unterordnung. Die Mutterschaftspolitik und die Frauen in ihrer Rolle als Staatsbürgerinnen. in: Feministische Studien 1/1992, S. 54-69
Pateman, Carole (1994): Der Geschlechtervertrag. in: Appelt, Erna/Neyer, Gerda (Hrsg.) (1994): Feministische Politikwissenschaft. Wien, S. 73-95
Rosenberger, Sieglinde Katharina (1997): Privatheit und Politik. in: Kreisky, Eva/Sauer, Birgit (Hrsg.) (1998): Geschlechterverhältnisse im Kontext politischer Transformation. Politische Vierteljahresschrift, Jg. 38/1997, Sonderheft 28/1997. Opladen/Wiesbaden, S. 120-136
Sauer, Birgit (1997): "Die Magd der Industriegesellschaft". Anmerkungen zur Geschlechtsblindheit von Staatstheorien. in: Kercher, Brigitte/Wilde, Gabriele (Hrsg.) (1997): Staat und Privatheit. Aktuelle Studien zu einem schwierigen Verhältnis. Opladen, S. 29-53
Young, Brigitte (1995): Staat, Ökonomie und Geschlecht. in: Kreisky, Eva/Sauer, Birgit (Hrsg.) (1997): Feministische Standpunkte in der Politikwissenschaft. Eine Einführung. Frankfurt/New York, S. 255-280
Young, Iris Marion (1993): Das politische Gemeinwesen und die Gruppendifferenz. Eine Kritik am Ideal des universalen Staatsbürgerstatus. in: Nagl-Docekal, Herta/Pauer-Studer, Herlinde (Hrsg.) (1993): Jenseits der Geschlechtermoral. Beiträge zur feministischen Ethik. Frankfurt, S. 267-304
Young, Iris Marion (1995): Unparteilichkeit und bürgerliche Öffentlichkeit. Implikationen feministischer Kritik an Theorien der Moral und der Politik. in: Brink, Bert van den/Reijen, Willem van (Hrsg.) (1995): Bürgergesellschaft, Recht und Demokratie. Frankfurt, S. 245-280
[...]
[1] Euchner, Walter (Hrsg.) (1967): Locke, John: Zwei Abhandlungen über die Regierung. (II, §82) Frankfurt, S. 253 zitiert bei Benhabib/Nicholson [1987: 531].
[2] Rousseau führt diese Idee aus in: Rousseau, Jean-Jaques (1993): Diskurs über die Ungleichheit = Discours sur l'inégalité. Paderborn/München/Wien/Zürich, S. 182-185
[3] Rousseau, Jean-Jaques (1971): Émile oder Über die Erziehung. Paderborn, S. 420f zitiert bei Benhabib/Nicholson [1987: 537].
[4] Es handelt sich hier um Regina Becker-Schmidt, die von Young zitiert wird. Das Zitat findet sich bei Becker-Schmidt, Regina (1992): Verdrängung Rationalisierung Ideologie. in: Knapp, Gudrun-Axeli/Wetterer, Angelika (Hrsg.) (1992): Traditionen Brüche. Freiburg, S. 78
[5] Es handelt sich hier um Cynthia Cockburn, deren theoretischer Ansatz von Young genauer dargestellt wird [Young, Brigitte 1995: 265-267].
[6] Young meint hier speziell die Dichotomie Öffentlich-Privat.
[7] Iris Marion Young bezieht sich hier auf Michael J. Sandel (und zwar auf folgendes Werk: Sandel, Michael J. (1982): Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge, Mass.).
[8] Diese Bezeichnung stammt von Barbara Duden. (und zwar aus: Duden, Barbara (1991): Der Frauenleib als öffentlicher Ort. Hamburg)
[9] Pateman bezieht sich hier auf T.H. Marshall. (und zwar auf folgendes Werk: Marshall, T.H. (1963): Citizenship and Social Class. in: Sociology at the Crossroads and other Essays. London)
[10] Pateman bezieht sich hier auf Sara Ruddick. (und zwar auf folgendes Werk: Ruddick, Sara (1983): Maternal Thinking. in: Trebilcot (Hrsg.) (1983): Mothering: Essays in Feminist Theory. Totowa, N.J.)
[11] Kontos bezieht sich auf Schmitt, Sabine (1995): Der Arbeiterinnenschutz im deutschen Kaiserreich. Stuttgart
[12] Kontos verweist hier auf: Bock, Gisela (1986): Zwangsterilisation im Nationalsozialismus. Opladen
[13] Hierzu äußern sich z.B. Kulawik und Sauer [1997].
[14] Zahlreiche Artikel zu dieser Problematik finden sich in: Kreisky, Eva/Sauer, Birgit (Hrsg.) (1998): Geschlechterverhältnisse im Kontext politischer Transformation. Politische Vierteljahresschrift, Jg. 38/1997, Sonderheft 28/1997. Opladen/Wiesbaden
[15] Mit diesem Themenkomplex befaßt sich Hoecker, Beate (1995): Politische Partizipation von Frauen. Ein einführendes Studienbuch. Opladen
Häufig gestellte Fragen zur "Staatliche Konstruktion von Geschlecht"
Was ist das Thema dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der staatlichen Konstruktion von Geschlecht, wobei der Fokus auf der theoretischen Betrachtung (Gesellschaftsvertragstheorie und Liberalismus) und der Analyse verschiedener Politikbereiche liegt.
Welche theoretische Perspektive wird eingenommen?
Geschlechtlichkeit wird ausschließlich als soziale Konstruktion betrachtet. Die genealogische Methode nach Foucault wird zur Analyse verwendet. Die Arbeit konzentriert sich auf die Gesellschaftsvertragstheorie und den Liberalismus.
Was ist die Leitfrage der Hausarbeit?
Die Leitfrage lautet: "Wie konstruiert der Staat Geschlecht?" Diese Frage wird sowohl theoretisch als auch anhand von Staatspraxis und -politiken untersucht.
Welche Definitionen sind für das Verständnis der Arbeit wichtig?
Wichtige Definitionen umfassen: Staat (Nationalstaat, kontraktualistische Definition, feministische Definition), Macht (Macht des Souveräns, Macht im Foucault'schen Sinne) und Geschlecht (sex versus gender).
Was ist der implizite Geschlechtervertrag im Gesellschaftsvertrag?
Carol Pateman argumentiert, dass im Gesellschaftsvertrag implizit ein Geschlechtervertrag existiert, der die Herrschaft der Männer über die Frauen zu begründen und legitimieren versucht.
Wie wirkt sich die Dichotomie von Öffentlichkeit und Privatheit aus?
Die Dichotomie von Öffentlichkeit (Staat, Politik) und Privatheit (Familie, subjektive Handlungszusammenhänge) beeinflusst die Geschlechterkonstruktion, indem sie Frauen oft in die private Sphäre verdrängt und ihre Rolle dort politisch ausblendet.
Was ist die Problematik des universellen Staatsbürgerstatus?
Das Ideal des universellen Staatsbürgerstatus wird oft als "Gleichsein" konstruiert, was zu einem Ausschluss von Individuen führt, die nicht dem Modell des rationalen Bürgers entsprechen, insbesondere Frauen.
Wie beeinflusst die vermeintliche Unparteilichkeit der Öffentlichkeit die Geschlechterkonstruktion?
Das Ideal einer unparteiischen normativen Vernunft schließt Individuen aus, die als emotional, begehrlich oder körperlich wahrgenommen werden, was oft Frauen betrifft.
Welche Rolle spielt die Macht- und Legitimationspolitik des Staates?
Der Staat beeinflusst die Geschlechterkonstruktion durch das Zulassen und Fördern hegemonialer Männlichkeit, die rechtliche Verregelung sprachlicher Diskriminierung und die Gestaltung des Wohlfahrtsstaates.
Wie beeinflusst der Wohlfahrtsstaat die Geschlechtergleichheit?
Der Wohlfahrtsstaat ist eine widersprüchliche Institution, die einerseits männliche Dominanz untergraben, andererseits aber auch geschlechtspezifische Ungleichheiten festigen kann. Es werden verschiedene Modelle (allgemeine Erwerbstätigkeit, Gleichstellung der Betreuungsarbeit, universelle Betreuungsarbeit) diskutiert.
Welche Bedeutung hat die Mutterschafts- und Reproduktionspolitik?
Mutterschafts- und Reproduktionspolitik sind eng verwandte Bereiche, die durch die neuen Reproduktionstechniken beeinflusst werden und Widersprüche aufweisen, da sie oft traditionelle Geschlechterrollen festigen.
Was ist das Problem mit Mutterschaftspolitik?
Mutterschaftspolitik ist eine staatliche Schutzpolitik, die Frauen oft als Mütter vereinnahmt und sie von der politischen Bühne oder dem Normalarbeitsverhältnis fernhält. Sie basiert auf verschiedenen Verständnissen von Mutterschaft, die nicht immer miteinander vereinbar sind.
Wie verändern Reproduktionstechnologien die Geschlechterverhältnisse?
Die Reproduktionstechnologie reorganisiert das Geschlechterverhältnis, indem sie das Körperkonzept verändert, den Beginn individuellen Lebens relativiert und neue Möglichkeiten zur Überschreitung individueller Körpergrenzen schafft.
Was sind die Herausforderungen bei der Gestaltung der Reproduktionspolitik?
Die Herausforderungen bestehen darin, Fraueninteressen zu berücksichtigen, einen Schließungsprozess des Reproduktionsdiskurses gegenüber Frauen zu verhindern und eine Neugestaltung der Generativität zu erreichen.
Was sind die Schlussfolgerungen der Arbeit?
Die staatliche Konstruktion von Geschlecht ist ein gesellschaftliches Projekt, das nur durch Auseinandersetzung mit und Kritik an den bestehenden Verhältnissen verändert werden kann. Der Staat sollte nicht als geschlechtsneutral oder machtlos angesehen werden, sondern als aktiver Gestalter der Geschlechterordnung.
- Quote paper
- Monika Bösche (Author), 1998, Die staatliche Konstruktion von Geschlecht - Eine Betrachtung der Zusammenhänge von Macht und Geschlecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111310