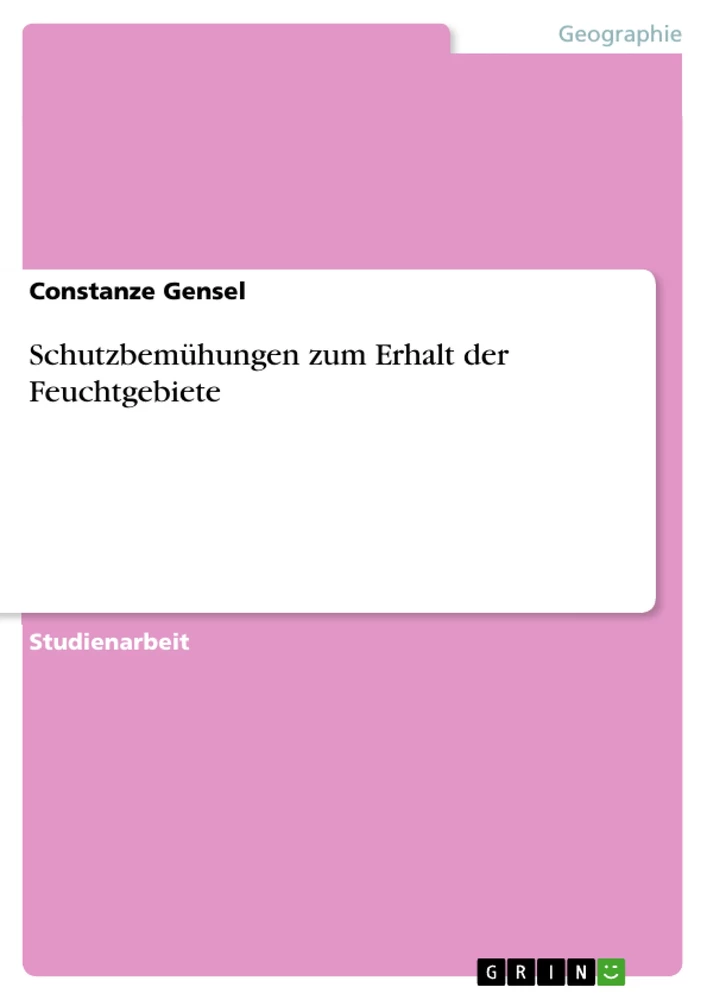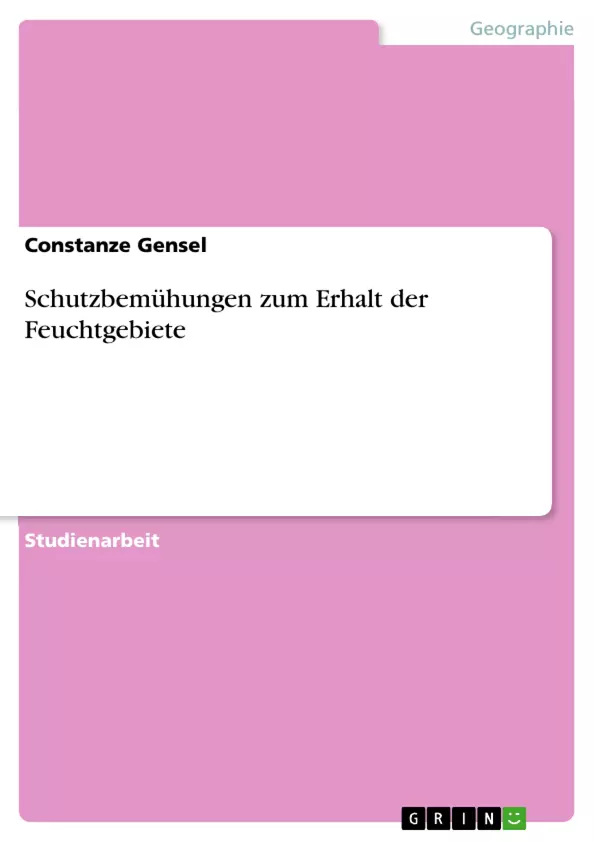Feuchtgebiete, wie z.B. Bäche, Flüsse, Seen, Quellen und Moore, sind ein wichtiger Teil im globalen Wasserkreislauf. Sie beherbergen eine Vielfalt an Lebensgemeinschaften und zeichnen sich durch ihre hohe ökologische Bedeutung, wie z.B. in der Artenvielfalt von Flora und Fauna, aus. Viele ihrer Funktionen kommen dem Menschen zugute.
Sie sind Trinkwasserreservoirs, tragen zur Verbesserung der Wasserqualität bei, verringern durch Speichern von Niederschlägen die Auswirkungen von Überschwemmungen und dienen vielfach als Erholungsräume. Feuchtgebiete zählen jedoch weltweit zu den gefährdetsten Le-bensräumen.
Vielfach sind Feuchtgebiete für den Naturschutz interessant, da sie einerseits durch Dränage-maßnahmen und Dammbauten im Bestand bedroht sind und andererseits häufig eine Vielzahl seltener und schützenswerter Lebewesen umfassen, die an die spezifischen Bedingungen dieses Lebensraums (siehe Biotop) angepasst sind. Die dort lebenden Pflanzen, Tiere, Pilze und Mik-roorganismen müssen mit dem ständigen Wasserüberschuss zurechtkommen, der häufig mit einer unzureichenden Sauerstoffversorgung und der Gefahr von Fäulnis verbunden ist. In Feuchtgebieten lebende Bäume haben daher als besonderen Anpassungsmechanismus besonde-re Wurzeln ausgebildet, die ihnen auch bei Überschwemmung die Atmung ermöglichen.
Inhalt
1. Allgemeines zu Schutzbemühungen
2. Ramsar- Convention
2.1. Ziele
2.2. Inhalt
2.3. Auswahlkriterien
2.4. Beispielregionen und Erfolge der Ramsar Convention
1. Der Ammersee
2. Lafnitztal
Die Erfolge
3. Literatur
„Und wird das Wasser sich entfalten,
sogleich wird sich´s lebendig gestalten;
Da wälzen sich Tiere, sie trocknen zum Flor,
Und Pflanzen- Gezweige, sie dringen hervor.“
Johann Wolfgang von Goethe
1. Allgemeines zu Schutzbemühungen
Feuchtgebiete, wie z.B. Bäche, Flüsse, Seen, Quellen und Moore, sind ein wichtiger Teil im globalen Wasserkreislauf. Sie beherbergen eine Vielfalt an Lebensgemeinschaften und zeichnen sich durch ihre hohe ökologische Bedeutung, wie z.B. in der Artenvielfalt von Flora und Fauna, aus. Viele ihrer Funktionen kommen dem Menschen zugute. Sie sind Trinkwasserreservoirs, tragen zur Verbesserung der Wasserqualität bei, verringern durch Speichern von Niederschlägen die Auswirkungen von Überschwemmungen und dienen vielfach als Erholungsräume. Feuchtgebiete zählen jedoch weltweit zu den gefährdetsten Lebensräumen.
Vielfach sind Feuchtgebiete für den Naturschutz interessant, da sie einerseits durch Dränagemaßnahmen und Dammbauten im Bestand bedroht sind und andererseits häufig eine Vielzahl seltener und schützenswerter Lebewesen umfassen, die an die spezifischen Bedingungen dieses Lebensraums (siehe Biotop) angepasst sind. Die dort lebenden Pflanzen, Tiere, Pilze und Mikroorganismen müssen mit dem ständigen Wasserüberschuss zurechtkommen, der häufig mit einer unzureichenden Sauerstoffversorgung und der Gefahr von Fäulnis verbunden ist. In Feuchtgebieten lebende Bäume haben daher als besonderen Anpassungsmechanismus besondere Wurzeln ausgebildet, die ihnen auch bei Überschwemmung die Atmung ermöglichen.
Der ökologische Wert von Feuchtgebieten ist nicht darauf beschränkt, dass sie vielen gefährdeten Arten Lebensraum bieten: Sie vermindern beispielsweise die Hochwassergefahr, indem sie Überschüsse an Regen- und Schmelzwasser aufnehmen und mit der Zeit langsam wieder abgeben. Die Vegetation und der Boden von Feuchtgebieten filtern Verunreinigungen aus dem Wasser heraus, wenn es versickert, und leiten es so gereinigt in Flüsse, Seen, Binnenmeere und Grundwasserleiter zurück. Feuchtgebiete an Küsten tragen zur Stabilisierung der Ufer bei, indem sie Sedimente zurückhalten und so die Landbildung fördern. Außerdem dämpfen sie die Kraft der Gezeiten und Wellen und schützen so die landeinwärts liegenden Gebiete vor Erosion.
2. Ramsar- Convention
2.1. Ziele
Dieses Übereinkommen, die Ramsar- Convention, ist ein zwischenstaatlicher Vertrag, der die Rahmenbedingungen für die internationale Zusammenarbeit zum Schutz von Feuchtgebietslebensräumen festlegt. Ursprünglich war die Ramsar- Convention auf den Schutz der ziehenden Wasser- und Wattvögel ausgerichtet.
Ursprünglich lag der Schwerpunkt auf der Erhaltung und der richtigen Nutzung von Feuchtgebieten zum Schutz von Wasservogel-Habitaten. Doch die grundlegenden Lehren haben sich über die Jahre hin zu der Erkenntnis erweitert, dass Feuchtgebiete – Küstenfeuchtgebiete genauso wie Mangroven, Korallenriffe und Seegrasbetten – als Ökosysteme extrem wichtig sind, sowohl für die Biodiversität als auch das Wohl der Menschen.
Aufgrund der Ergebnisse nachfolgender Konferenzen der Vertragsparteien, liegen nun die Ziele des Ramsar-Übereinkommens im generellen Schutz wichtiger und seltener Feuchtgebiete. Vor allem dem Verlust und der fortschreitenden Beeinträchtigung von Feuchtgebieten soll Einhalt geboten werden. Zur Erfüllung der Ziele übernehmen die Vertragsparteien der Konvention eine Reihe von Verpflichtungen.
Ziel der Ramsar-Convention ist es, die weitere Zerstörung von Feuchtgebieten zu verhindern, ihre Erhaltung und wohlausgewogene Nutzung sicherzustellen und gegebenenfalls ihre Wiederherstellung zu fördern.
Die Vertragsstaaten verpflichten sich u.a. folgende Hauptaufgaben zum Schutz ihrer Feuchtgebiete zu übernehmen:
- Nennung von mindestens einem Gebiet für die Liste der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung (Ramsar-Gebiete)
- Planung und Verwirklichung von Vorhaben nur bei gleichzeitiger Förderung der Erhaltung aller auf dieser Liste geführten Gebiete
- Bei Änderung des ökologischen Charakters eines solchen Gebietes ist das Ramsar-Büro zu informieren
- Wohlausgewogene Nutzung ("wise use") aller Feuchtgebiete
- Förderung der Erhaltung von Feuchtgebieten durch die Ausweisung von Schutzgebieten und Sicherstellung der nötigen Aufsicht
- Förderung der Ausbildung von Personal in den Bereichen Management, Forschung und Aufsicht
- Erstellung von nationalen Feuchtgebietsverzeichnissen
- Zusammenarbeit der Vertragsparteien bei der Umsetzung der durch die Konvention festgelegten Verpflichtungen
- Bei Feuchtgebieten, die sich über mehrere Länder erstrecken Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten und Durchführung gemeinsamer Aktionen
- Förderung von Forschung über Feuchtgebietsressourcen und Datenaustausch sowie Austausch von Publikationen
2.2. Inhalt
Die Ramsar Convention ist ein Rahmenprogramm zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung von Feuchtgebieten internationaler Bedeutung. Schutzgebietsausweisungen auf nationaler Ebene sollen durch internationale Kooperation gefördert und unterstützt werden.
1971 wurde in der iranischen Stadt Ramsar am Kaspischen Meer, unter anderem von Deutschland, das Ramsar-Abkommen unterzeichnet. Der WWF und die Weltnaturschutzunion (IUCN) spielten bei der Ausgestaltung der Konvention von Beginn an eine entscheidende Rolle. 1975 konnte das Abkommen in Kraft treten. 1980 fand die erste Mitgliedsstaatenkonferenz in Italien statt. Die Mitgliedsstaaten treffen sich alle drei Jahre. Inzwischen haben 133 Staaten das Abkommen unterzeichnet.
Die meisten durch das Ramsar-Abkommen geschützten Feuchtgebiete hat Großbritannien ausgewiesen. Deutschland steht mit 31 Gebieten auf Platz 11. Das größte der Ramsar-Gebiete ist das Delta-Gebiet des mächtigen Flusses Okawango in Botswana mit über 6,8 Millionen Hektar – einer Fläche von der Größe Bayerns. Die kleinsten Ramsar-Gebiete hingegen haben nur eine Größe von einem Hektar – wie zum Beispiel die Hosnie´s Quelle auf Christmas Island in Australien.
1229 Feuchtgebiete weltweit unterstehen derzeit dem Schutz des Ramsar-Abkommens.
Die Ramsar-Convention hat derzeit 144 Vertragsstaaten, deren 1.401 Ramsar-Gebiete eine Gesamtfläche von 123 Millionen Hektar umfassen, das entspricht der Größe Portugals. (Stand Jänner 2005).
Ein Schlüsselerfolg der Konvention liegt darin, das Bewusstsein der Wichtigkeit von Feuchtgebieten zu erhöhen. Moore und Sümpfe, sowie andere Feuchtgebiete wurden traditionell als nicht wünschenswert angesehen und somit entwässert oder „verdammt“. In den letzten Jahrzehnten wurde mehr und mehr der Wert von Feuchtgebiets–Ökosystemen als Quelle von Wasser, Nahrung und anderen Ressourcen, sowie hoher effizienter Wasseraufbereitung erkannt. Diese Erkenntnis ist zu einem großen Teil der Bemühungen der Ramsar Convention zu zuschreiben. Ramsar bietet den Rahmen für die Erhaltung und die sinnvolle Nutzung von Feuchtgebieten sowie ihrer Ressourcen.
Grundlage dieser Convention sind folgende drei Säulen:
- die Förderung von sinnvoller Nutzung von Feuchtgebieten
- die Entwicklung von internationalen Kooperationen
- die Entwicklung eines Netzwerkes an Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung
Neben der Ramsar- Convention gibt es weitere Konventionen, die sich mit dem Erhalt der Feuchtgebiete auseinander setzen.
Diese sind unter anderem:
- Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitäts- Convention)
- Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenconvention)
- Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner Convention)
2.3. Auswahlkriterien
In der Präambel der Ramsar-Convention wird ausdrücklich dargelegt, dass
- "Feuchtgebiete eine grundlegende Bedeutung als Regulatoren für den Wasserhaushalt und als Lebensraum für eine besondere Pflanzen- und Tierwelt, vor allem für Wat- und Wasservögel haben"
- "Feuchtgebiete ein Bestandteil des Naturhaushaltes von großem Wert für Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Erholung sind und ihr Verlust unwiederbringlich wäre",
- der Wunsch besteht, "der fortschreitenden Schmälerung und dem Verlust von Feuchtgebieten jetzt und in Zukunft Einhalt zu gebieten".
Zur Bestimmung der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung wurden Auswahlkriterien festgelegt. Die Feuchtgebiete, die zumindest einem Kriterium entsprechen müssen, werden nach ihrer internationalen ökologischen, botanischen, zoologischen, limnologischen und hydrologischen Bedeutung ausgewählt. Derzeit stehen weltweit über 1000 Ramsar-Gebiete auf der Liste der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung. Für "wohlausgewogene Nutzung" (wise use) wurde 1987 bei der Konferenz der Vertragsparteien in Regina (Kanada) folgende Definition festgelegt: "Unter wohlausgewogener Nutzung von Feuchtgebieten ist ihre nachhaltige Nutzung zum Wohle der Menschheit in einer mit dem Erhalt der Naturgüter des Ökosystems im Einklang stehenden Weise zu verstehen". Die Bestimmungen über die wohlausgewogene Nutzung gelten sowohl für die in der Liste stehenden Feuchtgebiete (Ramsar-Gebiete) als auch alle anderen Feuchtgebiete eines Vertragsstaates. Jeder Vertragsstaat der Ramsar-Convention ist verpflichtet, zumindest ein Gebiet für die Liste der Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung auszuweisen.
Gemäß der Vertragsstaatenkonferenz von 1999 (COP7 San José) erfolgt eine Einteilung der Kriterien in zwei Gruppen.
Gruppe A: Kriterien für repräsentative, seltene oder einzigartige Feuchtgebiete
Kriterium 1: Ein Feuchtgebiet gilt als international bedeutend, wenn es repräsentative, seltene oder einzigartige Beispiele von natürlichen oder naturnahen Feuchtgebietstypen innerhalb der entsprechenden biogeographischen Region aufweist.
Gruppe B: Kriterien für die Erhaltung der biologischen Vielfalt Kriterien basierend auf der Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften
Kriterium 2: Ein Feuchtgebiet gilt als international bedeutend, wenn es gefährdete, stark gefährdete Arten oder vom Aussterben bedrohte ökologische Gemeinschaften beherbergt.
Kriterium 3: Ein Feuchtgebiet gilt als international bedeutend, wenn es Populationen von Pflanzen- und/oder Tierarten beherbergt, die für die Erhaltung der biologischen Vielfalt in der jeweiligen Region von Bedeutung sind.
Kriterium 4: Ein Feuchtgebiet gilt als international bedeutend, wenn es Pflanzen- und/oder Tierarten in einem kritischen Stadium ihrer biologischen Entwicklungszyklen beherbergt, oder als Lebensraum bei ungünstigen Bedingungen dient.
Kriterien basierend auf der Bedeutung für Wasservögel
Kriterium 5: Ein Feuchtgebiet gilt als international bedeutend, wenn es regelmäßig 20.000 Wasser- und Watvögel beherbergt.
Kriterium 6: Ein Feuchtgebiet gilt als international bedeutend, wenn es regelmäßig 1 Prozent der Individuen einer Population, einer Art oder Unterart von Wasser- oder Watvögeln beherbergt.
Kriterien basierend auf der Bedeutung für Fische
Kriterium 7: Ein Feuchtgebiet gilt als international bedeutend, wenn es einen bedeutenden Anteil an einheimischen Fischarten, Unterarten oder Familien beherbergt, diese während eines bedeutenden Teils ihrer biologischen Entwicklung beherbergt oder Gebiet für Interaktionen zwischen Arten und/oder Populationen ist, die repräsentativ sind für das Wohlergehen und/oder den Wert von Feuchtgebieten und somit einen Beitrag zur weltweiten biologischen Vielfalt leisten.
Kriterium 8: Ein Feuchtgebiet gilt als international bedeutend, wenn es eine wichtige Nahrungsquelle für Fische darstellt oder, wenn es als Laichgrund, Kinderstube und/oder Wanderroute bedeutend ist und Fischbestände entweder innerhalb des Feuchtgebiets oder anderswo davon abhängen.
2.4. Beispielregionen und Erfolge der Ramsar Convention
1. Der Ammersee
Der Ammersee liegt etwa 30 km nördlich der Alpen und 40 km südwestlich der Stadt München. Er ist ein Kind der letzten Eiszeit. Im oberbayrischen Voralpenland wechseln Moränenketten und -kuppen mit Mulden und Talungen ab. Hier haben sich feuchte Senken und Hochmoore aber auch ausgedehnte Niedermoorkomplexe gebildet.
Als ausgewiesenes Ramsar-Schutzgebiet gehört der Ammersee mit seiner Flora und Fauna zu den Feuchtgebieten Internationaler Bedeutung (FIB). Zahlreiche Zugvögel finden hier jedes Jahr die letzte Raststätte vor der anstrengenden Überquerung der Alpen und das erste Ruhegebiet nach der Rückkehr im Frühjahr. Besonderen Wert haben auch die großen Niedermoore im Norden und Süden des Sees. Die Moorflächen mit ihren Verlandungszonen und Altwässern beheimaten viele selten gewordene Pflanzengesellschaften und sind wichtige
Brut- und Rückzugsgebiete für zahlreiche Rote-Liste-Arten.
2. Lafnitztal
Lafnitztal wurde Österreichs 11. Feuchtgebiet internationaler Bedeutung
Das Lafnitztal wurde durch das Büro der internationalen Ramsar-Konvention anerkannt und in die Liste der über 1.150 Feuchtgebiete internationaler Bedeutung aufgenommen. Es ist mit 2.180 Hektar das flächenmäßig viertgrößte österreichische Gebiet.
Das nominierte Gebiet erstreckt sich von den Orten Lafnitz (Bezirk Hartberg) und Neustift (Bezirk Oberwart) im Norden etwa 50 Kilometer entlang der Lafnitz und des Stögersbachs bis nach Fürstenfeld im Süden und berührt 19 Gemeinden. Es umfasst den Fluss selbst, die angrenzenden Überschwemmungsgebiete und dessen Wiesen im Talboden. Auch das Naturschutzgebiet "Lafnitz-Stögerbachmündung" bei Wolfau und der geschützte Landschaftsteil "Kaltenbrunner Lahn" liegen im neuen Ramsar-Gebiet.
Die obere und mittlere Lafnitz gehört zu den österreichweit letzten, weitgehend naturnah erhaltenen Flussabschnitten mit mäandrierender Flussdynamik, flussbegleitenden Auwäldern und talraumprägenden Dauerwiesen. Die Kraft des Wassers schafft Inseln, Sandbänke, Uferanbrüche, Totholzbereiche und Altwässer.
Hochwässer können den Talraum überfluten, der neben Feuchtwiesenkomplexen und Erlen-Eschen-Auwäldern auch magere Flachland-Mähwiesen gedeihen lässt. In den Auen leben Eisvogel, Flussregenpfeifer, Fischotter, Weiss- und Schwarzstorch sowie zahlreiche seltene Schmetterlings- und Libellenarten. Bedroht war der Naturraum in den letzten Jahren vor allem durch landwirtschaftliche Nutzung, Entwässerung, Aufforstung, Sand- und Schotterabbau sowie Wegebauprojekte.
Seit mehreren Jahren werden an der Lafnitz wichtige Naturschutzprojekte mit Beteiligung von Bund, Ländern und EU durchgeführt. Auf steirischer Seite konnten im Rahmen des "Passiven Hochwasserschutzes Rohr" 60 Hektar Überschwemmungswiesen gesichert werden. In Markt Allhau und Unterlungitz wurden Flächen für passiven Hochwasserschutz angekauft. In Deutsch Kaltenbrunn wurden 28 Hektar Ackerland für die Bereitstellung von Uferstreifen eingelöst. In Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart) wurde im Jahr 2000 das erste österreichische Ramsar-Informationszentrum eröffnet.
Die Erfolge
Öffentliche Erkenntnis des Wertes der Ramsar Gebiete und deren Schutzstatus durch ein internationales Abkommen sind wichtige Hilfen zum Schutz von Feuchtgebieten. Ein Beispiel
ist das große St. Lucia Ramsar Gebiet in Südafrika. Gemäß dem Regierungsengagement der Ramsar Conventionsmission 1992 wurde ein Projekt zum Abbau von Schwermetallen aus Sanddünen in diesem Gebiet gestoppt. Anstelle dessen führte hier die Regierung Südafrikas ein
Programm zur Unterstützung des ökonomischen Wachstums durch nachhaltigen Ökotourismus ein. Die Convention dient auch als Schirm für Feuchtgebiets – Projekte, die zur Linderung der Armut beitragen. Die „Working for Water“ und „Working for Wetlands“ Programme in Südafrika, zum Beispiel, stellten tausende von benachteiligte Personen ein und bildeten sie dahin gehend aus, die Gesundheit der Feuchtgebiete und deren Kapazität zur verlässlichen Trinkwasser - Versorgung wieder herzustellen.
Aber trotz ihrer Erfolge und andauernden Relevanz, wird die Ramsar Convention von einigen Regierungen bei Seite geschoben oder gar nicht angewendet. So vereinbarten 1999 bei der letzten Konferenz der Vertragsparteien (COP7) 55 Nationen bis zur nächsten Konferenz vom 18. bis zum 26. November 2002 fast 400 neue Ramsar Gebiete umzusetzen. Aber nur 27 Prozent der Nationen haben dieses Versprechen erfüllt. Im Vergleich dazu erfolgt weiterhin eine starke Unterrepresentation an Korallen-, Mangroven-, Seegras- und Torfmoor- Feuchtgebieten. Es gibt ebenfalls eine alarmierende Zahl an Ereignissen, die Teile der Ramsar Gebiete zerstören. Beispiele sind die Zerstörung eines Gebietes in Deutschland für die Verlängerung einer Landebahn, in Georgia für eine Öl–Verladeanlage und in Island der geplante Bau eines hydroelektrischen Dammes.
Ebenso alarmierend ist Spaniens Vorgangsweise im Feuchtgebiets-Management – im Speziellen weil Spanien Gastgeber für COP8 ist. Der kontroversielle nationale hydrologische Plan schlägt einen Wassertransfer quer durch Spanien vor, der den Bau von mehr als 100 neuen Dämmen vorsieht, die einen massiven Schaden an den Feuchtgebieten des Landes verursachen würden. Aus Sicht des WWF, ist dieser Plan unvereinbar mit den Auflagen der Vertragspartner. Zusätzlich ignoriert er ökonomische, soziale und ökologisch bessere Alternativen zur Wasserversorgung.
3. Literatur
- www.bmu.de/naturschutz_biologische_vielfalt/ natur_ohne_grenzen/eu vogelschutzrichtlinie/doc/print/6016.php
- http://gis.ubavie.gv.at/austria/natur/feuchtgebiete
- http://ramsar.org/index_list.htm
- http://ramsar.org/key_criteria.htm
- http://www.wetlands.org/RDB/Ramsar_Dir/_COUNTRIES.htm
- www.FORST.net
- www.LEBENS- MITTEL.net
- www. Naturschutz.at
- www.ramsar.org
- www.UMWELT.net
- www.WASSER.net
- www.wwf.de/imperia/md/content/pdf/feuchtgebiete/1.pdf
- Eberle, G.: Pflanzen unserer Feuchtgebiete und ihre Gefährdung. Kramer, 1979.
- Krägenow, P. / Wiesehöfer, G.: Vögel der Binnengewässer und Feuchtgebiete. Verlag Eugen Ulmer, 1999.
- Haarmann, K. / Pretscher, P.: Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der BRD. Kilda, 1976.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Feuchtgebiete und warum sind sie schutzbedürftig?
Feuchtgebiete, wie Bäche, Flüsse, Seen, Quellen und Moore, sind wichtige Bestandteile des globalen Wasserkreislaufs und beherbergen eine Vielfalt an Lebensgemeinschaften. Sie tragen zur Verbesserung der Wasserqualität bei, verringern Überschwemmungen und dienen als Erholungsräume. Sie sind gefährdet durch Dränagemaßnahmen und Dammbauten und beherbergen viele seltene und schützenswerte Lebewesen.
Was ist die Ramsar-Konvention?
Die Ramsar-Konvention ist ein internationaler Vertrag, der die Rahmenbedingungen für die internationale Zusammenarbeit zum Schutz von Feuchtgebietslebensräumen festlegt. Ursprünglich auf den Schutz der ziehenden Wasser- und Wattvögel ausgerichtet, zielt sie nun auf den generellen Schutz wichtiger und seltener Feuchtgebiete und die Verhinderung von deren Verlust und Beeinträchtigung ab.
Welche Ziele verfolgt die Ramsar-Konvention?
Das Hauptziel ist die weitere Zerstörung von Feuchtgebieten zu verhindern, ihre Erhaltung und wohlausgewogene Nutzung sicherzustellen und gegebenenfalls ihre Wiederherstellung zu fördern. Vertragsstaaten verpflichten sich unter anderem zur Nennung von Ramsar-Gebieten, zur Förderung der Erhaltung und zur Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Konvention.
Was bedeutet "wohlausgewogene Nutzung" im Kontext der Ramsar-Konvention?
"Wohlausgewogene Nutzung" (wise use) bedeutet die nachhaltige Nutzung von Feuchtgebieten zum Wohle der Menschheit in einer mit dem Erhalt der Naturgüter des Ökosystems im Einklang stehenden Weise.
Welche Auswahlkriterien gelten für die Bestimmung von Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung?
Feuchtgebiete müssen mindestens einem der festgelegten Kriterien entsprechen, die sich auf ihre internationale ökologische, botanische, zoologische, limnologische und hydrologische Bedeutung beziehen. Diese Kriterien sind in zwei Gruppen unterteilt: A (repräsentative, seltene oder einzigartige Feuchtgebiete) und B (Erhaltung der biologischen Vielfalt).
Nennen Sie Beispiele für Ramsar-Gebiete.
Der Ammersee in Deutschland und das Lafnitztal in Österreich sind Beispiele für Ramsar-Gebiete. Der Ammersee ist ein wichtiges Rastgebiet für Zugvögel und beheimatet seltene Pflanzengesellschaften, während das Lafnitztal einen naturnahen Flussabschnitt mit Auwäldern und Wiesen darstellt.
Welche Erfolge hat die Ramsar-Konvention erzielt?
Die Ramsar-Konvention hat das Bewusstsein für den Wert von Feuchtgebieten erhöht und zu Schutzmaßnahmen geführt, wie zum Beispiel die Verhinderung des Abbaus von Schwermetallen im St. Lucia Ramsar-Gebiet in Südafrika und die Förderung von Ökotourismus.
Welche Herausforderungen bestehen weiterhin bei der Umsetzung der Ramsar-Konvention?
Einige Regierungen wenden die Ramsar-Konvention nicht ausreichend an, es gibt eine Unterrepräsentation bestimmter Feuchtgebietstypen, und es kommt zu Zerstörungen von Ramsar-Gebieten durch Infrastrukturprojekte und andere Eingriffe.
Welche weiteren Konventionen befassen sich mit dem Erhalt von Feuchtgebieten?
Neben der Ramsar-Konvention gibt es unter anderem das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitäts-Convention), das Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenconvention) und das Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Berner Convention).
- Arbeit zitieren
- Constanze Gensel (Autor:in), 2006, Schutzbemühungen zum Erhalt der Feuchtgebiete, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111356