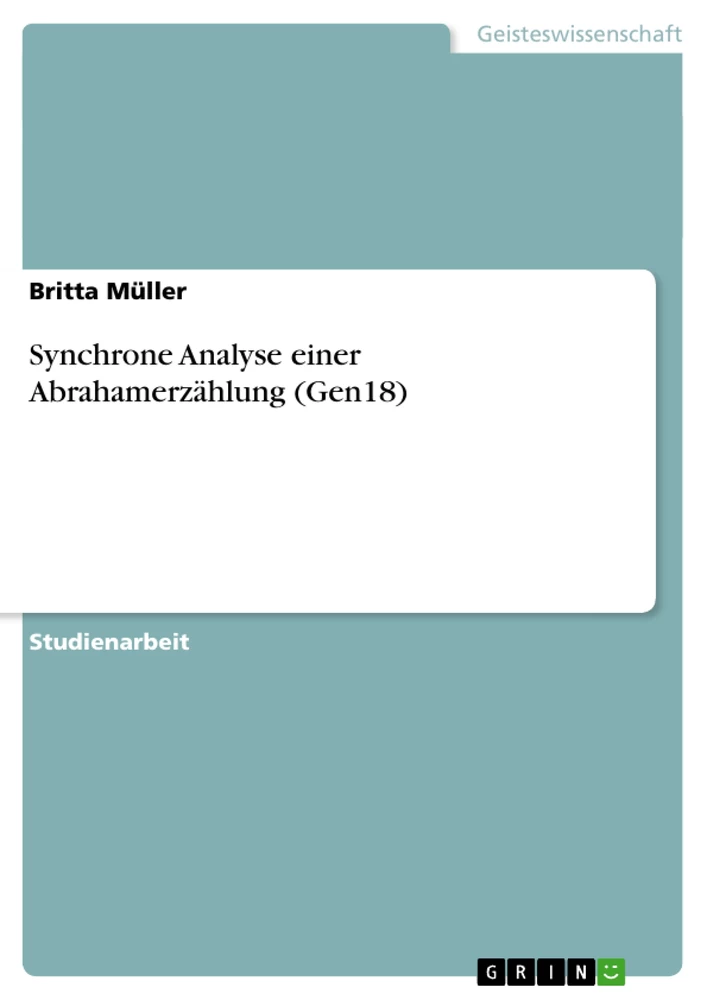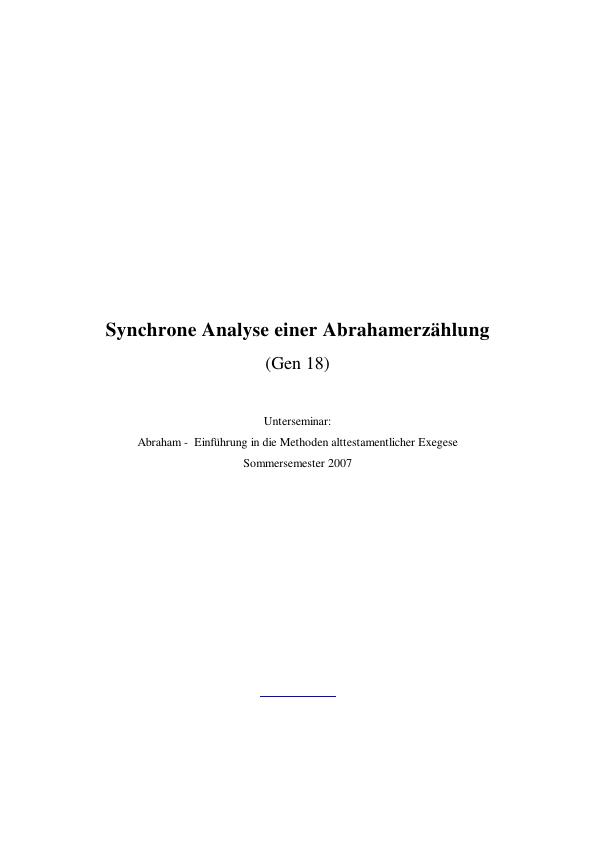Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Kontextabgrenzung und Kontexteinordnung
2. Gliederung und Komposition
2.1 Gliederung in zwei Hauptteile
2.2 Hauptkompositionselemente
2.3 Binnenkomposition
2.4 Kompositorische Verbindungslinien
3. sprachlich-syntaktische Analyse
3.1 Beobachtungen zum ersten Kompositionselement
3.2 Beobachtungen zum zweiten Kompositionselement
3.3 Beobachtungen zum dritten Kompositionselement
3.4 Beobachtungen zum vierten Kompositionselement
3.5 Beobachtungen zum fünften Komopositionselement
3.6 Beobachtungen zum sechsten Kompositionselement
4. semantische Analyse
4.1 Leitworte und Sinnlinien
4.2 Das Verhältnis der Sinnlinien zueinander und die sich sich hieraus entwickelnden Perspektiven
5. Charakterisierung der Erzählfiguren
5.1 Abraham
5.2 Sara
5.3 die Gäste
6. Schlusswort
Literaturverzeichnis
0. Einleitung
In der vorliegenden Arbeit soll eine synchrone Analyse der Abrahamerzählung Gen 18 erfolgen. Auf eine inhaltliche Fragestellung an den Text ist hierbei bewusst verzichtet, um eine möglichst unvoreingenommene und breite Annäherung an den Aussagegehalt der Erzählung erzielen zu können.
Ausgehend von den Methodenschritten der synchronen Analyse gliedert sich diese Arbeit in die Hauptkapitel Kontextabgrenzung und –einordung, Gliederung und Komposition, sprachlich-syntaktische Analyse und semantische Analyse sowie einer Charakterisierung der Haupterzählfiguren Abrahams, Saras und der drei Gästen. Da sich das Thema sowie auch der Spannungsverlauf der Erzählung Gen 18 anhand der Verwendung der Sinnlinien gut aufzeigen lässt, ist auf die semantische Analyse ein besonderer Schwerpunkt gelegt.
1. Kontextabgrenzung und Kontexteinordnung
Die Ortsangabe „bei den Terebinthen von Mamre“ ist nur ein Zeichen dafür, dass es sich bei der Erzählung in Gen 18,1-33 um einen in sich geschlossenen Text handelt. Durch diese explizite Nennung des Ortswechsels und auch durch den Hinweis auf die Tageszeit („Mittagshitze“) wird eine Distanz zum Vortext geschaffen.
Zudem wird von einer erneuten Gotteserscheinung und dem Auftreten dreier Männer berichtet. Diese Veränderung in der Konstellation der Handlungsträger ist ein weiteres Merkmal für eine eigenständige Textpassage.[1]
In Gen 18,33 wird auf einen nachfolgenden Ortswechsel verwiesen: „Und JHWH ging […] und Abraham kehrte um zu seiner Stätte“. Besonders die Verben „gehen“ und „umkehren“ beschreiben eine trennende Bewegung. Die beiden Handlungsträger gehen auseinander und läuten somit eine Veränderung in der Konstellation ein. Die Erzähleinheit ist nun abgeschlossen.
Die Formulierung „als er vollendet hatte“ drückt den inhaltlichen Endpunkt der Erzählung aus und verdeutlicht, dass es sich hier um die Schlusspassage handelt.
Durch den vorangestellten Dialog lässt es sich erschließen, dass mit „und JHWH ging“ schon auf das Auftreten in Sodom angespielt wird, es handelt sich also um eine kataphorische Substitution.
Insgesamt kann nun davon ausgehen, dass es sich bei Gen 18,1-33 um eine eigenständige und abgeschlossene Erzähleinheit handelt.
In Gen 18 werden Motive aufgegriffen, die für den weiteren Verlauf der Erzählung von großer Bedeutung sind. JHWH verkündigt noch ein Mal, dass Sara im nächsten Jahr einen Sohn gebären wird. Schon in Gen 17,19 hatte er dies Abraham gesagt, trotzdem zweifelt Sara aufgrund ihres Alters an der Botschaft.
Des Weiteren kündigt JHWH die Vernichtung Sodom und Gomorrahs an und zieht somit eine Sinnlinie zu Gen 19. Durch die Bitte Abrahams verspricht JHWH die Gerechten zu verschonen, die weitere Geschichte wird also in diesem Kapitel beeinflusst. Auffallend sind die Parallelen von Gen 18 und 19. In beiden Erzählungen ist der Protagonist zu Beginn am wichtigsten Versammlungsort seines Umfeldes (Zelteingang Gen 18,1 ó Stadttor Gen 19,1) und beide bekommen Besuch von Boten JHWHs (3 Männer Gen 18,2 ó 2 Boten Gen19,1). Ein Zusammenhang zwischen den beiden Kapiteln ist also offensichtlich.
2. Gliederung und Komposition
2.1 Gliederung in zwei Hauptteile
Die Erzählung in Genesis 18 lässt sich in zwei Hauptteile gliedern; von Vers 1-15 und Vers 16-33, die sich wiederum unterteilen lassen.
Der erste Teil spielt sich in Abrahams Zeltsiedlung ab, die Gäste werden dort empfangen und bewirtet. Erst in Vers 16 wird berichtet, dass die Männer aufbrechen[2] und Abraham ihnen folgt[3]. Dieser Aufbruch signalisiert einen Szenenwechsel und bedeutet somit einen tiefen Einschnitt in das Geschehen der Geschichte. Zwar bleibt durch die Begleitung Abrahams der Bezug zum ersten Teil offensichtlich, dennoch signalisiert der Aufbruch eine Veränderung in der Geschichte.
Zudem bleibt Sara zurück und somit eine Handlungsträgerin. Spielte sie im ersten Teil noch eine wichtige Rolle, ist sie im zweiten Teil gar nicht mehr präsent. Es wird nur berichtet, dass die Männer aufbrachen und Abraham sie begleitet (V. 16). Dass die Konstellation sich ändert ist ein weiteres Merkmal für eine Schnittstelle.
Dafür spricht auch, dass der vorangegangene Dialog zwischen JHWH und Sara beendet ist und nun diese Figurenrede von einem Erzählbericht abgelöst wird. Dieser Wechsel verstärkt noch einmal, dass der erste Teil beendet ist und nun ein neuer Abschnitt beginnt.
Ein solch tiefer Einschnitt durch den Ortswechsel, die Änderung in der Konstellation der Handlungsträger sowie den Wechsel vom Dialog zum Erzähltext ist einmalig in Gen 18 und lässt daher darauf schließen, dass der Text in zwei Hauptteile zu unterteilen ist.
2.2 Hauptkompositionselemente
Das erstes Kompositionselement umfasst die Verse 1-5. Hier empfängt Abraham die drei Männer vor seinem Zelt und erkennt in ihnen JHWH. Die Erzählung in diesem Abschnitt bewegt sich ausschließlich vor dem Zelt, erst in Vers 6 verlegt sich der Schauplatz ins Zelt[4]. Dieser kleine Ortswechsel verweist auf den Beginn eines neuen Sinnabschnitts und stärkt somit den Zusammenhang des ersten Abschnittes. Zudem treten im ersten Kompositionselement nur die vier Männer auf, Sara wird erst im nächsten Element erwähnt. Die in diesen Versen spezifische Figurenkonstellation verweist auch auf einen eigenständigen Sinnabschnitt. Erzählbericht und Figurenrede stehen in engem Zusammenhang, sodass eine Unterteilung hier aufgrund des Wechsels nicht sinnvoll wäre. Inhaltlich zeigen die Verse 1-5 einen logischen Zusammenhang; Abraham empfängt seine Gäste und lädt sie zum Abendessen ein, die auch sofort annehmen[5].
Das zweite Kompositionselement (Verse 6-10c) beginnt mit einem „und“. Man könnte darauf schließen, dass dies auf eine Syndese hindeutet, da es ja beide Elemente offensichtlich verbindet. Jedoch ist es Eigenart dieses Textes, dass fast jeder Satz mit „und“ beginnt[6]. Eine Unterlassung der Unterteilung aufgrund dieses Argumentes ist unverständlich. Der Ortswechsel und die neue Figurenkonstellation sind zwei Gründe für die Abgrenzung zum ersten Element. Innerhalb des zweiten Elements wird auf die Personen durch Pronomen zurückverwiesen, dies spricht für einen durchgehenden Abschnitt. Die Unterbrechungen der wörtlichen Rede durch den Erzählbericht weißt nicht auf eine neue Unterteilung hin, da zum einen die Anweisungen Abrahams bzw. das Gespräch während des Essens in direktem Zusammenhang stehen.
Zu Beginn des dritten Kompositionselemente (V.10d-15) findet man eine Asyndese[7]. Das ausbleiben des „und“ verweist auf den Beginn eines neuen Elementes. Auffallend ist, dass Sara sich hier „am Eingang des Zeltes befindet“. Genau die gleiche Ortsbeschreibung finden wir zu Beginn des ersten Abschnittes.
Außerdem richtet sich die Aufmerksamkeit auf das „aber“, das hier als adversative, „trennende“ Satzkonjunktionen fungiert. Zudem ist die Ortsangabe „am Eingang des Zeltes“ V. 10d eine Wiederaufnahme der Ortsangabe zu Beginn des 18. Kapitels[8]. Diese Wiederholung des Satzteils verdeutlicht noch ein Mal den Beginn des dritten Elementes. Dieses ist auch das letzte Element des ersten Hauptteils, die Abgrenzung zum vierten Teil somit hinfällig.
Im zweiten Hauptteil sind drei Unterteilungen möglich. Das erste Element bzw. insgesamt vierte Kompositionselement (V.16-21) beginnt mit einem auf die Rede JHWHs einleitenden Erzählbericht (V.16). Die Rede basiert auf den zuvor gelegten Bericht; deshalb ist hier kein weiterer größerer Gliederungsabschnitt einzufügen. Zudem beginnt es mit einer Wiederaufnahme. Schon im ersten Vers wird die Formulierung „und es erschien“ benutzt. Auch hier wird wieder „und es…“ in Kombination mit einem Verb der Bewegung benutzt; „und es standen […] auf.
Da wörtliche Figurenrede auf der Gliederungsebene immer als Einheit zu werten ist, lässt sich auch bis zum Vers 21 keine Unterbrechung finden. Erst ab Vers 22 findet man neue Voraussetzungen und kann somit ein neuer Abschnitt gesetzt werden.
Das fünfte Kompositionselement V.22-32 grenzt sich zum vorausgehenden dadurch ab, dass sich die Konstellation der Figuren ändert; die Männer wenden sich ab, während JHWH und Abraham bleiben[9]. Auch hier ist der Erzählbericht zu Anfang Vorbereitung auf den nachfolgenden Dialog und somit in engem Zusammenhang. Einen Schnitt hier zusetzen nicht nachvollziehbar. Ebenso wenig lässt sich der nachfolgende Dialog durch eine großen Gliederungsabschnitt trennen. Zwar wechselt ständig die Sprechrichtung, dennoch stehen die Aussagen in so engem Bezug, dass eine Unterteilung nicht sinnvoll wäre. Erst am Ende des Dialoges ist ein Gliederungsabschnitt zu setzen.
Damit beginnt das letzte und sechste Kompositionselement V.33. Diese ist als Schlusspassage zu verstehen, da sie noch einmal den inhaltlichen Endpunkt verdeutlicht („als er vollendet hatte“ V.33b). Zudem wird beschrieben, wie JHWH und Abraham auseinander gehen[10], diese Trennung symbolisiert das Ende dieses Kapitels und somit auch des Elementes.
2.2 Binnenkomposition
Binnenkomposition des ersten Kompositionselementes Gen 18,1-5 In diesem Element wechselt nach dem zweiten Vers der Erzählbericht zum Dialog zwischen Abraham und den drei Männern. Aufgrund dieses Wechsels kann man hier eine Feingliederung setzen. Allerdings beschreibt der Bericht die Umstände des Dialoges, deshalb wäre eine Grobgliederung nicht angebracht.
Ab dem Vers 5e stellt man eine Änderung der Sprechrichtung fest. Dies ist ein Hinweis dafür, dass hier ein neuer Abschnitt zu setzen ist. Da dies allerdings die Antwort auf das Angebot Abrahams ist, kann man hier auch nur einen Abschnitt im Rahmen der Feingliederung setzten.
Binnenkomposition des zweiten Kompositionselementes Gen 18,6-10c
Dieser Abschnitt lässt sich im Rahmen der Feingliederung in zwei Teile spalten. Nach dem Dialog, in dem Abraham Sara Anweisungen gibt, folgt ein Text in dem weitere Vorbereitungen und das Mahl beschrieben werden. Dieser Übergang von Dialog zu Text im Vers 7 unterteilt das zweit Element. Zusätzlich wird Abraham im Vers 7a renominalisiert[11]. Im gleichen Vers findet man auch die trennende Satzkonjunktion „aber“. Dies ist ein weiteres Zeichen für eine Distanz zum Vortext. Da der Vorgang aber immer noch zu den Vorbreitungen gehört, kann man die beiden Teile aber nicht ganz von einander lösen und setzt deshalb nur eine Feingliederung.
Im Vers 9 beginnt der Dialog zwischen den Männern und Abraham, es beginnt mit dem formelhafte Element „und sie sprachen“. Der Inhalt dieses Dialoges bezieht sich auf die Verheißung, dass Sara einen Sohn gebären wird, und nicht auf das vorangegangene Geschehen und ist deshalb separat zu setzen. Allerdings geschieht das Gespräch im Rahmen des Essens und hat somit dennoch eine Beziehung zum Vortext. Deshalb setzt man zwischen Vers 8 und 9 eine Unterteilung im Rahmen der Feingliederung.
Binnenkomposition des dritten Kompositionselementes Gen 18,10d-15
Der erste Abschnitt der Feingliederung lässt sich nach dem Vers 11 setzten. Hier endet der Erzähltext und anschließend folgt der Dialog. Zudem wird sowohl im Vers 11c, als auch im Vers 12a Saras Namen genannt und nicht durch ein Pronomen ersetzt.
Der folgende Dialog ist nicht weiter zu teilen. Zwar könnte man nach jedem Wechsel der Sprechrichtung einen neuen Abschnitt sehen, insbesondere in 13a in dem beschrieben wird, dass JHWH sich an Abraham richtet, obwohl das Gespräch eigentlich zwischen JHWH und Sara stattfindet. Allerdings stehen die Reden in so unmittelbaren Bezug zueinander, dass auch eine Separierung durch die Feingliederung das Bild verfälschen würde.
Binnenkomposition des vierten Kompositionselementes Gen 18,16-21
In diesem Element setzt man nach dem 16. Vers die erste Unterteilung. Dieser Vers beschreibt den Aufbruch der Männer und somit die geänderte Personenkonstellation. Zudem beginnt der nächste Abschnitt mit der trennenden Satzkonjunktion „aber“ und JHWH wird noch einmal explizit mit dem Namen genannt[12]. Beides Kriterien für die Gliederung. Dennoch beschreibt der erste Teil die Situation des folgenden Dialoges und steht somit im Zusammenhang. Deshalb ist eine Abtrennung durch eine Feingliederung angebracht.
Auch vom 19. zum 20. Vers lassen sich Merkmale für eine Gliederung finden, JHWH wird wieder mit dem Namen genannt und die Formulierung „und JHWH sprach“ kann man als formelhaftes Element auffassen. Zudem ändert sich der Inhalt des Dialoges, sprach JHWH zuvor über Abraham, spricht er jetzt über die Zukunft Sodom und Gomorrhas.
Binnenkomposition des fünften Kompositionselementes Gen 18,22-32
Dieses Element lässt sich in sechs ähnliche Teile gliedern. Der erste Teil umfasst die Verse 22 bis 26. In diesem Teil wird vorab die Figurenkonstellation geklärt. Anschließend spricht Abraham zu JHWH und bittet ihn die Gerechten in Sodom zu verschonen. Diese Rede beginnt mit „und Abraham [näherte sich und] sprach“ V.23. Im Vers 26 beginnt JHWHs Antwort mit der Formulierung „und JHWH sprach“.
Auch die Abschnitte 27-28; 29; 30; 31und 32 sind nach diesem Muster aufgebaut. Zunächst beginnt Abrahams Rede mit der Formulierung „und Abraham/ er sprach“ und JHWHs Antwort mit „und er sprach“. Von Abschnitt zu Abschnitt reduziert sich die Anzahl der Gerechten. Diese regelmäßige Struktur ermöglicht jeweils die Unterteilung im Rahmen der Feingliederung, eine Grobgliederung ist nicht möglich, da die Abschnitte in direktem Zusammenhang stehen.
Binnenkomposition des sechsten Kompositionselementes Gen 18, 33
Die Schlusspassage ist ein in sich geschlossener Abschnitt. Er beschreibt das Ende des Dialoges und die Trennung JHWHs und Abrahams. Obwohl im Vers 33d Abrahams Name noch ein Mal explizit genannt wird und somit eine Renominalisierung vorliegt, wird hier keine Untergliederung gesetzt, da die Verknüpfung der beiden Sätze sehr stark ist.
2.3 kompositorische Verbindungslinien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das erste Kompositionselement lässt sich leicht mit dem Letzten verbinden, zusammen bilden sie einen Rahmen für die Erzählung. Vers 1-5 leitet die Erzählung ein, die Schlusspassage 33 bildet das Ende des Besuches. Allerdings wenden brechen die Gäste mit Abraham schon vorher auf (V. 16) und die Männer wenden sich schon eher ab V. 22. Dies gehört auch zum Ende des Besuches, passiert aber während der Handlung und ist deshalb noch einzubeziehen.
Der 2. und 3. Kompositionsabschnitt ergänzen sich dahingehend, als dass der erste Abschnitt die Verheißung thematisiert und der zweite die darauf folgende Skepsis Saras zum Mittelpunkt macht.
Eine weitere Verbindung lässt sich zwischen dem 4. und 5. Abschnitt erkennen. Hier bildet die Problematik Sodoms eine gemeinsame Basis. Im ersten Abschnitt berichtet JHWH von seinem Plan Sodom zu Zerstören. Im 5. Teil wird dann Abrahams Stellung deutlich und die Verhandlung kommt zustande.
3. sprachlich-syntaktische Analyse
3.1 Beobachtungen zum ersten Kompositonsabschnitt Gen 18,1-5
Wortebene
Die große Anzahl an Verben im ersten Element lässt auf einen erzählenden Text schließen. Die Satzanfänge sind stets durch Konjunktionen wie „und“ bzw. „damit“ und „danach“(V.1-3a; 4b-5) verbunden, was auf logische Verknüpfungen schließen lässt. Während die Verse 1 bis 3a und 5e durchgehend im Präteritum geschrieben ist und somit für eine erzählende Passage steht, wird in den restlichen Zeilen die Gegenwartsform verwendet, ein Signal für einen besprechenden Text.
Subjekt der Sätze ist hauptsächlich Abraham, der somit in diesem Abschnitt dominiert. In einigen Sätzen sind die drei Männer bzw. JHWH direktes Subjekt (V. 2c, 5b, 5e). Auffällig ist, dass besonders im Bezug auf JHWH die Sätze oft ins Passiv gestellt werden[13]. Dadurch wird verhindert Gott als handelndes Subjekt zu nennen.
Im Vers 3c fordert Abraham JHWH auf: „so gehe doch nicht an deinem Knecht vorüber“. Diese Negation ist geschickt verwendet, da man so eine direkte Ansprache JHWHs umgeht.
Interessant bei der Benutzung der Artikel ist, dass von Anfang an ein bestimmter Artikel im Bezug auf das Zelt verwendet wird. Zudem wird Abraham in der ersten Zeile nicht namentlich genannt, sondern ist nur durch das „ihm“ repräsentiert[14]. Es lässt darauf schließen, dass dieser Textteil im Bezug auf einen vorangegangenen Teil steht, der aber nicht vorliegt.
Im ersten Vers erkennt man zudem eine Auslassung. Es wird zwar berichtete, dass die Männer vor Abraham stehen[15], aber nicht woher sie kommen.
Satzebene
Dieser Abschnitt besteht ausschließlich aus Verbalsätzen. Neben Deklarativsätzen findet man in der Rede Abrahams zudem mehrere Imperativsätze[16]. Der Abschnitt besteht aus einfachen Sätzen (SPO), allerdings werden viele durch ein „und“ verknüpft, was dazu führt, dass sehr lange Sätze entstehen. Diese Struktur und temporale Konjunktionen, wie „danach“ (V.5) unterstreichen eine strenge zeitliche Abfolge.
3.2 Beobachtungen zum zweiten Kompositonsabschnitt Gen 18,6-10c
Wortebene
Auch im zweiten Element findet man überwiegend Verben, was den Schluss auf einen erzählenden Text zulässt. Zusätzlich ist der Erzählbericht in der Vergangenheit formuliert; ein weiteres Signal für einen erzählenden Text. Dieser ist logisch verknüpft, was sich an der durchgehenden Verwendung der Konjunktion „und“ erkennen lässt.
Im Bericht ist stets Abraham das Subjekt, bis auf die Verse 7d, 9a und 10a, in denen der Bursche, die drei Männer bzw. JHWH Gegenstand des Satzes sind. Allerdings dominiert Abraham doch eindeutig auch diese Passage. Besonders Sara, die nur am Rande erwähnt wird (V. 6a) fällt nur eine passive Rolle zu.
Die Männer werden in diesem Abschnitt nur durch das Pronomen „sie“ bzw. „ihnen“ (V. 8c-9a) repräsentiert und nicht namentlich genannt. Dies deutet daraufhin, dass der Text nicht kohäsiv ist. Auch JHWH wird im Vers 10 das erste Mal genannt und nur mit „er“ betitelt, was zusätzlich verwirrend erscheint, da vorab mit „er“ stets Abraham gemeint war.
Auffällig sind das fehlende Subjekt und Objekt in den Versen 6d, der Satz ist auf die wesentlichen Elemente reduziert.
JHWHs Rede beginnt mit „wieder, ja wiederkommen“ (V.10b). Diese Anapher hat den Effekt das seine Worte eine besondere Betonung und somit Aufmerksamkeit erhalten. Zudem enden sowohl die Rede der Männer als auch die Worte JHWHs mit „Sara, deine Frau“ (V.9b, 10c). Diese Epipher vermittelt, dass die beiden Aussagen zusammengehören und deuten noch mal auf die unklare Trennung zwischen den drei Männern zu JHWH. Es scheint nicht ganz eindeutig, ob JHWH in den drei Männern repräsentiert ist oder separat steht.
Satzebene
Neben Deklarativsätzen kommen im zweiten Element auch Exklamativsätze (V. 6c-e, 9d, 10b-c) vor. Durch sie bekommen die Sätze mehr Nachdruck und Betonung. Der Interrogativsatz im Vers 9b verdeutlicht, mit welchen Absichten die Besucher kommen, dadurch dass sie Fragen stellen, offenbaren sie ihre Wissenslücken.
Die Sätze sind durchgehen mit „und“ verbunden und tragen somit zur durchgehenden Kohäsion bei.
3.3 Beobachtungen zum dritten Kompositonsabschnitt Gen 18,10d-15
Wortebene
Im dritten Element findet man wieder einen erzählenden Text, was sich an den vielen Verben erkennen lässt. Nirgendwo wird das Verb ausgelassen, es besteht eine durchgängige Struktur. Logisch verknüpft ist der Text, da man viele Konjunktionen und Partikel finden kann[17]. Während die wörtlichen Reden in der Gegenwartsform geschrieben sind, und somit für einen besprechenden Text stehen; ist der übrige Text im Präteritum geschrieben, was eher für einen erzählenden Text spricht.
Auffällig ist das in diesem Abschnitt nicht wieder Abraham dominiert, sondern Sara häufiger Subjekt ist[18]. Sie ist also Hauptakteur in diesem Abschnitt. Im Vers 15b wird eine Negation verwendet, was diese Aussage besonders betont. Interessant am Dialog ist, dass zunächst Sara spricht, daraufhin JHWH Abraham anspricht und wieder Sara antwortet. JHWH spricht Sara also nicht direkt an. Zudem wird sie auch nicht mit „du“ angesprochen, wie Abraham beispielsweise in Vers 5f. Stilistisch wird also eine Distanz zwischen Sara und JHWH geschaffen.
Satzebene
Im Gegensatz zu vorangegangenen Elementen ist in den Versen 10d-12a eine komplizierter Satzstruktur zu erkennen. Die Sätze sind durch Nebensätze geschachtelt, die manchmal durch disjunktive Konjunktionen verbunden werden[19].
Neben den Deklarativsätzen im Erzähltext, finden sich in den Reden viele Interrogativ- und Exklamativsätze. Diese abwechslungsreiche Kombination, unterstreicht die Funktion als lebhaftes Gespräch.
Eine temporale Konjunktion findet sich im Vers 12b „nachdem“; hiermit bekommt der Satz eine besondere Einordnung und somit Betonung.
3.4 Beobachtungen zum vierten Kompositonsabschnitt Gen 18,16-21
Wortebene
Im vierten Element werden besonders in der Rede JHWHs (V. 17b-21g) viele abstrakte Nomen verwendet. „Volk“ (V.18a), „seinen Söhnen und sein Haus“ (V.19b), „Gerechtigkeit und Recht“ (V.19d) und „Klagegeschrei“ (V.20b) sind einige Beispiele dafür. Dies ist ein Signal dafür, dass es sich hier eher um einen argumentativen Text handelt.
Zudem wird in der wörtlichen Rede Futur benutzt[20]. Dies zeigt die prophetische Botschaft in dem Text. Betont wird diese Stelle besonders durch die Wiederholung des Wortes „werden“. Ansonsten beherrscht die Gegenwartsform die Reden und Präteritum den Erzähltext.
Im Bezug auf das Handeln der Männer wird im Passiv geschrieben[21], was wohl den Zweck verfolgt, dass eine göttliche Person nicht als handelndes Subjekt dargestellt werden soll.
JHWH betitelt sich in den Reden selbst stets mit „ich“, was ihm einen persönlichen Zug gibt. Abraham spricht er hier nicht direkt an, sondern nennt immer nur den Namen, was eine gewisse Distanz erzeugt.
Satzebene
JHWHs Rede beginnt zunächst mit einem Interrogativsatz. Diese einführende Frage erzielt besondere Aufmerksamkeit beim Leser. Der weitere Verlauf besteht aus Deklarativsätzen. Erst der letzte Satz, der krönende Abschluss sozusagen ist ein Exklamativsatz, der somit einen festen Schlusspunkt setzt[22]. Auch hier ist die Satzstruktur in der Rede verschachtelter und führt somit zu komplexeren Sätzen.
3.5 Beobachtungen zum fünften Kompositonsabschnitt Gen 18,22-32
Wortebene
Im fünften Abschnitt sind die abstrakten Nomen auffällig; „Gerechte mit dem Frevler“ (V.23c), „der Richter der ganzen Erde nicht Recht“ (V.25f) und „Staub und Asche“(V.27f) sind einige der Signale für einen argumentatives Gespräch.
Die Reden bewegen sich in der Gegenwartsform, was auf einen besprechenden Text hindeutet. Passiv wird hier wieder im Bezug auf die Männer verwendet[23], aus Rücksicht diese göttlichen Personen nicht handelnd darzustellen.
Die Reden werden jeweils mit der Anapher „und er sprach“ eingeleitet. Egal ob es sich um JHWH oder Abraham handelt, es wird jeweils das gleiche Personalpronomen „er“ eingesetzt. So sind JHWH und Abraham auf einer Ebene, sie werden gleich bezeichnet und auch gleich oft benannt.
Satzebene
Durch die Gesprächsstruktur in diesem Abschnitt erklärt es sich, dass die Reden sowohl aus Deklarativ-, Interrogativ- als auch Exklamativsätzen bestehen.
Der Abschnitt besteht aus vielen kurzen Sätzen, die durch Konjunktionen miteinander verbunden werden. Im Erzählbericht handelt es sich dabei ausschließlich um die Konjunktion „und“. In den Reden, die etwas komplexer erscheinen werden zudem Konjunktionen wie „gemäß“ (V. 25b), „obgleich“ (V.27f) oder „wenn“ (u.a. V.28e) benutzt. Diese betonen die Begründungsstruktur des Abschnittes und unterstreichen die Kohäsion des Textes.
3.6 Beobachtungen zum sechsten Kompositonsabschnitt Gen 18,33
Wortebene
Im letzten Element werden genügend Verben benutzt, sodass man auf einen erzählenden Text schließen kann. Die Konjunktion „und“ zwischen den beiden Sätzen, lässt auf eine logische Verknüpfung der beiden Texte schließen.
Berichtet wird im Vergangenheitstempora und weist somit auf eine erzählende Passage hin. Subjekt sind JHWH und Abraham und somit gleich dominant.
Satzebene
Hier findet man zwei Deklarativsätze vor, wobei der erste Satz komplexer und verschachtelt ist und der zweite sich auf die elementaren Satzteile (SPO) beschränkt. Konjunktionen verbinden sowohl die beiden Sätze als auch die Satzteile, des ersten Satzes; „als“ betont an dieser Stelle die zeitliche Abfolge.
4. semantische Analyse
4.1 Leitworte und Sinnlinien
Abrahams Gäste
Eine Sinnlinie kennzeichnet das Auftreten der Männer und Abrahams Verhalten ihnen Gegenüber. Die einleitenden Worte „Und es erschien ihm JHWH“ (V.1) offenbart dem Leser, dass es sich bei dem Besuch nicht nur um einfache Gäste handelt. Beachten muss man, dass diese Information Abraham jedoch nicht hat.
Die Zeitangabe „um die Zeit der Mittagshitze“ (V.1b) ist in sofern für die Besucher von Bedeutung als dass sich um diese Zeit Reisende nach einem Platz für eine Rast umsehen.
Beschrieben werden die Gäste als „drei Männer“ (V. 2c). Dabei ist sowohl unklar, woher sie kommen, als auch ob sie JHWH implizieren.
Abrahams Verhalten zeugt von vorbildlicher Gastfreundschaft. Wie die Tradition es verlangt, läuft er seinen Gästen entgegen (V.2e) und berührt den Boden (V.2f). Dabei bietet er den Männern an: „waschet euch die Füße“ (V.4b) und „ich will nehmen einen Bissen Brot“ (V.5a). Dieses Angebot stellt sich als höfliche Untertreibung heraus, was sich an den Vorbereitungen (V. 6-8) erkennen lässt.
Gemäß der Tradition geleitet Abraham seine Gäste noch ein Stück[24]. Es war üblich seine Gäste bis ans Ende des eigenen Einflussbereiches zu führen, um ihnen Sicherheit zu gewährleisten
Bewirtung
Eine Sinnlinie lässt sich in der Bewirtung der Gäste erkennen. Zunächst wird von der schnellen Reaktion Abrahams Berichtet. Durch die Verben „eilen“ (V.6a, c) und „laufen“ (V.7) wird die rasche Reaktion verdeutlicht. Die Anweisungen an Sara[25] zeugen davon wie wichtig Abraham die Gäste sind. Auch wenn es nicht mehr nachvollziehbar ist, wie viel drei Maß sind muss es wohl eine große Menge gewesen sein. Zudem lässt Abraham ein Rind zubereiten[26]. Üblicher wäre es gewesen, den Gästen Schafsfleisch anzubieten, Rindfleisch galt derzeit als eine Delikatesse. Auch „Rahm und Milch“ (V.8a), gemeint sind wohl Frischmilch, Sauermilch oder Joghurt, ist besonders an heißen Tagen eine willkommene Stärkung[27].
Bemerkenswert: In den traditionellen jüdischen Speisegeboten ist diese Verbindung von Fleisch und Milch nicht erlaubt[28].
Verheißung eines Sohnes
Ein weiteres wichtiges Motiv in der Erzählung ist die Wiederholung der Verheißung, dass Sara und Abraham noch Nachkommen zeugen werden. JHWH teilt dies zunächst Abraham mit, obwohl er zuvor nach Sara gefragt hat. Allerdings weiß er, dass Sara im Zelt ist und somit mithören kann, was auch im Vers 10d bestätigt wird: „Sara aber hörte es“.
Die Erzählpassage berichtet, dass Sara nicht mehr menstruiert und somit auch nicht mehr fruchtbar ist[29].
In den Kontext der Verheißung kann man zudem Saras spontane Reaktion zählen, ihr Lachen. Für sie ist es nicht möglich, dass in ihrem und Abrahams Alter noch Kinder gezeugt werden[30]. Daraufhin fragt JHWH rethorisch, ob irgendetwas für ihn unmöglich sei und wiederholt noch einmal, dass er nach dem Jahr wiederkommen werde und Sara dann einen Sohn hat (V.13b-14d). Diese Wiederholung der Verheißung betont die immense Wichtigkeit.
Ankündigung der Vernichtung Sodoms
Zu Beginn des zweiten Teils wird berichtet, dass die Männer Richtung Sodom blickten. Damit nicht bloß gemeint, dass sie dahin schauen, sondern schon in diese Richtung gehen. Dafür spricht zudem, dass Abraham gehend mit ihnen war, also müssen auch die Männer gehen[31].
Im Vers 17- 19 erklärt JHWH warum er Abraham in seine Absichten einweiht. Abraham wurde von ihm zum Stammvater des Volks Gottes ernannt hat und seine Nachkommen auch zur Gottesfurcht und den rechten Einsichten erziehen soll. Die Zerstörung Sodoms soll ein bleibendes Denkmal werden, das stets an Gottes Macht als Richter erinnern soll[32] [33].
Konkret auf die Problematik Sodoms wird wieder ab Vers 20 eingegangen. Es wird berichtet, dass „das Klagegeschrei über Sodom“ groß sei. Mit Klageschrei ist nicht einfach ein Ausdruck des Schmerzens gemeint, sondern die ausdrückliche Aufforderung an den Richter, ihnen Rechtsschutz zu gewähren[34].
Als JHWH davon spricht „hinabsteigen und sehen“ (V. 21), das heißt in Sodom nach dem Rechten zu sehen, soll Abraham offensichtlich im Schicksal der beiden Städte die Konsequenz sehen, was passieren würde, wenn seine Nachkommen nicht erkennen was es heißt „sie bewahren JHWHs Weg, zu tun Gerechtigkeit und Recht“ V.19.
Im Vers 22 wird berichtet, dass sich die Männer Richtung Sodom abwenden. So wird noch einmal die Absicht JHWHs unterstrichen.
Verhandlungen
Ab Vers 23 beginnt Abraham mit JHWH zu verhandeln. Sechsmal setzt er an, mit der Zahl 50 beginnend und nähert sich vorsichtig immer niedrigeren Zahlen an. Jedes Mal antwortet JHWH kurz mit der Zusage, dass er Sodom in diesem Falle verschonen wird.
Dominiert wird dieses Prozedere von der Idee, wenn es genügend Gerechte in der Stadt gibt, wird sie verschont. Mit „Gerechten“ sind diejenigen gemeint, die JHWH achten und ihre Lebensweise nach seinen Vorstellungen ausrichten.
Abraham beendet die Verhandlung als er bei die Zahl 10 erreicht. Dies hat den Hintergrund, dass im jüdischen Verständnis die Zahl 10 die kleinste Einheit bildet[35]. Deshalb wird an dieser Stelle nicht abgebrochen, sondern hat ihr natürliches Ende gefunden.
4.2 Das Verhältnis der Sinnlinien zueinander und die sich sich hieraus entwickelnden Perspektiven
Die Sinnlinie der Gäste Abrahams lässt sich einfach mit den anderen Sinnlinien in Zusammenhang bringen. Die Bewirtung bezieht sich ja gerade auf die Gäste.
Auch die Verheißung wird durch die Gäste ausgesprochen, ebenso wie die Ankündigung JHWHs über den Untergang Sodoms, da JHWH ein Teil der Gäste ist. Somit erklärt sich auch der Zusammenhang der Sinnlinie „Gäste“ mit der Verhandlung.
Die Verknüpfung von der Bewirtung von Gästen und der Ankündigung einer Geburt findet sich nicht nur in der Bibel. Auch in der Antike waren solche Sagen verbreitet[36]. Es ist somit ein Modell was vertraut ist und lässt daher keinen Grund zu, warum es in diesem Fall nicht so sein sollte, dass dieser Sohn tatsächlich geboren wird.
Die Bewirtung und die Verheißung stehen allerdings in keinem Zusammenhang mit der Ankündigung des Unterganges Sodoms und den Verhandlungen. Das diese beiden Teile so strikt getrennt sind, unterstreicht die in der Gliederung vorgenommene Unterteilung in zwei Hauptteile.
Betrachtet man die Sinnlinien der Ankündigung der sicheren Vernichtung Sodoms und die Verhandlungen Abrahams mit JHWH, so kann man erkennen, dass die eine auf der anderen aufbaut. Ohne die vorangestellte Ankündigung wäre die Verhandlung zusammenhangslos. Die beiden Linien zusammen betrachtet lässt sich eine Entwicklung feststellen; zunächst kündigt JHWH an, dass er es fest vorhat Sodom zu vernichten, wenn er dort schlechte Zustände vorfindet. Durch Abrahams Bitten lässt er sich aber darauf ein, von der Zerstörung abzusehen, wenn er genügend Gerechte findet. Dieses Ende lässt nun zwei Möglichkeiten offen, entweder JHWH findet mehr als 10 Gerechte und Sodom bleibt erhalten oder es sind keine 10 Gerechte in der Stadt zu finden, was ihren Untergang besiegelt. Wie man dem weiteren Verlauf in Gen 19 entnehmen kann, wird Sodom vernichtet, was darauf schließen lässt, dass keine 10 Gerechten zu finden waren[37].
5. Charakterisierung der Erzählfiguren
Abraham
Wie schon im Rahmen der Sinnlinien erläutert, zeigt sich Abraham zunächst als guter Gastgeber. Die Auswahl der Speisen („Brotfladen“, „ein Rind“ und „Rahm und Milch“ V. 6,7) lässt darauf schließen, dass Abraham vermögend ist[38]. Er erweist sich dabei als großzügig, gastfreundlich aber auch äußerst höflich. Im Vers 5 wird berichtet, dass er seinen Gästen nur einen Bissen Brot offeriert. Dabei handelt es sich um eine höfliche Untertreibung, um dem Gast nicht das Gefühl zu geben, dass er großen Aufwand produziert.
Im Vers 11 wird beschrieben, dass Abraham schon alt ist.
Im zweiten Teil der Erzählung ist Abraham JHWHs Gesprächspartner. Schon durch die Tatsache, dass ihm JHWH erscheint und er mit ihm spricht kommt Abraham eine große Ehre und Bedeutung zu. In dem Gespräch zeigt Abraham sich nicht als demütiger Jasager, sondern bezweifelt JHWHs Vorhaben und verhandelt mit ihm darüber[39]. Abraham bringt seine Kritik offen vor: „Willst du den Gerechten mit dem Frevler hinraffen?“ (v:“23c). Er sagt „Das sei ferne von dir“ gleich zweimal, zunächst im Vers 25a und im Vers 25e. Damit bemängelt er, dass JHWHs Verhalten nicht mit dem gewohnten und bekannten Verhalten übereinstimmt. Obwohl er JHWH kritisiert, ist er sich seiner Stellung im gegenüber durchaus bewusst[40]. Der Leser lernt Abraham also als eine gastfreundliche und einflussreiche Person da, die sich aber nicht scheut vor „Vorgesetzten“ seine Zweifel zu äußern. Eine Persönlichkeit die auch noch heute in der Form hohes Ansehen genießt.
Sara
Sara zeigt sich zunächst nur als Frau Abrahams, die sich ihrer Rolle entsprechend verhält. Zum ersten Mal tritt sie in Erscheinung als sie von Abraham die Bitte oder den Befehl erhält, Brotfladen zu zubereiten (V.6). Da es nicht berichtet wird, dass sie sich widersetzt und die Gäste nachher essen, ist davon auszugehen, dass sie Abrahams Aufforderung nachgegangen ist.
Steht Sara zunächst im Hintergrund, kommt ihr ab Vers 9 eine tragende Rolle zu Teil. Zunächst wird berichtet, dass sie im Zelt ist und somit nicht an der Männerrunde teilnimmt, was für diese Zeit durchaus üblich ist. Die Verheißung eines Sohnes, die JHWH im Vers 10 ausspricht ist eigentlich an Sara gerichtet, denn zuvor hatte er nach ihr verlangt. Sara hört sie durch die Zeltwand[41], man könnte auch sagen sie lauscht. Allerdings wurde nach ihr gefragt und die Verheißung trifft sie im besonderen Maße. Daher wird es nicht als falsches Verhalten gewertet.
Nun wird erläutert, dass Sara genau wie Abraham schon alt ist und zudem keine Menstruation mehr hat. Dies ist wichtig, um Saras Situation zu begreifen. Sie ist eine alte Frau, die nicht mehr in der Lage ist Kinder zu bekommen und längst eingesehen hat, dass sie wohl nie eigene Nachkommen haben wird[42]. In diese Situation hinein behauptet für sie gesehen ein normaler Gast, sie würde noch Nachkommen erhalten. Dass es sich hierbei um JHWH handelt kann sie noch nicht erkannt haben. Daher lässt sich auch ihr Lachen erklären: „Und Sara lachte im Inneren“ (V.12). Sie lacht nicht, weil sie JHWHs Verheißung anzweifelt, sondern weil sie nicht begreift von wem es kommt und reagiert mit Skepsis.
Als sich JHWH dann zu erkennen gibt, leugnet sie ihr Lachen (V.15). Ihre Skepsis weicht dem Glauben. Sie leugnet also ihr Lachen nicht, weil sie sich vor JHWH schämt oder sich ertappt fühlt, sondern weil sie jetzt erst erkennt von wem die Botschaft kommt[43].
Die besondere Betonung Saras Alters und ihrer Unfruchtbarkeit stellen noch mal besonders heraus, dass die folgende Geburt Isaaks nur aufgrund der Gnade Gottes erfolgt und nicht Menschengemacht ist. Saras Einwände und ihre Beseitigung haben den gleichen Effekt beim Leser. Hat auch er Zweifel hinsichtlich der Durchführbarkeit, erhält er in der Person Saras eine Antwort.
die Gäste
Weitere Hauptakteure in der Erzählung sind die Gäste. Zunächst wird angekündigt, dass JHWH erscheinen wird (V. 1). Daraufhin tauchen drei Männer vor Abrahams Zelt auf. Es wird nicht ausdrücklich berichtet, ob JHWH in diesen Männern repräsentiert ist. Auch ihr plötzliches Auftreten ist rätselhaft. Es wird nicht berichtet woher sie kommen, sondern sind einfach auf einmal da (V. 2b). Zusätzlich verwirrt, dass im Dialog zunächst die Männer fragen und später nur noch von „er“ als Sprecher berichtet wird (vgl. V. 9, 10). Die klare Trennung zwischen den Männern und JHWH ist demnach nicht möglich.
Dass er dazu gehört, wird im Vers 16 deutlich. Hier wird berichtet, dass die Männer und Abraham Richtung Sodom aufbrechen und anschließend redet JHWH, er muss also dazu gezählt werden. Im Vers 22 trennen sich dann aber die Männer von JHWH.
Ihre Aufgabe in dieser Erzählung ist es zunächst einmal die Verheißung zu überbringen. Zudem weisen sie auf die Problematik in Sodom hin und ermöglichen es, dass Abraham noch seine Einwände einbringen kann.
6. Schlusswort
Abschließend lassen sich als Hauptthemen des Textes neben der Gastfreundschaft, die Verheißung des Sohnes und die Frage wie man mit der problematischen Situation in Sodom umzugehen hat, abgrenzen.
Eine Frage, die man nicht eindeutig klären kann, ist wohl die genaue Abgrenzung der Gäste, ob JHWH nun dazu gehört oder nicht, lässt sich nicht eindeutig klären.
Ein zusätzlicher Streitpunkt ist sicherlich auch die Frage nach dem Protagonisten. Abraham kommt in der Erzählung ein wichtiger Teil zu, allerdings widmet sich der Besuch der Gäste eigentlich Sara, die auch im Vers 10 bis 15 eindeutig die wichtigste Person ist. Es stellt sich nun die Frage, ob nicht eigentlich Sara die Hauptperson der Geschichte war und alles andere später hinzugefügt wurde. Dies lässt sich in einer synchronen Analyse jedoch nicht klären.
Literaturverzeichnis
Deselaers, Paul – Sattler, Dorothea Gottes Wege gehen – Die Botschaft von Abraham und Sara, Freiburg: Verlag Herder, 2007
Herrmann, Siegfried – Wolff, Hans Walter Biblischer Kommentar: Altes Testament; Bd I. Genesis, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins, 1981
Kampling, Rainer Sara lacht… Eine Erzmutter und ihre Geschichte, Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004
Keil, Carl Friedrich Genesis und Exodus, Giessen, Basel: Brunnen-verlag, 1983
Krauss, Heinrich – Küchler, Max Erzählungen der Bibel II – Das Buch Genesis in literarsicher Perspektive / Abraham – Isaak – Jakob, Freiburg: Paulusverlag, 2004
Schmidt, Ludwig „De Deo“: Studien zur Literakritik und Theologie d. Buches Jona, d. Gesprächs zwischen Abraham u. Jahwe in Gen 18,22ff u. von Hi 1 – 1. Auflage – Berlin, New York : de Gruyter, 1976
Soggin, Jan Alberto Das Buch Genesis: Kommentar, [Aus dem Ital. übers. von Thomas Frauenlob], Darmstadt: Wiss. Buchges., 1997
[...]
[1] siehe Gen 18,1-2
[2] „und es standen von dort die Männer auf“ 16a
[3] „Abraham aber [war] gehend mit ihnen“ 16c
[4] „am Eingang des Zeltes“ 1b, „und Abraham eilte ins Zelt“ 6a
[5] „so sollst du tun, wie du geredet hast!“ 5f,g im Gegensatz zu Gen19,2, in der die Männer die Einladung zunächst ablehnen
[6] bis auf V.10d „Sara aber …“, V.11a „Abraham und Sara…“ und V. 16c „Abraham aber…“
[7] „Sara aber hörte es […]“ V.10d
[8] „er saß am Eingang des Zeltes“ V.1b
[9] „und es wandten sich von dort die Männer und gingen nach Sodom“ V.22a,b
[10] „und JHWH ging […] und Abraham kehrte um zu seiner Stätte“ V.33
[11] „und zu den Rindern aber lief Abraham“
[12] „und JHWH aber sprach“ V.17
[13] „und es erschien JHWH“ V.1; „es soll doch ein wenig Wasser genommen werden“ V. 4
[14] „am Eingang des Zeltes“ V1b; „und es erschien ihm JHWH“ V.1a
[15] „drei Männer [waren] stehend vor ihm“ V.2c
[16] siehe V. 3c, 4b,c, 5c
[17] „aber“ je V. 10d-11a; „und“ je V. 12a,d, 13a, 14d, 15a,d; „nachdem“ V.12b; „denn“ V.15c
[18] siehe V. 10d, 11a, 12a,b, 13b,c, 14d, 15a,b,c,e
[19] „Sara aber hörte“; „er aber [war] hinter ihm“ V. 12a,b
[20] „Abraham wird werden, ja werden“ V.18
[21] „und es standen von dort die Männer auf“ V.16
[22] „soll ich vor Abraham verbergen was ich machen will?“ V. 17b; „[…] ich will es wissen!“ V.21g
[23] „und es wandten sich von dort die Männer“ V. 22a
[24] „Abraham aber [war] gehend mit ihnen“ V. 16c
[25] „drei Maß Mehl, Weizengries!“ V.6d
[26] „und nahm ein Rind, zart und gut, und gab es dem Burschen, und er eilte es zuzubereiten“ V. 7
[27] Krauss, Küchler: S.61
[28] Soggin S. 273
[29] „aufgehört hatte für Sara die Regel der Jahre“, vgl. Krauss - Küchler S.63
[30] „Nachdem ich welk geworden, soll mir noch Wonne werden? Und mein Herr ist alt“ V.12b-d
[31] siehe V.16
[32] vgl. Keil S.195
[33] ebenso Soggin S.274
[34] vgl. Krauss – Küchler S. 66
[35] Für die Errichtung einer Synagoge und deren Gemeinde sind mindestens 10 Personen nötig (vgl. Krauss - Küchler S.67)
[36] z.B. Ovid: Fasti 5,494ff: drei Fremde, die in Wirklichkeit Zeus, Poseidon und Hermes sind, werden von Hyrieus bewirtet und dem kinderlose Gastgeber wird zum Dank ein Sohn geboren.
[37] vgl. Schmidt S.151
[38] „Die Gastfreundschaft Abrahams ist die eines Nomadenscheichs, der einen Gast von Bedeutung bewirtet“ Herrmann – Wolff S. 337
[39] vgl. Schmidt S.143
[40] „obgleich ich nur Staub und Asche“ V.27f
[41] „Sara aber hörte es am Eingang des Zeltes“ V. 10d
[42] vgl. Deselaers-Sattler S. 25
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Abrahamerzählung Gen 18?
Die vorliegende Arbeit analysiert synchron die Abrahamerzählung Gen 18. Auf eine inhaltliche Fragestellung an den Text wird bewusst verzichtet, um eine möglichst unvoreingenommene und breite Annäherung an den Aussagegehalt der Erzählung zu erzielen.
Wie gliedert sich die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Hauptkapitel Kontextabgrenzung und –einordung, Gliederung und Komposition, sprachlich-syntaktische Analyse und semantische Analyse sowie einer Charakterisierung der Haupterzählfiguren Abrahams, Saras und der drei Gästen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der semantischen Analyse.
Wie wird der Kontext abgegrenzt und eingeordnet?
Die Ortsangabe „bei den Terebinthen von Mamre“ deutet auf einen in sich geschlossenen Text hin. Weitere Hinweise sind der Ortswechsel, die Tageszeit („Mittagshitze“) und die erneute Gotteserscheinung. In Gen 18,33 wird auf einen nachfolgenden Ortswechsel verwiesen.
Welche Motive werden in Gen 18 aufgegriffen?
In Gen 18 werden Motive aufgegriffen, die für den weiteren Verlauf der Erzählung von großer Bedeutung sind. Dazu gehören die Verkündigung der Geburt eines Sohnes für Sara, die Ankündigung der Vernichtung Sodom und Gomorrahs und die Parallelen zwischen Gen 18 und 19.
Wie ist die Erzählung in Hauptteile gegliedert?
Die Erzählung in Genesis 18 lässt sich in zwei Hauptteile gliedern: Vers 1-15 und Vers 16-33.
Welche Hauptkompositionselemente gibt es?
Das erste Kompositionselement umfasst die Verse 1-5, das zweite die Verse 6-10c, das dritte die Verse 10d-15, das vierte die Verse 16-21, das fünfte die Verse 22-32 und das sechste die Verse 33.
Welche Sinnlinien lassen sich in der Erzählung erkennen?
Wichtige Sinnlinien sind: Abrahams Gäste, die Bewirtung, die Verheißung eines Sohnes, die Ankündigung der Vernichtung Sodoms und die Verhandlungen Abrahams.
Wie wird Abraham charakterisiert?
Abraham wird als guter Gastgeber, vermögend, großzügig, gastfreundlich und höflich dargestellt. Im zweiten Teil der Erzählung ist er JHWHs Gesprächspartner und bezweifelt JHWHs Vorhaben und verhandelt mit ihm.
Wie wird Sara charakterisiert?
Sara wird zunächst als Frau Abrahams dargestellt, die sich ihrer Rolle entsprechend verhält. Später kommt ihr eine tragende Rolle zu Teil, besonders im Hinblick auf die Verheißung eines Sohnes. Sie ist skeptisch, leugnet ihr Lachen, und ihre Skepsis weicht dem Glauben.
Wie werden die Gäste charakterisiert?
Es wird nicht ausdrücklich berichtet, ob JHWH in diesen Männern repräsentiert ist. Ihre Aufgabe ist es, die Verheißung zu überbringen und auf die Problematik in Sodom hinzuweisen.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Die Hauptthemen sind Gastfreundschaft, die Verheißung des Sohnes und die Frage, wie man mit der problematischen Situation in Sodom umgehen soll.
Welche Fragen bleiben offen?
Die genaue Abgrenzung der Gäste (ob JHWH dazugehört) und die Frage nach dem Protagonisten (ob Sara oder Abraham) bleiben offen.
- Citation du texte
- Britta Müller (Auteur), 2007, Synchrone Analyse einer Abrahamerzählung (Gen18), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111454