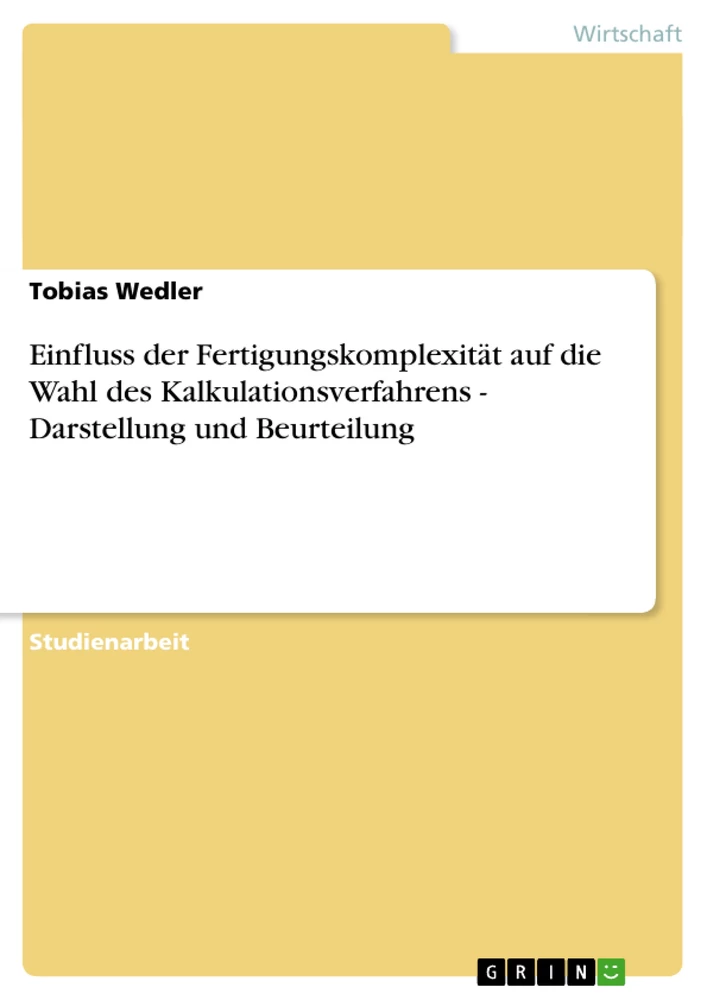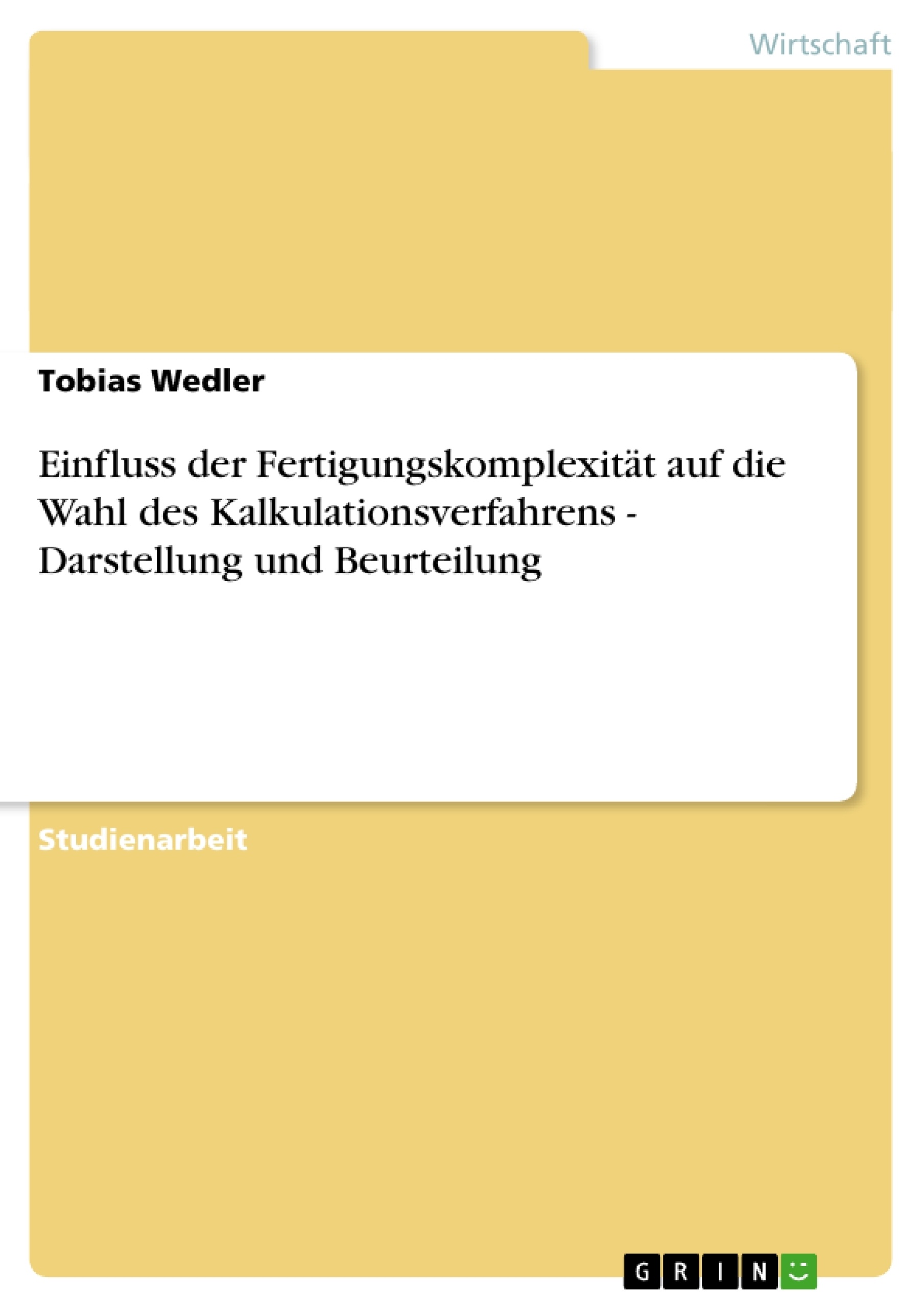Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen der Fertigungskomplexität
3. Darstellung und Beurteilung der Kalkulationsverfahren
3.1 Begriffsabgrenzung und Aufgabe der Kalkulation in der Kostenrechnung
3.2 Kalkulationsverfahren und Ihre praktische Anwendbarkeit.
3.2.1 Divisionskalkulation
3.2.2 Äquivalenzziffernkalkulation.
3.2.3 Zuschlagsverfahren
3.2.4 Maschinenstundensatzrechnung
4. Zuordnung der Fertigungsverfahren zu den Kalkulationsverfahren
5. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis:
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Verfahren der Kostenträgerstückrechnung
Abb. 2: Zuordnung der Kalkulationsverfahren zu Typen des Produktionsprogramm
Abb. 3: Formen der Divisionsrechnung und Ihre Anwendbarkeit
Abb. 4: Grundschema der Zuschlagskalkulation
1. Einleitung
Die heutige Unternehmenslandschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass verschiedenartige Unternehmen unterschiedlich komplizierte Produkte erzeugen, die auf verschiedenen Fertigungsstrukturen basieren. Durch die sich immer weiter beschleunigenden technologischen Entwicklungen mit steigendem Automatisierungsgrad und intensiven Wettbewerbs-Beziehungen zu den Beschaffungs- und Absatzmärkten, sind die Unternehmensstrukturen einem schleichenden Veränderungsprozess unterworfen.1 Die betriebliche Kostenrechnung ist von den betriebsindividuellen Gegebenheiten der Fertigung abhängig, deshalb muss die zunehmende Produktkomplexität und der Variantenreichtum einer Fertigung in der Wahl des Rechenverfahrens berücksichtigt werden.2
Die folgende Arbeit setzt sich mit der Problemstellung auseinander, welche Arten von Kalkulationsverfahren für welche Typen von Fertigungsstrukturen geeignet sind. Um unter den verschiedenen Kalkulationsverfahren auswählen zu können, müssen die einzelnen Einflussgrößen erfasst werden, die die Komplexität einer Produktfertigung ausmachen. Bedingt durch die Vielfalt der Einflussgrößen, konzentriert sich die Arbeit auf die Art des Fertigungsverfahrens als wichtigstem Einflussfaktor.
Darauf aufbauend erfolgt eine Darstellung der Kalkulationsverfahren3 und eine Beurteilung der praktischen Anwendbarkeit dieser Verfahren in Bezug auf die Komplexität verschiedener Fertigungsverfahren. Die Darstellung beschränkt sich auf Industriebetriebe, deren Leistungserstellung sich auf Produkte bzw. Güter bezieht. Für eine Gesamtbeurteilung wird eine vorläufige Zuordnung von Fertigungsverfahren zu geeigneten Kalkulationsverfahren vorgenommen. Abschließend erfolgt eine Schlussbetrachtung zu der Aufgabenstellung.
2. Grundlagen der Fertigungskomplexität
Eine Fertigung ist die durch Vorbereitung, Durchführung und Überwachung aller technischen Verfahren in einem Leistungserstellungsprozess vollzogene Produktion.4 Die Komplexität ergibt sich grundsätzlich aus der Summe der Elemente, Varianten und deren Beziehungen in einem Fertigungsprozess. Art und Umfang der Wiederholung der einzelnen Prozessabschnitte bestimmen das Fertigungsverfahren bzw. den Prozesstyp. In der Industrie unterscheidet man die Massenfertigung, Sortenfertigung, Serienfertigung, Einzelfertigung und Kuppelproduktion als Grundformen der Prozesstypen.5 Deren Komplexität wird maßgeblich durch die Struktur des Produktionsprogramms und die Kontinuität des Produktionsablaufs in einer Unternehmung beeinflusst.6
Die Struktur wird gebildet durch die Anzahl der Produkte, die Produktionsstufen und die Kombination der Einsatzstoffe. Das Produktionsprogramm lässt sich durch die Anzahl der erzeugten Produkte und ihrer Ähnlichkeit charakterisieren.7 Das Mengenkriterium der Anzahl von Produktarten differenziert die Unternehmen nach Einprodukt- und Mehrproduktbetrieben. Einproduktbetriebe erzeugen gleichartige (homogene) Güter, im Normalfall in einer großen Menge. Deshalb kommt hierbei in der Regel eine Massenfertigung nach standardisierten Fertigungsverfahren zur Anwendung.8 Mehrproduktbetriebe produzieren dagegen verschiedenartige (heterogene) Güter, deren Fertigungsstruktur eine erhöhte Komplexität aufweist. Als Programmtypen werden die Sortenfertigung, Serienfertigung und Einzelfertigung unterschieden. Die Ähnlichkeit unterscheidet homogene und heterogene Produkte, die sich wiederum in Produktprogramme untergliedern lassen.9 Die Zahl der Produktionsstufen einer Fertigung ergibt sich aus der Anzahl an Arbeitsverrichtungen, die zur Produktion eines Gutes erforderlich sind.10
Ein Produktionsverfahren ist kontinuierlich, wenn der Produktionsablauf ohne Unterbrechung erfolgt, deshalb wird hierbei in der Regel eine Produktart aus lediglich einem Einsatzstoff hergestellt. In konvergierenden Verfahren werden verschiedene Stoffe eingesetzt11. Einen divergierenden Charakter weist das Verfahren auf, wenn aus einem Einsatzstoff mehrere Produktarten erzeugt werden. Kontinuierliche Produktionsverfahren laufen über längere Zeit hinweg ohne Unterbrechung ab, diskontinuierliche werden in ihrem Ablauf dagegen regelmäßig unterbrochen.12
Allein diese ausgewählten Einflussgrößen der Fertigungskomplexität machen eine eindeutige langfristige Zuordnung eines Kalkulationsverfahrens zu einem Fertigungstypen nur bedingt möglich. Darüber hinaus verändern dynamische Umfeldeinflüsse die Anforderungen an Fertigung und Kalkulation. In der Praxis werden dennoch unterschiedlich aufgebaute Kalkulationsverfahren eingesetzt, da die Zuordnung es vor dem Hintergrund komplexer Fertigungsstrukturen ermöglicht, einen Überblick der wechselseitigen Abhängigkeiten herzustellen.13
3. Darstellung und Beurteilung der Kalkulationsverfahren
3.1 Begriffsabgrenzung und Aufgabe der Kalkulation in der Kostenrechnung
Aufbauend auf der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung ist die Kostenträgerstückrechnung die Kalkulation der Herstellungs- und Selbstkosten einer selbstständigen Leistungs- bzw. Produkteinheit.14 Bei einer Kostenartenrechnung wird eine Klassifizierung nach verschiedenen Kostenarten vorgenommen15, eine Kostenstellenrechnung gliedert das Unternehmen in rechnungstechnisch abgegrenzte Bereiche.16 In Abhängigkeit von den verschiedenen betrieblichen Gegebenheiten werden Kalkulationsverfahren und ihre Methoden als Regeln für die Verteilung der Kosten auf die Kostenträger eingesetzt.17 Als Kostenträger bezeichnet man hierbei die von einer Unternehmung erstellten Güter.18 Die Aufgaben der Kalkulation liegen in der Ermittlung preispolitischer Daten, insbesondere von Angebots- Verrechnungs- und Marktpreisen und der Bewertung von Beständen. Damit dient sie als Informationsinstrument für die Planung, Steuerung und Analyse des Produktions- und Absatzprogramms.19 Beispielsweise lässt sich die Wahl zwischen Eigenfertigung und Fremdbezug nur auf der Basis zuverlässiger entscheidungsrelevanter Kostendaten Ziel orientiert analysieren. Eine Kalkulation kann als Voll- oder Teilkostenrechnung ausgestaltet werden und anhand verschiedener Verfahren vollzogen werden. 20 Bei einer Vollkostenrechnung werden die anfallenden Gesamtkosten (fixe Kosten zuzüglich der variablen Kosten) auf das Absatz orientierte Produktionsprogramm als Kostenträger verteilt. Durch die Teilkostenrechnung wird dagegen ermittelt, in welcher Höhe bestimmte Teilkosten (z.B. Einzelkosten) bei der Herstellung und Verwertung einer Kostenträgereinheit entstehen.21 Die traditionellen Verfahren der Kalkulation rechnen mit Vollkosten, deshalb wird im weiteren Verlauf nicht weiter auf die Teilkostenrechnung eingegangen.22
Es lassen sich als Grundverfahren der Kalkulation die Divisions- und die Zuschlagskalkulation mit diversen Ergänzungen unterscheiden. Bei der Divisionskalkulation findet eine Unterteilung in einfache, mehrfache, einstufige und mehrstufige Verfahren statt. In besonderen Fällen wird sie um die Äquivalenzziffernkalkulation ergänzt. Bei der Zuschlagskalkulation lassen sich summarische und differenzierte Verfahren unterscheiden. Zusätzlich kann als Bezugsgröße ein Maschinenstundensatz zum Einsatz kommen.23
3.2 Kalkulationsverfahren und Ihre praktische Anwendbarkeit
Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Überblick über die verschiedenen hier vorgestellten Kalkulationsverfahren. Um unter diesen das für ein Fertigungsverfahren geeignete auszuwählen, wird im nachfolgenden Abschnitt eine Darstellung und Beurteilung der praktischen Anwendbarkeit der verschiedenen Verfahren vorgenommen.
[...]
1 Vgl. Böhler, W/Bauer, D, (1996), S. 1
2 Vgl. Zimmermann, G (2001) S. 101
3 Auf die Kalkulation von Kuppelprodukten wird nicht eingegangen.
4 Vgl Duden: Das Lexikon der Wirtschaft. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag 2001
5 Vgl. Seicht, G. (1997), S.159
6 Vgl. Schweitzer/Küpper. S.190 u. Vgl. Busse von Colbe, Pellens (1998), S. 847
7 Vgl. Busse von Colbe, Pellens (1998), S. 847
8 Vgl. Schweitzer, M/ Küpper, H-U. (1998) S. 188
9 Vgl. Busse von Colbe, Pellens (1998), S. 848
10 Vgl. Schweitzer, M/Küpper, H-U. (1998), S. 188
11 Vgl. Schweitzer, M/ Küpper, H-U (1998), S. 190
12 Vgl. Schweitzer, M/ Küpper, H-U (1998), S. 190f.
13 Vgl. Hummel, S/Männel, W (1986), S.264
14 Vgl. Coenenberg, A.G (1993), S. 92
15 Vgl. Schweitzer, M/ Küpper, H-U. (1998) S. 94
16 Vgl. Schweitzer, M/ Küpper, H-U. (1998) S. 127
17 Vgl. Däumler, K-D/Grabe J. (2003), S. 307
18 Vgl. Schweitzer, M/Küpper, H-U. (1998) S. 163
19 Vgl. Hummel, S/Männel, W (1986): S.258
20 Vgl. Schweitzer, M/Küpper, H-U. (1998) S. 169
21 Vgl. Schweitzer, M/Küpper, H-U. (1998) S. 166
22 Vgl. Däumler, K-D/Grabe J. (2003), S. 303
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Das Dokument befasst sich mit der Frage, welche Arten von Kalkulationsverfahren für welche Typen von Fertigungsstrukturen geeignet sind, wobei der Fokus auf der Art des Fertigungsverfahrens als wichtigstem Einflussfaktor liegt.
Was sind die Hauptabschnitte des Dokuments?
Das Dokument ist in folgende Abschnitte gegliedert: Einleitung, Grundlagen der Fertigungskomplexität, Darstellung und Beurteilung der Kalkulationsverfahren (inkl. Begriffsabgrenzung und Aufgabe der Kalkulation in der Kostenrechnung sowie Kalkulationsverfahren und ihre praktische Anwendbarkeit), Zuordnung der Fertigungsverfahren zu den Kalkulationsverfahren und Schlussbetrachtung.
Welche Kalkulationsverfahren werden in dem Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Divisionskalkulation (einfache, mehrfache, einstufige und mehrstufige Verfahren), die Äquivalenzziffernkalkulation und die Zuschlagskalkulation (summarische und differenzierte Verfahren) sowie die Maschinenstundensatzrechnung.
Was versteht man unter Fertigungskomplexität?
Fertigungskomplexität ergibt sich aus der Summe der Elemente, Varianten und deren Beziehungen in einem Fertigungsprozess. Art und Umfang der Wiederholung der einzelnen Prozessabschnitte bestimmen das Fertigungsverfahren bzw. den Prozesstyp.
Welche Fertigungstypen werden unterschieden?
In der Industrie unterscheidet man die Massenfertigung, Sortenfertigung, Serienfertigung, Einzelfertigung und Kuppelproduktion als Grundformen der Prozesstypen.
Was ist die Aufgabe der Kalkulation in der Kostenrechnung?
Die Aufgaben der Kalkulation liegen in der Ermittlung preispolitischer Daten, insbesondere von Angebots- Verrechnungs- und Marktpreisen und der Bewertung von Beständen. Damit dient sie als Informationsinstrument für die Planung, Steuerung und Analyse des Produktions- und Absatzprogramms.
Was ist der Unterschied zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung?
Bei einer Vollkostenrechnung werden die anfallenden Gesamtkosten (fixe Kosten zuzüglich der variablen Kosten) auf das Absatz orientierte Produktionsprogramm als Kostenträger verteilt. Durch die Teilkostenrechnung wird dagegen ermittelt, in welcher Höhe bestimmte Teilkosten (z.B. Einzelkosten) bei der Herstellung und Verwertung einer Kostenträgereinheit entstehen.
Warum ist die Zuordnung eines Kalkulationsverfahrens zu einem Fertigungstypen nur bedingt möglich?
Die Zuordnung ist bedingt möglich, weil dynamische Umfeldeinflüsse die Anforderungen an Fertigung und Kalkulation verändern und weil allein die ausgewählten Einflussgrößen der Fertigungskomplexität die Zuordnung erschweren. Trotzdem wird sie genutzt, um einen Überblick über die wechselseitigen Abhängigkeiten herzustellen.
- Citar trabajo
- Tobias Wedler (Autor), 2005, Einfluss der Fertigungskomplexität auf die Wahl des Kalkulationsverfahrens - Darstellung und Beurteilung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111472