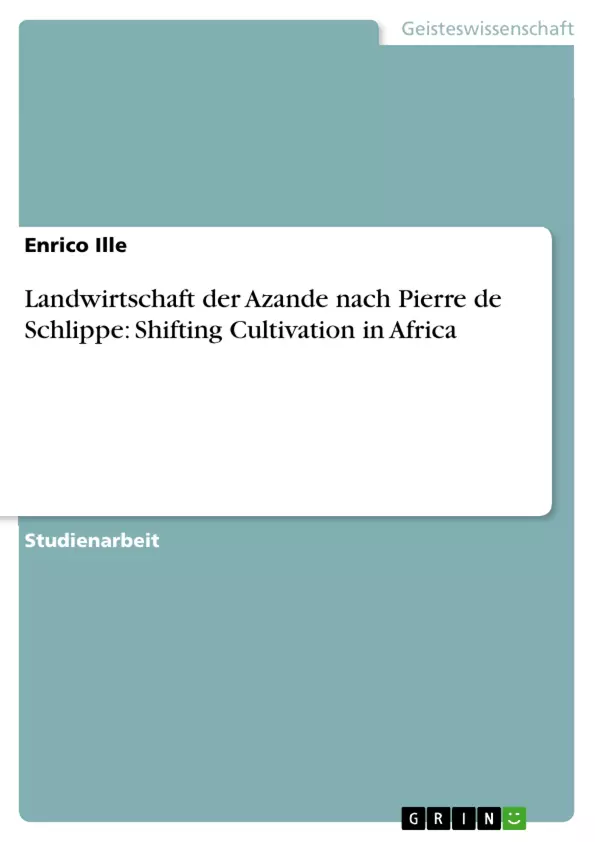Der für die vorliegende Arbeit relevante Teil der Erdkruste, die Lithosphäre, hat im Vergleich zu weiteren Schichten der Erde nur ein minimales Volumen und beinhaltet nur einen sehr kleinen Teil des planetarischen Gesteins. Im Gegensatz zu Erdkern, Erdmantel und der kernnäheren Erdkruste, die mit Nickel und Eisen, Silicium und Magnesium bzw. Silicium und Aluminium langzeitlich gleiche Stoffzusammensetzungen aufweisen, befindet sich die Lithosphäre ebenso wie Hydrosphäre und Atmosphäre, gemessen an geologischen Zeitabläufen, in einem ständigen biochemischen und physikalischen Wandlungsprozess. Somit ist die Lithosphäre oder Sedimenthülle zwar in der Basis vom Ausgangsgestein geprägt, beinhaltet aber im Einzelnen unterschiedlichste Stoffzusammensetzungen, deren Veränderung durch makrostrukturelle Prozesse wegen deren relativer Seltenheit in agrarökologischen Betrachtungen außen vor gelassen werden können.
Das Hauptaugenmerk liegt also in mikrostrukturellen Prozessen. Unter Mikrostruktur sind dabei die Wechselwirkungen der biosphärischen Elemente zu verstehen. Im Wesentlichen gehören dazu in der Lithosphäre die pflanzliche und tierische Biomasse, die Sedimenthülle als System chemischer Verbindungen in verschiedenen Aggregatszuständen sowie klimatische Bedingungen der Atmosphäre. Dabei ist die Biomasse vom Vorhandensein bestimmter chemischer Elemente abhängig, deren unterschiedliche Zusammensetzung unterschiedliche geochemische Umwelten hervorruft, die wiederum von der Biomasse beeinflusst werden. Das Verhältnis zwischen Lebewesen und biochemischer Umwelt ist daher in einem ständigen Wechsel von Überschuss und Mangel chemischer Elemente.
Inhaltsverzeichnis
1. Allgemeiner Teil
1.1. Geologische Grundlagen: Grundsubstanzen und Verwitterungsprozesse
1.1.1. Bedeutung des Ausgangsgesteins
1.1.2. Faktoren der Verwitterung
1.2. Biochemische Grundlagen: Nährstoffkreisläufe
1.2.1. Makro- und Mikronährstoffe
1.2.2. Voraussetzungen und Notwenigkeit der Nutzbarkeit
1.2.3. Ton-Humus-Komplex
1.3. Agrarökologische Grundlagen: Bodenqualitäten, Wachstumsvoraussetzungen
1.3.1 Bodenqualität: Struktur, Nährstoffe, Wasserführung, Relief
1.3.2. Wachstumsprozesse
1.3.3. Organische Materie (Gründüngung)
1.4. Geografische Grundlagen: Afrikanische Tropen (Boden, Klima, Vegetation)
1.4.1. Bodenarten der afrikanischen Tropen
1.4.2 Spezielle Problematik der Böden in Wechselwirkung mit Klima und Vegetation
1.4.3 Extensive Landwirtschaft (Wanderfeldbau)
2. Spezieller Teil
2.1. Geografisches Umfeld der Yambio Experimental Farm
2.2. Geschichte und politisches System der Azande (Kapitel 1)
2.3 Spezielle Situation des Zande Scheme (Kapitel 2)
2.4 Spezifische Umwelt der Yambio Experimental Farm (Kapitel 4)
2.5 Landwirtschaftliche Größen (Kapitel 5, 6, 8)
2.5.1 Anbaupflanzen
2.5.1.1. Zerealien
2.5.1.2. Hülsenfrüchte
2.5.1.3. Ölsaat
2.5.1.4. Stärkehaltige Wurzeln
2.5.1.5. Sonstiges
2.5.2. Besitzverhältnisse und Feldtypen
2.6 Agrarischer Jahreszyklus (Kapitel 11)
2.7. Territoriale Wanderung als shifting cultivation (Kapitel 13)
3. Literatur
Vorbemerkung
Das Fehlen von Verweisen innerhalb der Arbeit ist im ersten Teil darauf zurückzuführen, dass größtenteils elementares Wissen zur Thematik vermittelt wird, das zwar zum großen Teil der im Anhang angeführten Literatur (außer de Schlippe) entnommen wurde, aber durchaus lexikalisch erschließbare Fakten enthält, die keinerlei Interpretation oder spezifischen Nachweis benötigen. Der zweite Teil ist vollständig aus de Schlippe erwachsen, daher sind den Überschriften jeweils Kapitelangaben zugeordnet. Überhaupt ist Teil 2 eher als Inhaltswiedergabe zu verstehen als als thematische Ausarbeitung.
1. Allgemeiner Teil
1.1. Geologische Grundlagen: Grundsubstanzen und Verwitterungsprozesse
1.1.1. Bedeutung des Ausgangsgesteins
Der für die vorliegende Arbeit relevante Teil der Erdkruste, die Lithosphäre, hat im Vergleich zu weiteren Schichten der Erde nur ein minimales Volumen und beinhaltet nur einen sehr kleinen Teil des planetarischen Gesteins. Im Gegensatz zu Erdkern, Erdmantel und der kernnäheren Erdkruste, die mit Nickel und Eisen, Silicium und Magnesium bzw. Silicium und Aluminium langzeitlich gleiche Stoffzusammensetzungen aufweisen, befindet sich die Lithosphäre ebenso wie Hydrosphäre und Atmosphäre, gemessen an geologischen Zeitabläufen, in einem ständigen biochemischen und physikalischen Wandlungsprozess. Somit ist die Lithosphäre oder Sedimenthülle zwar in der Basis vom Ausgangsgestein geprägt, beinhaltet aber im Einzelnen unterschiedlichste Stoffzusammensetzungen, deren Veränderung durch makrostrukturelle Prozesse wegen deren relativer Seltenheit in agrarökologischen Betrachtungen außen vor gelassen werden können.
Das Hauptaugenmerk liegt also in mikrostrukturellen Prozessen. Unter Mikrostruktur sind dabei die Wechselwirkungen der biosphärischen Elemente zu verstehen. Im Wesentlichen gehören dazu in der Lithosphäre die pflanzliche und tierische Biomasse, die Sedimenthülle als System chemischer Verbindungen in verschiedenen Aggregatszuständen sowie klimatische Bedingungen der Atmosphäre. Dabei ist die Biomasse vom Vorhandensein bestimmter chemischer Elemente abhängig, deren unterschiedliche Zusammensetzung unterschiedliche geochemische Umwelten hervorruft, die wiederum von der Biomasse beeinflusst werden. Das Verhältnis zwischen Lebewesen und biochemischer Umwelt ist daher in einem ständigen Wechsel von Überschuss und Mangel chemischer Elemente.
1.1.2. Faktoren der Verwitterung
Die Bildung der rezenten Bodenverhältnisse erfolgte und erfolgt durch physikalische und chemische Prozesse unter Einfluss athmosphärischer und / oder klimatischer Bedingungen. Diese Prozesse werden unter Verwitterung zusammengefasst. Anders ausgedrückt ist damit die nachhaltige Veränderung von Gesteinen und deren Mineralien an der Erdoberfläche gemeint. Es handelt sich dabei um Lockerung und Verkleinerung des Festgesteins, das damit durch Wind und Wasser abtragbar wird und dessen Partikel dann Grundlage zur Bildung einer lockeren Auflage dienen. Der daraus hervorgegangene Boden bildet das Relief der Oberfläche und ist Voraussetzung für pflanzliches Leben.
Während in ariden und nivalen Klimaten eher die physikalische Verwitterung stattfindet, also mechanisch durch Aufsprengen bei scharfen Temperaturunterschieden oder Abtragen durch Wind, herrscht in humiden Klimaten die chemische Verwitterung vor. Dazu gehören Durchlöcherung von Gesteinen durch Lösung von Salzen oder auch Salzkristallbildung in kleinen Gesteinsritzen.
An Hängen bildet sich eine charakteristische Formation, wenn kleinere Gesteinsteile weiter hangabwärts abgetragen werden als größere. Diese Formation wird Catena genannt.
1.2 Biochemische Grundlagen: Nährstoffkreisläufe
1.2.1 Makro- und Mikronährstoffe
Unter den beteiligten Faktoren der Verwitterung, wie Wasser, Luft, Pflanzendecke, Mikroflora, Fauna, sowie Zeit, Klima und Relief, kommt den Mirkoorganismen als Reglern chemischer Elemente in Bezug auf Nährstoffe eine besondere Bedeutung zu. Ihre Tätigkeit besteht dabei weniger in der Zersetzung der Mineralien des Ausgangsgesteins (Quarz, Kalk, Gips und verschiedene Salze), als vielmehr in der Umsetzung der Nekromasse durch mikrobielle Enzyme in neue Mikrobenzellen. Ihre Stoffwechselendprodukte dienen zur Entstehung von Huminstoffen und nährstoffspeichernden Tonmineralien, die wiederum als lebensnotwendige Mikro- und Makronährstoffe von Pflanzen genutzt werden.
Es handelt sich dabei um unterschiedliche Mengen von folgenden Elementen (jeweils als an- oder kationische Salze): Als Makronährstoffe gelten Stickstoff, Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium und Schwefel, als Mikronährstoffe oder Spurenelemente Eisen, Mangan, Bor, Molybdän, Kupfer, Zink, Chlor und Kobalt. Zusammen mit Kohlendioxid und Wasser sind sie die Grundlage für den Aufbau von organischer Substanz durch die Pflanzen. Sterben sie ab, geben sie ebenso wie die tierischen Lebewesen als tote organische Masse, als Nekromasse, die Grundlage für die mikrobielle Zersetzung, die den Stoffkreislauf schließt.
1.2.2 Voraussetzungen und Notwendigkeit der Nutzbarkeit
Um die im Boden gegebenfalls angereicherten Nährstoffe nutzen zu können, benötigen Pflanzen spezifische Bodenverhältnisse. Ihre Wurzeln müssen den Boden ausreichend durchdringen können, damit Berührung mit den nährstofftragenden Elementen stattfindet. Dann hängt die Nutzbarkeit vonder Abgabefreudigkeit dieser Elemente ab, kennzeichenbar als Kationenaustauschkapazität, die chemische Verhältnisse anzeigt, unter denen Kationen mehr oder weniger leicht aus dem mineralischen Umfeld lösbar sind. Da für den diesen Vorgang Wasser eine tragende Rolle spielt, gehört auch die Bodenfeuchtigkeit zu den Faktoren der Nutzbarkeit.
Selbst wenn diese Umstände gegeben sind, brauchen Pflanzen zur schnellen Umsetzung der chemischen Elemente einfache organische und anorganische Verbindungen, die beispielsweise einen geringes Verhältnis Nährstoff / Kohlenstoff erfordern, da Kohlenstoff zur Langkettigkeit neigt.
Werden die in Pflanzen angereicherten Nährstoffe nicht durch Entnahme derselben in großem Maße entfernt, besteht die Möglichkeit eines Fließgleichgewichts, also annähernd ausgeglichene Stoffkreisläufe innerhalb eines Ökosystems. Nährstoffverluste durch Bodenerosion, Auslaugung, Verdunstung und Ähnliches werden dann durch Niederschläge, biologische Fixierung von Luftstickstoff und Einträge aus anderen Systemen weitgehend ausgeglichen.
Fließgleichgewichte sind jedoch nicht selbstverständlich, vor allem bei agrarischer Nutzung erhöht sich das auszugleichende Niveau erheblich. Kulturpflanzen haben einen wesentlich höheren Nährstoffbedarf, je nach genutztem Teil der Pflanze werden unterschiedliche, aber immer erhebliche Mengen von Nährstoffen bei der Ernte entnommen. Um die Bodenproduktivität zu erhalten, ist daher ein zusätzlicher Eintrag von organischem und anorganischem Material notwendig.
1.2.3 Ton-Humus-Komplex
Das wichtigste Nährstoffreservoirim Boden ist organisches Material, also lebende Wurzeln, Bodentiere, Mikroorganismen und tote organische Materie in verschiedenen Zersetzungsstadien. Bei der Zersetzung werden die Nährstoffe mineralisiert, einige Minerale werden sofort freigesetzt und damit direkt nutzbar, andere werden humifiziert, also in Form von Kleinstpartikeln, Kolloide (kleiner als 0,001 mm), als Humusfraktion gebunden. Die Huminkolloide werden an der Oberfläche von Tonpartikeln im Boden mit Hilfe von Wasser durch Ionenbindung adsorbiert. Da dafür kleine Tonpartikel und Bodenfeuchtigkeit die besten Voraussetzungen sind, ist der Humusgehalt eines trockenen Sandbodens vergleichsweise gering.
Durch die reaktionsfreudige, aber durch die vorhandene Feuchtigkeit schwer auslaugbare ‚Außenbindung’ des Humus stellt er einen wichtigen Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit dar.
Abgesehen von der Humusbildung ist organische Materie vom Standpunkt der Bewirtschaftung aus ebenso wertvoll durch erhöhte Wasserspeicherung in trockenen Böden, Auflockerung des Sediments durch Krümelbildung und daher verbesserte Belüftung in schweren, wasserreichen Böden.
1.3 Agrarökologische Grundlagen: Bodenqualitäten, Wachstumsvoraussetzungen
1.3.1 Bodenqualität: Struktur, Nährstoffe, Wasserführung, Relief
Primäres Ziel der Bodenkultivierung ist durch Bodenbearbeitung ideale Voraussetzungen für das pflanzliche Wachstum zu schaffen, nach dem Säen oder Pflanzen durch Entwässerung bzw. Bewässerung, Düngung und / oder Pflanzenschutz den Wachstumsprozess zu unterstützen, um schließlich ernten zu können.
Eine günstige Bodenbeschaffenheit liegt dann vor, wenn die benötigten Mineralstoffe gut nutzbar vorliegen und ein optimales Gleichgewicht zwischen Wasserhaltung, Wasserführung und Belüftung besteht. Dabei unterscheidetman verschiedene Bodenarten an Hand der Größenverhältnisse der bodenbildenden Mineralkörner.
Die drei wichtigsten Komponenten sind dabei Sand, Schluff und Ton, die sich größtenteils durch die Partikelgröße unterscheiden. Sie beträgt bei Ton bis zu 0,002 mm, bei Schluff 0,002 - 0,02 mm, bei feinkörnigem Sand 0,02 - 0,2 mm und bei grobkörnigem Sand 0,2 - 2 mm. Hat ein Boden einen hohen Anteil von Sand und Ton spricht man von Lehm, bei einem hohen Anteil von Schluff und Ton ist es ein Tonboden.
Durch die Größe der Partikelzwischenräume (Poren) wird die Wasserversickerungsfähigkeit (Drainage) bestimmt, während die größenrelative Oberfläche der Partikel den Gehalt an Wasser und darin gelösten Nährstoffen vorgibt.
Die Bearbeitbarkeit des Bodens wird durch seine Schwere klassifiziert. Die Bezugsgrößen sind dabei leicht und schwer. Leicht ist ein Boden, der über 80 % Sand enthält, daher grobkörnig, trocken und mager ist, mit schneller Versickerung und damit Auslaugung, sowie schneller Erwärmung. Ein schwerer Boden dagegen hat über 25 % Tonanteil, ist daher fein strukturiert durch Tonpartikel mit großer, chemisch aktiver Oberfläche. Die wasseraufsaugenden Partikel quellen bei Feuchtigkeit schnell auf, während sie bei Trockenheit ebenso schnell einschrumpfen. Da Böden aber meist aus einer Vielzahl verschiedener Tonmineralien mit verschiedenen Eigenschaften bestehen, dienen diese Klassifikationen lediglich der Orientierung.
Die schon angesprochenen Poren spielen auch für die Durchlüftung des Bodens eine große Rolle. Im Idealfall sind viele Zwischenräume von etwa 0,1 mm Durchmesser vorhanden, damit Wurzeln ungehindert wachsen und Sauerstoffdiffusion und Wasserfluss stattfinden können. Weitere Poren von weniger als 0,05 mm Durchmesser dienen dann der Wasserspeicherung, so dass Wasser schnell von der Oberfläche in tiefere Schichten versickern kann, aber in notwendigem Umfang zurückgehalten wird und tiefe Wurzelbildung möglich ist, sofern es keinen verdichterten Unterboden gibt.
Ideal sind also strukturell stabile Böden mit gut zersetzter organischer Materie, möglichst als wasser- und nährstoffhaltender Ton-Humus-Komplex, und reichem Vorhandensein von aktiven Bodenorganismen[1].
1.3.2. Wachstumsprozesse
Während des Wachstums bildet eine Pflanze komplexe organische Verbindungen, Kohlenhydrate, als Energiegrundlage für organischen Stoffwechsel und als Bausteine zur Synthetisierung von Fetten und Proteinen. In der Photosynthese wandelt sie dabei einfache anorganische Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Natrium, Kalium und Phosphor aus der Luft und dem Boden in chlorophyllhaltigen Pflanzenzellen mit Lichtenergie um.
Ziel der Landwirtschaft ist die maximale Nutzung dieser Energien und Substanzen durch Kulturpflanzen und Nutztiere, minimale dagegen durch Unkräuter und Schädlinge.
Als Beispiel für eine versuchte Annäherung an dieses Ideal soll die sogenannte Grüne Revolution dienen: nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Programme zur Ertragssteigerung in den Tropen angesetzt, wobei neugezüchtete Varianten von Weizen und Reis (sogenannte HYVs, High Yielding Varieties) eingesetzt wurden.
Die ungezüchteten Varianten waren meist große Pflanzen mit langen, schlaffen Blättern und tiefen, weitverzweigten Wurzelsystemen. Sie brachten geringe Erträge, verursacht und verstärkt durch die geringe Bodenfruchtbarkeit und den Stickstoffmangel tropischer Böden. Jedoch wurde dies durch großen Artenreichtum kompensiert, der zudem erhöhte Resistenz gegen Krankheit und Dürre bewahrte.
Für Ertragssteigerung kamen größere Pflanzendichte und anorganischer Dünger aber nicht in Frage, da Ersteres durch die Größe der Blätter und Stängel verhindert wurde, die sich bei Letzterem noch zunahm. Daher züchtete man zwergwüchsige oder nur kleinere Varianten von Getreide mit stabilen Stängeln und kleinen Blättern. Das nunmehr dichtere Pflanzen, die minimale Beschattung, begrenztere Wurzelsysteme und kürzere Reifezeiten schienen nun optimale Wachstumsprozesse zu bringen.
Doch die Ertragssteigerung ging einher mit einer höheren Anfälligkeit der zudem oft monokulturell angebauten Pflanzen, internationale und interdisziplinäre Institute beschäftigen sich seither mit dem Problem, das auch nichttropische Anbaugebiete in zunehmendem Maße betrifft.
In jedem Fall bleibt die geringere Koch- und Geschmacksqualität der neuen Arten, die einhergeht mit hohen Kosten für Dünger, Wasser, Herbizide und Insektizide, was die Programme nur für einen kleinen Kreis an Großwirten hilfreich macht.
1.3.3. Organische Materie (Gründüngung)
Bei der Kultivierung werden nicht nur pflanzliche Elemente des natürlichen Kreislaufs entfernt, sondern die Öffnung des Bodens bringt auch eine direktere Einwirkung des Luftsauerstoffs. Das gilt noch vielmehr für dauerhaft vegetationslose Brachflächen und Daueranbauflächen. Dabei geht zum Beispiel Stickstoff durch Verdunstung (Denitrifikation) und Auslaugung verloren.
Dem kann entgegen gewirkt werden zum Einen durch eine Mulchschicht in den Brachperioden, die die Temperatur an der Oberfläche herabsetzt und außerdem Erosionsschutz bietet. Dazu können beispielsweise die Überreste der Kulturpflanzen wie Wurzeln, Blätter und Stängel unterpflügt oder Mischungen aus Gräsern und stickstoffbindenden Hülsenfrüchtlern, Leguminosen, wie Klee, Wicke und Luzerne eingesät werden. Letzteres bewirkt neben der Mulchschicht eine Stabilisierung des Bodens durch ein dichtes Wurzelsystem, Bewahrung oder Bildung einer Krümelstruktur und Aufbau von Nährstoffen wie Stickstoff durch Symbiose mit stickstoffbindenden Bakterien.
Eine weitere Möglichkeit ergibt sich durch organische Dünger z.B. Reste von Kulturpflanzen und Abfälle von Nutztieren, wobei hier ein oft hoher Kohlenstoffanteil die Qualität des Düngevorgangs im Vergleich zu Mineraldüngern mindert. Hat man Nutztiere sind aber Substanzen wie Mist oder Gülle leicht zugänglich und billig.
Die Variante des Abflämmens der Getreidestängel führt teilweise zum Verdampfen des Stickstoffs, setzt aber Phosphor und Kalium in der Asche frei. Diese zweischneidige Wirkung prägt auch die Praxis der Brandrodung.
1.4. Geografische Grundlagen: Afrikanische Tropen (Boden, Klima, Vegetation)
1.4.1. Bodenarten der afrikanischen Tropen
Im gemäßigtem Klima Europas brauchen Böden etwa 10 000 Jahre, um aus Gestein zu ausgereiftem Untergrund zu werden, oft bilden sie dann weite, gleichartige Flächen. Ein Großteil von Afrikas Böden sind äußerst wechselhaft in ihrer Ausbreitung, denn seit Präkambrium verwittert dort das Urgestein ohne größe eruptive Bewegungen wie Vulkanausbrüche, durch Erosionstätigkeiten im Tertiär und Pleistozän an die Oberfläche gebracht und seitdem der direkten Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt.
Nach dieser langen Zeit sind viele Böden stark ausgelaugt und existieren als sekundäre Gesteinsformation, sogenannte Latosole. Diese sind rote und gelbe Böden mit guter Wasserführung, aber extremer Nährstoffarmut. Die Kaolinit-Anteile im Ton, feste Siliciumoxid-Aluminiumoxid-Verbindungen, und unformbare Eisen- und Aluminiumoxide verursachen geringe Kationenaustauschkapazität und geringes Wasserhaltevermögen.
Lateritische Horizonte, auch Eisenstein genannt, bilden Blöcke mit bis zu Höhe, meist abgeschlossen durch ein Plateau. Sie sind sehr hart, erzeugen oft Wassermangel in darüberliegenden Böden, erlauben wenig Durchwurzelung und sind ein Hauptgrund für Überschwemmungen.
Vertisole bilden den Gegensatz dazu. Es sind dunkle, rissige Tonböden an Flussniederungen, auch Schwarzerde genannt. Sie werden ständig überschwemmt und behalten dadurch chemische Aktivität. Sie sind nährstoffreich, fruchtbar, haben enge Grundwasserbindung und kommen vor allem in wechselfeuchten Klimaten vor. Der hohe Tongehalt bringt hohes Wasserhaltevermögen, daher geringe Durchlässigkeit und Wasserleitfähigkeit, was wiederum zu geringer Auslaugung führt. Als Mineralien sind vor allem Calcium und Magnesium sowie Natrium vorhanden.
Vertisole werden bei Trockenheit sehr hart und weichen ebenso schnell bei Feuchtigkeit wieder auf, durch diese starken Reliefbewegungen bildet sich bei wechselnder Witterung auch unmittelbar eine krümelige Oberschicht, die in ihrer Ungleichmäßigkeit aber auch die Wasserbewegung behindert. In einer möglichen Ansammlung von Wasser liegt auch eine der Hauptproblematiken dieser Böden, die Erosionsgefahr.
1.4.2 Spezielle Problematik der Böden in Wechselwirkung mit Klima und Vegetation
In den immerfeuchten Tropen intensivieren hohe Niederschlagsmengen die seit 2 Millionen Jahren gleichen Auswaschungsprozesse, die einhergehen mit extrem effektiven Abbauprozessen, verursacht durch hohe Temperaturen und andauernder Feuchtigkeit. Humus ist nicht vorhanden, vielmehr bestimmt die rapide Zersetzung des organischen Materials die im Vergleich zum Wald der europäischen gemäßigten Zone etwa fünffache Biomasse. Da diese unmittelbare Zersetzung einzige Grundlage der Fruchtbarkeit ist, verlieren die Böden bei Bewirtschaftung schon nach zwei bis drei Jahre jede Nutzbarkeit. Ausnahmen sind nur die Böden in den jungen, vulkanischen Gebirgen.
Diese Divergenz zwischen Klima- und Bodengunst, die in den nährstoffreichen Trockengebieten ein Pendant findet, macht die Übergangsgebiete sehr wichtig. Gleiches gilt auch für kleinräumige Variationen wie ein lokales nährstoffreiches Ausgangsgestein, eine günstige Höhenlage, ein geeignetes Relief oder ein ausgeglichener Wasserhaushalt.
Oft kommt jedoch die Problematik der Erosion hinzu. In hügelreichen Gebieten ist es vor allem die Wassererosion, die fruchtbare Oberschichten hangabwärts führt, was durch heftige Gussregen unterstützt wird. Hier ist die bodenschützende Vegetation besonders wichtig, als Faktoren wirken auch noch Hangrichtung und Bodendurchlässigkeit.
Hat die Abtragung begonnen, verschlimmert sich die Situation schnell, das immer mehr wasserspeichernde Partikel fehlen. Den Regenwäldern als Aufnahmeort für mehr als die Hälfte der weltweiten Niederschläge, kommt dabei besondere Bedeutung zu, zumal die durch Transpiration gebildeten Kumuluswolken bis in weite Teile des trockeneren Umlands notwendige Feuchtigkeit bringen. Vor dem Hintergrund der seltenen, aber durch Wassererosion gefährdeten Böden an den Flussniederungen, bekommen Rodungen des Regenwaldes eine weitere, unabsehbar gefährliche Dimension.
1.4.3 Extensive Landwirtschaft (Wanderfeldbau)
Ist man abhängig von dem Nährstoffreservoir, das der Boden bietet, und ist dieses Reservoir sehr schnell ausgeschöpft, ist eine Lösung für dieses Missverhältnis der Wanderfeldbau, der meist mit Brandrodung gekoppelt ist.
Bei der Brandrodung werden die im Holz angereicherten Nährstoffe sofort freigesetzt, es verbleibt ein sehr fruchtbarer Ascheboden, deren unmittelbar wachsende Nutzpflanzendecke vor Auslaugung und Erosion schützt. Dieser durch das Feuer beschleunigte Nährstoffumsatz bringt aber gleichzeitig einen großen Verlust an Stickstoff und Phosphor mit sich, teils beim Verbrennungsvorgang, teils durch Verwehungen und Auswaschungen der Asche.
Der Anbau bringt einen Verlust von etwa 40 Prozent der Bodennährstoffe pro Jahr. Dem nach zwei oder drei Jahren einsetzenden Ertragsrückgang folgt eine Brachezeit, die einen Sekundärwald hervorbringt. Folgt auch diesem ein Anbau, ist der Boden nach einem weiteren Zyklus für lange Zeit nicht mehr nutzbar. Nach Anbau auf allen umliegenden Böden bleibt dann nur noch die Wanderung in ein neues Gebiet.
2. Spezieller Teil
2.1. Geografisches Umfeld der Yambio Experimental Farm
Yambio Experimental Farm, in de Schlippes Untersuchung hauptsächliches Forschungsfeld, liegt im südlichen Sudan, wenige Kilometer von der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo entfernt. Klimatisch liegt sie im wechselfeuchten Klima mit beginnendem Regenzeit- / Trockenzeitwechsel, das Tageszeitenklima ist weniger ausgeprägt.
Der Boden besteht zum großen Teil aus Latosolen, die in verschiedenen Ausprägungen vorkommen. In Jahrtausenden der Erosion haben sich im harten Urgestein Adern gebildet, der feste Rahmen für die Flüsse. Das Wasser läuft in bestimmten Bahnen, oft mit kleineren Wasserfällen. Höhere Levels bestehen aus Lateritkrusten, von denen das leichtere Material hangabwärts abgetragen und an den Flusstälern angesammelt wurde. Ebenfalls durch Erosion losgelöste Ecken der Lateritkrusten bedecken Teile des lockeren Materials, wodurch treppenartige Hänge entstehen.
Eine solche Catena besteht aus fünf Stufen: An oberster Stelle ein Plateau aus Laterit, entweder mit Lehm-Kies-Schicht oder freigelegt, dann eine Auswölbung des Laterits, an der die Erosion vor dem Abbrechen ansetzt, darauf roter Lehmboden, bedeckt mit Lehm und Kies, danach ein steiler Talabhang aus gelbem Lehm und schließlich der Talboden, dessen Ton gelbe bis graue Farbe hat.
Der Rest des Landes ist tropische Savanne und Waldland.
2.2. Geschichte und politisches System der Azande (Kapitel 1)
Abgesehen von der Landwirtschaft, so stellten frühe Entdecker seit dem sechzehnten Jahrhundert fest, verfügten die Azande über ein äußerst stabiles, gut organisiertes System. Jedoch verwies sowohl die Lokalorganisation der Landwirtschaft als auch die klare Differenz zwischen herrschender Dynastie und Bevölkerung auf eine geschichtliche Besonderheit. Die orale Geschichtsüberlieferung beschäftigt sich dabei fast ausschließlich mit der Herrscherschicht, jedoch mit Betonung lokaler Vorkommnisse, bei gleichzeitiger Vermischung mit der lokalen Geschichte. Die Untertanen scheinen nicht gewechselt zu haben, wohl aber die Herrscher.
Die frühe Geschichte der Azande handelt von einer dünnen Bevölkerung sudanesischer Herkunft, die in Symbiose mit den Pygmäen lebt. Durchziehende nilotische Stämme aus dem Osten lassen eine Mischbevölkerung aus Bantu-Negros, Niloten und Pygmäen zurück, heute [1950] noch als hybride Gruppe der Logo-Moru-Madi. Im Zuge der großen Bewegung dringen vom Westen her Bantu ein und kommen bei Bahr al-Ghazal in Kontakt mit den Niloten, die teilweise unterworfen und assimiliert werden. Im siebzehnten Jahrhundert sind es sudanesische Eroberer aus Nordwesten, die lokale Sudaner und Bantu unterwerfen, aber kein stabile Herrschaft etablieren. Gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts schließlich erscheint am unteren Mbomu ein neuer Stamm, deren Legenden von göttlicher Herkunft auf arabische Herrscher vom Tschad- oder Taiwesh-See verweisen, dessen Söldnergruppen nun im Süden nach Herrschaftsgebieten suchten. Der Name ihres herrschenden Clans war Avongara.
Die Avongara etabölierten ein erfolgreiches Herrschaftsprinzip. Nach Eroberung der Ambomu bildete der Chief der Avongara Ngura eine permanente Kriegerklasse, palanga, die sich aus regelmäßig rekrutierten, jungen Männern aller eroberter Gebiete zusammensetzte. Ihre frühzeitige Erziehung im Sinne der Dynastie war einer ihrer Stützpfeiler. Bis zu den ökonomischen und politischen Wandlungen unter den Europäern operierte die Avongara -Dynastie ungemindert.
Erst im18. Jahrhundert tauchte der Name Zande für alle unterworfenen, ethnografisch und linguistisch differente Stämme auf, die Eroberung hatte zu diesem Zeitpunkt seine heutige Ausdehnung erreicht und die für alle eingeführte Sprache Pazande wurde Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung.
Jedoch gab es seit Ngura keine Einzelherrschaft mehr, vielmehr prägten harte Spannungen das Verhältnis zwischen den Avongara -Chiefs, die ihre Gebiete an Söhne und Brüder delegierten, was einer weiteren Kampfebene führte. Die Abandiya, Nachbarn, die die Sprache, das Gesetz und die Organisation der Avongara übernommen hatten, wurden zur Begrenzung der Expansion im Westen (noch heute werden Azande - Abandiya und Azande - Avongara unterschieden). Im Norden waren es ägyptische und türkische Truppen, die Mitte des 19. Jahrhunderts sich in zentralen Siedlungen niederließen und ihre Gesetze verbreiteten, aber durch schwache Kontrolle an der Peripherie dem Machtmissbrauch und Sklaverei der vorherigen Herrscher freien Lauf ließen. Im Süden reichte das Azande- Gebiet bis zum Uele und zum Bomokandi, auch hier waren Sklavenhändler am Werk, diesmal von der Ostküste. Seit Lord Stanleys Expedition zur Entdeckung des Kongo waren auch Feuerwaffen in der Hand der Avongara und die Sklaverei nahm immer größere Ausmaße. Der Höhepunkt war nach der Mahdi-Revolte im Sudan, die 1883 zur temporären Unabhängigkeit führte, jetzt fanden letzte Eroberungen im Norden und Osten statt.
1891 begrenzten Truppen des Freistaats Kongo die Macht der Avongara im Süden endgültig auf den Uele. Die Anti-Sklaverei-Kampagne der Belgier teilte die Avongara in Mahdi- und Belgien-Unterstützer. 1898 wurde Ägypten von den Briten zurückerobert, französische Truppen stoßen im Westen bis Fashada am Nil vor und 1905 wird der letzte unabhängige Avongara -Chief in der Schlacht bei Yambio besiegt und getötet.
Dieser Abriss der Geschichte macht das ursprüngliche politische System der Azande-Avongara plausibel. Alle Clans der unterworfenen Bantu und Niloten waren ausgelöscht worden, Vermischungen mit den Azande führten zu genug Mitgliedern im Avongara -Clan, dass nahezu alle Sub-Chiefs und darunter alle Ältesten aus dem Clan gestellt werden konnten.
Das politische System drückte sich in der Anordnung der Siedlungen und Wege aus: Von den Dörfern der Chiefs führten Wege zu den Sub-Chiefs, von deren Dörfern wiederum zu den Ältesten, deren untergebene Familienhaushalte wiederum an einem Weg entlang eines Flusses angeordnet waren. Es gab keinen Weg zwischen Familien unterschiedlicher Ältester, zwischen Ältesten oder zwischen Sub-Chiefs. Selbst an der notwendigen Gabelung zwischen den Wegen vom Chief zu zwei Sub-Chiefs sorgte ein Wächter dafür, dass jegliche politische Intrige von vornherein ausgeschlossen war.
Jeder Chief besaß ein eindeutig abgestecktes Territorium, auf dem er seinen Untertanen Beseidlungsrecht, aber keine Besitzrechte verlieh, unter der Voraussetzung einer Tributzahlung in Naturalien oder Arbeit und dem Entsenden junger Männer für die palanga. Die Etablierung eines Besiedlungsraums nach einmaliger Erlaubnis durch den Chief erfolgte völlig unabhängig, Abgrenzungen ergaben sich dann aus Gewohnheitsrecht. Jedoch konnte die tatsächliche Machtausübung des Chief nach Gebieten, aber auch zu verschiedenen historischen Momenten unterschiedlich sein.
2.3 Spezielle Situation des Zande Scheme (Kapitel 2)
Das Gebiet der Azande liegt heute in drei verschiedenen Herrschaftsgebieten, dem Sudan, dem Kongo und der Zentralafrikanische Republik. Die Macht der Chiefs wurde durch die Europäer eingeschränkt. Missionare haben Netzwerke von Schulen und Konfirmandenschulen aufgebaut und unternahmen linguistische Studien. Ungemindert herrschen traditionelle Glaubensvorstellungen, z.B. ein äußerst ausgeprägter Glaube an Hexerei und Zauberei, in Koexistenz mit dem Monotheismus vor.
Erste ökonomische Veränderungen ergaben sich in Belgisch-Kongo, wo in den frühen Zwanzigern Baumwolle eingeführt wurde, um cash-crop zu etablieren. 1934 wurde die Politik der paysannat indigène angesetzt, um die Entstehung eines Bauernproletariats zu verhindern. Dazu gehörte auch die Abkehr vom Wanderfeldbau. Erst zehn Jahre später wurde die Wichtigkeit dieses sozialen Ziels richtig wahrgenommen. Ein Netzwerk aus landwirtschaftlichen Forschungszentren des Institut National d’Études Agronomiques au Congo wurde aufgebaut, frühzeitig waren Warnungen vor weitgehender Bodenerosion wegen nur teilweiser Umstellung der Nutzungssysteme zu hören. So wurden nach dem Krieg experimentelle Anlagen für indigene Farmen angelegt, finanziert durch große Baumwollanbaugebiete. Es wurde experimentiert mit Aufteilung des Landbesitzes in gleichartige Blöcke, kreuzweise nach Besitz, längsweise nach Rodungskorridoren für Fruchtwechsel getrennt. Ein Beamter wurde beauftragt in Übereinstimmung mit der Clan-Organisation umzusiedeln und es wurden Sozialzentren mit Schulen, Kapellen, Apotheken, Lagerhäusern und Gasthäusern aufgebaut. 1947 begann ein Zehn-Jahres-Plan.
Im anglo-ägyptischen Sudan erschienen in den Zwanzigern für den Süd-Sudan ökonomischer Wandel völlig utopisch, erst recht in der Wirtschaftsdepression der Dreißiger, nur Verwaltung, Ausbildung und medizinischer Versorgung wurden etabliert. Dadurch kam allerdings die Frage des sozialen Wandels schon frühzeitig auf, doch der sporadische Baumwollanbau, der nebenher lief, war wenig erfolgreich, er wurde später Teil des Zande-Scheme. Anfang der Zwanziger wurden alle Azande in Straßennähe umgesiedelt, um eine Epidemie der Schlafkrankheit einzudämmen. Dabei spielten soziale oder landwirtschaftliche Beöange kein Rolle. Als Ende der Dreißiger die Situation unter Kontrolle war, waren die Böden völlig überlastet, den Azande wurde erlaubt, zur traditionellen Lebensweise zurückzukehren. Seit 1943 setzte sich die Einsicht durch, dass eine Verbesserung des Soziallebens auf Dauer nur mit ökonomischer Entwicklung zu finanzieren sei. Der Director of Agriculture des Sudan wählte für eine experimentelle Umsetzung den Zande-District aus (die Argumente waren der relativ reiche Regenfall, die reichste Vegetation des Sudan und die angeblich disziplinierteste Bevölkerung).
Das somit installierte Zande Scheme hatte zum Ziel, die Azande in die völlige Selbstversorgung zu führen mit dem Verkauf eigener Produkte und sozialer und ökonomischer Stabilität. Das ‚Equatoria Projects Board’, 1946 durch die sudanesische Regierung gegründet, versuchte eine Baumwollindustrie mit Anbau, Spinnen und Weben sowie Hilfszweigen zu etablieren, zur Organisation wurde eine ‚Production Division’ gebildet. 1946-49 lag das Hauptindustriezentrum in Nzara, 15 Meilen nordwestlich von Yambio.
Eine ‚Trading Division’ sollte ein Netzwerk an Läden zum Schutz gegen kommerzielle Ausbeutung von außen aufbauen und zu einem vernünftigem Umgang mit dem Einkommen aus dem cash crop erziehen. Jedoch gab es kein klares Konzept für den sozialen Wandel, bei der Aufgabe der Vorstellung von Selbstversorgung wurde unter anderem auf das Ziel der sozialen Stabilität zurückgeschraubt.
Als erste Maßnahme wurde eine leicht zerstreute Ansiedlung angeordnet, um zu konzentrierte Siedlungen zu vermeiden, aber trotzdem zur Sesshaftigkeit zu gelangen. Von 1946-50 wurden durch den bei den Azande beliebten Major Wyld Familien von 60 000 Bauern umgesiedelt.
ImYambio District wurden Modellfarmen eingerichtet als lange Bänder individueller Besitzungen und Fruchtwechsel in Streifen. Jeder Bauer hatte ein Besitzung, 800-1000 Meter lang, 150 Meter breit mit der Vorderseite zu einem gemeinsamen Pfad, der 50-60 Besitzungen als Siedlung unter einem Ältesten vereinte. Da vorher unzureichend geforscht wurde, gingen Besitzungen quer durch Flusstäler, Steinvorsprünge und landwirtschaftlich unnutzbares Land.
Es war jedem freigestellt, wie er seine Heimstatt auf der Besitzung platzierte, auch die Fruchtfolge war individuell, wenn auch die Vorzüge des Anbaus in Fruchtwechselstreifen aufgezeigt wurden, die aber kaum beachtet wurden.
1947 begann der Baumwollanbau, man gründete eine Agricultural Training School und bildete die Yambio Experimental Farm. Durch einige Mitarbeiter wurde die Einstellung eines Sozialexperten angeregt, was jedoch erst 1952 erfolgte, während schon 1948 eine Ernährungsstudie durchgeführt wurde. In Fortsetzung jener Studie entstand de Schlippes Studie 1948-50, die zwar erst 1956 in Druck gehen konnte, aber schon 1951 in die Umsetzung einer auf Grund der Studie vorgeschlagenen Heckenstreifen-Farm mündete.
Nach zehn Jahren waren vor allem in der Ausstattung große Veränderungen erkennbar, mit Gewerbe-, Trainings- und Forschungszentren, Straßen, Apotheken, Schulen und Busch-Shops, sowie ausgebildeten Produktionskräften im Gewerbezentrum Nzara. Doch letzteres sollte nur einen kleinen Teil des Experiments einnehmen, wogegen statt der geplanten 2 Prozent der Arbeitskräfte heute schon 5 Prozent dort arbeiteten. Das Einkommen aus der cash crop ist weiterhin klein, man ist abhängig von nationalen und internationalen Baumwollpreisen.
Die Wiederbesinnung auf das Ziel der Selbstversorgung liegt in Hinblick auf anhaltender politischer Unsicherheit wieder im weiten Raum der Planung, ebenso die Frage des sozialen Wandels, die durch die 1945-51 stark wechselnde Mitarbeiterschaft immer wieder dem Blick auf die Produktionssteigerung weichen musste.
2.4 Spezifische Umwelt der Yambio Experimental Farm (Kapitel 4)
In einem System der shifting cultivation passiert der Blick auf Buschland immer in Hinblick auf verschiedene Stufen einer grünen, natürlichen Brache. Die Bewertung des potentiellen Bebauungslandes erfolgt dabei nicht durch Zählen der Jahre, sondern von der Vegetation wird auf Fruchtbarkeit für dieses und jenes Anbauprodukt geschlossen.
Dabei gibt es zwei Arten der Fruchtbarkeit. Die erste, die tatsächliche Fruchtbarkeit, wird durch die oben beschriebene Verteilung der Böden bestimmt. Die zweite Art, die Stufe der Fruchtbarkeit durch die Vegetation.
Für diese müssen ökologisch-wissenschaftliche und indigene Begriffe unterschieden werden. Zweitere dienen der deutlichen Kommunikation innerhalb einer Gruppe und der sprachlichen Ausformung relevanter Umweltgrößen.
So ist die unterste Stufe der Catena oft mit Galeriewald bedeckt, der bire-di, Wald des Flusses, genannt wird, an sumpfigen Ufern steht stattdessen das Grasland ndawiri mit Segge und anderen Grasarten. An der Grenze zur zweiten Stufen steht kein Galeriewalr, sondern Elefantengras (baka, Pennisetum purpureum), hier gibt es schwarzen Boden (pavuru-di), der früher einziges Anbaugebiet war. Pavuru-di wird auch das ganze Tal bis zur dritten Catena-Stufe genannt, erst wenn der Boden völlig degeneriert ist, wird der Begriff aufgehoben. Pavuru-di ist ein dunkelbrauner oder gelber bis roter Lehmboden, kolluvial, also tiefgründig, feinstrukturiert, humus- und nährstoffreich.
Alles oberhalb von pavuru-di ist ri-ngbi, Dach des Landes, eigentlich das Plateau der obersten Stufe, aber auch eine degenerierte zweite oder dritte Stufe wird so bezeichnet.
ri-ngbi (Dach des Landes) Plateaus, alles Land über pavuru-di, topografisch oberste Stufe, aber ökologisch auch degenerierte zweite und dritte Stufe. Hier gibt es jährlich Buschfeuer, das nur ein Gras-Baumland oder Savanne zurücklässt. Das Land heißt dann ngaragba bis junges Gras nachgewachsen ist. Der Wald des Plateaus heißt bire-ngua, Wald der Bäume, und enthält die feuerresistenten Arten.
Wird ein Stück Land das erste Mal kultiviert, heißt es ngasu, jungfräuliches Land, die zweite Kultivierung ist fute. Beide Begriffe gelten für verschiedene Bodenformationen. Geht ein fute -Boden ins dritte Jahr, ist er kurufute (alter fute) und wird Grasbrache, die Sorte des wachsenden Grases zeigt dann seine Eigenschaften an.
Insgesamt gibt es über 700 Pazande -Bezeichnungen für Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen, Gräser, Kräuter usw. Für die Yambio Experimental Farm war vor allem die Unterschiedung der Artenvariant und der Bodenbeschaffenheit in der Catena wichtig, da sich teilweise enorme Unterschiede ergaben.
2.5. Landwirtschaftliche Größen (Kapitel 5, 6, 8)
2.5.1. Anbaupflanzen
2.5.1.1. Zerealien
Die weitaus wichtigste Rolle für die Landwirtschaft der Azande spielt Eleusine coracana Gaertn., auch Fingerhirse, endonym moru. Sie wächst in bis zu 120 cm Höhe, trägt aber schon bei 25 cm Früchte, nämlich 4-16 Ähren von 4-8 cm Längemit kleinen Körnern. Sie ist stark von Bodenkonditionen, Wetter, Kultivierung und Abwesenheit von Krankheitserregern abhängig, auch die Wachstumsphasen variieren je nach Boden, Saison, Kultivierung, Unkräutern und Fruchtfolge.
Auf armen Böden reagiert sie meist wenig auf Dünger, sie bevorzugt gute Plateauböden oder die tieferen Stufen der Catena. Bei größerer Trockenheit gedeiht sie schneller, was vor allem bei spätem Einsetzen der Regenzeit sehr wichtig wird. Dann wird erst mit der feuchten Luft ausgesät, um in der Trockenzeit möglichst lange ernten zu können. Ihr Einsetzen beendet auch die Aussaat, die somit Anfang Juni bis Ende September stattfindet. Die Reife beginnt im Dezember nach Ende der Regenzeit, doch ohne Schaden kann bis Ende März geerntet werden.
Eleusine wird breitwürfig gesät, die Wuchsdichte ist also völlig vom erfolgreichen Keimen abhängig, wobei Zahl und Größe der Ähren sich meist mit der Anzahl der Stängel ausgleichen. Die geernteten Teile bringen wenig Proteine, aber viele Kalorien und außerdem die zwanzigfache Menge an Calcium im Gegensatz zu bestem Sorghum. Sie werden als Mahl genutzt, oft zusammen mit Cassava-Mehl und zu Brei oder einem Bier mit bitterem Geschmack verarbeitet.
Es gibt verschiedene natürliche Feinde, aber meist wenig Ausfälle, auch Pflege ist nicht notwendig. Im Speicher ist nicht auf Schädlinge zu achten, weshalb jahrelange Haltbarkeit abgesichert ist. Außerdem existieren viele resistente Varianten.
Die zweite Wichtigkeitsstufe unter den Zerealien nimmt Mais oder ngabaya ein, der bis zu drei Meter hoch werden kann, im Azande -Gebiet aber im Wachstum meist gehemmt ist und somit 1 - 1,50 Meter erreicht. Ohne große Versorgung kann er einen Ertrag von 2 000 kg je ha erreichen, Realität sind 300-800 kg. Mais bevorzugt reichen, feuchten und humushaltigen Boden, Zweitböden aber lieber als Erstböden.
Bei den Azande wird Mais in Kombination mit anderen Pflanzen weiträumig gesät und hat eine Wachstumsperiode von 100-107 Tagen. Er reagiert wenig auf atmosphärische Faktoren, geht aber bei anhaltender Trockenheit ein, statt langsamer zu reifen. Zeitlich wird die Aussaat durch die Feuchtigkeit begrenzt, die für den Keimvorgang nötig ist, sind Wasservorräte vorhanden kann sie schon im Februar beginnen, normalerweise aber Mitte März. Der Reifeprozess findet seinen Abschluss Ende September beim Einsetzen der Trockenheit.
Mais beinhaltet viele durchschnittliche Nährwerte, kann aber wegen einer leichten Giftigkeitkein Hauptnahrungsmittel werden. Er wird als Brei oder teilweise als gerösteter Kolben gegessen, seltener ist Bierherstellung.
Nur auf schlechten Böden ist das Risiko des Ernteverlustes durch Termitenbefall und andere Schädlinge hoch, doch regelmäßig wird Mais Opfer von Affen, weshalb in der Reifezeit Bewachung notwendig ist. Um dies zu erleichtern, wird oft in der Nähe der Heimstätte ausgesät. Eichhörnchen graben die junge Saat aus, Perlhühner und andere Vögel vergreifen sich am reifen Kolben und im Lager ist die Gefährdung durch Schädlinge groß. Für letzteres werden darum offene Gerüste genutzt oder die Blätter an den Kolben belassen, damit sie sich selbst schützen.
Vor allem in den heißeren und trockeneren Ländern ist Sorghum Hauptzerealie, in Yambio ist er eher untergeordnet. Der Trockenheitswiderstand und die Anpassungsfähigkeit ist sehr hoch, wie bei Eleusine ist das Raumbedürfnis aber sehr ausgeprägt. Saatzeiten, Bodenkondition, Unkrautverhältnisse und der Wettbewerb mit Schlingpflanzen bestimmen das Wachstum. 170-290 cm Höhe ist möglich, die Stängel sind lose mit Ähren rötlicher Körner bewachsen. Am besten wächst Sorghum in Verbänden auf Erstböden.
Der Anteil an Proteinen ist sehr hoch, die Kalorien nur durchschnittlich, aber Sorghum ist reich an Vitamin B1. Mehl, Brei und seltener Bier sind die Berarbeitungsprodukte. Einige bei Tiefersetzung nachwachsende Sorten bescheren eine zweite Ernte, nach der Aussaat im Juli bis September wird daher Januar und Juli bis August geerntet. Bei besonderen Bodenverhältnissen kann die Ernte bis November aufgeschoben werden, die bitteren Früchte der Zweiternte überleben im Gegensatz zu den ersten Reifeprodukten die Angriffe durch Tauben. Einige Gefahr besteht durch Getreidebrand, die Lagerung ist schwierig.
2.5.1.2. Hülsenfrüchte
Typische Hülsenfrucht im Gebiet ist die Kuhbohne, auch Vigna unguiculata Walp. oder Vigna sinensis Endl. Sie hat einen aufgerichteten oder kletternden Stängel, ist dreiblättrig mit zwei Farben und trägt weiße Blüten. Die Hülsen sind 12-15 cm lang und dünn, hängen in Trauben und beinhalten ovale, crémefarbene Bohnen mit weißem Punkt. Sie ist eine der ältesten Kulturpflanzen Zentralafrikas.
Die Grüne Kichererbse (Phaseolus mungo L.) wächst in aufgerichteten Büschen, wird 30-50 cm groß und hat lange, zylindrische Hülsen mit kleinen grünen Bohnen. Ihre Blätter haben Haare. Die Azande bauen sie in kleinen Flächen von 20-100 m² von April bis September an und ernten Juni bos Mitte Dezember. Oft verkürzen sich die Phasen auf Mitte Juni bis Mitte August bzw. Oktober bis November, wobei die Kichererbse schon vor der Reife als Blattgemüse verzehrt wird.
Kuhbohne und Kichererbse haben normale Proteinwerte, während Erstere reich an Vitamin B1 ist, versorgt Zweitere mit Eisen und Calcium. Beide müssen kaum geschützt werden.
Die Lima-Bohne stammt aus Südamerika und ist weniger bedeutend. Doch sie ist noch weniger anfällig, wächst nach der Aussaat Juni und Juli in Ascheböden an der halb zerstörten Bäumen hoch und kann November und Dezember geerntet werden.
Die Bambara-Erdnuss ist mit der Erdnuss verwandt, ist pro Hülse aber nur einfach bestückt und bildet sehr große Pflanzen aus. Wie die Erdnuss wird sie Mai und Juni in kleinen Flecken gesät, Ernte ist bis Ende November möglich. Sie bekommt keine Krankheiten und ist einfach zu lagern, ihr Kalorienwert ist sehr hoch.
2.5.1.3. Ölsaat
Arachis hypogea L., die Erdnuss, hat gefiederte Blätter und eine Pfahlwurzel mit Bakterienbewuchs. Ihre gelbe Blüten neigen sich nach der Befruchtung zum Boden und Bohren sich ein, aus ihnen entwickeln sich hölzerne Hülsen mit ein bis vier Samen.
Sie ist nach der Eleusine wichtigste Anbaufrucht, an den Nährwerten gemessen die wichtigste durch hohen Anteil an Proteinen, Öl und Nikotinsäure (letztere ist auch als Vitamin-B2-Komplex bekannt). In der fleichlosen Ernährung, die lange Zeiten des Azande -Jahres prägt, ist sie daher von einzigartiger Wichtigkeit.
Die Erdnuss gedeiht auf sehr unterschiedlichen Böden, weniger gut im Schatten oder in Konkurrenz mit Baumwurzeln und Termiten, auch bevorzugt sie Zweitböden. Probleme hat sie mit schweren Lehmböden. Ihr Wachstumszyklus beträgt 100 Tage, das heißt mit der Aussaat April bis Juni, manchmal auch März, wird geerntet von Juli bis September. Da die Erdnuss sehr anfällig für Virus-Krankheiten ist, wird prophylaktisch enge gesät (25-30 cm), trotzdem gibt es ab und zu große Ernteverluste.
Sesam ist die zweitwichtigste Ölfrucht, wächst auf leichtem, rotem Lehm im Grasland der Zweitböden. Er reagiert nicht auf organischen Dünger, nur auf Mineraldünger und kann anscheinend Mineralien gut aus verwittertem Gestein aufnehmen. Er braucht keinen Schatten und bringt stabile, aber geringe Erträge.
Semamum orientale L. wächst in geraden Stängeln mit vielen, gezahnten Blätter mit einer Höhe von 50-150 cm. Die Blüten sind rosa bis weiß, die Hülsen werden 2-3 cm lang und öffnen sich bei Reife, sodass die ovalen, weißen bis braunen Samen herausfallen.
Er wächst bis zum Einsetzen der Trockenheit, wird eng gesät, sind die Pflanzen kleiner und reifen schneller. Die Aussaat erfolgt Mitte Juni bis Mitte Juli, geerntet werden kann erst nach den schweren Regenfällen. Verschiedene Krankheitserreger sind eine Gefahr, die Azande betreiben aber keine Unkrautbekämpfung. Die Lagerung passiert in Körben, vorher werden die geernteten Teil lange auf dem Feld wegen des großen Unterschieds zwischen Frisch- und Trockengewicht liegengelassen.
Hyptis ist eine dritte Ölpflanze, pfefferminzähnlich, darum auch als Gewürzpflanze wichtig. Es ist sehr weit auf Erstböden verbreitet und wächst auf verschiedenen Böden, bringt aber wenig Ertrag. In Verbindung mit Eleusine erfolgt die Aussaat Juli bis September, geerntet wird Dezember, Januar oder später. Es enthält wenige Nährwerte, dient jedoch als gutes Trockenmittel oder wird für Teig zusammen mit Eleusine oder Sorghum verwendet.
Den Bereich der Ölsaat wird noch ergänzt durch öltragende Kürbisarten und die Ölpalme.
2.5.1.4. Stärkehaltige Wurzeln
Cassava oder Maniok (Manihot utilissima Pohl.) wird bei den Azande nicht oft konsumiert, sondern als Hecke zur Feldbegrenzung genutzt. In ihrem Gebiet hat Cassava nur einen geringen Nährwert, doch sie ist extrem bodenvariabel und beönigt minimalen Arbeitsaufwand. Außerdem ist sie fast unbegrenzt lange im Boden haltbar und dient daher als Reserve in Hungerzeiten.
Als Nebenfrucht findet man Cassava in fast jedem Zweit- oder Drittanbau, als Teil der Brache braucht sie keinerlei Unkrautbekämpfung. Zwar ist sie nach zehn Monaten erntbar, kann aber 40 Monate im Boden bleiben, geerntet wird meist in den Notzeiten Februar bis Mai. Pro Hektar und Jahr werden 6-40 Tonnen produziert, daher ist nahezu immer mehr da als verbraucht werden kann. Die Krankheitsresistenz ist eine weitere Absicherung.
Für die normale Ernährung ist die Süßkartoffel Ipomoea batatas Poir wichtiger. Sie hat trompetenartige Blüten und Schlingstängel mit herzförmigen Blättern, die Bodenfrüchte sind zucker- und stärkereich. Auf kleinen Flächen bringt sie als guter Nährstofflieferant hohen Ertrag, ist aber weniger im Boden haltbar als Cassava. Geerntet wird meist nach Bedürfnis, bei einer Aussaat im Juni und Juli ist das von Oktober bis März möglich.
Von den wildwachsenden Arten, die genutzt werden, nimmt Yams die oberste Position ein, wenn seine Wichtigkeit auch von Cassava und Batate verringert wurde. Dabei wird eine bestimmte Variante zwischen März und Juni in Hausnähe umgesetzt, ab Ende September erfolgt die Ernte bis weit in die Trockenzeit hinein, andere Varianten, die unter Bäumen wachsen, können während der harten Regen im Juli und August geerntet werden.
Eine weitere genutzte Stärkepflanze ist Taro.
2.5.1.5. Sonstiges
Die Ernährung der Azande wird durch folgende Früchte weiterhin bereichert: Als Fruchtgemüse und Früchte dienen Kürbis, Gurke, Flaschenkürbis, Okra, Roselle, Wassermelone, Banane und Mango. Blätter und Stängel werden entnommen von Kuhbohne, Cassava, Batate, Kürbis, Flaschenkürbis, Okra, Roselle, Hanf, Rotem Pfeffer und verschiedenen Bäumen, Kräutern und Wildkräutern. Mit teils anderer Verwendung gehören auch Jute, Solanum, Zuckerrohr und Süßes Sorghum dazu.
Außerhalb der Ernährung kommen Flaschenkürbisse, Dekkhan-Hanf (Kenaf), Baumwolle und Ficus Thonningi zur Anwendung. Tabak und Gemeiner Hanf, letzterer verboten, werden ebenfalls eingesetzt. Chili wird, wie auch Baumwolle, größtenteils als cash crop gebraucht.
2.5.2. Besitzverhältnisse und Feldtypen
Auf den ersten Blick liegen die Felder der Azande in völligem Chaos beieinander. Dem steht die tatsächlich sehr genaue Verteilung von Besitztümern und Aufgaben innerhalb eines Haushalts diametral entgegen.
Die Frau ist die ökonomische Hauptkraft, aber gesellschaftlich untergeordnet, außerdem gilt Blutsverwandtschaft mehr als Heiratsverwandtschaft, die oft polygam, genauer polygyn ist. Die Folge sind stark getrennte Aufgabenbereiche, in denen jedes Haushaltsobjekt einen spezifischen Besitzer hat. Dazu gehören zum Beispiel mitgebrachte Haushaltsgegenstände der Ehefrau.
Deren Besitzrecht ist jedoch insofern eingeschränkt, dass sie die Verantwortung für die Versorgung von Mann und Kindern trägt, aber in jedem Fall hat sie bei Trennung das Recht zur Mitnahme ihres Besitzes. Der Mann dagegen setzt seinen Besitz und sein Einkommen ohne Rechenschaftspflicht ein. Unbewegbare Besitztümer wie Häuser verbleiben immer beim Mann, da er den Hauptanteil am Aufbau hat. Doch sein Besitz dient meist als reiner Prestigewert, wie zur Versorgung von Gästen.
Jede erwachsene Frau hat auf einem Hof einen abgeschlossenen und kompletten Bereich für sich, was auch für abhängige Familienmitglieder wie die Mutter, die Schwiegermutter, die Schwester und die erwachsene Tochter gilt. Auf den meisten Feldern ist die Ehefrau Hauptarbeitskraft, doch der Ehemann entscheidet über den Einsatz der Erträge. Dabei kann der Mann seine Frau auch für Dienstleistungen auf seinem Feld bezahlen, was weniger für monogame als für polygame Haushalte gilt. Ein monogamer Haushalt kann die Verhältnisse sogar umkehren.
Die Frauen arbeiten nicht selbstverständlich zusammen, erst eine persönliche, positive Beziehung kann Ursache dafür sein. Junge Männer, die noch keine Familie gegründet haben, besitzen eigene Felder, die aber nur einen Momentanbedarf decken, sie sind weiterhin von den Müttern und Schwestern abhängig, die auch die Lagerung vornehmen.
Da mit dem administrativ vorgeschriebenen Anbau von Baumwolle oder Sesam Felder entstanden sind, auf denen Männer die Hauptarbeit leisten, finden hier nun zusätzliche Zahlungen an Frau und Kinder für Mithilfe statt, je nach Position der Ehefrauen auch unabhängige Abgaben.
Jede kleinste ökonomische Einheit, in diesem Fall eine Frau, verfügt über einen vollständigen Besitz, also Felder, Werkzeuge, Haushaltsgeräte und Gebäude.
Die verschiedenen Feldtypen werden nach der vorgefundenen Fruchtbarkeit angelegt. Sie unterscheiden sich durch die Kombination bestimmter Anbaupflanzen als Verband mit simultanen oder abfolgenden Saatzeiten, als Folge in gleicher Saison oder Beides.
Trotz der vorherrschenden Mosaikstruktur des Bodens und der Pflanzenvielfalt gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Feldtypen, die sich innerhalb einer Gruppe als Ergebnis von Versuch und Irrtum durchgesetzt haben. Die beiden bedeutendsten Feldtypen sind öti-moru (Feld der Eleusine), auch Eleusine-Hauptverband, der nach Rodung angelegt wird, und baawande (Platz der Erdnüsse), auch Eleusine-Erdnuss-Verband, der nach einem reinen Erdnussfeld entsteht. Da die Eleusine schon allein durch die allgemeine begriffliche Ausrichtung zentral für die Azande ist, soll nur öti -moru hier und im folgenden Kapitel zum agrarischen Jahreszyklus einbezogen werden.
Öti-moru wird sowohl auf ngasu als auch auf fute angelegt, die Arbeitsabfolge ist in beiden Fällen gleich, meist werden höhere Stufen der Catena genutzt.
Für ngasu sind die Auswahlkriterien Gras-Baumland, Strauchland oder Wald. Mai bis Juli wird gehackt und Bäume werden gefällt. Nach zwanzig Tagen beginnt das Brennen, übriggebliebene Gräser und Zweige werden abgesammelt und auf kleinen Haufen verbrannt, während weitere Bäume durch Feuer abgetötet werden (hoe-and-burn). In graslosem Baumland werden lediglich die Bäume abgeschlagen und dann verbrannt (slash-and-burn).
Kurz nach dem letzten Arbeitsgang wird Mais in weiten Löchern (1,50 - 2 m) ausgesät, auf füte manchmal mit Cassava-Stecklingen. Nach zwei bis sieben Wochen wird die Saat-Mischung des Eleusine-Verbands eingebracht, wobei Kenntnisse für die richtigen Abstände erforderlich sind. Währenddessen wird gehackt.
Die innere Logik dieses Timing ist wahrscheinlich, dass die zwanzig Tage zwischen Hacken und Brennen dem Trocknen des Grases dienen, während der Abstand zwischen Mais- und Eleusine-Aussaat weniger klar ist. Als Ideal wird oft die letztere Aussaat bei Graswachstum von 10-15 cm und Maishöhe von 20-25 cm beschrieben, aber in Wirklichkeit erfolgt manchmal aus verschiedenen Gründen bis zur Maisernte keine weitere Aussaat.
Ebenso besteht die Frage des Unkrauts: Nach der teilweisen Zerstörung im ersten Arbeitsgang blüht es nach dem Feuer wieder auf, was einen noch genaueren Hackvorgang erfordert. Die gleiche stimulierende Wirkung wird allerdings genutzt, wenn der erste Anbau nach dem zweiten Abbrennen beginnt. Da fute oft reinen Grasbewuchs hat, werden weniger Abstände eingehalten, hier beginnt die Arbeit nicht Mitte Juli, sondern schon Mitte Juni, aber auf beiden endet die Feldarbeit Ende September.
Die Eleusine geht zwei oder drei Tage nach dem Säen auf, zwei bis vier Tage später wird neu gereinigt und gegebenfalls nachgesät. An der Größe und Wiederstandsfähigkeit der Pflanzen werden weitere notwenige Arbeiten bestimmt.
Die Zusatzpflanzen zur Eleusine richten sich nach der ökologischen Lage und der Jahreszeit. Mais ist nur bis Ende August möglich, Cassava nur auf fute, wodurch letztere nach zwei- bis dreijährigere Wachstumsperiode ein gutes Nachprodukt in der Brachezeit ist. Sesam wächst nur auf ngasu, Hyptis und nachwachsendes Sorghum eher auf ngasu als auf fute. Somit werden Hyptis und Sesam mit früher Eleusine Mitte Juni bis Ende August ausgebracht, Sorghum mit später Eleusine Juli bis Mitte September. Teilweise kommen andere Anbaupflanzen wie Dekkhan-Hanf, Wassermelonen und Gurken hinzu.
Großangelegte Unkrautbekämpfung findet immer Mitte September bis Mitte November, also drei bzw. zwei Monate nach dem Aussäen und ein Monate bzw. zwei Monate vor der Ernte statt. Diese Maßnahme geschieht nur einmalig, dabei werden größere Gräser und Kletterpflanzen ausgerissen und Keime auf Baumstümpfen abgebrochen. Da passiert in reiner Handarbeit. Da der enge Wuchs der Eleusine nur teilweise Abtransport erlaubt, werden die meisten Reste auf den Baumstümpfen angesammelt, zumal dem aufgeschichteten Gras Wachstumsreiz auf die Eleusine zugesprochen wird.
Mais wird ab September geerntet, Eleusine ist reif ab Mitte Oktober. Ist sie frühreif, muss sie wegen der Gefährdung durch harte Regenfälle gleich abgeerntet werden, ansonsten ist Zeit bis Ende Januar, in Ausnahmefällen bis März. Sesam kommt November und Dezember vom Feld, Hyptis Januar und Sorghum Dezember und Januar.
Öti-moru kann grundsätzlich ohne Bewachung weit weg vom Haushalt gelassen werden, allein die Zerstörung von Mais und Sorghum ist dabei zu befürchten.
2.6. Agrarischer Jahreszyklus (Kapitel 11)
(Vorbemerkung: Da auch de Schlippe seine Ausführungen nicht völlig ohne narrativen Charakter gestaltet, habe ich ihn auch nicht völlig aus meiner ‚Nacherzählung’ verbannt. Zu den beschriebenen klimatischen Verhältnissen siehe S. 20)
Am 20. Januar 1950 erscheint der Neu-Mond mit dem Namen Wirimarungbu, das Kind der Hitze, oder Wegebe, die Hand hat aufgeräumt, denn eine heiße, trockene und staubige Periode setzt ein und alle Ernten werden abgeschlossen. Unter Einfluss der kontinentalen Luftmasse lässt die heiße Luft die Haut austrockenen und die Lippen aufspringen. Staub aus den nördlichen Wüsten wird angeweht, zahlreiche Buschfeuer brechen aus.
Ende Januar bilden sich einige Wolken, am 31. Januar kommt ein kurzer Regenschauer, der für einen Tag die Luft und den Boden reinigt. Dann ist alles wie vorher.
Auf den Felder wird weiterhin Eleusine geerntet, dazu ein wenig Baumwolle, Süßkartoffeln und Cassava gibt es für den täglichen Bedarf. Einige gelangweilte Jugendliche graben Ratten ein, während die Männer auf der Jagd und beim Fischen sind, Frauen brauen Bier. Es ist die Zeit für zahlreiche Besuche und die Nächte sind voll von Festen und Tanz.
Dann kommt die Nachricht auf, dass am 16. Februar großer Baumwollmarkt sei, sofort sind alle beim Baumwollernten, 60 Prozent der Bevölkerung nimmt am Markt teil, wer zu viel hat, muss zu weiter entfernteren gehen, denn am 22. Februar ist jedes Baumwollgeschäft vorbei. Die Hauptjagdsaison beginnt, die Männer ziehen sich zu Grashütten an den Flüssen zurück.
Am 21. Februar geht der Mond Namarungbu auf, die Mutter der Hitze, auch einfach Marungbu, die Hitze. Kinder fallen in allgemeine Müdigkeit und schlechte Laune, denn der Mangel an frischem Gemüse und Früchten macht sich bemerkbar. Zwar gibt es genug zu essen, aber der Vitamin-A-Mangel greift sie an. Sie verlieren viel Gewicht.
Die ersten Tage von Marungbu bringen 40 mm Regen. Der Regen beendet die Süßkartoffel-Ernte, die Baumwoll- und Eleusine-Saison ist endgültig vorbei, fast jegliche landwirtschaftliche Tätigkeit kommt zum Erliegen.
Aber einige unternehmerische Frauen sehen diese Regenfälle schon als Anzeichen für ein neu beginnendes Landwirtschaftsjahr, sie bauen einige wenige Hecken an und säen Mais und Kürbis.
Bis zum 2. März jedoch herrscht absolute Hitze vor, auch wenn die Luft unter Einfluss der atlantischen Äquatorial-Luftmasse ein wenig feuchter ist. Staub liegt weiterhin in der Luft, in der Nacht sind in fernen Kumulus-Wolken Gewitter zu sehen.
Auch diese Hitze wird überraschend früh beendet, am 3. März ein erster Regenschauer, dann folgen bis zum 26. März sieben regnerische Tage. Mai-tutu-he, mai-akedo, furu-mai werden diese Regen genannt, der reinigende Regen, der Regen der akedo -Termiten, die Regen mit dem Geruch der Erde. Noch beginnt das landwirtschaftliche Jahr nicht richtig, Männer sind weiterhin bei der Jagd, allgemein bereitet man sich mit Reperaturarbeiten auf die schweren Regenfälle vor, auch die Gebäude des Chiefs müssen repariert werden, seine zahlreiches Saatgut erlaubt erste Säarbeiten. Die Azande folgen seinen Anweisungen, ihre eigenen Böden sind ihnen noch zu trocken und zu hart. Wenn die Saat aufgeht, wird der Chief die erste Ernte haben.
Zu Hause werden Termiten gefangen, Honig gesammelt und Mangos geerntet, das Ende der ersten nährstoffarmen Zeit. Nun beginnt auch eine größere Aussaat von Mais und Kürbis, doch nur halbherzig, denn so sehr frühe Ernten notwendig sind, so groß ist auch die Zurückhaltung wegen des Risikos, das teilsweise knappe Saatgut zu verlieren. Die Regen kamen zu früh, als dass nicht noch weitere Trockenheit folgen könnte. Abends am Lagerfeuer finden unter den Alten lange Diskussionen über diese Fragen statt. Die Bodenbearbeitung beginnt, wenn ngbanda kitö na gara, die Milchstraße, Grenze zwischen Regen- und Trockensaison, und anzungu, die Pleiaden, auf den Körper gestochene Punktmuster, nach Einbruch der Dunkelheit am Zenith stehen.
Der Mond am 19. März heißt Zerekpe, kühle Blätter, sein Wetter ist seit 3. März schon da: Die ersten Regen kommen, Bäume und Sträucher halten ihre längst gewachsenen Blätter bereit. Ende März und Anfang April erscheinen die letzten Züge des heißen Wetters.
Jetzt beginnt große Heckenpflanzung, Mais wird gesäht, auf den Höfen süßes Sorghum und Tomaten. Die Wildtaube stoppt ihr Schreien, ist ihr Ruf wieder zu hören, ist die Zeit des Säens vorbei.
Verschiedene Regen nehmen der Luft weiter die drückende Hitze, sie beleben das landwirtschaftliche Leben, Saat und Werkzeuge müssen erhandelt werden, es gibt weiterhin wilden Honig und Mangos. Zur Saat kommen Bambara-Erdnüsse und Cassava hinzu, ebenso eigene Kürbisse. Männer bauen Hütten bei den Feldern, um sie zu bewachen.
Ein neuer Mond am 17. April, Merekoko, Stängel des süßen Sorghums, deutet das erste Getreide, das sich zeigen wird, das teilweise als Ersatz für die ab jetzt fehlende grüne Nahrung dient. Eine Zeit des Mangels deutet sich an. Die Angst setzt langsam ein. Scharfer Ostwind und eine Regentropen ist alles, was sich am Himmel zeigt. Wenn jetzt nicht bald die große Regenphase kommt, verschiebt sich die Ernte wichtiger Nahrung immer weiter nach hinten.
Verschiedene Regenmacher-Zeremonien werden durchgeführt. Die Ahnen-Gräber der Chiefs werden gereinigt, man pilgert zu einer Quelle, in deren großen Bäumen Ahnengeister wohnen. Ein Strick wird um einen Baum gebunden, an ihm Hühnerfedern und Saat aufgehängt, Menschen warten, beten, essen von der Saat, nehmen Wasser und werfen es an den Baum, um Regenfall zu imitieren. Orakel werden befragt, Regenmacher beginnen ihre Zauber. Es gelingt, Kumuluswolken bilden sich, doch Regen bleibt noch aus, niemand riskiert weiterhin zu säen, nur die Bodenbearbeitung geht voran.
Regen fällt Anfang Mai, auch an einigen weiteren Tagen. Die Anbaupflanzen sind sicher, Verdunstung wird bis November unter 3 mm bleiben, doch noch weiterhin herrscht Unsicherheit. Nur im Schärfen der Äxte und erstem Baumfällen deutet sich endlich der Beginn des großen Eleusine-Verbands an, auf anderen Feldern werden jetzt Yams, Okra, Roselle, Mais, Sesam, Bambara-Erdnuss, Tomate und Kletterkürbisse angebaut.
Ab 16. Mai, Beginn für den Mond Bawirikurungbu, Platz der kleinen Schüsseln, stellen sich alle auf die geringen Mahlzeiten ein. Alle Nahrung aus der Trockenzeit ist verbraucht, neue ist noch nicht gewachsen. Nur schwer hält man sich davon ab, die Saat zu verspeisen. Doch der heftige Regen, der Bawirikurungbu diesen Monat bestimmt, vertreibt jede Angst. Nun beginnt die Arbeit am Haupt-Eleusine-Verband.
In der ersten Hälfte des Juni wird fast nicht anderes gemacht. So wird der erste Sesam zwischen das Gras gestreut. Da das Opfer der ersten Früchte noch nicht dargebracht wurde, kann die Eleusine nicht ausgesät werden. Der Hunger macht die Arbeit schwer, eine unsichere Balance besteht zwischen dem Wunsch, späterem Hunger vorzubeugen, und dem Bedürfnis, sich auszuruhen.
Man steht vor Sonnenaufgang auf, vergisst, dass es kein Frühstück geben wird, Männer rauchen in den Pausen und bei der Arbeit, um sich aufzuwärmen und die Zeit weniger spürbar zu machen. Um elf kehrt man nach Hause zurück, ruht sich drei bis vier Stunden aus, dann geht man wieder an die Arbeit.
Gehackt wird am Morgen, Handrodung, Brennen und Baumfällen passiert am Nachmittag, außer der Regen unterbricht. Später, wenn die Arbeit am Eleusine-Feld sich dem Ende neigt, wird es mehr zu essen und mehr Regen geben, so dass von früh bis zum Nachmittag gearbeitet wird. Nicht jeder arbeitet freilich so kontinuierlich, jetzt wird am deutlichsten spürbar, was es heißt, nur eine oder mehrere Frauen zu haben. Wohlhabendere gleichen das Gefälle verschiedentlich durch Bier-Feiern aus.
Am 15. Juni erscheint der Mond Banzinga, der Platz mit Fackeln, gemeint sind die unabgebrannten Enden der Fackeln, mit denen man bis jetzt Termiten gefangen hatte. Ein weiterer Teil des Speiseplans fällt weg, mit Fleisch und Fisch weitere. Fast ausschließlich frühreife Maiskolben sind zur Nahrung vorhanden.
Das Wetter ist nun durchgängig kühl und feucht. Es wird weiter an den Eleusine-Feldern gearbeitet, nachdem das makawa, das Opfer der ersten Früchte, auf dem öti-moru im Bereich der ältesten Ehefrau durchgeführt wurde, wird auch gesät.
Da man nun abschätzen kann, wieviel Eleusine-Saat verwendet wird, kann der Rest in die Ernährung inbezogen werden. Es gibt immer mehr Mais, Süßkartoffeln und erster Sorghum sind reif. Auch die ersten halbreifen Bambara-Erdnüsse können abgeerntet werden.
Die Arbeit konzentriert sich weiterhin auf den Eleusine-Verband, das Hacken setzt wieder ein, nachdem Brand- und Handrodung abgeschlossen ist und Mais, Gurken, Wassermelonen und Cassava in die Erde gebracht sind. Auf den fute Böden kann schon die gesamte Bandbreite gesät werden.
Der 14. Juli bringt den Mond Bamburu, der abgeschorene Platz, also die gerodete Fläche. Kultivierung des Bodens tritt in die letzte Phase, mehr Nahrung bringt mehr Kraft, und die frische Erinnerung an den Hunger motiviert zur Arbeit. Die meiste landwirtschaftliche Arbeit des Jahres findet jetzt statt.
Das Wetter bleibt unverändert regenreich, dabei auch mit sehr wasserreichen, fast zerstörerisch heftigen Regengüssen. Man beschäftigt sich mit dem Sammeln und Verkauf von Chili, sammelt Pilze. Auf dem Eleusine-Feld ist das Hacken und Säen in vollem Gange, auf den anderen Feldern bringt man Sesam, Kürbisse, Erdnüsse, Yams und auch Eleusine aus.
Buza, Bewässerung, der Mond am 13. August, bringt weniger Regen als normalerweise, die Bewölkung nimmt immer mehr ab, Temperaturen und Verdunstung steigen. Landwirtschaftliche Arbeit geht wieder deutlich zurück, denn das Säen der Eleusine neigt sich schon wieder langsam dem Ende, während Bambara-Erdnüsse geerntet werden können. Die Wildtaube setzt wieder mit ihren Schreien ein, die Vögel apare wechseln ihr graues Gefieder gegen ein braunes, Raupen im Boden sind 15 mm groß geworden und beginnen die Verpuppung und der Baum dakpa erblüht, alles Zeichen für: Die Aussaat von Eleusine ist beendet.
Mit dem Mond Wenza am 12. September, benannt nach den wehenden, hochgewachsenen Gräsern, wandelt sich der Tagesablauf. Es ist wenig Regen, ein Grund mehr, dass landwirtschaftliche Aktivität zunehmend abnimmt. Es gibt keine Bambara-Erdnüsse mehr, dafür ersten Mais im Eleusine-Verband, dieser muss verschiedentlich von Unkraut befreit werden. Doch man baut eher an Lagerstätten, denn man bereitet sich auf die großen Ernten vor.
Das Beschäftigungsgefälle zwischen Mann und Frau ist jetzt besonders groß, denn während sie weiterhin früh aufsteht und häusliche Aufgaben erfüllt, kann der Mann sich langen Schlaf bis neun Uhr morgens leisten, ein reichliches Frühstück, sowie drei bis vier weitere Mahlzeiten verlangen.
Doch ab dem 11. Oktober, beim Mond Tamvuo, das geschlagene Gras, beginnt die Ernte der Eleusine. Zwar verbringen Männer ihre Zeit auch wieder mit Jagen und Fischen, was ihnen der zunehmend klare Himmel und nur ab und zu heftige Gewitter erlauben, da die Flüsse nun weniger starke Flut, aber noch hohen Wasserstand haben und das Zusammentreiben von Wild in Netze durch Buschfeuer möglich wird.
Doch der Aufwand an Unkrautbeseitigung und Ernte wächst enorm. Auf den fute- Böden ist die erste Eleusine reif, ebenso Sesam und Bohnen. Erdnüsse, Mais und Süßkartoffeln erweitern die Nahrung. Die öltragenden Kürbisse wurden leider durch Schlangen fast völlig zerstört, daher wird es im nächsten Jahr keine Saat geben. Doch weiteres Gemüse wie Okra, Roselle, andere Kürbisse geben reichen Ausgleich, wie auch sonstiges blättriges Gemüse.
Rauchen ist nun nicht mehr zum Vergessen des Hungers, sondern gemeinschaftliches Vergnügen.
Donner, die Übersetzung von Ngbangba, des Mondes vom 10. November, weist auf die kontinuierliche Abnahme des Regens. Nur sieben Gewitter bringen insgesamt 40 mm in einem Monat. Die Landwirtschaft erreicht ihr zweites Maximum, bestehend vor allem aus Baumwollpflücken und Eleusine-Ernte, die nun auch auf ngasu stattfinden kann. Dagegen bedarf es bei Sesam, Kalebassen, Kürbisssen und anderen Anbauprodukten weniger Aufwand.
Ein dramatischer Wechsel des Wetters setzt ab dem 9. Dezember ein. Banduro, der Platz des Nebels, verdient seinen Namen nur durch die ersten Tage, in denen ein kühler Nordwind Nebel erzeugt, danach beginnt wieder die Trockenzeit, mit Hitze, Winden und Staub. Die Bäume verlieren ihre Blätter, Falken halten mit lauten Schreien nach Buschfeuer Ausschau, da sie meist Beute mit sich bringen. Kühle Luft am Abend macht das Wetter vorerst ein wenig erträglicher.
Ein erster Baumwollmarkt wird eröffnet, er zieht über die Hälfte der Bevölkerung an, doch größtenteils prägt die Eleusine-Ernte das Bild. Auch Sesam, teils zum Verkauf, wird in großem Umfang abgeerntet, Wassermelonen sind reif und verbleiben vorerst als Reserve auf den Feldern. Weihnachten und Neujahr sind Zeiten der allgemeinen Freizeit.
Bevor das Jahr am 8. Febrauar wieder mit Wegebe beginnt und die volle Hitze das landwirtschaftliche Jahr endgültig beendet, geht am 8. Januar des neuen Jahrs der Mond Ngi auf. Die Fröhlichkeit, die ihm seinen Namen gibt, durchzieht diese reiche Zeit: Fülle an Eleusine, Hyptis, Sorghum, Wassermelonen, Tabak und Gemüse, Trinken, Tanzen, Feiern, lange Reisen, Heiratsarrangements, aber auch alte Fehden und Gerichtsverhandlungen, all das macht diese Zeit zum aktiven Höhepunkt des Jahres.
Am Himmel sind keine Wolken. Regen ist nicht in Sicht.
Klima auf der Yambio Experimental Farm 1950
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.7. Territoriale Wanderung als shifting cultivation(Kapitel 13)
Neben dem Jahreszyklus gibt es noch die Wanderung als scheinbar nicht vollständig bewusste, aber immens wichtige Form des Lebenszyklus. Fragen nach diesen Bewegungen begegnen oft reinem Unverständnis, da in der Selbstwahrnehmung territoriale Stabilität vorherrscht.
Tatsächlich finden Ortswechsel nur unter großem Druck statt, was insbesondere an der großen Zuneigung eines Bauern zu seinem verlassenen Land zu erkennen ist. Die Wechsel bilden mehrere Wendepunkte im Leben, der Mann erlebt sie als Kind, als junger Mann, wenn er zur palanga geschickt wird oder einen eigenen Haushalt gründet, später auf Anordnung des Chiefs oder in Umsiedlungsprogrammen. Weitere Gründe sind der Tod einer Ehefrau, wiederholte Unglücksfälle wie Kindestod, Krankheiten, wiederholte Ernteausfälle und schließlich Schwierigkeiten bei der Suche nach geeignetem Land.
Stirbt das Familienoberhaupt, ziehen die Verbliebenen zu Brüdern oder Söhnen als abhängige Verwandte oder kehren zur eigenen Familie zurück. Stirbt eine Ehefrau muss der Ehemann sofort die Besitzung aufgeben, alle Gebäude und Habseligkeiten zerstören und ohne einen Blick zurück die Gegend verlassen, nur den anderen Frauen ist die Rückkehr zur Nachernte erlaubt. Damit soll die Witwerkrankheit vermieden werden, die allerdings auch durch erfolgreiche bagumbayo -Zauberei vertrieben werden kann, was immerwährendes Verweilen an einem Ort ermöglicht.
Tritt wiederholt Krankheit auf oder stirbt ein Kind, wird das Orakel befragt, ob eine bedrohliche Zauberei im Spiel ist und ein Umzug notwendig wird. Gleiches wird bei fortwährendem Ernteausfall getan, wobei zwischen Auslaugung des Bodens und Befall durch Zauberei keine Trennung gemacht wird, Beides vielmehr miteinander wahrgenommen wird.
Das Orakel wird nicht in Frage gestellt, ein Umzug findet entweder in eine benachbarte Flussregion statt oder der Ältesten wird um ein neues Gebiet gebeten. Auch das Aufsuchen eines anderen Ältesten, eines anderen Subchiefs oder sogar eines anderen Chiefs ist möglich. Erst wenn vermehrt Abwanderung auftritt, wird ein Chief bemüht sein, das Orakel zu annullieren.
Durch das Orakel wird eine allgemeine Gegend vorgegeben, der genaue Standorts wird in der Nähe der fruchtbarsten Catena-Stufe angelegt, meist oberhalb des Galeriewaldes und unterhalb des Lateritschilds (beim bire-pavuru-di), teils wegen der Nähe zum Wasser, teils aus Brauch. Das fruchtbare Elefantengras wird gemieden, da es den kleinen Hacken der Azande zu großen Widerstand entgegensetzt.
Weitere Überlegungen sind Nähe zu Freunden und Verwandten oder gerade Isolation von Nachbarn und unerwünschten Verwandten (dieser Isolationswunsch ist in der jüngeren Generation der Umsiedlungszeit weniger ausgeprägt). Ebenso wird auf Abwesenheit von natürlichen Feinden geachtet, so bergen Hügel oft Pavianherden, Morast Wildschweine und weites, feuchtes Grasland Wasserzwergböckchen, während in unbewohnten Wald öfter Elefanten einfallen. Vor der letztendlichen Entscheidung wird erneut das Orakel befragt, lässt dieses Zweifel offen oder begegnen sich verschiedene unheilkündende Ereignisse, beginnt die Suche von Neuem.
Der Umzug findet meist in der Trockenzeit statt, wobei erst provisorische Grashütten gebaut werden, worauf erste Rodung für die Bebauung und den ersten Erdnuss-Eleusine-Verband folgen. Kleine Pfade zwischen den Feldern sollen Landverlust vermindern. Erste Höfe entstehen durch die Entfernung der obersten Bodenschicht nach der Erdnuss-Ernte, in der Oktober-Pause entstehen erste Lagerräume, dann Hütten.
Das erste Jahr ist darum voll von Rodungs- und Bautätigkeiten, auch müssen Besitztümer transportiert und Nachernte im alten Land eingebracht werden. Ist die Entfernung sehr groß, herrscht oft großer Hunger. Doch eine mangelhafte Wissensweitergabe zwischen den Generationen macht oft die völlig neue Erfahrungssuche für jeden Einzelnen nötig.
Dass dieses Dasein mit unstabilen Boden- und Lebensverhältnissen nicht mit dem beständigen Wachstum auf Grund jahrhundertelanger Nutzung stabiler Böden wie in Europa vergleichbar ist, so schließt de Schlippe, ist nicht verwunderlich.
3. Literatur
Goldammer, Johann Georg: Feuer in Waldökösystemen der Tropen und Subtropen, Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 1993
Herkendell, Josef und Eckehard Koch: Bodenzerstörung in den Tropen, München: C.H. Beck, 1991
Manshard, Walther und Rüdiger Mäckel: Umwelt und Entwicklung in den Tropen. Naturpotenzial und Landnutzung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995
Papadakis, Juan: Soil in: Encyclopædia Britannica, Inc.: Britannica 2001 Deluxe Edition CD-ROM 1994-2001
de Schlippe, Pierre: Shifting Cultivation in Africa. The Zande System of Agriculture, London: Routledge & Kegan Paul, 1956
Schubert, Rudolf (Hrsg.): Lehrbuch der Ökologie, Jena: Gustav Fischer, 1984
Stugren, Bogdan: Grundlagen der Allgemeinen Ökologie, Jena: Gustav Fischer, 41984
Tischler, Wolfgang: Agrarökologie, Jena: Gustav Fischer, 1965
Tischler, Wolfgang: Ökologie der Lebensräume. Meer, Binnengewässer, Naturlandschaften, Kulturlandschaft, Stuttgart: Gustav Fischer, 1990
Tivy, Joy: Landwirtschaft und Umwelt. Agrarökosysteme in der Biosphäre, Heidelberg, Berlin, Oxford: Spektrum Akademischer Verlag, 1993
Walter, Heinrich und Siegmar-W. Breckle: Spezielle Ökologie der Tropischen und Subtropischen Zonen, (Ökologie der Erde, Band 2), Stuttgart: Gustav Fischer, ²1991
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was behandelt der Allgemeine Teil des Dokuments?
Der Allgemeine Teil behandelt geologische Grundlagen (Grundsubstanzen, Verwitterungsprozesse, Bedeutung des Ausgangsgesteins), biochemische Grundlagen (Nährstoffkreisläufe, Makro- und Mikronährstoffe, Ton-Humus-Komplex), agrarökologische Grundlagen (Bodenqualitäten, Wachstumsvoraussetzungen, organische Materie) und geografische Grundlagen (Afrikanische Tropen: Boden, Klima, Vegetation, extensive Landwirtschaft).
Was sind die geologischen Grundlagen, die im Allgemeinen Teil behandelt werden?
Die geologischen Grundlagen umfassen die Bedeutung des Ausgangsgesteins für die Lithosphäre und die Sedimenthülle sowie die Faktoren der Verwitterung, einschließlich physikalischer und chemischer Prozesse.
Welche biochemischen Grundlagen werden erläutert?
Die biochemischen Grundlagen umfassen Nährstoffkreisläufe, die Bedeutung von Makro- und Mikronährstoffen, Voraussetzungen und Notwendigkeit der Nutzbarkeit von Nährstoffen für Pflanzen und die Rolle des Ton-Humus-Komplexes.
Was sind die agrarökologischen Grundlagen des Allgemeinen Teils?
Die agrarökologischen Grundlagen beinhalten Bodenqualitäten (Struktur, Nährstoffe, Wasserführung, Relief), Wachstumsvoraussetzungen und die Bedeutung organischer Materie (Gründüngung).
Welche geografischen Grundlagen werden im Allgemeinen Teil abgedeckt?
Die geografischen Grundlagen konzentrieren sich auf die afrikanischen Tropen und deren spezifische Bodenarten, das Klima, die Vegetation und die spezielle Problematik der Böden in Wechselwirkung mit Klima und Vegetation, einschließlich extensiver Landwirtschaft (Wanderfeldbau).
Was behandelt der Spezielle Teil des Dokuments?
Der Spezielle Teil befasst sich mit dem geografischen Umfeld der Yambio Experimental Farm, der Geschichte und dem politischen System der Azande, der speziellen Situation des *Zande Scheme*, der spezifischen Umwelt der Yambio Experimental Farm, landwirtschaftlichen Größen (Anbaupflanzen, Besitzverhältnisse und Feldtypen), dem agrarischen Jahreszyklus und der territorialen Wanderung als *shifting cultivation*.
Was sind die Anbaupflanzen, die im Speziellen Teil betrachtet werden?
Die Anbaupflanzen umfassen Zerealien (Fingerhirse, Mais, Sorghum), Hülsenfrüchte (Kuhbohne, Grüne Kichererbse, Lima-Bohne, Bambara-Erdnuss), Ölsaat (Erdnuss, Sesam, Hyptis, öltragende Kürbisarten, Ölpalme) und stärkehaltige Wurzeln (Cassava, Süßkartoffel, Yams, Taro).
Was sind die Besitzverhältnisse und Feldtypen, die im Speziellen Teil beschrieben werden?
Beschrieben werden die Besitzverhältnisse innerhalb der Azande-Haushalte (Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau, Besitzrechte) und die verschiedenen Feldtypen, die nach Fruchtbarkeit angelegt werden (z.B. *öti-moru*, *baawande*).
Was beinhaltet die Beschreibung des agrarischen Jahreszyklus?
Die Beschreibung des agrarischen Jahreszyklus schildert detailliert die verschiedenen Monate, die mit ihnen verbundenen klimatischen Bedingungen und die entsprechenden landwirtschaftlichen Tätigkeiten der Azande.
Was wird unter territorialer Wanderung als *shifting cultivation* verstanden?
Die territoriale Wanderung als *shifting cultivation* beschreibt die Gründe für Ortswechsel (Tod, Unglücksfälle, Ernteausfälle), die Rolle des Orakels bei der Standortwahl und die Vorgehensweise beim Umzug und der Neuanlage von Feldern.
Welche Literatur wird in dem Dokument zitiert?
Die zitierte Literatur umfasst Werke zu Feuer in Waldökosystemen der Tropen, Bodenzerstörung in den Tropen, Umwelt und Entwicklung in den Tropen, Bodenkunde, Wanderfeldbau in Afrika (*de Schlippe*), Ökologie, Agrarökologie und Landwirtschaft und Umwelt.
- Quote paper
- Enrico Ille (Author), 2003, Landwirtschaft der Azande nach Pierre de Schlippe: Shifting Cultivation in Africa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111513