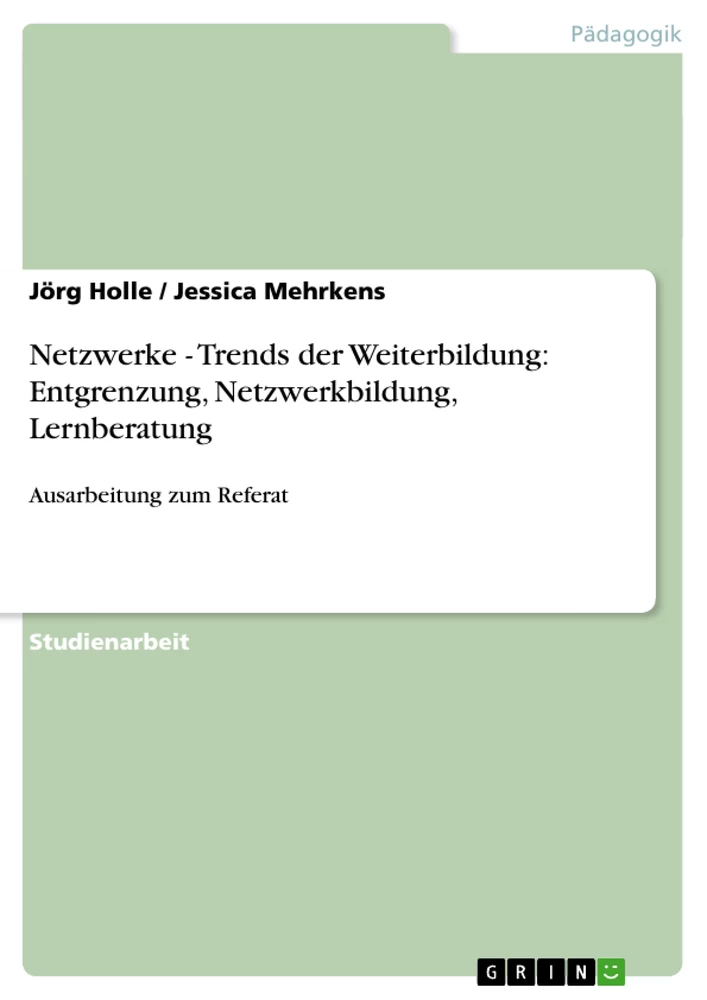Inhalt
1. Einleitung
2. Zum Netzwerkbegriff
3. Was sind Netzwerke?
3.1 Netzwerkprobleme
3.1.1 Umweltprobleme
3.1.2 Strukturprobleme
3.1.3. Interne Austauschprobleme
3.1.4. Kommunikations- und Beziehungsprobleme
3.1.5 Wertprobleme
3.1.6 Steuerungsprobleme
3.2 Wissensnetze
4. Regionale Netzwerke am Beispiel der „Lernenden Regionen“
5. Zusammenfassung und Fazit.
Literatur
1. Einleitung
Unabhängig vom gesellschaftlichen Bereich sind Netzwerke heutzutage überall zu finden: In der Ethonlogie und Soziologie (Soziale Netzwerke), in der Betriebswirtschaftslehre (Netzwerkeorganisation), in der Systemtheorie sowie in der Politikwissenschaft, (Wikipedia, 2005, http://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerk, zuletzt aufgerufen 21.09.2005) um nur einige zu nennen.
Aber auch in der Erziehungswissenschaft boomt der Bergriff „Netzwerk“. Faulstich und Wilbers stellen daher die Frage, ob hier nicht „alter Wein in neuen Schläuchen verkauft wird“ (P. Faulstich, K. Wilbers: Netzwerke als Impuls für die Aus- und Weiterbildung in der Region, 2002 in: P. Faulstich, K. Wilbers (Hrsg.). Wissensnetzwerke, Bielefeld, 2002) und ob das „Netzwerk“ das Konzept der „Kooperation“ ersetzt.
Was sind aber Netzwerke? Wie sehen sie aus, was zeichnet sie aus? Diese Arbeit will einen kurzen Überblick darüber geben und ggf. Methoden der Netzwerkanalyse aufzeigen.
2. Zum Netzwerkbegriff
Bevor die Frage gestellt werden kann, was Netzwerke eigentlich sind ist vorher zu klären, was der Netzwerkbegriff eigentlich impliziert und ob es sich nicht doch, wie oben erwähnt, um die Renaissance des Kooperationsbegriffes handelt.
Faulstich (2002) sagt über den Netzwerkbegriff, dass man ihn als Wärmemetapher auffassen kann: Netzwerke suggerieren, dass sie offen, dezentral und symmetrisch sind, auf Vertrauen und Durchlässigkeit beruhen und dass in ihnen verteilte Kompetenzen und Ressourcen vorherrschen (vgl. S. 21).
Wohlfahrt (2002) fügt noch hinzu, dass Netzwerke als visionär, basisdemokratisch, selbstregulativ und flexibel angesehen werden, teilweise erscheinen Netzwerke als „Königsweg zur Bewältigung von Risiken aller Art.“ (Wohlfahrt, U. 2002, Zur Geschichte interorganisatorischer Netzwerke in: In: Nuissl, E. (Hrsg.): Lernende Regionen, DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung 1/2002, S. 39).
Schäffter grenzt den Netzwerkbegriff in fünf Schritten durch die Gegenüberstellung von ähnlichen und gegensätzlichen Konzepten ab (vgl. Schäffter 2004, S. 32).
Erstens sei nicht jedes Beziehungsgeflecht ein Netzwerk, da Netzwerke etwas Dauerhaftes und Belastbares sind (vgl. S. 32), während andere Beziehungen flüchtig sein können. Netzwerke entstehen durch ursprünglich informelle Beziehungen zwischen mehreren Akteuren, d. h. dass es Netzwerken gewachsene Strukturen zu Grunde liegen. Interessant dabei ist, dass, anders als bei einer Kooperation, Netzwerke nicht auf Drängen eines einzelnen Akteurs hin entstehen.
Weiter beruhe nicht jede Kooperation auf vernetzten Strukturen. Das lässt sich darauf zurückführen, dass Kooperationen von zwei Parteien bewusst eingegangen werden (vgl. S. 32), was bei Netzwerken nicht der Fall ist (s. o.). Netzwerke bieten also eher eine Grundlage für Kooperationen, da Netzwerke nicht durch unmittelbare und manifeste Strukturen gekennzeichnet sind, die aber aus der Netzwerkarbeit entstehen können. Zudem ist in einer Kooperation der wechselseitige Nutzen direkt zurechenbar während er in einem Netzwerk eher diffus bleibt. Das liegt vor allem auch in der Art der Zusammenarbeit, die in einer Kooperation aufgabenzentriert ist und in einem Netzwerke eher beziehungsdominiert (vgl. S. 33).
Drittens sind Netzwerke eher durch Differenz als durch Gemeinschaft geprägt (vgl. S. 33). Jeder „Knoten“, also Akteur im Netzwerk, ist für sich autonom. Daher sind Netzwerke Verbünde von Einzelnen, egal ob Institution oder Einzelperson.
Als vierten Punkt nennt Schäffter, dass Netzwerke komplementär zur formalen Organisation stehen. Damit ist gemeint, dass Netzwerke weniger formalisiert sind und auf unausgesprochenen Vertrauensbeziehungen basieren, womit vor allem wechselseitige Hilfe und Unterstützung (social support) gemeint sind (vgl. S. 33). Das erscheint logisch, da Netzwerke zwischen und durch die Knoten gewachsen sind und da jeder Knoten autonom ist gibt es wenig Hierarchie, die für eine Strukturierung sorgen könnte.
Das letzte Merkmal ist, dass es auch in Netzwerken Macht und Konkurrenz gibt, wenn auch in einer anderen Form als gewöhnlich. Während Macht sich in vertikalen Hierarchien ausdrückt kommt sie in Netzwerken dadurch zum Ausdruck, welcher Knoten eher im Zentrum steht und wer in der Peripherie (vgl. S. 34).
Es lässt sich ganz klar erkennen, dass der Netzwerkbegriff in der jetzigen Verwendung etwas Neues ist. Der Kooperationsbegriff ist demnach eher ein Teil des Netzwerkes ebenso wie Konkurrenz. Die überwiegend positiven Assoziationen mit dem Netzwerkbegriff, wie z. B. Offenheit und Vertrauen sind zwar gerechtfertigt, jedoch sind einige Aspekte wie die Dezentralität und die Symmetrie kritisch zu betrachten, da auch in Netzwerken Machtgefälle vorherrschen, die eben jene Dezentralität nutzen, um Konkurrenten von den Zentren fern zu halten bzw. um dort (Informations-)Asymmetrien zu schaffen.
3. Was sind Netzwerke?
Nachdem der Netzwerkbegriff einführend behandelt wurde ist es sinnvoll, Netzwerke genauer zu betrachten. Laut Faulstich sind Netzwerke nichts Neues (2002), da es z. B. früher schon die kommerziellen Verbünde der Hanse sowie das kriminelle Netzwerk der Mafia gab. Dennoch sind wir jetzt endlich in der Netzwerkgesellschaft angekommen (vgl. Faulstich 2002, S. 21), da es heute mehr Netzwerke als je zuvor gab.
Nach Faulstich und Wilbers (2002) können Netzwerke breit gefächert: global, regional, personal und virtuell sein und alle erziehungswissenschaftlichen Handlungsfelder wie z. B. Schule und Weiterbildung umfassen und durchdringen (vgl. S. 1).
Demnach gibt es Netzwerke, in denen sich Schulen zusammenschließen wie z. B. Net-Part.Schule (http://www.kiko.de/blk/wasist.html, zuletzt aufgerufen 22.09.2005), wieder andere Netzwerke fördern die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Arbeitswelt, siehe Netzwerk der Kooperationsstellen Hochschulen-Gewerkschaften in Niedersachsen und Bremen (http://www.kooperation-hochschule-gewerkschaft.de/, zuletzt aufgerufen 22.09.2005). Im Bereich der Erwachsenenbildung beschäftigen sich Netzwerke z. B. mit dem Dialog zwischen Studenten und Absolventen (http://www.uni-muenster.de/Erwachsenenbildung-Broedel/Netzwerk-Dialog/, 22.09.2005).
Man sieht anhand weniger Beispiele wie komplex und divers die bestehenden Netzwerke sind und welche unterschiedlichen Ziele verfolgt werden können. Es bleiben aber einige unübersehbarer Gemeinsamkeiten. Als Merkmale von Netzwerken nennt Wohlfahrt (2002) freiwillige Mitgliedschaft, verhältnismäßig lockere Organisationsform, keine geschriebene Verfassung, keine gemeinsamen Finanzen auf Dauer, keine Exekutivorgane. Bei den meisten aktuellen Netzwerken kann man auch eine Präsenz im Internet feststellen. Die Nutzung der modernen Technologie trägt vor allem zur Senkung der Transaktionskosten von Kommunikationen bei (vgl. Faulstich/Wilbers 2002, S. 3).
Netzwerke der Erziehungswissenschaft beziehen sich auf Interaktionen zwischen Menschen und sind Formen sozialer Integration (Faulstich 2002, S. 22). Sie sind aber auch eine besondere Form von Interaktionssystemen, was vor allem daran liegt, dass Netzwerke sich auf Vertauen, Anerkennung und gemeinsame Interessen stützen.
Da sie auf kommunikativen Beziehungen basieren, die sich nicht in Geld- oder Marktverhältnisse auflösen (vgl. Faulstich 2002, S. 23) sind sie angesichts des zunehmenden Markt- und Staatsversagens eine neue Hoffnung der Politik (vgl. Faulstich 2002, S. 25). Hinzu kommt, dass Netzwerke auch als effiziente und kostengünstige Steuerungssysteme betrachtet werden (vgl. Nuissl, 2002, S. 3).
Allerdings sind Netzwerke kein Allheilmittel. Genauso wie es Markt- und Staatsversagen gibt, gibt es auch Netzwerkversagen (vgl. Faulstich 2002, S. 25). Diese Probleme haben ihren Ursprung darin, dass Macht und Konflikte in Netzwerken nur verlagert sind (s. o.).
3.1 Netzwerkprobleme
Da Netzwerke in der ausdifferenzierten und globalisierten Wissens- und Informationsgesellschaft immer dichter werden gehört die Arbeit in Netzwerken zu den favorisierten Arbeitsformen (vgl. Miller, T. 2002, S. 103). Der Ursprung dafür liegt, wie schon erwähnt in der Milderung des Konkurrenzdrucks, in der Erschließung neuer Märkte und in der Bündelung von Ressourcen.
Die Probleme, die in Netzwerken auftauchen können, sind Umweltprobleme, Strukturprobleme, Austauschprobleme, Kommunikations- und Beziehungsprobleme, Wertprobleme und Steuerungsprobleme (vgl. Miller, T., S. 104). Ein Grund dafür ist, dass Netzwerke komplexe Gebilde mit unvorhersehbaren Eigendynamiken sind, die allen Beteiligten flexible und manchmal auch aufreibende Balanceakte abnötigen (vgl. Miller, T., S. 115).
3.1.1 Umweltprobleme:
Mit Umwelt sind hier u. a. Konkurrenz-Netzwerke auf dem Markt bzw. der Region, rechtliche Vorgaben, Medien, die sowohl Öffentlichkeitsarbeit unterstützen können als auch dem Image schaden können und aktuelle Ereignisse, auf die das Netzwerk reagieren muss (vgl. Miller, T. 2002, S. 105).
Netzwerke haben also für sie spezifische Umgebungen, die sowohl die Netzwerkarbeit fördern als auch behindern kann. Im Gegensatz zu den folgenden Problemen kann das Netzwerk dieses Problem nicht vollständig kontrollieren, sondern lediglich etwas beeinflussen.
3.1.2 Strukturprobleme
Die Struktur eines Netzwerks soll einen Arbeitsrahmen und –ablauf festlegen. Bei Netzwerken kann es auf der einen Seite zu Überstrukturierung kommen, die die Innovationskraft und Kreativität, sowie die Flexibilität hemmen kann. Auf der anderen Seite führt eine Unterstrukturierung zu Redundanz, was eine Beeinträchtigung der Entscheidungsfähigkeit und des zielgerichteten Arbeitens nach sich zieht (vgl. Miller, T., S. 107).
Die Größe des Netzwerks hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf seine Struktur: kleine Netzwerke sind schnell überlastet, große Netzwerke werden schnell unübersichtlich und bringen Probleme bei der Aufgabenbewältigung mit sich (vgl. Miller, T., S. 107).
3.1.3 Interne Austauschprobleme
Netzwerke beinhalten viele Ressourcen, die innerhalb des Netzwerkes getauscht werden und dadurch synergetische wirken. Wenn das Geben und Nehmen nicht balanciert genug ist entstehen Austauschprobleme (vgl. Miller, T., S. 108). Solche Ungleichgewichte sind nur dann problematisch, wenn für das Eingebrachte kein Ausgleich geschaffen werden, z. B. in Form einer gehobenen Position oder mehr Einfluss. Daraus können allerdings wieder neue Balanceprobleme entstehen (vgl. Miller, T., S. 108). Netzwerke reagieren sehr empfindlich auf diese Art von Problemen.
3.1.4 Kommunikations- und Beziehungsprobleme
Diese Probleme sind gut nachvollziehbar, da ein Netzwerk aus vielen eigenständigen Knoten besteht, die ihre eigenen Sichtweisen und Interessen einbringen. Daher müssen die Akteure auch erst mal eine einheitliche Sprache und Terminologie finden (vgl. Miller, T., S. 108). Da es auch möglich ist, dass in Netzwerken Konkurrenten zusammen arbeiten gibt es auch ein Problem mit der Transparenz bzw. Offenlegung von bestimmten Absichten oder Leistungen. Daher ist es unerlässlich in Netzwerken, dass eine stabile Vertrauensbasis hergestellt wird.
3.1.5 Wertprobleme
Analog zu den Kommunikationsproblemen hat jeder Akteur im Netzwerk eigene Wertvorstellungen. Diese werden sowohl in den persönlichen Neigungen als auch in den Leitbildern und Kulturen der Knoten erkennbar (vgl. Miller, T., S. 110). Daher muss auch hier ein gemeinsamer Nenner gefunden werden, da sich ansonsten eine „permanente Erwartungsdiffusion“ (Miller, T. 2002, S. 110) einstellt, die auf Dauer für das Netzwerk nicht tragbar ist.
3.1.6 Steuerungsprobleme
Wie man aus den vorgenannten Problemen sehen kann ist die Netzwerksteuerung ein großer Balanceakt. Wenn das Netzwerk nicht im Gleichgewicht ist kann es dysfunktional werden. Daher ist die Steuerung von Netzwerken wichtig für das Funktionieren von Netzwerken und wird häufig von Steuerungsgruppen übernommen (vgl. Miller, T., S. 110). Diese können jedoch nur Aufgaben der Koordination und Kontrolle übernehmen, was im Netzwerk nicht ausreichend ist, da dabei die Strukturierung des Netzwerks, die Funktionsfähigkeit und die Beziehungsebene der Netzwerkmitglieder vernachlässigt werden.
Wie man sieht sind die Probleme in Netzwerken vielfältig, was eine stetige Weiterentwicklung und Optimierung notwendig macht. Will ein Netzwerk erfolgreich sein, muss es sich als „lernendes Netzwerk“ begreifen (vgl. Miller, T., S. 115).
3.2 Wissensnetze
Im Bereich der Erziehungswissenschaft sind gerade Wissensnetze interessant, denn sie versprechen ein zukunftsweisendes Konzept. Wissensnetzen wird ein hohes Innovationspotential zugesprochen (vgl. Faulstich 2002, S. 28). Aber was versteht man unter Wissensnetzen? Und was kann in Wissensnetzen überhaupt vermittelt werden? Denn genauso vielfältig wie Netzwerke sind ist auch Wissen: implizit und explizit, intern, mental und extern kulturell vermittelt, individuelles und systematisches Wissen (vgl. Faulstich 2002, S. 28).
Die Hauptaufgabe von Wissensmanagement und damit Wissensnetzwerken ist es, „implizites zu explizitem, individuelles zu systematischem Wissen und damit verfügbar zu machen“ (Faulstich, 2002, S. 34). Laut Faulstich (2002) dient regional verortetes Wissen für solche Wissensnetzwerke. Daher ist es sinnvoll, sich in diesem Zusammenhang Netzwerke im regionalen Kontext anzusehen.
4. Regionale Netzwerke am Beispiel der „Lernenden Regionen“
Trotz der zunehmenden Globalisierung oder gerade wegen ihr gewinnen Regionen an Bedeutung, da sie als Wirtschaftsstandorte zueinander in Konkurrenz treten (vgl. Adrian/Bock 2002, S. 32). Das liegt vor allem daran, dass z. B. Infrastrukturen, Lebensqualität, Arbeitskräftepotenzial und regionale Wissenskulturen zunehmend wichtiger werden.
Der Ansatz, den der Staat mit den „Lernenden Regionen“ verfolgt, geht in die gleiche Richtung. Hier wurde die Notwendigkeit erkannt, dass zur persönlichen und beruflichen Entwicklung Lebenslanges Lernen gehört. Deshalb hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BmBF) in 2000 das Projekt „Lernende Regionen“ ins Leben gerufen (http://www.bmbf.de/de/414.php, zuletzt aufgerufen 23.09.2005).
In diesem Projekt werden 73 modellhafte, regionale Netzwerke gefördert, die zum einen ein umfassendes Beratungs-, Lern- und Bildungsangebot vorweisen können und zum anderen dazu beitragen wollen, die Beschäftigungsfähigkeit in kleinen und mittleren Unternehmen zu stärken (vgl. BmBF 2004, http://www.bmbf.de/pub/lernende_regionen_foerderung_von_netzwerken.pdf.).
Die Idee, zu dieser Netzwerkbildung aufzurufen, ist aus der Einsicht entstanden, dass Kooperation und Vernetzung Bildungsanbietern und –veranstaltern helfen sollen, den Strukturwandel in Richtung Lebenslanges Lernen zu gestalten (vgl. BmBF 2004, S. 6). Dabei sollen die Knoten/Akteure aus unterschiedlichen Bildungsbereichen kommen, so z. B. allgemein- und berufsbildende Schulen und Hochschulen, gewerkschaftliche und kirchliche Bildungseinrichtungen aber auch kommerzielle Anbieter. Unterstützt werden sollen sie auf der einen Seite von Unternehmen, Kammern und Gewerkschaften und auf der anderen Seite von Bildungsberatungsstellen, Jugendämtern, Arbeitsämtern sowie kulturellen Einrichtungen (vgl. S. 6).
Anhand von Abb. 1. kann man sehen, wie diese unterschiedlichen Knoten zusammen arbeiten: aus der großen Gemeinschaft werden Arbeitskreise gebildet, die ihrerseits die Aufgaben übernehmen, für die sie am geeignetsten sind. So wird z. B. die Wissensbörse mit der Einrichtung eines Bildungsportals beauftragt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Beispiel für die Organisationsstruktur eines Netzwerks für Lebenslanges Lernen (Quelle: BmBF, Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken; http://www.bmbf.de/pub/lernende_regionen_foerderung_von_netzwerken.pdf.)
Dass durch diese Initiative etwas bewegt wurde wird auf vielen Internetseiten bestätigt – immerhin sind 73 Netzwerke daran beteiligt. In der Programmdarstellung der Bundesministeriums für Bildung und Forschung gibt ein sehr positives Resümee einen kurzen Ein- und Überblick über die Netzwerkaktivitäten (vgl. BmBF, 2004 http://www.bmbf.de/pub/lernende_regionen_foerderung_von_netzwerken.pdf . S. 12). Dort heißt es, dass Allianzen zustande gekommen sind, die vorher undenkbar schienen, dass durch die Netzwerkarbeit neue Blickwinkel eröffnet werden und verborgene Potenziale frei werden.
Dieses Beispiel für eine Offensive der Netzwerkbildung und –arbeit ist wahrscheinlich einzigartig und sicherlich könnte und sollte man die einzelnen Netzwerke noch viel intensiver untersuchen. Das würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es ist an dieser Stelle nur wichtig zu sehen, dass Netzwerkarbeit in Deutschland praktiziert wird dass es nicht nur ein Konstrukt ist, was nicht angewendet werden kann.
5. Zusammenfassung und Fazit
Netzwerke sind, obwohl es sie schon lange gibt, ein neues Modell der Zusammenarbeit. In ihnen finden sich unterschiedliche Akteure zu einem bestimmten Ziel zusammen. Dadurch entstehen viele synergetische Effekte, von denen nicht nur alle im Netzwerk profitieren, sondern auch die Adressaten des Netzwerkes.
Ein sehr zentraler Punkt sind aber auch die Netzwerkprobleme. Nachdem Faulstich (2002) den Netzwerkbegriff als Wärmemetapher bezeichnet und Netzwerke als neue Hoffnung und als Arbeitsform der Zukunft gesehen werden, darf man trotz allem nicht vergessen, dass Netzwerke fragile Gebilde sind, die vernünftig balanciert werden müssen.
Probleme bei Netzwerken können sehr vielfältig sein, da sie nicht nur im Inneren hervorgerufen werden können, sondern auch von außen auf Netzwerke einwirken können. Daher ist es sinnvoll, weiterhin Netzwerkanalysen zu betreiben, um zum einen mehr über die Funktionsweisen und Mechanismen zu erfahren und zum anderen um für die zukünftigen Probleme der vermutlich dominierenden späteren Arbeitsform gerüstet zu sein.
Einen wichtigen Schritt in die Richtung wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung schon gemacht, indem dort die „Lernenden Regionen“ ausgeschrieben wurden. Nicht nur wurden dadurch lokale Netzwerke gegründet, die anscheinend ihrer Aufgabe, den Strukturwandel für die Gesellschaft in Richtung Lebenslanges Lernen vorzubereiten, gut nachkommen.
Ein wichtiger anschließender Schritt wäre die Erfolgsmessung der einzelnen Netzwerke, wobei nicht nur „harte“ Fakten und Zahlen berücksichtigt werden müssen, sondern auch der Lernerfolg und die gefühlten Verbesserung durch die neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit der einzelnen Einrichtungen und Akteure.
Literatur:
Adrian, L., Bock, S. 2002: Die Wiederentdeckung der Region – Chancen und Grenzen kommunaler Netzwerkstrategien. In: Nuissl, E. (Hrsg.): Lernende Regionen, DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung 1/2002, S. 3
BMBF 2004: Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken. http://www.lernende-regionen.info/dlr/index.php, zuletzt aufgerufen 23.09.2005
Faulstich, P. 2002. Attraktive Wissensnetze in: Faulstich, P., Wilbers, K. (Hrsg.): Wissensnetzwerke. Bielefeld, 2002
Faulstich, P., Wilbers, K. 2002. Netzwerke als Impuls für die Aus- und Weiterbildung in der Region in: Faulstich, P., Wilbers, K. (Hrsg.): Wissensnetzwerke. Bielefeld, 2002
Miller, T. .2002: Netzwerkprobleme und ihre Steuerungsmöglichkeiten aus systemtheoretischer Sicht. : Faulstich, P., Wilbers, K. (Hrsg.): Wissensnetzwerke. Bielefeld, 2002
Nuissl, E. 2002. Regionen und Netzwerke in: Nuissl, E. (Hrsg.): Lernende Regionen, DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung 1/2002, S. 3
Schäffter, O. 2004. Auf dem Weg zum Lernen in Netzwerken – Institutionelle Voraussetzungen für lebensbegleitendes Lernen. In: Brödel, R. (Hrsg.): Weiterbildung als Netzwerk des Lernens. Bielefeld. 2004
Häufig gestellte Fragen
Was sind Netzwerke laut diesem Text?
Netzwerke sind ein neues Modell der Zusammenarbeit, in dem unterschiedliche Akteure für ein bestimmtes Ziel zusammenkommen. Dies führt zu Synergieeffekten, von denen nicht nur die Netzwerkmitglieder, sondern auch die Adressaten des Netzwerks profitieren.
Welche Probleme können in Netzwerken auftreten?
Netzwerke können mit Umweltproblemen, Strukturproblemen, Austauschproblemen, Kommunikations- und Beziehungsproblemen, Wertproblemen und Steuerungsproblemen konfrontiert sein. Diese Probleme können durch interne Faktoren oder externe Einflüsse verursacht werden.
Was versteht man unter "Lernenden Regionen"?
"Lernende Regionen" ist ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), das regionale Netzwerke fördert, um ein umfassendes Beratungs-, Lern- und Bildungsangebot zu schaffen und die Beschäftigungsfähigkeit in kleinen und mittleren Unternehmen zu stärken.
Was sind Wissensnetze?
Wissensnetze sind Netzwerke, die sich auf den Austausch und die Vermittlung von Wissen konzentrieren. Sie haben ein hohes Innovationspotential und dienen dazu, implizites zu explizitem Wissen und individuelles zu systematischem Wissen zu machen.
Welche Merkmale zeichnen Netzwerke aus?
Netzwerke zeichnen sich durch freiwillige Mitgliedschaft, relativ lockere Organisationsform, keine geschriebene Verfassung, keine gemeinsamen Finanzen auf Dauer und keine Exekutivorgane aus. Viele aktuelle Netzwerke sind auch im Internet präsent.
Welche Rolle spielt Vertrauen in Netzwerken?
Vertrauen ist in Netzwerken unerlässlich, da sie auf kommunikativen Beziehungen basieren, die sich nicht in Geld- oder Marktverhältnisse auflösen. Eine stabile Vertrauensbasis ist notwendig, um Kommunikations- und Beziehungsprobleme zu vermeiden.
Wie beeinflusst Macht die Netzwerke?
Auch in Netzwerken gibt es Macht und Konkurrenz. Macht drückt sich jedoch nicht in vertikalen Hierarchien aus, sondern dadurch, welcher Knoten im Zentrum steht und wer in der Peripherie.
Was sind mögliche Steuerungsprobleme in Netzwerken?
Die Netzwerksteuerung ist ein großer Balanceakt. Wenn das Netzwerk nicht im Gleichgewicht ist, kann es dysfunktional werden. Es ist wichtig, die Strukturierung des Netzwerks, die Funktionsfähigkeit und die Beziehungsebene der Netzwerkmitglieder nicht zu vernachlässigen.
Was wird als Fazit aus dem Text gezogen?
Netzwerke sind ein neues Modell der Zusammenarbeit, das jedoch auch Probleme birgt. Es ist wichtig, Netzwerkanalysen zu betreiben, um die Funktionsweisen und Mechanismen besser zu verstehen und für zukünftige Probleme gerüstet zu sein. Die "Lernenden Regionen" sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, es wäre aber wichtig eine Erfolgsmessung durchzuführen.
- Arbeit zitieren
- Jörg Holle (Autor:in), Jessica Mehrkens (Autor:in), 2005, Netzwerke - Trends der Weiterbildung: Entgrenzung, Netzwerkbildung, Lernberatung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111532