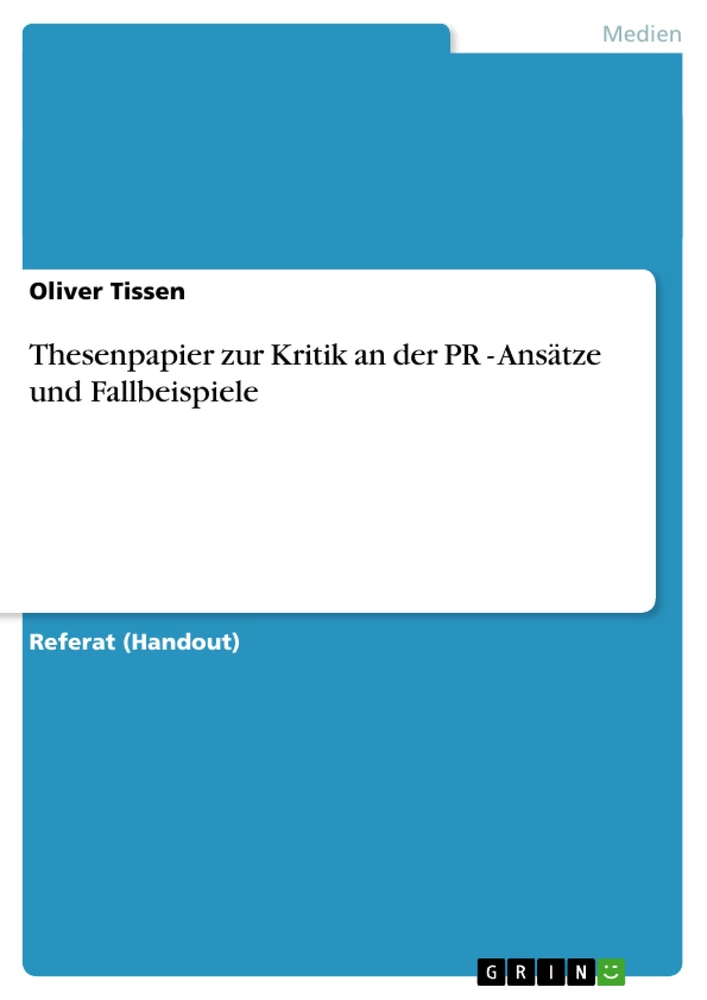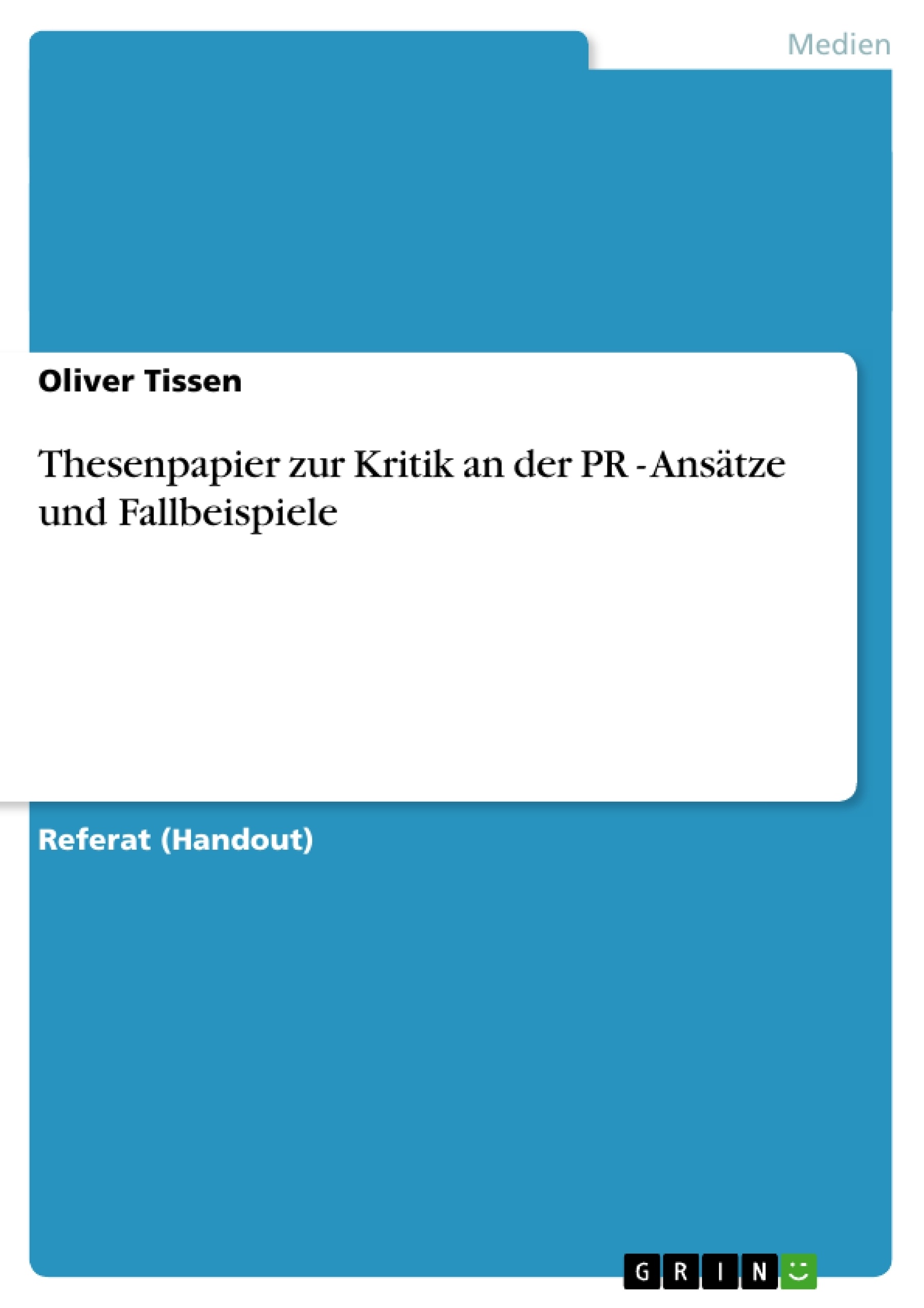Einführung in das Thema:
Das Thema zur Kritik an der PR in Abhängigkeit zum Journalismus ist im derzeitigen und sich weiter wandelnden Medienkontext nicht nur aktuell, sondern in vielerlei Hinsicht brisant. Die Trennung zwischen redaktionellen Inhalten und werblich gefärbten aber unter dem Siegel des Journalismus veröffentlichten Anzeigentexten droht in Zeiten immer schneller publizierender Mediengattungen, gerade Online-Publikationen, immer schwieriger. Längst hat sich neben dem klassischen, im Zuge zurückgehender Anzeigenbuchungen meist schlecht bezahlten Journalismus, eine neue Form des Journalismus entwickelt. Der PR-Journalismus[1]. Klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vermischt sich immer mehr mit den Marketing-Interessen der Unternehmen.
Dieses Thesenpapier beleuchtet die o.g. Aspekte von verschiedenen Standpunkten. Zur Verdeutlichung werden zwei Case (Edelmann/Ciquita) angeführt.
Thema : Kritik an der PR Ansätze und Fallbeispiele
Datum: 17.01.2008
Referent: Oliver Tissen
Veranstaltung: PR und Öffentlichkeitsarbeit (ÖA), Modul 4 / Wirtschafts- Kommunikation
Einführung in das Thema:
Das Thema zur Kritik an der PR in Abhängigkeit zum Journalismus ist im derzeitigen und sich weiter wandelnden Medienkontext nicht nur aktuell, sondern in vielerlei Hinsicht brisant. Die Trennung zwischen redaktionellen Inhalten und werblich gefärbten aber unter dem Siegel des Journalismus veröffentlichten Anzeigentexten droht in Zeiten immer schneller publizierender Mediengattungen, gerade Online-Publikationen, immer schwieriger. Längst hat sich neben dem klassischen, im Zuge zurückgehender Anzeigenbuchungen meist schlecht bezahlten Journalismus, eine neue Form des Journalismus entwickelt. Der PR-Journalismus[1]. Klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vermischt sich immer mehr mit den Marketing-Interessen der Unternehmen. Unter dem Gesichtspunkt der Wirklichkeitsbildung durch PR kommt es oftmals nicht mehr nur zur gegenseitigen „Befruchtung von PR und Journalismus“ (Intereffikation) sondern zu einer einseitigen, persuasiv interessengebundenen Abspaltung durch PR vermittelte Inhalte und Ereignisse. PR hat in Unternehmen eine strategische Management-Funktion (vgl. Merten/Westerbarkey: 1994: 210). Darüber hinaus sind PR in der Lage durch die Verbandelung mit den Medien gezielt falsch zu informieren und Wirklichkeit zu beugen bzw. zu erzeugen. In der Öffentlichkeit werden durch den Einsatz von PR positiv aufgeladene Stellvertreter sog. Images erzeugt. Diese Images werden professionell mit fiktionalen Mitteln konstruiert. Das Image hat dabei nach Merten und Westerbarkey mehrere Vorteile: es ist indifferent gegenüber Wahrheiten und lässt viel Platz für Interpretation und Konstruktion. Ein Image ist nicht manifest sondern variabel - es kann sich der Situation anpassen oder angepasst werden.
1. Betrachtungen, Kernaussagen
1.1.
70 Prozent aller redaktionellen Beiträge in Zeitungen sind durch Presseabteilungen und deren Arbeit beeinflusst (vgl. Kunczik/Zipfel: 2005: 190ff) PR und Journalismus stehen sich als Systeme im Machtkampf mit beidseitigen Interessen und Abhängigkeiten (Intereffikation/Interpenetration) gegenüber.
1.2.
Im erweiterten Intereffikationsmodell nach Liebert steht Werbung als zu kommunizierender Faktor auf der Seite der PR und wird durch die vordefinierten Kanäle transportiert.
1.3.
Aufgabe der PR: Informationsleistungen für Redaktionen bieten und Themen installieren. Ansprechpartner sein für Themen und Beiträge. Fundierte Quellen-Recherche vorausnehmen (interessengeleitete Informationspolitik)
Einige Maßnahmen:
1. Anzeigen werden so gestaltet, dass Leser sie als redaktionelle Beiträge einstuft (Advertorial).
2. Die wirtschaftliche Abhängigkeit (z.B. Rückgang in der Anzeigenbuchung) verpflichtet viele Verlage zu Koppelgeschäften.
3. Verbände, Organisationen und Unternehmen erstellen vorformulierte Beiträge als Arbeitshilfen für Journalisten, die aufgrund von Zeitnot häufig kaum redigiert in den redaktionellen Teil interessenorientierte Meinungsäußerung einbringen
4. Pressekonferenzen, Produktvorstellungen und Pressemitteilungen werden unter Berücksichtigung journalistischer Auswahlkriterien zu inszenierten Ereignissen.
1.4.
Standards und Arbeitsweisen von in der ÖA tätigen Journalisten sind hoch. Meist sind die Inhalte so aufbereitet, wie es das Zielmedium erwartet. Zeitfaktor und Fokus auf ein jeweiliges Thema sind schärfer gesetzt- Infos dementsprechend vorgefiltert und bearbeitet.
1.5.
Forscher wie Joachim Westerbarkey (1995), aber auch PR-Profis wie der frühere PR-Chef der Volkswagen AG, Klaus Kocks, haben das Bild einer parasitären Beziehung zwischen Journalismus und PR gezeichnet. Kocks zufolge ist PR „eine Kommunikationsdisziplin, die nur in einer publizistisch intakten Landschaft funktioniert“. Er sieht „PR als Parasiten (im besten Sinne)“, der „allergrößtes Interesse an der Gesundheit seines Futtertieres“ haben müsse. Soll heißen: Öffentlichkeitsarbeit ist nur so lang funktionsfähig, wie auch der Journalismus als Wirt funktioniert (Kocks 1998).
2. Fallbeispiel
2.1. Die Brutkastenlüge im Irak-Krieg
Die Brutkastenlüge
Waren es bei der Destabilisierung von missliebigen Regierungen und der Aufstandsbekämpfung in Lateinamerika überwiegend CIA-Agenten, die durch gezielte Falschmeldungen US-Interventionen legitimieren sollten, wurde zur Vorbereitung des Kriegs gegen Irak eine der größten PR-Agentur in den USA unter Vertrag genommen. Ausgestattet mit einem Budget von 10,7 Mio. $ startete die PR-Agentur Hill & Knowlton 1990 einen Propagandafeldzug für die "Befreiung" Kuweits. Höhepunkt der in der Geschichte wohl erfolgreichsten PR-Kampagne war eine gezielte Lüge, die von der Bush-Administration und der kuwaitischen Regierung gestreut wurde. Am 10. Oktober 1990 schilderte vor dem Ausschuß für Menschenrechte des US-Kongresses die 15-jährige Kuwaiterin Nayirah unter Tränen die Greueltaten irakischer Soldaten. Diese hätten in einem kuwaitischen Krankenhaus 15 Babys aus Brutkästen gerissen, auf den Boden geworfen und dort sterben lassen. Die Brutkästen seien entwendet worden. Aus anderen Krankenhäusern wurden ähnliche Vorfälle geschildert, so dass u.a. Amnesty International 312 auf diese Weise getötete Babys und gestohlene Brutkästen zählte - ai dementierte diese Angabe später. Präsident Bush griff die Greuelgeschichte in seiner Kriegskampagne immer wieder auf, so dass der zunächst kriegskritische US-Senat der Intervention zustimmte und durch die mediale Aufbereitung der Geschichte auch innerhalb der US-Gesellschaft ein Meinungsumschwung zu verzeichnen war [...] (Quelle: Gegeninformationsbüro[2] ).
2.2. Chiquita und die Agentur Edelmann
„Vom Ausbeuter zum Vorbild“ Im Januar druckte das Wirtschaftsmagazin „Brand Eins“ eine Reportage über den Bananenkonzern Chiquita. Das Stück hieß „Vom Ausbeuter zum Vorbild“ und wimmelte von Komplimenten. Zwar sei Chiquita früher „der Krake“ genannt worden, weil sich der Konzern nach Gutsherrenart in Lateinamerika breitgemacht hatte. Aber das sei Geschichte. Spätestens 2001 sei dem Konzern der „Wandel vom Saulus zum Paulus“ gelungen. [...] Im Oktober vergangenen Jahres veranstaltete Edelman in Hamburg eine große Pressekonferenz. Dabei wurde Chiquitas Engagement in der Rainforest Alliance gefeiert, die sich „nachhaltig für Mensch und Tier“ in Lateinamerika einsetze. Schon im Vorfeld des „PR-Programms“, so Kunze, seien Journalisten mit Material versorgt worden. Dann seien eben so schöne Artikel entstanden wie der in „Brand Eins“ [...]
3. Fazit und Ausblick
3.1
Einfluss von PR wächst mit Zeitnot der Journalisten und hängt ab von: eigener Rollendefinition, Medientyp, Arbeitsbereich, Berufserfahrung, Position und politischer Überzeugung (PR-Praktiker, PR-Skeptiker etc.) großer Einfluss der PR auf Journalismus bei Routine-Ereignissen oder Spezial- Stories in Konflikt- und Krisensituationen
3.2.
PR ist Metakommunikator und organisiert Kommunikation durch Steuerung von Kommunikation. Die Kommunikation ist sachlich nicht angreifbar, da vom (politischen) Tagesgeschehen abgekoppelt und anhand von Fakten schwer zu entkräften. Themen werden strategisch platziert und in Kanäle des Medien-Systems transportiert.
PR-Profis sind Wahrnehmungsmanager.
„Sie testen, wie elastisch Wahrheit sein
kann“. (Klaus Merten im Spiegel)
3.2.
Bezugnehmend auf Kocks und Liebert darf sich das Verhältnis von PR und Journalismus nicht zu einem “Reversiven Pararsitismus” hin verändern. Eine solche Veränderung würde das Gleichgewicht stören. Während in Zeiten des Anzeigendiktats und den Einbußen der Verlage und Medienhäuser auf dem Werbemarkt in vielen Redaktionen Zeit-, Personal- und Geldnot herrschen, werden in den Marketing-Abteilungen Etats und Personal aufgestockt.
Quellenangaben/Link- und Literatur
Internet-Quellen: Der Spiegel vom 21.7.2006, Nr. 31/2006: Public Relations: Meister der Verdrehung.
http://service.spiegel.de/digas/find?DID=48046168 (Kostenpflichtiger Download aus dem Archiv)
Die Reaktion von Richard Edelman auf den Artikel im Spiegel: http://www.edelman.com/speak_up/blog/archives/2006/08/hit_me_with_you.html
Liebert, Tobias (2004): „Von der Zweier- zur Dreierbeziehung (Intereffikation)“
http://www.intereffikation.de/
Klassische Literatur:
BENTELE, Günter/ LIEBERT, Tobias / SEELING, Stefan (1997): „Von der Determination zur Intereffikation. Ein integriertes Modell zum Verhältnis von Public Relations und Journalismus.“ In: BENTELE, Günter / HALLER, Michael (Hrsg.): Aktuelle Entstehung von Öffentlichkeit. Akteure, Strukturen, Veränderungen. Konstanz: UVK.
KUNCZIK, Michael / ZIPFEL, Astrid (2001): Publizistik. Ein Studienhandbuch. Köln, Weimar, Wien: Böhlau. S. 196f.
MERTEN, Klaus (1999): Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Bd. 1: Grundlagen der Kommunikationswissenschaft. Münster, Hamburg, London: Lit. S. 268ff.
RUß-MOHL, Stefan (2004): PR und Journalismus in der Aufmerksamkeits-Ökonomie. In: RAUPP, Juliana / KLEWES, Joachim (Hrsg.): Quo vadis Public Relations? Festschrift für Barbara Baerns. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. S. 52-65.
[...]
[1] (siehe hierzu: Liebert; Erweitertes Intereffikationsmodell)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Dokuments "Kritik an der PR Ansätze und Fallbeispiele"?
Das Dokument behandelt die Kritik an Public Relations (PR) Ansätzen, insbesondere im Verhältnis zum Journalismus, und analysiert Fallbeispiele, in denen PR kritisch betrachtet wird. Es untersucht, wie PR die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst und inwiefern die Grenzen zwischen redaktionellen Inhalten und PR-gesteuerten Informationen verschwimmen.
Welche Rolle spielt die Intereffikation im Kontext von PR und Journalismus laut dem Dokument?
Die Intereffikation beschreibt das Zusammenspiel und die gegenseitige Beeinflussung von PR und Journalismus. Das Dokument beleuchtet, wie PR die Arbeit von Redaktionen beeinflusst, indem sie Informationsleistungen anbietet und Themen setzt. Es wird auch kritisiert, dass PR durch die Verflechtung mit den Medien gezielt falsch informieren oder die Wirklichkeit verzerren kann.
Was sind einige der im Dokument genannten Maßnahmen, durch die PR Journalismus beeinflusst?
Das Dokument nennt mehrere Maßnahmen: 1) Anzeigen werden als redaktionelle Beiträge gestaltet (Advertorials). 2) Wirtschaftliche Abhängigkeiten verpflichten Verlage zu Koppelgeschäften. 3) Verbände und Unternehmen erstellen vorformulierte Beiträge für Journalisten. 4) Pressekonferenzen werden als inszenierte Ereignisse gestaltet.
Welche Fallbeispiele werden im Dokument "Kritik an der PR Ansätze und Fallbeispiele" behandelt?
Das Dokument behandelt zwei Fallbeispiele: 1) Die Brutkastenlüge im Irak-Krieg, bei der durch PR verbreitete Falschinformationen die öffentliche Meinung beeinflussten. 2) Die PR-Arbeit der Agentur Edelman für den Bananenkonzern Chiquita, die darauf abzielte, das Image des Unternehmens positiv zu verändern.
Was ist die Kernaussage des Fazits im Dokument?
Das Fazit betont den wachsenden Einfluss von PR, der von der Zeitnot der Journalisten abhängt. PR wird als Metakommunikator betrachtet, der die Kommunikation durch Steuerung organisiert. Das Dokument warnt vor einem "reversiven Parasitismus", bei dem PR den Journalismus zu stark beeinflusst und das Gleichgewicht stört. Die Arbeit von PR-Profis wird als Wahrnehmungsmanagement beschrieben.
Was sind die wichtigsten Quellen und Referenzen, die im Dokument "Kritik an der PR Ansätze und Fallbeispiele" genannt werden?
Das Dokument verweist auf Internetquellen wie einen Artikel aus dem Spiegel und die Reaktion von Richard Edelman darauf. Es zitiert auch Tobias Lieberts Konzept der Intereffikation. Klassische Literatur von Autoren wie Bentele, Kunczik, Merten und Ruß-Mohl wird ebenfalls genannt.
Wer sind die im Dokument "Kritik an der PR Ansätze und Fallbeispiele" genannten Experten?
Das Dokument erwähnt Joachim Westerbarkey, Klaus Kocks (ehemaliger PR-Chef von Volkswagen AG), Klaus Merten und Tobias Liebert als Experten in den Bereichen PR und Journalismus.
- Citation du texte
- Oliver Tissen (Auteur), 2008, Thesenpapier zur Kritik an der PR - Ansätze und Fallbeispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111631