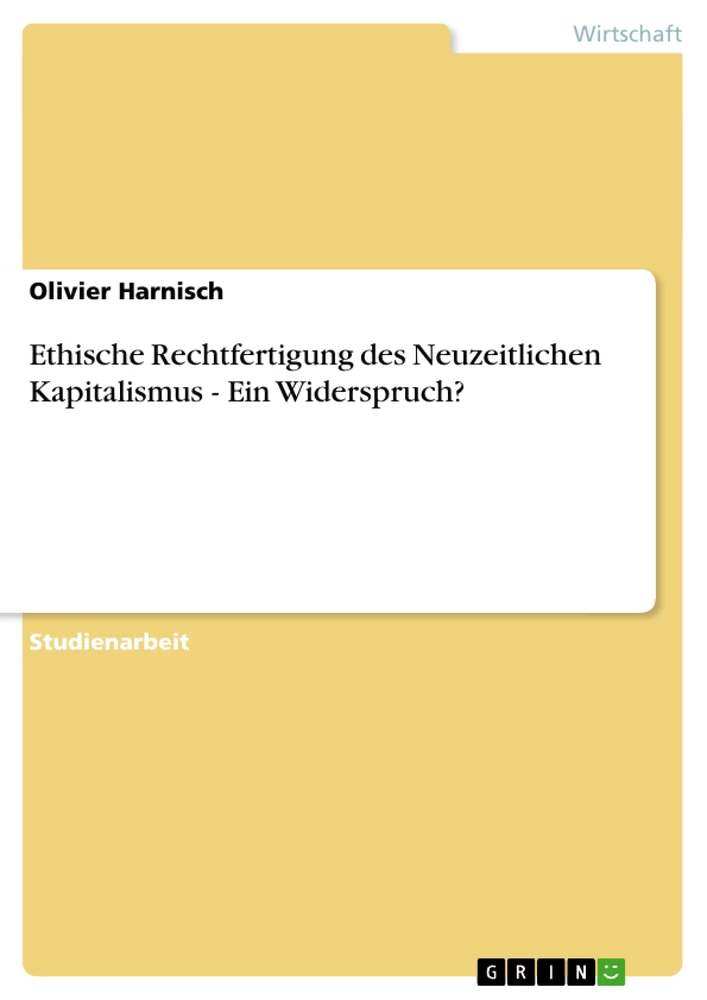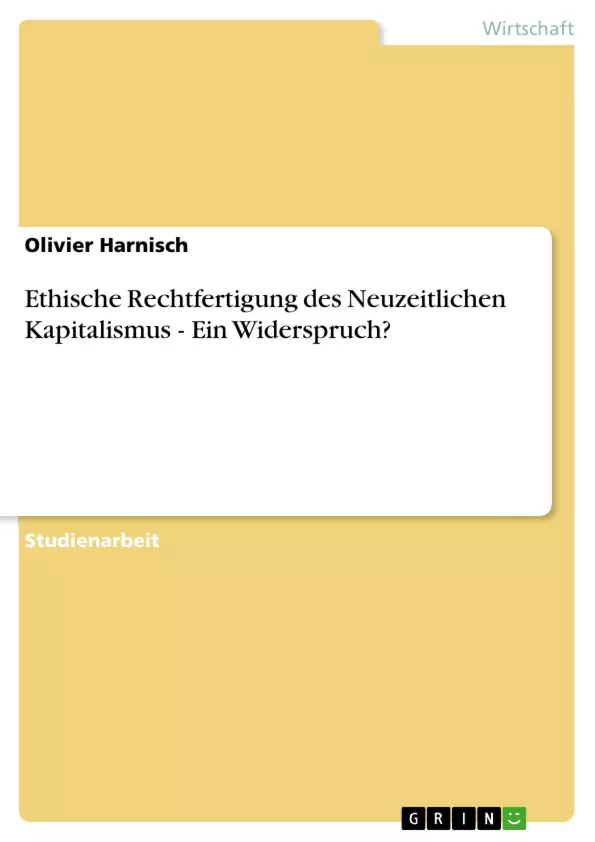Die Hauptzwecke eines Wirtschaftssystems sind die effiziente Nutzung der Ressourcen, welche einer Gesellschaft zur Verfügung stehen, sowie die gerechte Verteilung des erwirtschafteten Sozialproduktes, wobei die Distribution dem inneren Mechanismus überlassen oder bewußt durch äußeren Eingriff gesteuert werden kann. Diese beiden Hauptziele können allerdings nur im Einklang mit den übergeordneten Zielen einer Gesellschaft umgesetzt werden, da der wirtschaftliche Lebensbereich nur einen Teil des gesellschaftlichen Spektrums abdeckt. Es gab immer wieder Tendenzen, wirtschaftliche Modelle zu ideologisieren und die angewandten Methoden auf andere Gesellschaftsbereiche auszuweiten. Der Kapitalismus ist hierbei keine Ausnahme. Verfechter der Marktwirtschaft weiten ihre Prinzipien häufig auf außer-ökonomische Gesellschaftsbereiche aus und sprechen ihnen eine naturgesetzliche Allgemeingültigkeit zu. Der Kapitalismus wird hauptsächlich mit den Argumenten der Naturgesetzlichkeit, der konzeptuellen Simplizität und der Realitätstreue gerechtfertigt. Es wird argumentiert, dass seine Mechanismen denen der Natur entsprechen und der Mensch daher nur begrenzt eingreifen sollte, auch wenn er ausgeprägte Möglichkeiten dazu hat. Trotz dieser Anschauung werden enorme Ansprüche an den Kapitalismus gestellt, da er ideologisch dem neuzeitlichen, individualistisch geprägten Freiheitsgedanken sehr nahe steht. Man sieht eine enge Verbindung zwischen der kapitalistischen Entwicklung und dem Werdegang der modernen, freiheitlichen Gesellschaftssysteme. Beide Konzepte basieren auf das gemeinsame Axiom der individuellen Freiheit eines jeden Menschen. Über den Individualismus hinaus wird in der Marktwirtschaft ein Menschenbild vertreten, das nicht der weit verbreiteten Vorstellung eines guten, moralischen Menschen entspricht. Dieses Bild wird im wirtschaftlichen Kontext dennoch allgemein akzeptiert.
[...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ..
2. Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen
2.1. Ethische Rechtfertigung
2.2. Neuzeitlicher Kapitalismus
3. Axiome und Paradigmen
3.1. Die Bedeutung von Axiomen und Paradigmen
3.2. Axiome und philosophische Stützen des Kapitalismus
3.2.1. Die Teleologie
3.2.2. Der Utilitarismus
3.2.3. Der Empirismus
3.2.4. Der Individualismus
3.2.5. Die Vetragstheorie
3.3. Meine eigenen Axiome
4. Die geschichtliche Entwicklung des Kapitalismus
4.1. Der klassische Kapitalismus
4.2. Depression und Gewerkschaften
4.3. Der Keynesianismus
4.4. Der Monetarismus
4.5. Globalisierung
4.6. Zwei Alternativen zum neo-liberalen Kapitalismus
4.6.1. Der Sozialismus
4.6.2. Die soziale Marktwirtschaft
5. Die gesellschaftliche Bedeutung des Kapitalismus
6. Das Individuum im Kapitalismus
7. Ethische Kritik des Kapitalismus innerhalb seines Paradigmas
7.1. Moralische Naturgesetze
7.2. Mechanistische Funktionsweise
7.3. Die Bedeutung des Menschen
7.4. Kontrolle durch Menschen
7.5. Infiltration in Gesellschaft und Wissenschaft
8. Ethische Kritik des Kapitalismus außerhalb seines Paradigmas
8.1. Die wahre Natur des Menschen
8.2. Der Mensch als soziales Wesen
8.3. Nutzenfunktionen
8.4. Wohlstandskriterien
8.5. Das Gefangenendilemma
8.6. Verteilungsgerechtigkeit
8.7. Produktvielfalt und Ressourcenverschwendung
9. Ethische Rechtfertigung des neuzeitlichen Kapitalismus
9.1. Teilsystem der Gesellschaft
9.2. Freiheitliches System
9.3. Ethik im Kapitalismus
9.4. Der Einfluß des Staates
9.5. Kapitalismus und Moralität
10. Fazit
Literaturverzeichnis
Abstract
Die Hauptzwecke eines Wirtschaftssystems sind die effiziente Nutzung der Ressourcen, welche einer Gesellschaft zur Verfügung stehen, sowie die gerechte Verteilung des erwirtschafteten Sozialproduktes, wobei die Distribution dem inneren Mechanismus überlassen oder bewußt durch äußeren Eingriff gesteuert werden kann. Diese beiden Hauptziele können allerdings nur im Einklang mit den übergeordneten Zielen einer Gesellschaft umgesetzt werden, da der wirtschaftliche Lebensbereich nur einen Teil des gesellschaftlichen Spektrums abdeckt. Es gab immer wieder Tendenzen, wirtschaftliche Modelle zu ideologisieren und die angewandten Methoden auf andere Gesellschaftsbereiche auszuweiten. Der Kapitalismus ist hierbei keine Ausnahme. Verfechter der Marktwirtschaft weiten ihre Prinzipien häufig auf außer-ökonomische Gesellschaftsbereiche aus und sprechen ihnen eine naturgesetzliche Allgemeingültigkeit zu. Der Kapitalismus wird hauptsächlich mit den Argumenten der Naturgesetzlichkeit, der konzeptuellen Simplizität und der Realitätstreue gerechtfertigt. Es wird argumentiert, dass seine Mechanismen denen der Natur entsprechen und der Mensch daher nur begrenzt eingreifen sollte, auch wenn er ausgeprägte Möglichkeiten dazu hat. Trotz dieser Anschauung werden enorme Ansprüche an den Kapitalismus gestellt, da er ideologisch dem neuzeitlichen, individualistisch geprägten Freiheitsgedanken sehr nahe steht. Man sieht eine enge Verbindung zwischen der kapitalistischen Entwicklung und dem Werdegang der modernen, freiheitlichen Gesellschaftssysteme. Beide Konzepte basieren auf das gemeinsame Axiom der individuellen Freiheit eines jeden Menschen. Über den Individualismus hinaus wird in der Marktwirtschaft ein Menschenbild vertreten, das nicht der weit verbreiteten Vorstellung eines guten, moralischen Menschen entspricht. Dieses Bild wird im wirtschaftlichen Kontext dennoch allgemein akzeptiert. Die kapitalistische Philosophie beinhaltet weitere Widersprüche und logische Unklarheiten. Dennoch hat sich der Kapitalismus in der Realität bewährt, und er hat gezeigt, dass er mit dem Prinzip der individuellen Freiheit kompatibel ist und ihm bisher tatsächlich weitestgehend gedient hat. Trotzdem muß eine kontinuierliche Infragestellung und Weiterentwicklung des kapitalistischen Gedankengutes erhalten bleiben, da die Schwächen der Marktwirtschaft unübersehbar sind und sich mit Sicherheit Verbesserungsmöglichkeiten ergeben. Außerdem entwickelt sich die Gesellschaft kontinuierlich, dementsprechend ändern sich ihre Bedürfnisse und Anschauungen im Laufe der Zeit. Dennoch wird es wohl nicht möglich sein, ein Wirtschaftsmodell zu entwickeln, dass von allen Menschen befürwortet wird, da das vertretene Menschenbild und das daraus resultierende Gerechtigkeitsverständnis für die Bewertung des Systems von großer Bedeutung sind, und hier wird es immer unterschiedliche Anschauungen geben.
1. Einleitung
Zum Anfang des 21. Jahrhunderts ist der weltweite Siegeszug des kapitalistischen Wirtschaftsmodells nicht mehr zu leugnen. Praktizierbare Alternativen zum Kapitalismus werden in der westlichen Welt politisch kaum noch ernsthaft in Betracht gezogen. Der Zusammenbruch des Warschauer Paktes und der zugrundeliegenden sozialistischen Ideologie hat die Marktwirtschaft in eine einsame, rivalitätsarme Lage versetzt. Die Ökonomien der ehemaligen sozialistischen Länder haben seither in unterschiedlichem Umfang marktwirtschaftliche Prinzipien übernommen und die früher zahlreichen kritischen gegnerischen Stimmen des Kapitalismus sind in der Regel kaum noch in den legislativen und exekutiven Gremien der Politik vertreten. Ist diese Entwicklung zu begrüßen oder ist vielmehr zu befürchten, dass die abnehmende Infragestellung der Marktwirtschaft in Zukunft auch zunehmend weniger Gehör finden wird? Wird langfristig die Bereitschaft bestehen bleiben, sich mit alternativen Möglichkeiten der materiellen Bedarfsdeckung von Gesellschaften zu befassen oder wird diese Aufgabe den bereits zahlreichen militanten, global organisierten Randgruppen und der Wirtschaftsphilosophie überlassen? Das wäre bedauernswert, da diese Entwicklung wohl zu einem zunehmend arroganten Selbstverständnis des kapitalistischen Gedankengutes führen würde, um so mehr, weil die Schwächen des Kapitalismus unübersehbar sind. Verteilungsungerechtigkeiten, Marktversagen, Externalitäten, sind nur einige Beispiele für wirtschaftliche Herausforderungen, die der Marktmechanismus alleine nicht zufriedenstellend lösen kann. Diese Tatsachen werden in der Regel von Verfechtern der Marktwirtschaft eingeräumt, werden jedoch zugleich in Kauf genommen, mit der Begründung, dass der Kapitalismus das für menschliche Gegebenheiten realistischste Wirtschaftsmodell sei. Ferner habe er eine in der Vergangenheit beispiellose Entwicklung der Wissenschaften sowie einen kontinuierlich ansteigenden materiellen Wohlstand ermöglicht und gefördert. Die erste Begründung zeigt die Wichtigkeit des bei dieser Kritik zugrundeliegende Menschenbild. Eine bewußte und klare Grundüberzeugung zu den menschlichen Eigenschaften ist für derartige Überlegungen und Auseinandersetzungen unerläßlich. Das zweite Argument ist als Tatsache nicht zu bestreiten, ist es jedoch zufriedenstellend? Hätten sich Wohlstand und Wissenschaft auch ohne Kapitalismus auf derartig positive Weise entwickeln können? Und kann dieser in der Welt sehr ungleichmäßig verteilte Wohlstand als Rechtfertigung ausreichen? Ist das nicht eine sehr einseitige Einschätzung der gesellschaftlichen Entwicklung? Liegt hier nicht auch die Gefahr, dass wir, die in einem kapitalistischen System leben und von ihm womöglich geprägt wurden, gerade die Kriterien zur Bewertung anwenden, welche von der Marktwirtschaft herausgehoben werden und uns somit in einem hermeneutischen Zirkel befinden? Trotz des Erfolges des Kapitalismus besteht in der Gegenwart kein Konsens über seine Überlegenheit im Vergleich zu anderen Wirtschaftsmodellen. Von den nur noch wenigen nicht-kapitalistischen Ländern (Kuba, Nordkorea, …) her abgesehen, existieren in zahlreichen kapitalistischen Demokratien parlamentarische Minderheiten, die weiterhin leidenschaftlich auf die Defizite der Marktwirtschaft hinweisen. Auch in der akademisch-philosophischen Welt herrscht keineswegs Einigkeit über die Superiorität des Kapitalismus. Die in jüngster Zeit zu bedeutenden und exponierten internationalen Anlässen (Seattle, Davos, …) immer häufiger auftretenden Demonstrationen gegen die hemmungslose geographische und gesellschaftliche Ausbreitung der Marktwirtschaft und die daraus resultierende Globalisierung weisen auch auf einen zunehmenden Unmut bei zumindest einzelnen, jedoch international organisierten, Gruppierungen hin. Sie beklagen die weltweit enormen Wohlstandsunterschiede, die zunehmende Entfremdung der Menschen untereinander und die geringe Beachtung der nicht-humanen Existenz sowie die offensichtliche Unfähigkeit der Politik, zukünftige Generationen in das ökonomische Kalkül einzubeziehen. Verfechter des Kapitalismus argumentieren weiterhin mit der historisch parallelen Entwicklung von individueller Freiheit und ökonomischem Liberalismus. Die konsequente Umsetzung marktwirtschaftlicher Prinzipien sei mit einer diktatorischen Politik langfristig nicht vereinbar. Im Übrigen gewährleiste das realitätstreue Menschenbild des Kapitalismus ein zwar nicht perfektes aber dennoch menschenfreundliches und in der Realität umsetzbares Wirtschaftsmodell, was entscheidend besser sei als ein idealistisches, nicht umsetzbares Konzept. Es ist dennoch interessant zu beobachten, dass der Begriff "Kapitalist" eine scheinbar pejorative Konnotation beinhaltet und so manche marktwirtschaftlich gesinnte Menschen sich nicht als Kapitalisten bezeichnen würden. Man kann die Behauptung wagen, dass die kapitalistische Ideologie mit weniger Erfolg voranschreitet als das entsprechende Wirtschaftsmodell. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass das zugrundeliegende Menschenbild und das daraus zwangsläufig resultierende Verständnis menschlicher Interaktionen in den Augen vieler Menschen zwar den existierenden Gegebenheiten entspricht, jedoch dem in den meisten Kulturen und Religionen herrschenden Bild eines guten Menschen nicht entspricht. Dies würde bedeuten, dass in den Augen dieser Menschen eine Diskrepanz zwischen dem Seienden und dem Gewünschten (Gesollten) existiert. Diese Überlegung kann eine normative Einschränkung der individuellen Freiheit des Menschen im Wirtschaftsleben rechtfertigen, gegen welche Liberalisten sich aussprechen. Wenn wir Menschen unseren eigenen Ansprüchen an Menschlichkeit nicht genügen, sollten wir dann nicht nach einem Weg suchen, dieser Vorstellung gerecht zu werden, auch, wenn dies ein Maß an Freiheitseinschränkung beinhaltet? Das Laissez-Faire-Prinzip kann nur funktionieren, wenn der Mensch, trotz seiner Fehlbarkeiten in der Lage ist, in bestimmten Situationen und auf bewußte Weise nicht egoistisch zu handeln. Sonst würde sich dieses Prinzip selbst unterminieren, da der individuelle Freiheitsgedanke, auf dem es basiert nicht langfristig aufrecht erhalten werden könnte. Ungezügeltes, rücksichtsloses, Mitmenschen-nicht-beachtendes Verhalten produziert Unfreiheit und beseitigt die Freiheit, die dieses Verhalten ursprünglich ermöglicht hat.
2. Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen
Von Menschen entwickelte Begriffe haben keine objektive Bedeutung, sie werden vor dem Hintergrund der Erfahrungen und Vorstellungen eines jeden Individuums verstanden. Um die Möglichkeit von Mißverständnissen zu verringern, ist es deshalb sinnvoll, die in der Aufgabenstellung angewendeten Begriffe, so wie ich sie verstehe, im hermeneutischen Sinne zu erläutern. Dies gibt dem Leser die Möglichkeit, die auf diese Begriffe aufbauenden Gedankenvorgänge genauer nachzuvollziehen.
2.1. Ethische Rechtfertigung
Die Ethik ist die Wissenschaft der Moral. Sie untersucht, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Handeln als gut bezeichnet werden kann. Ein Handeln kann diese unbedingte Bewertung nur erhalten, wenn es für das Erreichen eines für die Menschheit höchsten Gutes förderlich ist. Die individuelle Freiheit des Menschen wird häufig als dieses höchste, keiner Rechtfertigung bedürfende Gut betrachtet. Diese Freiheit impliziert jedoch zwangsläufig, dass jeder Mensch autonom entscheiden kann, ob er dieser Ansicht zustimmen möchte. Schließt man sich dieser Argumentation an, so muß akzeptiert werden, dass alle Handlungen, die diese Freiheit fördern, per se gut sind. Diese weit verbreitete Ansicht vertrete auch ich. Dies jedoch nur bedingt, weil sie mir als nicht weitgehend genug erscheint. Sie schließt weder zukünftige Generationen mit ein, noch berücksichtigt sie die Rechte nicht menschlicher Lebewesen, Mitgeschöpfe, die meiner Auffassung nach ebenfalls schützenswerte Rechte besitzen. Da die Tier- und Pflanzenwelten ihre Interessen nicht selbst vertreten können, muß der Mensch sie im Rahmen seiner ethischen Überlegungen einbeziehen. Manche Philosophen gehen noch einen Schritt weiter, indem sie der nicht-lebenden Schöpfung Rechte einräumen[1]. Diese Philosophie hingegen ist für mein Verständnis schwierig nachzuvollziehen, da die Kombination von nicht-organischer Existenz und Recht nicht ableitbar ist. Ich werde den Kapitalismus deshalb unter dem Aspekt untersuchen, ob er den freiheitlichen Rechten der lebenden und zukünftigen Lebewesen gerecht wird. Ein für ethische Untersuchungen der Marktwirtschaft entscheidendes Kriterium ist die Differenzierung zwischen teleologischen und deontologischen Positionen. Das kapitalistische System, auch wenn es die Notwendigkeit von Ethik zum Teil negiert, favorisiert die teleologische Denkrichtung. Ein Handeln, dass seinen vorher festgelegten Zweck erfüllt, ist wertvoller als eines, das sein Ziel verfehlt. Im Gegenteil hierzu legt die deontologische Anschauung den Schwerpunkt auf den Maßstab, der für das Handeln zugrunde gelegt wurde, der wichtiger ist als das letztendlich erzielte Ergebnis.
2.2. Neuzeitlicher Kapitalismus
Der Kapitalismus ist ein Wirtschaftsmodell, eine Form der Wirtschaftsorganisation, die auf der Grundlage des Tausches zwischen freien, selbstinteressierten Individuen beruht. Obgleich es verschiedene Ausprägungen der Marktwirtschaft gibt, hat dieses Wirtschaftssystem nach Koslowski drei wesentliche Merkmale, die es von anderen Wirtschaftssystemen abgrenzen: Private Verfügung über Produktionsmittel; Markt- und Preismechanismus als Koordinationsmittel; Gewinn- und Nutzenmaximierung als wesentliche Motivation der Wirtschaftenden.[2] Nell-Breuning hingegen definiert den Kapitalismus aus der Perspektive des Eigentums an den Produktionsfaktoren und schreibt: „Deshalb habe ich jene Wirtschaftsweise als „kapitalistisch“ bezeichnet, bei der Kapital und Arbeit in der Weise aufeinander angewiesen sind, dass es zwei verschiedene Gruppen von Personen sind, deren eine (nur) Kapital und deren andere (nur) Arbeit einsetzt, wobei der Wirtschaftsprozeß im ganzen von seiten derer, die das Kapital einsetzen, organisiert und geleitet wird.“[3] In den folgenden Ausführungen wird der Begriff “Marktwirtschaft” als Synonym zu Kapitalismus verwendet. Der Hauptgrund hierfür liegt darin, dass der Kapitalismus tatsächlich als Wirtschaftsmodell zu betrachten ist und nicht als Gesellschaftssystem, auch wenn er starken Einfluß auf die außer-ökonomische Lebensweise der ihn praktizierenden Gesellschaft ausübt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Begriff „neuzeitlicher Kapitalismus“ zu definieren. Es kann hierunter zum Beispiel der nach dem zweiten Weltkrieg weit verbreitete Keynesianismus verstanden werden. Hierbei geht es um eine Form der Marktwirtschaft, die die Schwächen der Selbstregulierungstheorie erkannt hat und eine aktive, kontrazyklische Wirtschaftspolitik befürwortet. Als weiteres mögliches Synonym für „neuzeitlicher Kapitalismus“ kann auch der in den 70er Jahre durch Milton Friedman berühmt gewordene Monetarismus dienen. Der Monetarismus propagiert eine Rückkehr zur Enthaltung des Staates aus der aktiven Wirtschaftspolitik. Die Hauptaufgabe der Regierungen wird in der Gewährleistung einer ökonomisch fruchtbaren Umgebung gesehen, sodass Unternehmer in der Lage sind, effektiv zu planen und nicht-produktive Marktfriktionen minimiert werden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen hierfür ist eine geringe und gleichmäßige Inflationsrate. Eine aktives Eingreifen des Staates in die Privatwirtschaft halten Monetaristen für schädlich, da dies unter Umständen die Verfügbarkeit von Kapital für Unternehmerinvestitionen erschweren kann. Des weiteren beziehen Monetaristen, allen voran Milton Friedman, eine konkrete Position zur Notwendigkeit von moralischem Handeln seitens der Privatunternehmen. Moralisches, nicht gesetzlich gebotenes, Handeln (ein aus kantianischer Perspektive tautologischer Ausdruck), sei im wahrsten Sinne unmoralisch, da es das moralische Unternehmen in eine wettbewerbsmäßig gefährdete Lage gegenüber seiner Konkurrenz bringe und somit das von Aktionären investierte Kapital in Gefahr setze. Aktieninhaber kaufen Anteile von Unternehmen, von denen sie annehmen, dass sie sich erfolgreich auf dem Markt durchsetzen werden. Moralisches Handeln seiten der Unternehmen sei vom Gesetzgeber nicht geboten, führe zu einer Erhöhung der Kosten und sei somit ein Betrug am Aktionär. Als weitere mögliche Definition für „neuzeitlicher Kapitalismus“ kann auch die seit den 90er Jahre stark voranschreitende Globalisierung mit ihren Nebenerscheinungen dienen. Zahlreiche finanzstarke, multinationale Unternehmen sind seit der sukzessiven Öffnung vieler Märkte in den letzten Jahren weltweit vertreten. Diese Entwicklung hat zu der Entstehung zahlreicher neuer ethischer Problemstellungen geführt. Zum Beispiel stellt die Ausfuhr von Gewinnen aus Drittweltländern eine Herausforderung. Auch die zunehmende Verschlechterung der Handelskonditionen (Terms of Trade) für Länder der dritten Welt hat zu starken internationalen Friktionen geführt. Da der „neuzeitliche Kapitalismus“ auf verschiedenste Weisen definiert werden kann, werde ich in den folgenden Ausführungen auf Erscheinungen der drei erwähnten Entwicklungen eingehen.
3. Axiome und Paradigmen
3.1. Die Bedeutung von Axiomen und Paradigmen
Axiome sind Grundgewißheiten, mit denen alle weiteren Überzeugungen eines Menschen kompatibel sein müssen, um logische Gedankenstrukturen aufzubauen, die zu Paradigmen entwickelt werden. Es sind nicht weiter reduzierbare Überzeugungen, die oftmals die Persönlichkeit eines Menschen prägen, weil sie seine allgemeine Weltanschauung und seine spezifischen Ansichten zu bestimmten Themen stark beeinflussen. Amitai Etzioni hat Paradigmen wie folgt beschrieben:
„Die vorherrschenden Paradigmen definieren nicht nur das, was für wahr gehalten wird. Auch die Kriterien, nach denen solche Behauptungen bewertet werden, sind streng subjektiv oder Teil des eigenen Paradigmas. Die Denkweise der Marxisten, Psychologen und neoklassischen Ökonomen erscheinen uns nur dann logisch, wenn wir uns ihre Grundannahmen und ihre Bewertungssysteme aneignen.“[4]
Da Axiome und Paradigmen stark internalisiert sind, werden sie vom Träger selten in Frage gestellt und, wenn von einer anderen Person angegriffen, oftmals mit Leidenschaft verteidigt. Sie können auf zahlreiche Weisen zustande kommen. Häufig entstehen sie graduell durch Erziehung, Lebenserfahrung, Kultur, Bildung, … und werden auf unbewußte Weise internalisiert. Manchmal werden Sie durch Introspektion bewußt angenommen. René Descartes ist ein bekanntes Beispiel eines Philosophen, der im Erwachsenenalter alle übernommenen Überzeugungen bewußt ablegte, um durch intensive Kontemplation und Überlegungen zu unerschütterlichen Gewißheiten zu gelangen. Sein einziges hieraus resultierende Axiom war die absolute Gewißheit, dass sein Geist existiere, er folglich sei. Daher stammt sein berühmter Satz „Ich denke, also bin ich.“[5] Descartes baute anschließend sein gesamtes Denken auf dieses einzige, ursprüngliche Axiom auf. Eine weitere, sehr häufige, Quelle für Axiome ist die Religion. In Diskussionen und Abhandlungen, besonders in denjenigen der Philosophischen Art, die tiefgründige und fundamentale Gedanken behandeln, erscheint es sinnvoll, die Zuhörerschaft oder Leserschaft von vorne herein, über die eigenen Axiome aufzuklären. Dies hat den Vorteil, dass die Argumente aus der Perspektive des Vortragenden besser verstanden werden können. Im Übrigen werden Auseinandersetzungen oftmals auf einer höheren Ebene geführt, obwohl die Differenzen auf unterschiedliche Axiome zurückzuführen sind. Das Erreichen eines Konsenses ist somit sehr unwahrscheinlich, da dies eine Veränderung in den Axiomen eines Gesprächspartners notwendig machen würde. Eine Übereinstimmung kann vollkommen oder partiell sein: Zum einen können sowohl die Axiome des Gesprächspartners geteilt als auch die Logik der Argumentationskette nachvollzogen werden. Dadurch entsteht eine vollkommene Übereinstimmung zwischen Gesprächspartnern. Auch wenn den Axiomen (Prämissen) nicht zustimmt wird, ist es dennoch möglich eine logische Argumentation zu erkennen. Somit bleibt eine partielle Übereinstimmung. Als Beispiel kann eine Diskussion über die Christliche Religion zwischen einem Christen und einem Atheisten dienen. Auch wenn der Atheist den Axiomen des Christen nicht zustimmen mag, kann er sich dennoch in sein Denken hineinversetzen, wenn es logisch auf diesen Prämissen aufbaut. Eine weitere Möglichkeit der partiellen Übereinstimmung beruht auf gemeinsame Axiome, mit einer anschließenden Differenz bezüglich der Logik des auf diesen Prämissen aufgebauten Gedankengerüstes. Die Philosophie bietet zahlreiche Beispiele von rationalistischen Denkrichtungen, die auf ursprünglich gemeinsame Anschauungen beruhen, um danach unterschiedlich logisch zu argumentieren. Eine klare Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten der Übereinstimmung ist sehr wichtig, um mögliche Differenzen innerhalb einer Diskussion einfacher erkennen zu können und die Argumentation an richtiger Stelle anzusetzen.
3.2. Axiome und philosophische Stützen des Kapitalismus
Die Axiome des Kapitalismus sind zum Teil auf seine denkerische Vorgeschichte zurückzuführen, da er zeitlich nach zahlreichen philosophischen Konzepten entwickelt wurde. Die Gründer des marktwirtschaftlichen Gedankengutes haben sich von diesen Konzepten beeinflussen lassen und haben eigene Theorien hierauf aufgebaut.
3.2.1. Die Teleologie
Diese philosophische Lehre ist eine bedeutende Grundlage für den Kapitalismus. Sie besagt, dass alle Geschehnisse, einschließlich der menschlichen Handlungen, auf ein bestimmtes, positiv zu bewertendes Ziel (Telos) gerichtet sind. Diese Theorie spricht allen Geschehnissen einen Sinn zu, dabei ist es irrelevant, ob dieser Sinn bekannt ist oder nicht. Für die ethische Rechtfertigung von Handlungen und Regelsystemen ist die Teleologie sehr wichtig, da das beabsichtigte Ziel einer ethischen Überprüfung unterzogen werden kann und die betroffene Handlung unter ethischen Aspekten bewertet werden kann. Da der Mensch gemäß der kapitalistischen Theorie stets im eigenen Interesse handelt, sind ihm die Ziele seiner Handlungen in diesem Sinne zwangsläufig bewußt. Die Teleologie hat die Entwicklung westlicher Gesellschaften stark beeinflußt, und es ist denkbar, dass sie die natürliche Neigung des Menschen, für alle natürlichen Gegebenheiten eine Erklärung zu finden, weiterhin verstärkt hat.
3.2.2. Der Utilitarismus
Diese philosophische Anschauung hatte ebenfalls einen entscheidenden Einfluß auf die kapitalistische Entwicklung. Hier geht es um das Hervorbringen von Glück für die Menschheit als moralisches Bewertungskriterium für Handlungen. Das klar formulierte Ziel des Utilitarismus ist „das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl von Menschen“. Auf dieser Position aufbauend, hat Adam Smith das Konzept der „unsichtbaren Hand“ entwickelt. Selbstinteressierte Handlungsträger konkurrieren im Marktgeschehen gegeneinander und ohne Einmischung der staatlichen Autoritäten, was zwangsläufig zu einer optimalen Allokation der Ressourcen führt, und der Wohlstand sowie das Glück der Gesellschaft werden maximiert. Die Umsetzung der utilitaristischen Maxime hat sich als stets problematisch herausgestellt, da Auswirkungen und Ergebnisse von einzelnen Handlungen selten vollständig abzusehen sind. Weiter hat die Frage der Gerechtigkeit im Utilitarismus immer große Probleme aufgeworfen. Ist ein großes Leid für ein einzelnes Individuum mit dem Nutzen einer Vielzahl von Menschen zu rechtfertigen? Wie sind die Ansprüche der Natur in dieser Philosophie zu betrachten? Um die Anwendung des Utilitarismus zu vereinfachen, wurde der Regelutilitarismus vorgeschlagen, der sich mit der Entwicklung allgemeiner glückmaximierender Handlungsregeln beschäftigt, anstatt jede einzelne Handlung einer utilitaristischen Überprüfung zu unterziehen. Der Utilitarismus hat das gegenwärtige Denken stark geprägt, und heute werden politische, rechtliche und wirtschaftspolitische Entscheidungen häufig nach utilitaristischen Maßstäben getroffen.
3.2.3. Der Empirismus
Der Empirismus besagt, dass jegliches Wissen aus der sinnlichen Wahrnehmung abgeleitet wird. Im Gegensatz zum Rationalismus, der der Vernunft und dem apriorischen Wissen einen höhere Gewichtung einräumt als der Sinneserfahrung, spricht der Empirismus der Vernunft lediglich eine synthetisierende Funktion zu. Der Kapitalismus ist auf einer empiristischen Anschauung aufgebaut, er läßt vergleichsweise wenige apriorische Normen zu. Verfechter der Marktwirtschaft weisen auf das tatsächlich zu beobachtende Verhalten des Homo Oeconomicus hin und lehnen Gesellschaftliche Systeme ab, die den Anspruch erheben, Verhaltensveränderungen im Menschen zu bewirken. Die in der Realität gewonnenen Erkenntnisse werden als Maßstab herangezogen, und die typisierende Aussage, dass der Mensch selbstinteressiert handelt, wird aus der beobachtenden Erfahrung abgeleitet. Als Rechtfertigung für die Marktwirtschaft werden häufig die empiristischen Argumente der Realitätstreue, der materiellen Wohlstandserzeugung und des seit zweieinhalb Jahrhunderten Fortbestehens des Kapitalismus genutzt.
3.2.4. Der Individualismus
Der Individualismus hat den Kapitalismus und das westliche Freiheitsverständnis entscheidend geprägt, indem der Mensch unter Betonung seiner individuellen Freiheit zum Ausgangspunkt der Wertehierarchie gemacht wurde. Von der menschlichen Freiheit geht alles individualistische Denken und Handeln aus, denn sie ist das letzte, nicht mehr begründungsbedürftige Gut freiheitlicher Gesellschaften. Teilsysteme derartiger Gesellschaften, wie es der Kapitalismus ist, bedürfen einer Moral, da dem Individuum in vielen Lebenslagen große Entscheidungsspielräume überlassen werden. Diese Tatsache wird in der kapitalistischen Theorie oft geleugnet. Die individualistische Moralität gibt dem Menschen bei Interessenkonflikten die Möglichkeit, innerhalb seiner vielfältigen Handlungsmöglichkeiten die Freiheit seiner Mitmenschen und Mitgeschöpfe zu bedenken und entsprechend zu entscheiden. Somit wird dem Bürger mehr Verantwortung für sein Handeln gegeben. Sehr individualistisch gesinnte Gesellschaften wie in den angelsächsischen Ländern verdeutlichen diesen Fokus auf die Einzelverantwortung, indem Sie soziale Einflüsse bei Straftaten oder ärmliche Lebensverhältnissen weniger gelten lassen, als dies zum Beispiel in Westeuropa der Fall ist, wo der Individualismus weniger ausgeprägt ist.
3.2.5. Die Vertragstheorie
Diese von Thomas Hobbes geprägte Gerechtigkeitstheorie besagt, dass Menschen innerhalb einer Gemeinschaft aufgrund der wechselseitigen Interaktionen implizite Verträge mit ihren Mitmenschen eingehen, die für die Allgemeinheit von Vorteil sind. Er geht in seinen Ausführungen auf einen ursprünglichen, gesetzlosen Naturzustand zurück, in dem jeder Mensch im vollen Besitz seiner natürlichen Freiheiten ist. Dieser Ursprungszustand bietet dem Individuum keine Sicherheit, da er sich ständig vor der herrschenden Willkür fürchten muß. Die Vetragstheorie vertritt die These, dass der Mensch bereit ist, Einschränkungen in seiner Freiheit hinzunehmen, wenn prinzipiell jedem ein gleiches Recht an Grundfreiheiten zuzubilligen ist und er, sollte er in dem angestrebten System zu den am wenigsten Begünstigten zählen, den größtmöglichen Vorteil erlangt. Thomas Hobbes schreibt hierzu: „[...] denn es ist eine wahre Vereinigung in einer Person und beruht auf dem Vertrag eines jeden mit einem jeden, wie wenn ein jeder zu einem jedem sagte: „Ich übergebe mein Recht, mich selbst zu beherrschen, diesem Menschen oder dieser Gesellschaft unter der Bedingung, dass Du ebenfalls Dein Recht über Dich ihm oder ihr abtrittst“, Auf diese Weise werden alle einzelnen eine Person und heißen Staat oder Gemeinwesen.“[6] Die Vertragstheorie ist eine Ableitung des Utilitarismus und hat das kapitalistische Denken geprägt, denn die Marktwirtschaft gesteht dem Menschen prinzipiell volle Vertragsfähigkeit zu und das System beruht auf die Einhaltung abgeschlossener Verträge. In einem abgeschlossenen Privatvertrag geht der Bürger freiwillig eine gegenwärtige oder zukünftige Freiheitseinschränkung ein, da er sich einen wirtschaftlichen Vorteil davon verspricht.
3.3. Meine eigenen Axiome
Es erscheint mir notwendig, vor meinem eigentlichen Vorhaben, den Kapitalismus ethisch zu rechtfertigen, meine Axiome darzulegen. Diese Kenntnis wird dem Leser, den Zugang zu meinem Gedankengerüst erleichtern und die Ebene eines möglichen Dissenses aufzeigen. Mein Hauptaxiom ist, wie zuvor bereits angedeutet, die Überzeugung, dass der menschliche Geist per se frei ist. Er kann durch keine bewußt einwirkende äußere Macht in seiner denkerischen Tätigkeit behindert werden. Er stellt seine eigenen Regeln auf und befolgt sie nach Belieben. Diese Freiheit ermöglicht dem Menschen, sich selbständig und nach eigener Vorstellung geistig zu verwirklichen. Um jedoch seine Freiheit vollständig umsetzen zu können und dieses Grundprinzip nicht zu gefährden, muß der Bürger zwangsläufig die gleiche Freiheit anderer Menschen bejahen. Eine Anschauung, die die eigene Freiheit bejaht und den Mitmenschen die ihrige verneint ist weder logisch noch langfristig haltbar. Baruch de Spinoza zufolge ist diese Grundeinstellung ein wichtiges Merkmal eines vernünftigen Menschen: „Hieraus folgt, dass Menschen, die sich von der Vernunft regieren lassen, d.h. Menschen, die unter der Leitung der Vernunft ihren Nutzen suchen, nichts für sich verlangen, was sie nicht auch für andere Menschen begehren, und daß sie also gerecht, treu und ehrenhaft sind.“[7] Der Geist wird durch seinen Selbsterhaltungstrieb aufrechterhalten, ist jedoch vom menschlichen Körper abhängig. Die Existenz des individuellen Geistes kann nur durch die Wahrung des dazugehörenden Organismus aufrecht erhalten werden. Stirbt ein Körper, erlischt mit ihm die Funktion des korrespondierenden Geistes. Der Körper hingegen hat spezifische Bedürfnisse (needs), die befriedigt werden müssen, um leben zu können. Hier gibt es zwei Schnittstellen zu den Mitmenschen: Einerseits lassen sich manche Bedürfnisse und Wünsche nur im Einklang mit anderen Menschen umsetzen, andererseits müssen einige dieser Bedürfnisse und Wünsche auf begrenzte Ressourcen zurückgreifen, die prinzipiell allen Menschen und anderen Lebewesen zustehen. Diese Angewiesenheit auf andere Menschen erfordert kontinuierliche Interaktionen und Verhandlungen zwischen diesen, um Konsens zu erzielen. Das ist eine Voraussetzung, damit das Prinzip der Freiheit nicht in Frage gestellt wird. Da von den nicht-humanen Lebewesen keine Verteidigung ihrer Interessen zu erwarten ist, muß der Mensch, als das geistig am weitesten entwickelte Lebewesen, diese Bedürfnisse beachten. Diese Tatsache verlangt, dass der freie Geist, um seine Freiheit zu bejahen, die Freiheit seiner Mitgeschöpfe gleichermaßen bejahen muß, um nicht widersprüchlich zu sein. Die Umsetzung dieser Maxime wird durch die Tatsache erschwert, dass der Homo Sapiens faktisch hauptsächlich, wenn auch nicht ausschließlich, von seinem Eigeninteresse geleitet wird. In den meisten Entscheidungssituationen zeigt sich, dass Menschen Ihren eigenen Nutzen immer wieder in den Vordergrund stellen. Verfechter der Marktwirtschaft bedienen sich dieser Eigenschaft, um eine Vielzahl von kapitalistischen Gesetzen und Prinzipien zu erklären und zu rechtfertigen. Für manche extrem gesinnte Kapitalisten ist diese Eigenschaft, die einzige wirklich vorhersagbare menschliche Eigenschaft, die alles Handeln beeinflußt. Manchmal nehmen diese Erklärungen tautologische Formen an. Handlungen, die auf dem ersten Blick selbstlos erscheinen, werden mit der Befriedigung eines tieferen Bedürfnisses erklärt. Altruismus wird negiert. Wer zum Beispiel eine Summe Geld an eine wohltätige Organisation spendet, empfindet eine gewisse Genugtuung, die als Belohnung ausgelegt werden kann. Wäre dieses positive Gefühl nicht zu erwarten, würde dieser Mensch nicht spenden. Dies ergibt für Vertreter anderer Menschenbilder ein sehr einseitiges Bild der Humanität. Diese Ansicht teile auch ich. Der Egoismus erklärt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Vielzahl menschlicher Verhaltensweisen, deckt sie jedoch nicht alle ab. Der Mensch hat auch gelegentlich auch das Bedürfnis “gutes” zu tun, ohne hierfür jeglichen materiellen oder geistigen Nutzen zu erwarten. Solche Handlungen sind per se gut, das erzielte Ergebnis ist zweitrangig. Liebe, Mitleid, Einfühlsamkeit, usw. ... können mit Eigeninteresse nicht auf befriedigende Weise erklärt werden, insofern sind gesellschaftliche Konzepte, die nur auf diese Eigenschaft bauen nicht umfassend genug. Ferner sind ethische Konzepte, die auf die Freiheit und Bedürfnisse der gegenwärtig lebenden Schöpfung fokussieren, nicht umfassend genug, da sie die Rechte der zukünftiger Generationen nicht berücksichtigen.
4. Die geschichtliche Entwicklung des Kapitalismus
Es gab immer normative Erwartungen an den Staat, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten, sei es nur, sich aus dem Marktgeschehen weitestgehend herauszuhalten, um die möglichst besten Handelsbedingungen gewährleisten zu können. Andere erwarten, dass Regierungen aktive Wirtschaftspolitik betreiben, weil sie erkannt haben wollen, dass die Marktwirtschaft nicht in allen Situationen optimale Ergebnisse erzielen kann. Die Epoche, zu der von staatlicher Seite am wenigsten in den Marktmechanismus eingegriffen wurde, war der Zeitraum vom Ende des 18. bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein. Das war die Zeit des Merkantilismus, in der Regierungen sich darauf konzentrierten, eine positive Handelsbilanz zu erzielen, um das eigene Land zu stärken. Obwohl es zu dieser Zeit bereits prominente Kritiker der ungezügelten Marktwirtschaft gab, hielt sich der Staat weitestgehend aus privatwirtschaftlichen Angelegenheiten heraus. Je weiter die industrielle Revolution voranschritt, desto mehr wurden die verheerenden Auswirkungen des ungezügelten Kapitalismus sichtbar.
4.1. Der klassische Kapitalismus
Der klassische Kapitalismus wird in der Regel mit der Lehre Adam Smiths’ in Verbindung gebracht. Vor Adam Smith hatten vor allem utilitaristisch gesinnte Philosophen den denkerischen Weg für die Marktwirtschaft geebnet. Charakteristisch sind für den Kapitalismus einerseits die extreme Produktivitätssteigerungen durch Arbeitsteilung und die daraus resultierenden Skalenerträge sowie die kurzfristig selbstregulierenden Eigenschaften des sich selbst überlassenen Marktes. Adam Smith vertrat die Theorie, dass obwohl das Individuum sich nur auf seine eigenen Interessen besinnt, das Zusammenwirken einer Vielzahl dieser Eigeninteressen Ergebnisse hervorbringt, die dem Sozialinteresse entsprechen. Dieses Ergebnis wird vor allem durch effiziente Produktion und entsprechendem Haushalt der knappen Ressourcen sowie einer optimalen Verteilung des Produktionsergebnisses nach dem Prinzip des wirtschaftlichen Beitrages und der Zahlungsbereitschaft erreicht. Somit wurde eine Einmischung des Staates als schädlich angesehen, da das Optimum nicht mehr erreicht werden könnte. Das bewußt herbeigeführte Ergebnis mußte demnach zwangsläufig suboptimal sein. Dieses Phänomen der ungesteuerten Kongruenz zwischen Individual- und Sozialinteresse ist interessant, da es den Status eines mechanistischen Naturgesetzes annimmt. Ein bewußter Eingriff des Menschen in diesen Prozeß wird als nicht notwendig betrachtet. Allerdings räumte Adam Smith bereits Bereiche ein, in denen die marktwirtschaftliche Effizienz versagt: Bei öffentlichen Gütern und Externalitäten zum Beispiel ist ein marktexterner Eingriff notwendig. Aus diesem Grunde wurde ein gewisses Maß an staatlichem Einfluß trotz allem als unvermeidbar angesehen. Nach Smith wird David Ricardo als weiterer großer klassischer Vertreter des Kapitalismus angesehen. Er propagierte eine Beseitigung der Handelsbeschränkungen zwischen den Nationen, damit jedes Land seine Handelsvorteile (competitive advantages) ausnutzen und weiter ausbauen kann, und, genauso so wie jeder Markteilnehmer vom freiem Handeln auf dem nationalen Markt profitiert, profitiert auch jede Nation vom freien Handeln auf internationaler Ebene. Diese Theorie hat besonders in den beiden letzten Jahrzehnten im Hinblick auf Globalisierung und regionale Binnenmärkte wieder an Bedeutung gewonnen.
4.2. Depression und Gewerkschaften
Bereits zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die verheerenden sozialen Auswirkungen des frühzeitlichen Kapitalismus deutlich. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterfamilien waren unmenschlich. Sehr lange Arbeitstage, Kinderarbeit und Niedrigstlöhne waren an der Tagesordnung und ein Großteil der Bevölkerung kam kaum über das Existenzminimum hinaus. Darüber hinaus waren Fabrikarbeiter den heftigen wirtschaftlichen Zyklen ausgesetzt und konnten oftmals nach Belieben entlassen werden, da sie keinen Kündigungsschutz genossen. Unternehmer nutzten ganz nach dem Prinzip des Selbstinteresses ihre kaum eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten aus. Aufgrund dieser extremen Entwicklungen wurden Gewerkschaften zugelassen, um dem Angebotsmonopol der Industrie auf dem Arbeitsmarkt ein Machtpendant zu bieten. Die Gewerkschaften erkämpften beachtliche Zugeständnisse für ihre Mitglieder. Bereits zu dieser Zeit wurde erkannt, dass der Kapitalismus sich nicht vollständig selbst überlassen werden konnte. Es wurde vor allem deutlich, dass der erreichte Zustand nur schwer mit den Idealen des Utilitarismus zu vereinbaren war, da der Wohlstand auf eine absolute Minderheit verteilt war und die große Mehrheit unter ärmlichen Bedingungen lebte. Die erste große Desillusion der kapitalistisch gesinnten Philosophen bezog sich auf die nicht zufriedenstellende Distribution des Wohlstandes.
4.3. Der Keynesianismus
Die zweite große Desillusion traf zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein, als die Theorie der kontinuierlichen Tendenz zum Marktgleichgewicht sich nicht bewahrheitete. Die großen Wirtschaftsnationen waren erheblichen Zyklen ausgesetzt und zeigten nur geringe Stabilität. Die große Depression der 20er Jahre sowie die daraus resultierende langfristige Arbeitslosigkeit und Armut zeigten, dass die propagierte inhärente Stabilität der Kapitalistischen Wirtschaft nicht der Realität entsprach. John Maynard Keynes entwickelte eine Theorie, wonach der Kapitalismus sich in Zyklen entwickelt, da Anbieter und Nachfrager verschiedene Tatsachen annehmen und nicht in gleichen Zeiträumen planen. Auch die Auswirkungen des Sparverhaltens der Bevölkerung in wirtschaftlich starken Zeiten wurde untersucht. Der Keynesianisch geprägte Kapitalismus besagt, dass der Staat in der Ökonomie nicht lediglich als Aufseher sondern auch als aktiver Stabilisator auftreten muß. Er tut dies vor allem, in dem er die Auswirkungen von Wirtschaftszyklen reduziert. Ist zum Beispiel in einer Rezession die Privatnachfrage zu schwach, so springt der Staat als Alternativnachfrager ein, in dem er eine aktive Verschuldungspolitik betreibt. Somit sinkt das Nachfrageniveau im geringeren Maße. Steigt die Privatnachfrage wieder an, zieht sich der Staat zurück und nutzt die resultierenden erhöhten Steuereinnahmen, um das Haushaltsdefizit wieder auszugleichen und die Staatsverschuldung zu reduzieren. Keynesianer sind sogenannte Nachfrageökonomen, da sie die Ansicht vertreten, dass die Nachfrage die Wirtschaft maßgeblich steuert, im Gegensatz zu Monetaristen (Angebotsökonomen), die das Hauptaugenmerk auf die Angebotsseite legen und bei Rezessionen eher Steuerreduzierungen befürworten, um die Wirtschaft durch Unternehmerinvestitionen anzukurbeln. Keynesianer erhofften sich durch die aktive Wirtschaftspolitik der Regierungen eine Glättung der Zyklen. Der Keynesianismus war besonders nach dem zweiten Weltkrieg und bis in den 70er Jahren hinein populär, als eine bis dato unbekannte Erscheinung auftrat. Wirtschaftliche Stagnation und Inflation erschienen gleichzeitig. Dies war für Keynesianer schwierig zu erklären, da beide Phänomene eigentlich nicht zeitgleich auftreten konnten. Wirtschaftliche Stagnation war traditionell mit Preisstabilität oder gar Deflation verbunden worden, weil zu diesen Zeiten die Nachfrage nach Gütern und auf dem Arbeitsmarkt schwächer war, somit geringerer Druck auf Preise und Löhne herrschte. Die 70er Jahre brachten erneut eine sehr individualistische Theorie hervor, die dem Keynesianismus Konkurrenz machte.
4.4. Der Monetarismus
Dem Monetarismus liegt die klassisch-kapitalistische Anschauung zugrunde, dass eine Einwirkung der Regierung auf dem Privatgütermarkt prinzipiell schädliche Auswirkungen hat. Diese Ansicht wurde monetaristisch erklärt, in dem Sinne, dass der Staat durch seine getätigten Investitionen in der Privatwirtschaft die Verfügbarkeit von Kapital negativ beeinflußt (Crowding-Out Effect). Dies hat erhöhende Auswirkungen auf das Zinsniveau und unterdrückt private Investitionsinitiativen, da weniger Projekte nach dem Diskontierungsprinzip wirtschaftlich zu realisieren sind. Nach einiger Zeit der Anpassung würden Investoren die geschätzte Inflation mit einplanen, was die Inflation wiederum weiter antreibt. Anstatt die Wirtschaft durch aktive, steuernde Wirtschaftspolitik zu beeinflussen, soll der Staat seine Hauptaufgabe darin sehen, die Inflationstendenzen des Geldes einzudämmen und nur eine langsame sowie vor allem kontinuierliche Preissteigerung zuzulassen. Dies ermöglicht Investoren, effektiv zu planen und mindert ihr Risiko. Man erkennt hier eine ideologische Rückkehr in die Richtung des Laissez-Faire Prinzips und zu den mechanistischen Naturgesetzen des Marktes. Die zahlreichen einzelnen Handlungen der Unternehmer wirken mit- und gegeneinander auf dem Markt, um ein gesellschaftlich optimales Wirtschaftsergebnis zu erreichen. Die Aufgabe der Regierungen wird wieder auf die Gewährleistung von optimalen Handelsbedingungen reduziert. Der bekannteste Verfechter des Monetarismus, Milton Friedman, vertritt die Ansicht, dass die Hauptaufgabe des Staates im wirtschaftlichen Bereich die Erschaffung von Gesetzen ist, die den Güter- und Dienstleistungsverkehr vereinfachen. Diese Gesetze allein sind für den Unternehmer verbindlich. Der Unternehmer soll diesen Gesetzen folgen und sich auf die Mehrung des Aktionärenwohlstandes (Shareholder Value) besinnen. Moralisches Verhalten von Seiten der Unternehmensleitung ist wirtschaftlich unerwünscht, da sie dieses Unternehmen im Vergleich zu weniger moralisch engagierten Mitbewerbern in eine ungünstige Lage bringt und das Überleben des Unternehmens somit gefährdet. Dies ist ein Betrug am Aktionär, da sein Auftrag an das Management klar das Erzielen einer höchstmöglichen Rendite (Return on Investment) ist. Ferner ist die aus einem eventuellen Konkurs resultierende Arbeitslosigkeit unmoralisch, wenn der Konkurs durch nicht-gebotene, moralische Handlungen seitens der Unternehmensleitung herbeigeleitet wurde. Dennoch wird trotz aller Laissez-Faire Bekundungen auch im Monetarismus wieder eine Pflicht des Staates erkennbar, nämlich, den Geldwert stabil zu halten. Hier wird wieder deutlich, dass die Wirtschaft ohne normative Vorgaben, welche Gestalt sie auch immer annehmen, nicht auskommen kann.
4.5. Globalisierung
Was langsam nach dem zweiten Weltkrieg mit der Expansion multinationaler Firmen begann, setzte sich in den 80ern und besonders in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts fort. Vor allem US amerikanische, Europäische und Japanische Unternehmen erkannten abflachende Umsatzsteigerungen und Sättigungserscheinungen in ihren Heimatmärkten und begannen, in das Ausland zu expandieren. Eine Expansion in die wirtschaftlich ebenfalls hochentwickelte Welt ergibt kaum ethische Probleme, da die Gastländer rechtlich in der Lage sind, ihre Interessen zu vertreten und als ebenbürtige Partner mit den Firmen zu verhandeln. Sie sind auf die Investitionstätigkeiten der multinationalen Unternehmen nicht angewiesen. Außerdem stellt das Phänomen der Gewinnexporte keine großen Probleme. Weit mehr Schwierigkeiten ergeben sich, wenn diese Firmen sich in Zweit- und Drittwelt Ländern etablieren, deren Bruttosozialprodukt zum Teil geringer ist als der Konzernumsatz. Einerseits schaffen diese Konzerne bitter benötigte Arbeitsplätze und können somit erhebliche Konzessionen von diesen Ländern erlangen, andererseits werden Profite häufig nicht im gleichen Land selbst re-investiert sondern ins Heimatland transferiert. Konzerninterne Transaktionen werden so gestaltet, dass Gewinne in Hochsteuerländern verhältnismäßig gering ausfallen und in Niedrigsteuerländern aufkommen. Dies schadet Drittweltländern verhältnismäßig mehr als hochentwickelten Nationen. Außerdem wird oft kritisiert, dass nur wenig anspruchsvolle Tätigkeiten in Drittweltländer verlagert werden, Expertenarbeiten bleiben im Heimatland, somit entwickelten sich diese Drittweltländer im Bereich des humanen Kapitals (Know-how) kaum weiter. Verteidiger dieses Zustandes weisen darauf hin, dass diese Situation den Drittweltländern dennoch auf Ihrem Weg in die wirtschaftliche Entwicklung unterstützten, da die Arbeitslosigkeit verringert und das Bruttosozialprodukt gesteigert wird. Somit kann von Länderseite her mehr in Infrastruktur und Ausbildung investiert werden. Gegner erwidern, dass die Schere zwischen armen und reichen Ländern zum Teil aufgrund solcher Entwicklungen immer weiter auseinander klafft.
4.6. Zwei Alternativen zum neo-liberalen Kapitalismus
Seit seiner Entstehung muß der Kapitalismus kritische Gegenstimmen hinnehmen. Besonders hervorgehoben wird dabei die Einseitigkeit der kapitalistischen Theorie, die das Axiom des individuellen Selbstinteresses und die darauf aufbauenden ökonomischen Prinzipien auf verschiedene Gesellschaftsbereiche überträgt. Zum Beispiel haben kapitalistisch gesinnte Sozialwissenschaftler versucht, die Institution der Ehe und das Kindergebären mit ökonomischen Argumenten zu erklären. Alternative Wirtschaftsmodelle haben gemeinsam, dass vergleichsweise mehr normative Elemente in das Wirtschaftsleben einfließen werden als im Kapitalismus, sodass ein kleinerer Anteil den vermeintlich mechanistischen Effekten überlassen wird.
4.6.1. Der Sozialismus
Der Sozialismus legt andere Schwerpunkte als der Kapitalismus. Der im Kapitalismus bedeutende Individualismus und die zahlreichen ökonomischen Opportunitäten zur individuellen Verwirklichung werden im großen Maße zugunsten einer stark gesteuerten, auf die Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft orientierten, Wirtschaftspolitik geopfert. Die Möglichkeit zum Privateigentum, besonders an den Produktionsfaktoren, wird drastisch reduziert. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur Marktwirtschaft ist das Gerechtigkeitsverständnis. Es wird in der Wohlstandsdistribution weit mehr Wert auf die Bedürftigkeit eines jeden Individuums gelegt als im Kapitalismus, wo der individuelle Beitrag am Sozialprodukt im Vordergrund steht. Daher stammt das sozialistische Ziel, Klassen innerhalb der Gesellschaft zu eliminieren, da die entsprechenden Positionen innerhalb der Gesellschaft in der Regel vererbt werden und die Klassenunterschiede sich im Laufe der Zeit meistens verfestigen. Eine gesellschaften- und generationenübergreifende Moral lehnen marxistisch gesinnte Sozialisten ab, sie vertreten vielmehr die Ansicht, dass die gegenwärtigen gesellschaftlichen Gegebenheiten, die Moral maßgeblich prägen. So schrieb Marxs´ Mitarbeiter Friedrich Engels:
„Wir behaupten (dagegen), alle bisherige Moraltheorie sei das Erzeugnis, in letzter Instanz, der jedesmaligen ökonomischen Gesellschaftslage.“ [...] „So können wir daraus nur den Schluß ziehen, dass die Menschen, bewußt oder unbewußt, ihre sittlichen Anschauungen in letzter Instanz aus den praktischen Verhältnissen schöpfen, in denen ihre Klassenlage begründet ist.“[8]
Ein wichtiger Unterschied zu marktwirtschaftlich orientierten Philosophen besteht in der Überzeugung, dass die gegenwärtigen Verhältnisse keineswegs das bestehende Gesellschaftssystem rechtfertigen können, da sie die Kriterien der Bewertung beeinflussen. Auch glauben Sozialisten nicht an den effizienten Mechanismus des Marktes und halten es für sinnvoller, die Produktion zentral zu planen. Es wird hierfür eine Einschränkung der menschlichen Entfaltungsmöglichkeiten in Kauf genommen. Der humane Egoismus wird zwar nicht geleugnet, man geht jedoch davon aus, dass er, wenn er nicht gezügelt wird, zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unterdrückung der Massen führt. Daher erhebt die sozialistische Ideologie den Anspruch, den Menschen umzuerziehen, eine Aufgabe, die der Staat übernimmt. Im Gegensatz zum Kapitalismus, der die menschlichen Eigenschaften als Ausgangsbasis nimmt, um das System diesen Gegebenheiten anzupassen, versucht der Sozialismus den Menschen so zu formen, dass er dem normativen Menschenbild entspricht.
4.6.2. Die soziale Marktwirtschaft
Dieses vor allem in Nord- und Westeuropa angewandte Modell versucht unter Wahrung der Freiheit des Individuums, den Auswirkungen des ungebremsten Kapitalismus entgegenzuwirken. Auch wenn die soziale Marktwirtschaft in den verschiedenen Ländern, in denen sie praktiziert wird, unterschiedliche Formen annimmt, gibt es einige gemeinsame Merkmale. Das Deutsche Nachkriegsmodell wird traditionell als soziale Marktwirtschaft verstanden, doch kann auch das Skandinavische Modell der siebziger Jahre als solche bezeichnet werden. Dennoch ist die soziale Marktwirtschaft eher eine Abwandlung des Kapitalismus als ein eigenständiges Wirtschaftssystem. Der Staat nimmt im Vergleich zum liberalen Kapitalismus eine größere Steuerungsfunktion ein. Mit gesellschaftlichem Konsens, Mitspracherecht der Mitarbeiter in Betrieben, progressives Steuersystem und anschließender breiter Streuung der Steuereinnahmen seitens des Staates, usw. … wird beabsichtigt, eine gerechte Wohlstandsverteilung zu erzielen, indem sowohl der Beitrag am Sozialprodukt als auch die individuelle Bedürftigkeit des Individuums in der Distribution berücksichtigt wird.
5. Die gesellschaftliche Bedeutung des Kapitalismus
Der Kapitalismus ist kein Gesellschaftssystem sondern ein Wirtschaftsmodell, diese Tatsache wird oft übersehen. Dem zufolge ist gemäß Koslowski sein Hauptzweck, eine wirtschaftliche effiziente sowie gerechte Güter- und Dienstleistungsproduktion und Verteilung zu gewährleisten: „Die Ökonomie ist die Lehre der effizienten Verfolgung gegebener Zwecke. Sie ist eine Lehre von den rechten Mitteln und kann daher nicht über die Frage, was wir wollen sollen, was vernünftige Zwecke sind, eine abschließende Auskunft geben. Der Begriff der wirtschaftlichen Effizienz als Handlungsmaxime vermag dem Individuum die Wahl zwischen Zwecken und Werten nicht abzunehmen. Wir bedürfen für die Entscheidung darüber, was wir eigentlich wollen, Wertvollzugsregeln.“[9] Häufig wird die Marktwirtschaft als Gesellschaftsmodell betrachtet. Ihre Gesetze und Problemlösungen werden auf zahlreiche andere Bereiche des Lebens (Wissenschaft, Kultur, …) übertragen und der Markt zum Maß aller Dinge gemacht. Als Wirtschaftskonzept ist der Kapitalismus bislang unübertroffen, da er bewiesen hat, dass er von allen bisher praktizierten Systemen die effizientesten, produktivsten, kreativsten und fortschrittlichsten Ergebnisse hervorgebracht hat. Werden die in der Welt vorhandenen Ressourcen als knappe Güter betrachtet, so kann deren Verschwendung als unmoralisch betrachtet werden, da dies die Lebensmöglichkeiten zukünftiger Generationen erschwert. Dennoch zeigt auch der Kapitalismus einen Hang zur Verschwendung, besonders der sogenannten öffentlichen Güter, da sie einen geringen oder keinen Marktwert für den einzelnen besitzen. Auch die stark ausgeprägten Marketingmaßnahmen werden kritisiert, da sie keinen materiellen Nutzen produzieren. Auch andere Wirtschaftsmodelle haben das Verschwendungsproblem nicht lösen können, wobei sie im Sozialismus der Erfahrung nach höher ausfallen als in der Marktwirtschaft. Im Verlauf seiner bisherigen Geschichte hat der Kapitalismus gezeigt, dass seine Funktionsweise den natürlichen menschlichen Eigenschaften sehr entspricht. Obwohl der wissenschaftliche Fortschritt in den letzten zwei Jahrhunderten nicht auf die Existenz der Marktwirtschaft alleine zurückzuführen ist, hat sie maßgeblich dazu beigetragen. Es gab sicherlich einen wechselseitigen Einfluß von Wirtschaft und Wissenschaft, denn der Druck zu Wohlstandsmehrung und Profitmaximierung hat die erfinderischen Tätigkeiten der Forscher finanziell und ideell gefördert, besonders im Bereich der angewandten Forschung. Neue Erfindungen hingegen haben immer wieder ökonomische Opportunitäten für die Privatwirtschaft hervorgebracht. Auch wenn der Kapitalismus ein reines Wirtschaftsmodell ist, gibt es Anzeichen dafür, dass dessen Anwendung einen Einfluß auf das Innenleben einer Gesellschaft hat. Man kann seit Jahrzehnten in fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern, besonders in großen Städten, eine stärkere Individualisierung der Gesellschaft beobachten. Soziale Bindungen wie Nachbarschaft, erweiterter Familienkreis, usw. …, die in vorkapitalistischen Zeiten sehr bedeutsam waren, haben an Bedeutung verloren. Auch die zuvor angedeutete Ausweitung ökonomischer Prinzipien auf nicht-ökonomische Lebensbereiche wird immer deutlicher. Gesellschaftsrelevante politische Entscheidungen werden häufig nach wirtschaftlichen Kriterien getroffen. Daraus resultiert allerdings nicht zwangsläufig, dass diese Prinzipien von Natur aus tatsächlich auf diese Bereiche anwendbar sind. Es ist durchaus möglich, dass die anhaltende Umsetzung der Marktwirtschaft die Gesellschaft und das politische Geschehen so beeinflußt hat, dass diese Ausweitung überhaupt ermöglicht und später sogar gefördert wurde. Die Hauptfrage ist, wie Etzioni sie stellt: „Die Menschen westlicher Gesellschaften streben nach Konsum und Wohlstand; doch ist dies der Fall, weil sie von Natur aus besitzergreifend sind oder weil sie von den Werten des reifen Kapitalismus geprägt wurden?“[10] Anders ausgedrückt: Ist der Mensch von Natur aus ein Homo Oeconomicus oder wurde er zu einem gemacht, oder ist beides zu verzeichnen?
6. Das Individuum im Kapitalismus
Im Kapitalismus ist das Individuum das Maß aller Dinge, somit steht die Marktwirtschaft im engen Einklang mit dem westlichen demokratischen Freiheitsverständnis von heute. Gleichzeitig wird der Mensch als selbstinteressiertes Individuum gesehen. Er möchte sein Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten und benötigt hierfür Planungs- und Handlungsfreiheit, deshalb werden seine Entfaltungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt gestellt. Dennoch wird der Mensch in der kapitalistischen Theorie als atomistische Nachfrageeinheit betrachtet, die erst ab einer kritischen Masse gleichgesinnter Nachfrager ökonomisch bedeutsam wird. Einzelne Wünsche und Bedürfnissee sind nicht marktfähig, wenn sie nicht von einer kräftigen Zahlungsfähigkeit und –bereitschaft unterstützt werden, und werden somit nicht berücksichtigt. Die Tatsache, dass die Prinzipien der Marktwirtschaft auf dem Individualismus beruhen, die Spielregeln des Systems jedoch auf Massen ausgerichtet sind, stellt einen inhärenten Widerspruch dar. Nur Massen, in Geldeinheiten ausgedrückt können wirtschaftlich etwas bewegen. Leidenschaft und Engagement zählen kaum, wenn die Voraussetzung der Mindestmenge nicht erfüllt ist.
7. Ethische Kritik des Kapitalismus innerhalb seines Paradigmas
Auch wenn den stützenden Grundüberzeugungen des liberalen Kapitalismus zugestimmt wird, bietet dieses Wirtschaftssystem mehrere Angriffspunkte, da einige rechtfertigende Argumente und Schlußfolgerungen widersprüchlich sind.
7.1. Moralische Naturgesetze
Eines dieser Widersprüche bezieht sich auf das naturgesetzliche Verhalten des Marktes. Menschen handeln im Wirtschaftsgeschehen zwar teleologisch, d.h. zielorientiert, die Wirtschaft als Ganzes ist jedoch selbstregulierend und Bedarf keines Eingriffes von außen. Teleologische Führung der Wirtschaft ist überflüssig und sogar schädlich, da sie die optimale Allokation der dem Menschen zur Verfügung stehenden Ressourcen verhindert. Gesetzgeber sollen die Gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erschaffen, damit sich die positiven Auswirkungen der Marktwirtschaft entfalten können. Somit Bedarf es seitens der Unternehmensleitungen auch keiner über die Einhaltung der Gesetze hinausgehenden Handlungen. Wenn Wirtschaftsakteure ihrer Natur entsprechend im eigenen Interesse handeln, entsteht zwangsläufig ein moralisch gutes Ergebnis, da es auf mechanistische Weise eine gerechte Verteilung der Ressourcen und des Einkommens erreicht hat. Die Logik dieses Argumentes ist nicht einleuchtend. Koslowski schreibt hierzu: „Zu glauben, dass ein wirtschaftlich effizientes System schon eine gute oder moralische Gesellschaft ausmacht und dass die Wirtschaft das Ganze der Gesellschaft ist, ist ein ökonomistischer Fehlschluß.“[11] Die Handlungen selbstmotivierter Individuen können, wenn sie auf die Maximierung des eigenen Nutzens ausgerichtet sind, nicht im moralischen Sinne gut sein, sie sind außermoralisch. Dies bedeutet nicht, dass sie zwangsläufig moralisch schlecht sind, jedoch impliziert Moralität bei Interessenkonflikten ein Maß an Selbsteinschränkung, um die Freiheit der gegenwärtigen und zukünftigen betroffenen Mitgeschöpfe zu wahren. Gerade diese Haltung unterstützt der Kapitalismus nicht, da die erwarteten positiven Ergebnisse unter diesen Umständen gefährdet werden. Auch das erzielte Ergebnis, die mechanistisch zustanden gekommene Wohlstandsverteilung, kann nicht als moralisch gut angesehen werden, da sie aufgrund von zahlreichen von außermoralischen Handlungen hervorgerufen wurde und demnach nicht gewollt herbeigeführt wurde. Moralität setzt immer einen Willen voraus.
7.2. Mechanistische Funktionsweise
Die mechanistische Funktionsweise des Marktes, so wie sie bereits beschrieben wurde, ist ebenfalls fragwürdig: Wirtschaftswissenschaftlern steht kein Versuchslabor zur Verfügung, in dem sie analog zu ihren Kollegen anderer Disziplinen ihre Theorien empirisch überprüfen können. Das Prinzip der Ceteris Paribus Klausel ist in den Wirtschaftswissenschaften kaum anwendbar, da das Labor sich sozusagen im wirklichen Leben befindet und einem kontinuierlichen Wandel ausgesetzt ist. Demnach lassen sich Thesen auch kaum vollständig wissenschaftlich verifizieren oder falsifizieren, es sei denn, es werden so viele Hilfshypothesen hinzu genommen, dass das gesamte zugrundeliegende Modell realitätsfremd wird. Etzioni erklärt dieses Problem wie folgt: „Neoklassische Ökonomen beginnen zwar oft mit sehr wenigen Annahmen, fügen aber im Laufe ihrer Versuche, ihre Behauptungen und die Daten aufeinander abzustimmen, zahlreiche ad-hoc Annahmen hinzu.“[12] Einige immer wieder verwendete wirtschaftliche Konstruktionen treten in der Realität nicht auf, werden jedoch zur Veranschaulichung der marktwirtschaftlichen Funktionsweise herangezogen. Zum Beispiel ist das Modell der vollkommenen Konkurrenz bisher nie aufgetreten, dessen reelle Auswirkungen können daher nicht vollständig belegt werden. Manchmal werden in Modellkonstruktionen auch reelle Gegebenheiten bewußt ausgelassen, um wirtschaftliche Theorien zu verdeutlichen. Hierdurch wird die Realität verändert, und die Wahrheit der betroffenen Hypothesen kann lediglich vermutet werden.
7.3. Die Bedeutung des Menschen
Ein weiterer Widerspruch wurde bereits angedeutet und betrifft die Stellung des einzelnen Menschen in der Marktwirtschaft. Das einzelne Individuum steht am Anfang aller kapitalistischen Überlegungen, dennoch ist die Funktionsweise des Systems auf Massen ausgelegt. Einzelne Interessen treffen im Marktgeschehen aufeinander, daraus bilden sich Nachfrage- und Angebotskräfte die mit- und gegeneinander wirken. Nur die marktfähigen Bedürfnisse setzen sich ohne äußere Eingriffe durch. Einzelne, marginale Interessen werden nicht berücksichtigt, da sie in diesem Modell untergehen. Lediglich Zahlungskräftige Individuen können ihre Einzelinteressen durchsetzen. Kultur und Gesellschaft laufen dadurch die Gefahr vereinheitlicht zu werden. Ein Phänomen, dass bereits in westlichen Gesellschaften beobachtet werden kann. Länderübergreifend werden Verbrauchs- und Freizeitverhalten immer ähnlicher. Jugendliche in Europa unterscheiden sich kaum noch von ihren gleichaltrigen Mitmenschen in Japan und Nordamerika. Koslowski beschriebt diese Entwicklung wie folgt:
„Industrielle Massenproduktion und Massenkaufkraft bewirken eine egalitäre Tendenz im Kapitalismus, die bei allem Augenmerk auf die Ungleichheiten der Einkommensverteilung häufig übersehen wird, eine Tendenz zur Angleichung der Lebensstile bei aller Ungleichheit der Vermögensverteilung. Sie führt dazu, dass die Durchsetzung eines individuellen Konsumstils im Vergleich zum „Durchschnittskonsum“ immer schwieriger wird. Dies steht im Gegensatz zu der Tatsache, dass eines der wichtigen und zutreffenden Argumente für den Kapitalismus das Faktum ist, dass er individuelle Lebensstile und –weisen in einem Ausmaß wie kein anderes Wirtschaftssystem möglich macht.“[13]
Die marktfähigen Gastronomie-, Kleidungs-, und Unterhaltungskonzepte haben sich durchgesetzt. Das Individuum verliert an Individualität, die gegensätzlichen Interessen auf dem Markt nehmen zwangsläufig ab. Diese Entwicklung resultiert in einen immer effizienter funktionierenden Markt, Reibungsverluste werden nehmen ab. Dies läßt die Annahme zu, dass der Mensch von der kapitalistischen Form des Wirtschaftens geprägt wird, ein Gedanke der in der Theorie nicht zulässig ist, da von gegebenen Bedürfnissen ausgegangen wird. Existiert diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Markt tatsächlich und ist Vielfalt ein Kriterium für kultureller Reichtum, kann von einer Verarmung der Kultur gesprochen werden. Ist kultureller Pluralismus ein für die Welt erstrebenswertes Gut, verlangt diese Entwicklung ein konzertiertes Eingreifen durch die staatlichen Behörden auf nationaler Ebene und von der Staatengemeinschaft auf internationaler Ebene. Es müssen gewisse intellektuelle und materielle Produkte sowie menschliche Interessen, die sich auf dem Markt nicht durchsetzen können, von Seiten der Staaten geschützt werden.
7.4. Kontrolle durch Menschen
Die klassische kapitalistische Theorie sieht die Notwendigkeit ein, auch wenn der Staat möglichst wenig in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen soll, dass die rechtmäßige Funktion der Wirtschaft dennoch gewährleistet und kontrolliert werden muß?. Diese Aufgabe wird der staatlichen gesetzgeberischen Autorität (Legislative) und weiteren Gremien (Judikative, Exekutive, Kartellämter, …) übertragen. Die Prämisse, dass der Mensch ein egoistisches Wesen ist und selbstinteressiert handelt, ist eine fundamentale Voraussetzung, damit die Marktwirtschaft funktionieren kann. Dennoch bleibt die Frage offen, von wem diese Kontrollaufgaben erfüllt werden sollen, wenn nicht von selbstinteressierten Menschen. Dieses Problem wird deutlich, wenn Regierungen vor Wahlen medienwirksame wirtschaftspolitische Entscheidungen treffen oder wenn sie, wie in den USA verbreitet, sich von starken Interessenverbänden (Lobbyisten) beeinflussen lassen. Der Kapitalismus gibt keine befriedigende Antwort darauf, wie diese Problematik gelöst werden kann. Es gibt zwar das System der Gewaltenteilung und der permanenten wechselseitigen Kontrolle zwischen staatlichen Behörden, wobei der Bürger mit seinem Wahlrecht die ultimative Kontrollfunktion einnimmt, dennoch ist das faktische Ergebnis aufgrund von zahlreichen möglichen Manipulationen nicht befriedigend.
7.5. Infiltration in Gesellschaft und Wissenschaft
Der Kapitalismus kommt der tendenziell egoistischen Natur des Menschen entgegen, und es bleibt fraglich, inwiefern eine Wechselwirkung zwischen Menschen und System besteht und wie stark sie ist. Es ist durchaus denkbar, dass die Praxis der Marktwirtschaft einen Einfluß auf die Psyche der Menschen hat. Fördert Sie sein selbstinteressiertes Verhalten, ergibt sich eine Spirale, da das zunehmende ökonomische Denken selbst eine weitere Festigung der Marktwirtschaft bewirkt. Die Kernfrage ist, welcher Anteil des Homo Oeconomicus naturbedingt ist und welcher Anteil durch den Kapitalismus verstärkt wurde. Es ist erkennbar, dass Gesellschaft und Wissenschaft stark vom Kosten-Nutzen-Denken beeinflußt werden. Der Druck der Marktopportunitäten z.B. fördert die angewandte Forschung und macht es sehr schwierig, ethische Barrieren aufrechtzuerhalten. Die aktuelle Diskussion um das Klonen von Menschen macht deutlich, welch gewaltiger Druck hinter Wissenschaftlern steht, sich in ihren Forschungsfeldern stets weiter zu entwickeln. Auch außerökonomische Bereiche wie Bildung, Kultur usw. … werden zunehmend den Marktgesetzen ausgeliefert. Diese Entwicklung setzt die gesellschaftliche Pluralität in Gefahr, da wirtschaftliche Argumente in den Vordergrund treten, andere Aspekte verlieren an Bedeutung.
8. Ethische Kritik des Kapitalismus außerhalb seines Paradigmas Werden die Grundannahmen der kapitalistischen Theorie abgelehnt, so ergeben sich weitere mögliche Kritikpunkte.
8.1. Die wahre Natur des Menschen
Die Menschen zeigen immer wieder, dass ihre Handlungen nicht durch Egoismus allein getrieben werden. Es gibt eine Vielzahl menschlicher Handlungen, die auf dem ersten Blick nicht mit Selbstinteresse zu erklären sind. Liebe, Mitleid, Nachbarschaftshilfe, usw. … sind Verhaltensweisen, die sicherlich auf andere Motive zurückzuführen sind. Es ist durchaus denkbar, dass der Mensch das Bedürfnis hat, Gutes um seiner selbst willen zu tun. Einige eingefleischte Verfechter des Kapitalismus versuchen, alle Motive auf den gemeinsamen Nenner des Egoismus zurückzuführen. Dieser gedankliche Spagat ist jedoch wenig überzeugend und tautologisch. Es muß bei dieser Frage dennoch keine Extremposition eingenommen werden. Es kann die Ansicht vertreten werden, dass die Mehrheit menschlicher Verhaltensweisen einen egoistischen Zweck verfolgen, dieses Motiv jedoch nicht alle Handlungen erklärt. Wenn der Mensch auch das Bedürfnis hat, gutes zu tun, bedeutet es, dass er eine moralische Neigung hat. Dies ergibt ein ganzheitlicheres Bild des Menschen, das in die kapitalistische Theorie integriert werden muß. Eine Theorie, die Egoismus als Alleinmotiv humaner Verhaltensweisen sieht, wird der Komplexen Natur des Menschen nicht gerecht.
8.2. Der Mensch als soziales Wesen
Die Theorie der Marktwirtschaft berücksichtigt nicht im ausreichenden Maße, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. In Anlehnung an das vorangegangene Kapitel, wird im Kapitalismus die Ansicht vertreten, dass das nur stimmt, solange das Soziale Umfeld dem Eigeninteresse des Individuums dient. Das ist eine tautologische Erklärung, denn, legt der Mensch Wert auf funktionierende soziale Beziehungen, ist er zwangsläufig bereit, in diese zu investieren, ohne direkte Kosten-Nutzen-Überlegungen anzustellen. Dieses Bedürfnis der gesellschaftlichen Interaktionen läßt sich nicht in marktgerechte Nachfrage und Angebotsfunktionen ausdrücken. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben belegt, dass der Mensch ohne soziale Bindungen nicht lebensfähig ist, damit hat er in dieser Hinsicht keine Wahl.
8.3. Nutzenfunktionen
Der dem Kapitalismus zugrundeliegende Utilitarismus geht davon aus, dass die Handlungsnorm der Glücksmaximierung für die größtmögliche Anzahl von Menschen anwendbar ist. Das impliziert eine Meßbarkeit des Ergebnisses. Davon abgesehen, dass dieses Vorhaben sehr schwierig ist, in die Praxis umzusetzen, wird übersehen, dass Glücksgefühle im Zeitverlauf und intersubjektiv relativ sind. Etzioni beschreibt dieses Phänomen wie folgt:
„Innerhalb jedes Landes gilt jedoch: je höher das relative Einkommen, desto glücklicher sind die Individuen, die relativ besser dran sind. Diese Phänomene lassen sich damit erklären, dass Referenzgruppen meist auf die Nationen beschränkt sind und nicht über die Landesgrenzen hinaus wirken. Easterlins Ergebnisse werden von Duncan (1975) weiter untermauert: In Detroit wurde bei einer Gruppe von Testpersonen, deren reales Einkommen zwischen 1955 und 1971 um 42 anstieg, kein besonderer Anstieg im Glücksgefühl feststellt, weil die Einkommen der Referenzgruppe genau so gestiegen war wie das der Testpersonen.“[14]
Hier ergibt sich eine Schwierigkeit, die Kapitalismus und Utilitarismus inkompatibel macht, da die Menschen im wirtschaftlichen Handeln den erwarteten marginalen Glücksgewinn (Nutzen) eines Gutes mit Zahlungsbereitschaft kommunizieren. Jedoch muß berücksichtigt werden, dass ein warmes Essen einem sehr armen Menschen wohl mehr Glück bereiten wird als ein zusätzlicher Luxuswagen einem Millionären. Dennoch wird der Millionär seinen Wunsch erfüllen und die Luxuswagen-Produktion beeinflussen können. Der mittellose Mensch hingegen wird dies nicht können, da er zwar die potentielle Zahlungsbereitschaft für das Essen aufbringt, dies monetär jedoch nicht unterstützen kann. Insofern verpufft sein Bedürfnis auf dem Markt. Utilitaristisch gesehen ist das Ergebnis dieser Gegebenheit nicht glücksmaximierend, kapitalistischen Kriterien zufolge ist es optimal. Die Wohlstandsdistribution ist sowohl für den Kapitalismus als auch für den Utilitarismus problematisch. Hinzu kommt die utilitaristische Schwierigkeit, nach der Maxime der Glücksmaximierung für die höchstmögliche Anzahl von Menschen zu handeln. Zwar hat die von John Rawls vorgenommene Unterscheidung zwischen Regelutilitarismus und Handlungsutilitarismus dieses Vorhaben vereinfacht, die konkrete Vorgehensweise bleibt dennoch undefinierbar.[15]
8.4. Wohlstandskriterien
Der Wohlstand einer Gesellschaft ist nicht alleine nach materiellem Kriterien zu bewerten. Kapitalisten ermitteln den gesellschaftlichen Fortschritt nach der Entwicklung des Volkseinkommens, eine sehr einseitige Einschätzung. Auch wenn diese Größe ein Indikator ist, reicht sie nicht aus, um den tatsächlichen Wohlstand einer Nation zu messen. Intangible Faktoren spielen eine bedeutende Rolle. Lebensqualität läßt sich nicht nur nach Reichtum bemessen. Umweltzustand, Kriminalitätsrate, Meinungsfreiheit, Bildungsqualität, usw. … sind Kriterien, die den empfundenen Wohlstand einer Gesellschaft mit beeinflussen, obwohl sie in die Berechnung des Bruttosozialproduktes nicht einbezogen werden. Auch wenn in den letzten Jahren langsam dazu übergegangen wurde, eine ganzheitlichere Bewertung vorzunehmen und weitere Kriterien zu integrieren, besteht nach wie vor die Tendenz, sich auf monetäre Faktoren zu beschränken. Geht man davon aus, dass Staaten künstliche Gebilde sind, die von Menschen für Menschen entwickelt wurden, müßte der nationale Wohlstand aus der Summierung der individuellen Meinungen zum tatsächlich empfundenen Wohlstand abgeleitet werden. Dies ist eine utilitaristisch orientierte Position. Von der Unmöglichkeit dieses Vorhabens abgesehen, würden die Menschen bei solch einer Bewertung eine Vielzahl von Kriterien einfließen lassen.
8.5. Das Gefangenendilemma
Das Gefangenendilemma bereitet der kapitalistischen Theorie große Schwierigkeiten. Die klassische Lehre besagt, dass das Zusammentreffen der individuellen Interessen auf dem Markt zu einem Ergebnis führt, dass dem Gesamtinteresse der Gesellschaft entspricht. Das oft erwähnte Beispiel des Gefangenendilemmas zeigt jedoch eindeutig, dass das oftmals nicht zutrifft. Ganz dem kapitalistischen Gedanken folgend, tendiert der Mensch nicht immer dazu, mit seinen Mitmenschen zu kooperieren. Ob er nur kooperiert, wenn er sein Eigeninteresse eindeutig in der Zusammenarbeit erkennt oder nicht, ist in diesem Zusammenhang sekundär. In manchen Situationen ist die Kooperation zwischen Beteiligten die für die Allgemeinheit eindeutig nutzenbringendste Verhaltensweise. Zusammenarbeit ist jedoch kein einmaliger, kurzfristiger Vorgang, sie setzt eine gewisse Vertrauensbasis voraus, die sowohl kulturell innerhalb der Gesellschaft als auch zwischen einzelnen Individuen aufgebaut wird. Wenn der Kapitalismus lediglich gegnerisches Verhalten fördert, werden die Möglichkeiten zur Kooperation dauerhaft unterminiert. Somit würde die Marktwirtschaft den Menschen in seinem Verhalten wiederum prägen, etwas, was in der kapitalistischen Theorie negiert wird. Der Kapitalismus mit seinem ständigen Druck zur Profitmaximierung fördert das kurzfristige Denken und setzt geringeres Gewicht auf vertrauensvolle und langfristige Kooperation, da die Ergebnisse der Zusammenarbeit oft langfristig nicht erkennbar sind und somit nicht in wirtschaftliche Rechnungen einfließen.. Der permanente Druck des Kapitalmarkes und die gegenwärtige Konzentration der Unternehmer auf das Shareholder Value ermutigt dazu, kurzfristig positive Ergebnisse zu erzielen. Hier zeigt sich wieder ein Schwerpunkt auf monetäre Ergebnisse. Eine ganzheitliche unternehmerische Perspektive, die zwar durch Diskontierung zukünftiger Einnahmen das Entscheidungskriterium letztendlich auf einen reinen finanzieller Nenner bringt, aber dennoch weitere qualitative und quantitativen Faktoren zuläßt, hat sich nicht bewahrheitet.
8.6. Verteilungsgerechtigkeit
Der ungebremste Kapitalismus fördert das Auseinanderklaffen der Wohlstandsschere. Die reichen Gesellschaftsschichten erhöhen ihr Vermögen überproportional, die weniger reichen Klassen hingegen werden nur langsamer wohlhabender oder werden zeitweilig sogar ärmer. Eine kapitalistische Rechtfertigung ist, dass es den Armen langfristig materiell trotzdem besser geht als zuvor. Dennoch sind Reichtum und Armut, nach Überschreitung des Existenzminimums, ein relative Begriffe. Wer genug zum überleben hat, definiert seinen Wohlstand im Vergleich zu den reicheren Schichten. Können diese Unterschiede gerechtfertigt werden? Die Kontribution des Einzelnen zum Sozialprodukt als Distributionskriterium ist eine individualistische Anschauungsweise und nicht ausreichend. Auch die Bedürftigkeit muß berücksichtigt werden, da die materielle Ausgangsposition der Menschen durch die Institution des Erbens nicht gleich ist. Arthur Rich beschreibt diese Problematik wie folgt:
„Schon ein früherer Zusammenhang [...] ließ erkennen, dass beim Verteilungsproblem, soll es menschengerecht angegangen werden, sowohl der Gesichtspunkt der Leistungs- wie der der Bedarfsgerechtigkeit beachtet werden muß. Die Mißachtung, selbst nur die Vernachlässigung eines dieser Gesichtspunkte, führt zwangsläufig zu Ungerechtigkeiten. Die Marktwirtschaft mit ihrem Primat des individuellen Leistungsprinzips entspricht bestenfalls der Leistungsgerechtigkeit, nicht aber der der Bedarfsgerechtigkeit.“[16]
Wer die Ansicht vertritt, dass jedem das zusteht, was er geleistet hat, muß eingestehen, dass das geerbte Vermögen und die hineingeborene soziale Schicht nichts mit eigenen Leistungen zu tun hat.
8.7. Produktvielfalt und Ressourcenverschwendung
Die Existenzberechtigung von Produkten wird auf mechanistische Weise auf dem Markt entschieden. Nur ein Bruchteil aller entwickelten Produkte und Dienstleistungen erweisen sich als marktfähig und gehen in die Produktion. Die Mehrheit der Produkte erreicht nicht die letzte Stufe des Entwicklungszyklus. Dennoch erscheint auf dem Markt eine Vielzahl von Angeboten verschiedener Produzenten, die sich zum Teil kaum von einander unterscheiden. Diese Produkte und Dienstleistungen müssen, um sich auf dem Markt durchsetzen zu können, mit Werbung vermarktet werden. Es wird geschätzt, dass gegenwärtig etwa 30% der Verkaufspreise von Marketingkosten verschlungen werde. Sowohl die zahlreichen, abgebrochenen Produktentwicklungen als auch die anschließenden Vermarktungsanstrengungen für produzierte Güter sind nicht wohlstandsmehrend und können als Ressourcenverschwendung angesehen werden, denn sie beruhen auf die nicht koordinierten Planungen von individuellen Unternehmen. Wie bereits beschrieben, ist Verschwendung unmoralisch, da sie negative Auswirkungen auf das Leben zukünftiger Generationen hat.
9. Ethische Rechtfertigung des neuzeitlichen Kapitalismus
Einige mögliche Kritikpunkte zum kapitalistischen System sind in den vorangegangenen Ausführungen behandelt worden. Es ist möglich, sich auf philosophische Weise ein Wirtschaftssystem vorzustellen, das weniger Schwächen aufweist, dennoch ist die Umsetzbarkeit in der reellen Welt von wesentlicher Bedeutung, da dieses Modell sonst nur als Beispiel und Vorbild dienen kann. Ein Wirtschaftsmodell wird von Menschen für Menschen entwickelt, daher bleibt die Realitätstreue wichtig. Im Übrigen bleibt ein von allen Menschen anerkanntes, optimales System auch der Philosophie verwehrt, da einige Bewertungskriterien auf Wertvorstellungen zurückgehen. Wertvorstellungen gehen auf Grundüberzeugungen zurück, und es ist sehr schwierig, andere Menschen auf dieser Ebene zu überzeugen. Daher wird es in dieser Hinsicht immer Meinungsunterschiede zwischen Menschen geben, auch wenn sich große Mehrheiten für einzelne Wertvorstellungen bilden können. Wie kann die Marktwirtschaft ethisch gerechtfertigt werden? Indem auf die unterstützende Wirkung hingewiesen wird, die sie auf das rechtsstaatliche Freiheitsverständnis des Menschen in der modernen Demokratie ausübt. Es darf nicht übersehen werden, dass die Länder, die in den letzten zwei Jahrhunderten kontinuierlich marktwirtschaftliche Prinzipien in der Privatwirtschaft angewendet haben, meistens parallel dazu positive Entwicklungen im Bereich der individuellen Freiheit in ihren Gesellschaften verzeichnen konnten. Hiervon hat der Menschen mit seinem Grundrecht profitiert.
9.1. Teilsystem der Gesellschaft
Der Kapitalismus ist ein Teil eines ganzheitlichen Gesellschaftssystems, in dem er die Organisation wirtschaftlicher Aspekte abdeckt. Aus diesem Grund muß erinnert werden, dass die Marktwirtschaft ein untergeordnetes System ist, das im Einklang mit dem übergeordneten Modell sein muß. Sie dient als Mittel zu dem höheren Zweck, ein gesellschaftliches System zu unterstützen, dass der Erhaltung der menschlichen Grundfreiheiten dient. Diese Ansicht teilt die katholische Kirche in ihrem kürzlich neu formuliertem Katechismus: „Die Entfaltung des Wirtschaftslebens und die Steigerung der Produktion haben den Bedürfnissen der Menschen zu dienen. Das wirtschaftliche Leben ist nicht allein dazu da, die Produktionsgüter zu vervielfachen und den Gewinn oder die Macht zu steigern; es soll in erster Linie im Dienst der Menschen stehen.“[17] Der Kapitalismus kann nicht wertfrei sein, da er die positiven Werte des Systems unterstützen soll. Er ist kein Endzweck an sich, sondern ein Modell dessen sich die Menschheit bedient, um höhere Ziele zu erreichen. In diesem ganzheitlichen Gesellschaftssystem sowie in seinen Teilsystemen werden Handlungsgebote und -verbote ausgesprochen, je nachdem, ob sie der Erreichung des höheren Zieles dienlich sind oder nicht. Diese Gebote und Verbote werden Gesetze genannt. Entsprechend dem freiheitlichen Gedanken dieses Rechtssystem werden mehr Verbote als Gebote ausgesprochen. Was nicht verboten ist, ist in der Regel implizit erlaubt. Die Gesetze können jedoch nicht das gesamte Spektrum menschlicher Interaktionen abdecken. Das würde dem freiheitlichen Gedanken widersprechen, da zu viele Gesetze die Freiheit wiederum einschränken. Deshalb sind eine begleitende ethische Reflexion und eine gesellschaftliche Moral notwendig, denn die Gesellschaft kann nicht nur anhand der Gesetze funktionieren. Der Kapitalismus hat die Aufgabe, innerhalb des gesellschaftlichen Systems, für die möglichst effiziente Nutzung der knappen natürlichen Ressourcen zu sorgen. Eine Aufgabe, die er in Anbetracht der reellen Gegebenheiten gut erfüllt. Wird das Argument angenommen, dass die modernen Demokratien moralische Systeme sind und dass der Kapitalismus diese Systeme unterstützt, ist der Kapitalismus zwangsläufig moralisch.
9.2. Freiheitliches System
Der Kapitalismus ist ein auf das Individuum aufbauendes Wirtschaftsmodell. Er läßt dem Menschen den Freiraum, sich in wirtschaftlicher Hinsicht nach eigenen Vorstellungen zu verhalten und zu verwirklichen. Diese Freiheit wird dem Menschen als Grundrecht gewährt, ein Recht also, das er sich weder verdienen noch erarbeiten muß, sondern automatisch hat. In dieser Hinsicht sind alle Menschen tatsächlich gleich. Sie besitzen von Natur aus, das gleiche Maß an Handlungsfreiheit. Aus dieser Perspektive heraus ist die individualistische Tendenz des Kapitalismus besonders deutlich, da sie den Menschen selbst überläßt, wie sie sich innerhalb ihrer Freiheit entfalten. Diese Freiheit gewährt ihnen auch die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was für sie eine erstrebenswerte Selbstverwirklichung ist. Es gibt im Kapitalismus keine staatliche Autorität, die Ihren Bürgern vorschreibt, welche Tätigkeit sie im Dienste der Allgemeinheit erlernen und ausüben sollen. Es wird davon ausgegangen, dass der Markt die Attraktivität und Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen über das relative Lohngefüge selbst regelt. Diese offene, freiheitlich gesinnte Einstellung zum Menschen bedarf eines gesellschaftlichen Systems als Grundlage, dessen Umsetzung die Freiheiten aller Menschen wahrt und schützt, damit es sich selbst nähren und entfalten kann. Es ist jedoch in diesem Zusammenhang wichtig zu beachten, dass das Gewähren von wirtschaftlichen Grundrechten für alle in der Gesellschaft lebenden volljährigen Menschen zutreffen muß, damit eine Korrelation in der Entwicklung von wirtschaftlicher Freiheit und gesellschaftlicher Freiheit abgeleitet werden kann. Denn Diskriminierungen gegenüber bestimmten Menschengruppen (Geschlechtsdiskriminierung, Rassendiskriminierung) machen auch kapitalistische Systeme in unfreien Gesellschaften denkbar. Dieses gemeinsame Prinzip der natürlichen Freiheiten in der Marktwirtschaft und in der Demokratie macht beide zu moralischen Systemen..
9.3. Ethik im Kapitalismus
Das Argument, Ethik sei für wirtschaftliche Entscheidungen im Kapitalismus überflüssig, da moralisches Verhalten sich kostensteigernd auswirke und ein Betrug am Eigentümer (Shareholder) sei, ist verständlich. Moralisches Verhalten ist jedoch in allen Lebenslagen notwendig, in denen die Interessen der Mitgeschöpfe betroffen sind. Koslowski zufolge ist eine die gängige Moral beeinflussende Wirtschaftsethik im Kapitalismus unverzichtbar: „Eine Wirtschaftsethik ist gerade in der Marktwirtschaft nötig, weil eine marktwirtschaftliche Ordnung der Freiheit der Entscheidung und damit der ethischen Verantwortlichkeit großen Raum läßt.“[18] Im Übrigen ist die Absicht, sich in der Wirtschaft moralisch zu verhalten, eine außerwirtschaftliche Entscheidung, da das übergeordnete Gesellschaftssystem diesen Entschluß notwendig macht. Das Argument gilt auch für die Problematik der Re-distribution des erwirtschafteten Sozialproduktes. Diese Entscheidung muß auch als außerwirtschaftlich gelten, da die Verteilung mit den Grundwerten der Gesellschaft kompatibel sein muß. Die Schnittstellen der Argumentationskette sind wie folgt: Ausgangspunkt der Überlegungen ist das Axiom der unantastbaren individuelle Freiheit des Menschen. Von dieser Basis ausgehend wird ein ganzheitliches gesellschaftliches System entwickelt, das die Erhaltung dieser individuellen Freiheiten als zentrale Maxime beinhaltet. In diesem System werden bestimmte Handlungen geboten und verboten (durch Gesetze), je nach dem, ob sie der Erreichung des Gesamtziels dienlich sind. Da diese Normierung nicht alle möglichen menschlichen Handlungen abdecken kann und weil eine Vielzahl von Handlungen erst aus dem Kontext heraus als moralisch oder unmoralisch bewertet werden kann, sind ethische Reflexion und ein moralisches gesellschaftliches Bewußtsein unverzichtbar.[19] Das Gesamtsystem setzt sich aus verschiedenen Teilsystemen zusammen, die jeweils einen Gesellschaftsbereich abdecken: Die Ökonomie umfaßt das Wirtschaften, die Wissenschaft Forschung und Lehre usw. … Alle Teilsysteme müssen mit dem Gesamtsystem im Einklang sein. Der moderne Kapitalismus in seinen vielen verschiedenen Formen erfüllt diesen Anspruch. Er unterstützt die neuzeitliche Demokratie und das zugrundeliegende Freiheitsverständnis.
9.4. Der Einfluß des Staates
Eine auf sich alleine gestellte Wirtschaft begibt sich in keine eindeutige Richtung, sie entwickelt sich auf irrationale Weise vor sich her. Sie beugt sich immer wieder den spontanen Wünschen und Bedürfnissen der Gesellschaft oder einzelner einflußreicher Bürger, eine langfristige Perspektive ist nicht möglich. Die Verbindung zu den höheren Zielen des Gesamtsystems besteht nicht, da dies nicht explizit gefördert wird. Eine bewußte Steuerung des Wirtschaftsgeschehens ist notwendig, und der Kapitalismus als Wirtschaftsmodell ist innerhalb einer solchen Organisation optimal, da er breiten Freiraum läßt und für sein Funktionieren relativ wenig Regulierungen benötigt. Wenig Regulierung bedeutet viel Entscheidungsspielraum und mehr Freiheit. Unter gleichen Voraussetzungen ist zwischen zwei Subsystemen, die ein vergleichbares Ergebnis erzielen, dasjenige, das weniger Regulierungen benötigt, vorzuziehen, da es dem menschlichen Freiheitsgedanken gerechter wird. Stimmt man dieser Einschätzung zu, ist der Kapitalismus für den Menschen als gut zu bezeichnen, da er ihm ermöglicht, wirklich Mensch zu sein und im Rahmen seiner Fähigkeiten nach eigenem Ermessen zu handeln. Da es bisher in der Realität keine Umsetzung von Wirtschaftsmodellen gab, die den menschlichen Merkmalen gerechter werden und dem Individuum soviel Freiraum überlassen, muß der Kapitalismus als das bislang moralischste praktizierte System angesehen werden.
9.5. Kapitalismus und Moralität
Wie geht der Mensch mit seiner moralischen Freiheit um? Der Kapitalismus läßt ihm ja einen großen Handlungsspielraum und somit viele Möglichkeiten, moralisch zu handeln. Moralisches Handeln setzt freiwilliges Handeln voraus. Die Realität zeigt jedoch, dass der Mensch wenig Gebrauch von seiner moralischen Freiheit macht. Im Gegenteil, man kann sogar erkennen, dass die zunehmende Freisetzung von gesellschaftlichen und religiösen Zwängen, die sich auch im wirtschaftlichen Handeln bemerkbar machen, die Bereitschaft des Menschen reduzieren, seine Freiheit im Namen seiner Mitgeschöpfe freiwillig einzuschränken. Problematisch wäre die Erkenntnis, dass der Kapitalismus dem Bürger zwar einen größeren moralischen Entscheidungsspielraum gewährt, ihn jedoch so prägt, dass er zunehmend weniger die Bereitschaft aufbringt, dies zu tun. Es gibt Anzeichen für eine derartige Entwicklung. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Marktwirtschaft ein Verhalten fördert, dass die Mitmenschen als Mittel zur Erreichung der eigenen Ziele betrachtet, anstatt sie im kantianischen Sinne stets als Endzwecke zu sehen. Adam Smith sah darin eine rationale Verhaltensweise, folgender Zitat macht dies deutlich: „Dagegen ist der Mensch fast immer auf Hilfe angewiesen, wobei er jedoch kaum erwarten kann, dass er sie allein durch das Wohlwollen der Mitmenschen erhalten wird. Er wird sein Ziel wahrscheinlich viel eher erreichen, wenn er deren Eigenliebe zu seinen Gunsten zu nutzen versteht, indem er ihnen zeigt, dass es in ihrem eignen Interesse liegt, das für ihn zu tun, was er von ihnen wünscht.“[20]. Ein solches Verhalten steht im Widerspruch zum moralischen Verständnis Kants: „Nun sage ich: der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel zu beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, sondern muß in allen seinen sowohl auf sich selbst als auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden.“[21]. Michael Prowse sieht hier einen dem Kapitalismus inhärenten Widerspruch: „Capitalism gives us the means to treat others well [...] But market interactions are not like this. In the market we are given incentives to maximise our personal utility or well-being. And this leads us to treat others as objects to be manipulated to further our ends.“[22] Diese Erkenntnis ist ein schwierig zu lösendes Problem, denn einerseits besteht der Anspruch, dem Menschen, seine unantastbaren natürlichen Freiheiten zu belassen, andererseits muß dieser diese Freiheiten auch auf moralische Weise wahrnehmen und pflegen, weil dem System ansonsten das Fundament entzogen wird und in sich zusammenbricht. Dies hingegen ist keine rein wirtschaftliche Frage, sie geht weiter. Sie betrifft das gesamte Gesellschaftssystem. Der Kapitalismus ist nur ein Teilsystem des ganzen Gesellschaftssystem und korrespondiert in seinen Zügen der Demokratie. Der Mensch muß sich in dieser freiheitlichen Gesellschaftsstruktur zurechtfinden. Ein auf freiheitliches Denken ausgerichtetes System, dass entgegengesetzte Auswirkungen hat stellt ein Problem dar. Ganz offensichtlich sind im zwanzigsten Jahrhundert ehemals bedeutende soziale Bindungen abgeschwächt, da der Mensch hedonistischer und egozentrischer geworden ist. Mit großer Sicherheit sind diese Auswirkungen zumindest anteilig der Marktwirtschaft zuzuschreiben. Es scheint sich eine gegenseitige Wechselwirkung zwischen dem Menschen und dem System abzuzeichnen. Man geht anfänglich von bestimmten menschlichen Eigenschaften aus, denen das Kapitalistische System entgegenkommt. Gleichzeitig fördert dieses System die vorausgesetzten Eigenschaften und bestätigt sich selbst. Somit ist ein Ausweg aus diesem Zirkel kaum möglich, es sei denn man läßt Eingriffe seitens des übergeordneten Gesellschaftssystems zu. Unter der Prämisse der Realisierbarkeit ist es schwierig, sich ein ökonomisches Konzept vorzustellen, das dem Menschen so sehr gerecht wird, wie der Kapitalismus. Jedoch müssen die Grenzen eines Ökonomischen Systems erkannt werden. Dies wurde in der Vergangenheit oft übersehen. Besonders seit der Rivalität Kapitalismus/Sozialismus gibt es die Tendenz zu ideologisieren und das wirtschaftliche Denken auf alle Lebensbereiche auszuweiten.. Ein Ökonomisches System soll primär einen effizienten Ressourcengebrauch gewährleisten. Die Verbindung zu dem übergeordneten gesellschaftlichen System tritt bei der Re-Distribution des Wohlstandes in Erscheinung. Eine normative Regelung ist dann schlicht notwendig. Die klassische, kapitalistische Vorstellung, dass der Markt dies selbst regelt ist nicht realistisch. Die Übertragung von Naturgesetzen auf menschliche Systeme ist nicht haltbar. Da der Mensch bewußt handelt, und die Handlungen einer Vielzahl von Menschen sich gegenseitig beeinflussen, ist ein Minimum an Koordination notwendig. Die klassische Lehre des Kapitalismus umgeht die Frage, indem sie Probleme wie öffentliche Güter, Externalitäten usw. ... als Ausnahmen behandelt. In der Realität zeigt sich, dass eine aktive Einmischung der staatlichen Autoritäten notwendig ist. Dennoch besteht die permanente Gefahr, dass die Koordinierungs- und Kontrollfunktionen von Menschen übernommen wird, die persönlichen Wertvorstellungen und Ziele in den Vordergrund stellen.
10. Fazit
Es gibt in der Geschichte der Menschheit kein Beispiel eines Gesellschafts- und Wirtschaftssystems, dass der Natur des Menschen in gleicher Weise gerecht wird, wie die Kombination Demokratie und Marktwirtschaft. Wird die individuelle Freiheit eines jeden einzelnen Menschen als das oberste Gut fortschrittlicher, menschenwürdiger Gesellschaften betrachtet, so muß alles getan werden, um dieses Gut zu wahren. Andere, ebenfalls als wichtig betrachtete Güter, müssen bei diesem Vorhaben unter Umständen zurückgestellt werden. Ein gutes Beispiel ist das erstrebenswerte Gut der Gleichheit zwischen Menschen. Eine konsequente Verfolgung dieses Ziels gerät ab einem gewissen Grad in Konflikt mit dem absoluten Freiheitsziel und muß deshalb weichen, bis eine Kompatibilität wieder eintritt. Daher ruht die Akzeptanz eines gewissen Maßes an Ungleichheit zwischen Bürgern, denn die Umsetzung der eigenen Freiheit durch jedes Individuum bringt diese Ungleichheiten hervor. Die Umverteilung durch den Staat verringert diese entstandene Ungleichheit wiederum. Man könnte hier argumentierten, dass dies zu Lasten der Freiheit geschieht. Letztendlich ist es, wie im dritten Kapitel dargelegt eine auf Grundwerte beruhende Definitions- und Auslegungsfrage. Das Prinzip, dass eine kleine Minderheit im Auftrag der Mehrheit entscheidet, wird sich nicht verhindern lassen, wenn eine Gesellschaft handlungsfähig bleiben möchte. Eine Willkür durch diese Minderheit wird durch Pressefreiheit und regelmäßige Wahlen verhindert. Der Kapitalismus hat bislang diesem Grundsatz im großen Maße gedient und muß daher beibehalten werden, solange keine realistischen umsetzbaren Alternativmöglichkeiten entwickeln werden. Um diese Möglichkeit weiterhin aufrecht zu erhalten, darf die Kritik am Kapitalismus nicht verstummen.
Literaturverzeichnis
Descartes, R. (1637): Abhandlung über die Methode des Richtigen Vernunftgebrauchs und der Wissenschaftlichen Wahrheitsforschung, Stuttgart (1971)
Etzioni, A. (1988): Die Faire Gesellschaft, Frankfurt am Main (1996)
Engels, F. (1878): Anti-Dühring, Marx-Engels-Werke, Berlin (1962)
Hobbes, Th. (1651): Leviathan, Stuttgart (1976)
Homann, K. (1988): Die Rolle Ökonomischer Überlegungen in der Grundlegung der
Ethik, in H. Hesse: Wirtschaftswissenschaft und Ethik, Berlin, 1988
Kant, I. (1784): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Verlag Felix Meiner Hamburg (1965)
Katechismus der Katholischen Kirche, München (1993)
Koslowski, P. (1982): Ethik des Kapitalismus, 6. Auflage, Tübingen (1982)
Koslowski, P (1994): Die Ordnung der Wirtschaft. Studien zur Praktischen Philosophie und Politischen Ökonomie, Tübingen (1994)
Meyer-Abich, K-M. (1989) Wirtschaftliche Verantwortung für die Natur, in E.K.
Seifert, Pfriem: Wirtschaftsethik und Ökologische Wirtschaftsforschung, Bern/Stuttgart
(1989)
Nell-Breuning, O. von (1983): Worauf es mir ankommt (1983)
Prowse, M. (2000): Pause for thought: Hanging on to some ethical elbow room, Financial Times (23.12.2001)
Rawls, J. (1975): Zwei Regelbegriffe, in O. Höffe: Einführung in die Utilitaristische Ethik, München (1975)
Rich, A. (1990): Wirtschaftsethik Bd. II, Gütersloh (1990)
Smith, A. (1776): Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen, 6. Auflage, DTV München, (1993)
Spinoza, B. de (1677): Die Ethik, Stuttgart (1977)
[...]
[1] Vgl. Meyer-Abich, 1989, S. 58ff
[2] Vgl. Koslowski, 1982, S. 11
[3] Nell-Breuning, 1983
[4] Etzioni, 1996, S. 42
[5] Vgl. Descartes, 1971, S. 31
[6] Hobbes, 1976, S. 155
[7] Spinoza, 1977, S. 481
[8] Engels, 1962, S. 87
[9] Koslowski, 1994, S. 161
[10] Etzioni, 1996, S. 415
[11] Koslowski, 1994, S. 166
[12] Etzioni, 1996, S. 251
[13] Koslowski, 1982, S. 59
[14] Etzioni, 1996, S. 327
[15] Vgl. Rawls, 1975, S. 98
[16] Rich, 1990, S. 197
[17] Katechismus der katolischen Kirche, 1993, Punkt 2426
[18] Koslowski, 1994, S. 157
[19] Vgl. Homann, 1988, S. 223 ff
[20] Smith, 1993, S. 16
[21] Kant, 1965, S. 51
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Der Text ist eine umfassende Analyse und ethische Rechtfertigung des neuzeitlichen Kapitalismus. Er untersucht dessen Begriffsdefinitionen, philosophischen Grundlagen, geschichtliche Entwicklung, gesellschaftliche Bedeutung, sowie die Rolle des Individuums innerhalb des Systems. Darüber hinaus werden ethische Kritikpunkte innerhalb und außerhalb des kapitalistischen Paradigmas beleuchtet.
Welche philosophischen Axiome und Paradigmen werden im Zusammenhang mit dem Kapitalismus diskutiert?
Der Text behandelt die Bedeutung von Axiomen und Paradigmen im Allgemeinen und geht speziell auf die Teleologie, den Utilitarismus, den Empirismus, den Individualismus und die Vertragstheorie als philosophische Stützen des Kapitalismus ein. Auch die eigenen Axiome des Autors werden dargelegt.
Wie wird die geschichtliche Entwicklung des Kapitalismus dargestellt?
Die Entwicklung wird in Phasen unterteilt: klassischer Kapitalismus, Depression und Gewerkschaften, Keynesianismus, Monetarismus und Globalisierung. Zudem werden der Sozialismus und die soziale Marktwirtschaft als Alternativen zum neo-liberalen Kapitalismus betrachtet.
Welche ethischen Kritikpunkte am Kapitalismus werden innerhalb seines eigenen Paradigmas angeführt?
Die Kritikpunkte umfassen die Infragestellung moralischer Naturgesetze, die mechanistische Funktionsweise, die Bedeutung des Menschen, die Kontrolle durch Menschen und die Infiltration in Gesellschaft und Wissenschaft.
Welche ethischen Kritikpunkte am Kapitalismus werden außerhalb seines Paradigmas angeführt?
Diese Kritikpunkte umfassen die Betrachtung der wahren Natur des Menschen, des Menschen als soziales Wesen, Nutzenfunktionen, Wohlstandskriterien, das Gefangenendilemma, Verteilungsgerechtigkeit sowie Produktvielfalt und Ressourcenverschwendung.
Wie wird der neuzeitliche Kapitalismus ethisch gerechtfertigt?
Die ethische Rechtfertigung erfolgt durch die Betrachtung des Kapitalismus als Teilsystem der Gesellschaft, als freiheitliches System und die Bedeutung von Ethik im Kapitalismus. Der Einfluß des Staates und die Beziehung zwischen Kapitalismus und Moralität werden ebenfalls diskutiert.
Was sind die wichtigsten im Text behandelten Begriffe?
Zu den wichtigsten Begriffen gehören ethische Rechtfertigung, neuzeitlicher Kapitalismus, Teleologie, Utilitarismus, Empirismus, Individualismus, Vertragstheorie, Sozialismus, soziale Marktwirtschaft, Homo Oeconomicus, und Utilitarismus.
Welche Rolle spielt das Individuum im Kapitalismus laut Text?
Das Individuum wird als Ausgangspunkt der Wertehierarchie betrachtet, wobei die Betonung auf seiner individuellen Freiheit liegt. Gleichzeitig wird der Mensch als selbstinteressiertes Individuum gesehen, dessen Entfaltungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt gestellt werden.
Welche Rolle spielt die Globalisierung im Kapitalismus laut Text?
Die Globalisierung wird als ein wichtiger Faktor des neuzeitlichen Kapitalismus behandelt, mit der Ausweitung multinationaler Unternehmen in Zweit- und Drittweltländern. Es wird auf ethische Problemstellungen wie Gewinnexporte, Verschlechterung der Handelskonditionen für Drittweltländer und Verlagerung von Tätigkeiten eingegangen.
Was ist die Kernaussage oder Fazit des Textes?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass es in der Geschichte der Menschheit kein anderes System gibt, dass der menschlichen Natur in gleichem Maße gerecht wird wie die Kombination aus Demokratie und Marktwirtschaft. Solange keine realistischen Alternativen entwickelt werden, sollte die Marktwirtschaft beibehalten und weiterentwickelt werden. Kritik am Kapitalismus sollte stets vorhanden sein, um Verbesserungspotentiale aufzuzeigen.
- Quote paper
- MBA, MSc Olivier Harnisch (Author), 2001, Ethische Rechtfertigung des Neuzeitlichen Kapitalismus - Ein Widerspruch?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111643