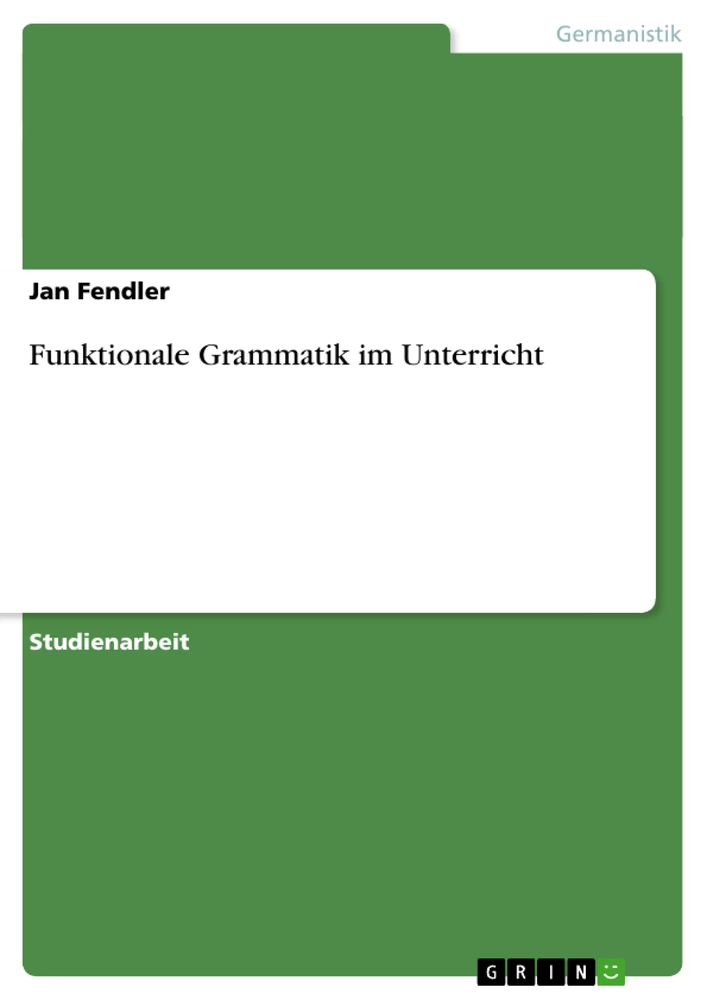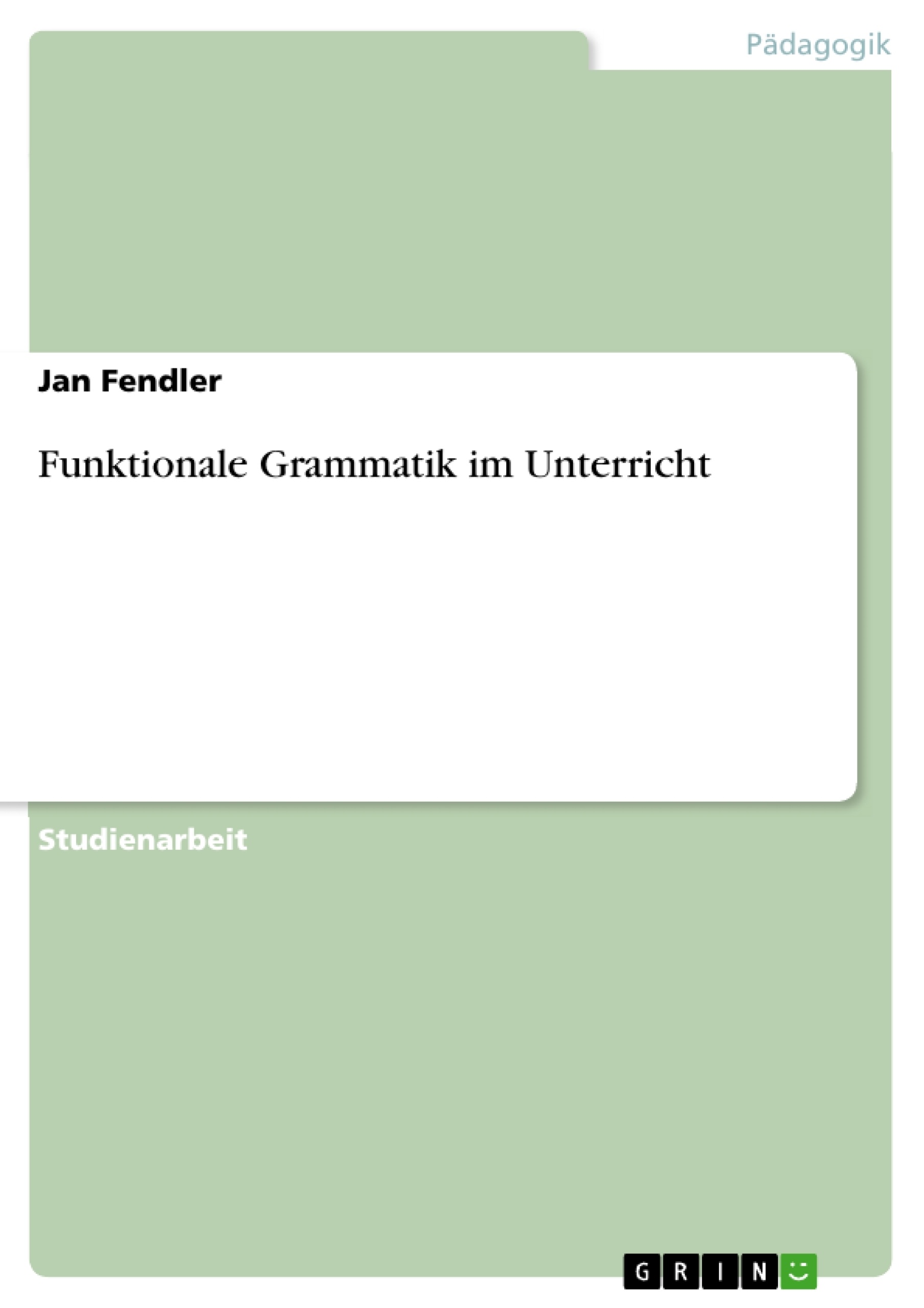Grammatik als wesentlicher Bestandteil des ganzheitlichen Sprachunterrichts unterliegt der strukturellen Gestaltung von Unterrichtsmethoden. Wurde die Grammatik zu Zeiten der Grammatik-Übersetzungs-Methode als traditionelle Schulgrammatik verstanden, die im Mittelpunkt des Geschehens zu sehen war, so orientierte sich die Direkte Methode an behavioristischen Lehrverfahren, in deren Mittelpunkt Drill und Practise des sprachlichen Gebrauchs standen. Regelverständnis wurde nun nicht mehr als deduktives Lehrverfahren angewandt, sondern induktiv. Die Grammatik selbst meist nur in Form eines Anhangs einer jeden Lektion. Diese Vernachlässigung von Regelwissen der Grammatik widersprach dem Handeln der entsprechenden Unterrichtsmethode. Die Audiolinguale Methode konzentrierte sich zum Beispiel auf die alltäglichen Kommunikationsmuster der Lerner, die man durch authentische Sprachsituationen trainierte (Pattern Drill). Fehler wurden systematisch „ausradiert“. Die Bedeutung eines Regelverständnisses war nur schwach ausgeprägt, nicht aber die Forderung nach grammatisch korrekter Beherrschung. So erkannte man die individuellen grammatikalischen Strukturen jeder einzelnen Sprache an, dass der Lerner aber auch ein Verständnis (Warum wird welche grammatikalische Regel in welcher Kommunikation angewendet?) für diese benötigt, um selbstständig und zukünftig fehlerarm zu kommunizieren, beachtete man nicht. Wenn Grammatikunterricht in erster Linie durch Sprechnachahmung unterrichtet wird, folglich kein expliziter Grammatikteil im Unterricht besteht, so kann auch keine Systematisierung erfolgen.
Die Wende der 80er Jahre – Fremdperspektive als Novum des Sprachenerwerbs -ermöglichte den interkulturellen Sprachvergleich auf den sozio- und psycholinguistischen Ebenen, gleichzeitige trat die Forderung nach Zweisprachigkeit und Regelwissen für den Lerner in das unterrichtliche Geschehen. Die Folge aus diesem dynamischen Strukturprozess war die Kognitivierung des Sprachunterrichts, ein Verständnis von Sprachwissen (Regelwissen der Grammatik und Lexik) und Sprachbewusstsein (sozio- & psycholinguistische Konstrukte), das einen Unterrichtsansatz mit dem Zentrum der „language awareness“ erfordert und damit dem mentalistischem Ansatz und die Notwendigkeit einer reformierten Grammatik erkannte.
Inhaltsverzeichnis
1. Theorie der Funktionalen Grammatik
Historischer Abriss
Grammatik als wesentlicher Bestandteil des ganzheitlichen Sprachunterrichts unterliegt der strukturellen Gestaltung von Unterrichtsmethoden. Wurde die Grammatik zu Zeiten der Grammatik-Übersetzungs-Methode als traditionelle Schulgrammatik verstanden, die im Mittelpunkt des Geschehens zu sehen war, so orientierte sich die Direkte Methode an behavioristischen Lehrverfahren, in deren Mittelpunkt Drill und Practise des sprachlichen Gebrauchs standen. Regelverständnis wurde nun nicht mehr als deduktives Lehrverfahren angewandt, sondern induktiv. Die Grammatik selbst meist nur in Form eines Anhangs einer jeden Lektion. Diese Vernachlässigung von Regelwissen der Grammatik widersprach dem Handeln der entsprechenden Unterrichtsmethode. Die Audiolinguale Methode konzentrierte sich zum Beispiel auf die alltäglichen Kommunikationsmuster der Lerner, die man durch authentische Sprachsituationen trainierte (Pattern Drill). Fehler wurden systematisch „ausradiert“. Die Bedeutung eines Regelverständnisses war nur schwach ausgeprägt, nicht aber die Forderung nach grammatisch korrekter Beherrschung. So erkannte man die individuellen grammatikalischen Strukturen jeder einzelnen Sprache an, dass der Lerner aber auch ein Verständnis (Warum wird welche grammatikalische Regel in welcher Kommunikation angewendet?) für diese benötigt, um selbstständig und zukünftig fehlerarm zu kommunizieren, beachtete man nicht. Wenn Grammatikunterricht in erster Linie durch Sprechnachahmung unterrichtet wird, folglich kein expliziter Grammatikteil im Unterricht besteht, so kann auch keine Systematisierung erfolgen.
Die Wende der 80er Jahre – Fremdperspektive als Novum des Sprachenerwerbs -ermöglichte den interkulturellen Sprachvergleich auf den sozio- und psycholinguistischen Ebenen, gleichzeitige trat die Forderung nach Zweisprachigkeit und Regelwissen für den Lerner in das unterrichtliche Geschehen. Die Folge aus diesem dynamischen Strukturprozess war die Kognitivierung des Sprachunterrichts, ein Verständnis von Sprachwissen (Regelwissen der Grammatik und Lexik) und Sprachbewusstsein (sozio- & psycholinguistische Konstrukte), das einen Unterrichtsansatz mit dem Zentrum der „language awareness“ erfordert und damit dem mentalistischem Ansatz und die Notwendigkeit einer reformierten Grammatik erkannte.
Aber erst die mentalistische Wende, sprachliches Handeln und Sprachreflexion als primäre Ziele, mit den theoretischen Grundlagen kognitiver Lehrverfahren, postulierte die Grammatik nicht in der traditionellen Form als notwendigen Anhang bzw. als traditionelle Schulgrammatik, sondern als einen elementaren Bereich des Sprachenkönnens zum Ziel des funktionalen Umgangs mit Sprache.
Notwendigkeit der Grammatik
Ohne Grammatik gäbe es keine einheitlichen Regeln für die Verwendung von Wörtern (die dann auch nicht existieren dürften) und ihrer Bedeutung in Sätzen (die ebenfalls nicht existieren könnten). Sprache bestünde aus unkoordinierten Lauten, die in losen Folgen aneinandergereiht wären. Dennoch wäre die Vermittlung von emotionalen Informationen, losgelöst von Grammatik, möglich. Aber eine Sprache ohne festgelegte Grammatikregeln wäre unsystematisch und ließe keine Möglichkeit für das Erlernen einer Sprache selbst, folglich gäbe es keine Kommunikation. Unter der Annahme der Identitätshypothese könnte man argumentieren, dass die einzige Systematisierung durch die von Chomsky postulierten unbewussten, angeborenen, höchst abstrakten, sprachspezifischen, universellen und kognitiven Erwerbsmechanismen erfolgen würde. Wobei angemerkt sei, dass Wortschatz, spezifische Formen der verschiedenen morphologischen Teilsysteme (Nominalflexion, Phoneminventar etc.) und Idiosynkrasien der einzelnen sprachlichen Syntax nicht existieren dürften und somit der Inhalt der Universalgrammatik marginal wäre.
Es steht außer Frage, und das zeigte schon der historische Abriss, dass die Grammatik aus dem Erwerbs- und Lernprozess von (Fremd)Sprache nicht zu entfernen ist. Viel bedeutender jedoch ist die Erkenntnis, dass nicht die Beherrschung ihrer Regeln oder gar Grammatik als Selbstzweck Ziel des Unterrichts sein kann (vgl. Grammatik-Übersetzungs-Methode, bzw. Vermittelnde Methode) sondern der Grammatik eine dienende Rolle zukommt. „Sie soll Kommunikation im umfassenden Sinne ermöglichen.“ (Götze, 1993) Eine kommunikativ-funktionale Grammatik wird benötigt, die sich in den Ansatz der Pragmalinguistik und mentalistischen Wende einordnet und dem Lerner den Sprachgebrauch sowie das Sprachverständnis (Sprachwissen) erleichtert. Die Synthese von Sprachgebrauch und Sprachwissen ermöglicht die Entwicklung eines Sprachbewusstseins, welches als Ausgangspunkt zur Entwicklung elaborierter kognitiver Strukturen gesehen werden kann. Ihr Ziel – eine metakommunikative Kompetenz hinsichtlich Verstehen, Analyse und Produktion (vgl. Ulrich, 2001).
Darüber hinaus sind aber auch weitere Faktoren für die Bedeutung der Grammatik im Fremdsprachenunterricht von hohem Interesse. Mit Verweis auf den bildungsorientierten Ansatz, wie er in der Grammatik-Übersetzungs-Methode postuliert wurde, gilt die Einsicht in Bauweise, Funktion und Geschichte der Sprache als Teil des allgemeinen Bildungswissens, folglich als notwendiges Element der Grammatik. Die Förderung des korrekten Gebrauchs der Standardsprache als Mittel zum Verständnis grammatischer Strukturen hilft auch der orthographischen Beherrschung von Wörtern. Aber nicht nur die Standardsprache verbessert die Rechtschreibung und Zeichensetzung, sondern ebenso das Erlernen grammatischer Strukturen – ein funktionaler Ansatz. So kann Groß- und Kleinschreibung wesentlich einfacher durch den Lerner behandelt werden, wenn ein Verständnis für Satzbau und Satzstruktur gegeben ist. Deutsch als Fremdsprache bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, Strukturen der Muttersprache als Grundlage für das Erlernen von Deutsch zu verwenden. Dabei sei verwiesen auf das Ranschburgische Phänomen (Juhász, 1970) – dass Lerner ihre Aufmerksamkeit auf Unterschiede richten und Kontrastmangel zur „homogenen Hemmung“ führt.
Klärung des Funktionsbegriffs
Sofern von einer kommunikativ- funktionalen Grammatik gesprochen wird, muss auch der Begriff der Kommunikation näher erläutert werden. Kommunikation als Darstellungs-, Ausdrucks- und Appellfunktion die dem Menschen vorbehalten ist (vgl. Organum-Modell, Bühler 1978) steht zugleich in Abhängigkeit zu Kontextfaktoren, die der Mensch kognitiv erschließen muss.
Die Äußerung eines Satzes kann verschiedene kommunikative Funktionen haben. Der Satz „Mir ist kalt.“ beinhaltet nicht nur eine Ausdrucksfunktion, mit welcher der Sprecher seiner Umwelt die Information über sein Befinden mitteilen möchte, sondern kann in der Darstellungsfunktion erklären, warum der Sprecher zum Beispiel zittert und „Gänsehaut“ hat. Zusätzlich kann diese Äußerung eine indirekte Aufforderung mittels Appellfunktion enthalten, die den Hörer dazu auffordert das Fenster zu schließen.
Kognitiv erfordert die kommunikative Funktion vom Sprecher/ Schreiber die Filterung von Intakes aus dem kontextbezogenen Input, welcher wiederum für das Bilden von Hypothesen sowie ihre Prüfung verwendet werden muss, um einen erfolgreichen Kommunikationsprozess (Output) zu entwickeln.
Dabei testet der Lerner die gebildeten Hypothesen anhand von Informationen, die ihm durch Rückmeldung aus der Umwelt gegeben werden, aber auch metasprachlich durch den Rückgriff aus sicheren Informationsquellen und rezeptiv mittels aktuellen fremdsprachlicher Daten. Hypothesen, die jenes Falsifikationsprinzip bestanden haben, werden in die Lernersprache übernommen und ermöglichen somit den Aufbau eines lernersprachlichen Wissens zur verbesserten Kommunikation mit der Lernumgebung.
Die Kommunikationsfunktion kann aber nur dann erfolgreich bewältigt werden, wenn ein grammatisches Verständnis vorhanden ist, ausreichende Lexik vom Sprecher beherrscht wird, und dieser beurteilen kann, ob die Äußerung in den entsprechenden Kontext der Situation passt „…eine funktionale Orientierung schließt grammatisches Wissen nicht aus, sondern ein.“ (Götze 1999). Nach Immanuel Kant wird dies als Funktion der Urteilskraft bewertet - die grammatische Kompetenz ist daher in die kommunikative eingebettet und ein wesentlicher Bestandteil zur erfolgreichen Kommunikation. Jakobsen (1969) erweiterte die Bedeutung der Kommunikation, indem er sie als Oberbegriff für alle Funktionen der Sprachverwendung bezeichnete. Helbig (1999) operationalisierte diese Auffassung, indem er die Mehrdeutigkeit des Funktionsbegriffs in vier folgende Funktionen ordnete.
- Grammatische Phänomene wie Satzglieder, Endstellung des Finitums im eingeleiteten Nebensatz etc. erhielten eine syntaktische Funktion im Bereich der Kommunikation.
- Eine Unterscheidung zwischen innersprachlich (die Bedeutung eines Wortes) und außersprachlich (die Denotation) als semantische Funktion in der Sprachwissenschaft.
- Die kommunikative Funktion, die Strukturen zu Thema-Rhema und Referenzen im Text definiert sowie abschließend
- die logische Funktion, die den Leser/ Hörer die Darstellung von Äußerungen in Sätzen erschließen lässt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Dokuments "Inhaltsverzeichnis"?
Das Dokument befasst sich mit der Theorie der Funktionalen Grammatik und ihrer Anwendung im Sprachunterricht. Es behandelt historische Aspekte, die Notwendigkeit von Grammatik, die Klärung des Funktionsbegriffs und praktische Aspekte des Unterrichts.
Welche Rolle spielt Grammatik im Sprachunterricht laut diesem Dokument?
Das Dokument argumentiert, dass Grammatik ein wesentlicher Bestandteil des Spracherwerbs und -lernens ist. Es wird betont, dass Grammatik nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zur Ermöglichung von Kommunikation im umfassenden Sinne dienen sollte. Eine kommunikativ-funktionale Grammatik wird befürwortet, die Sprachgebrauch und Sprachwissen vereint.
Was ist die Bedeutung des Funktionsbegriffs im Kontext der Funktionalen Grammatik?
Der Funktionsbegriff bezieht sich auf die verschiedenen kommunikativen Funktionen, die eine Äußerung haben kann, wie Darstellungs-, Ausdrucks- und Appellfunktion. Er beinhaltet auch die kognitiven Prozesse, die erforderlich sind, um Intakes aus dem kontextbezogenen Input zu filtern und Hypothesen zu bilden.
Wie hat sich der Grammatikunterricht im Laufe der Zeit verändert?
Das Dokument beschreibt, wie sich der Grammatikunterricht von der traditionellen Schulgrammatik der Grammatik-Übersetzungs-Methode über behavioristische Ansätze der Direkten Methode hin zu kommunikativ-funktionalen Ansätzen entwickelt hat. Es wird die Bedeutung des Sprachbewusstseins und der metakommunikativen Kompetenz hervorgehoben.
Welche Argumente werden für die Notwendigkeit von Grammatik angeführt?
Ohne Grammatik gäbe es keine einheitlichen Regeln für die Verwendung von Wörtern und ihrer Bedeutung in Sätzen. Sprache bestünde aus unkoordinierten Lauten und es gäbe keine Möglichkeit für das systematische Erlernen einer Sprache.
Welche Funktionen der Sprache werden im Dokument erwähnt?
Das Organum-Modell von Bühler (1978) wird erwähnt, das die Sprache in Darstellungs-, Ausdrucks- und Appellfunktion unterteilt. Auch die von Jakobson (1969) erweiterte Bedeutung der Kommunikation als Oberbegriff für alle Funktionen der Sprachverwendung wird genannt, sowie die Operationalisierung des Funktionsbegriffs durch Helbig (1999) in syntaktische, semantische, kommunikative und logische Funktionen.
Was wird unter dem Begriff "Sprachbewusstsein" im Dokument verstanden?
Sprachbewusstsein ist ein Verständnis von Sprachwissen (Regelwissen der Grammatik und Lexik) und Sprachbewusstsein (sozio- & psycholinguistische Konstrukte). Es ermöglicht die Entwicklung elaborierter kognitiver Strukturen und eine metakommunikative Kompetenz hinsichtlich Verstehen, Analyse und Produktion.
Welche Rolle spielt die Standardsprache im Grammatikunterricht?
Die Förderung des korrekten Gebrauchs der Standardsprache als Mittel zum Verständnis grammatischer Strukturen hilft auch der orthographischen Beherrschung von Wörtern.
Was ist das Ranschburgische Phänomen und wie ist es relevant?
Das Ranschburgische Phänomen (Juhász, 1970) besagt, dass Lerner ihre Aufmerksamkeit auf Unterschiede richten und Kontrastmangel zur „homogenen Hemmung“ führt. Es ist relevant, weil es darauf hinweist, dass der Vergleich von Strukturen der Muttersprache und der Zielsprache das Lernen erleichtern kann.
- Quote paper
- Jan Fendler (Author), 2008, Funktionale Grammatik im Unterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111726