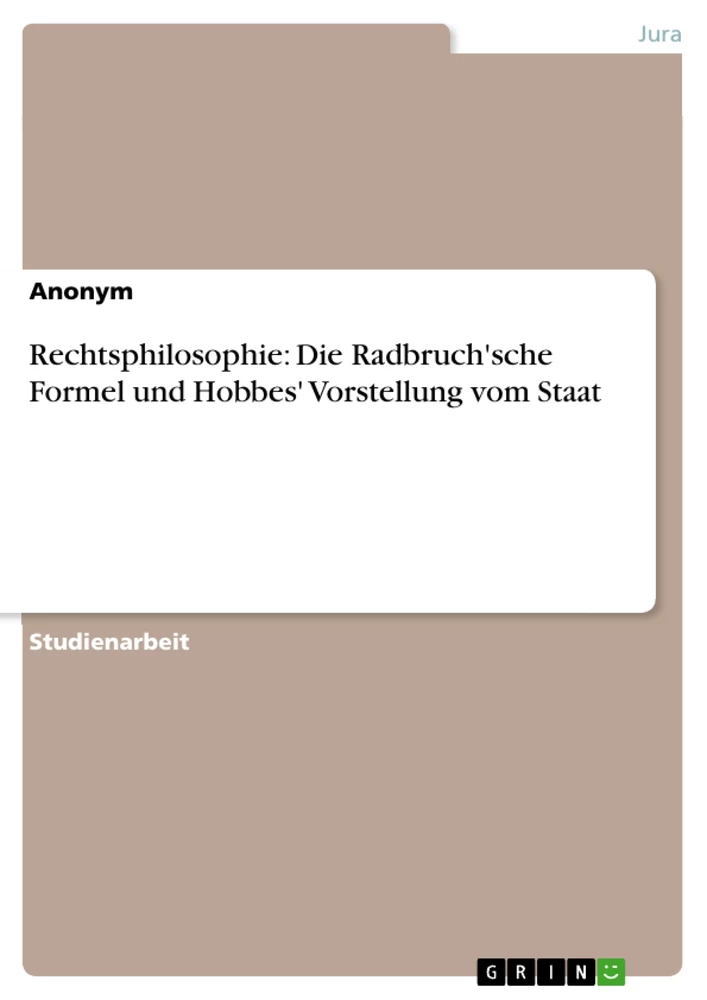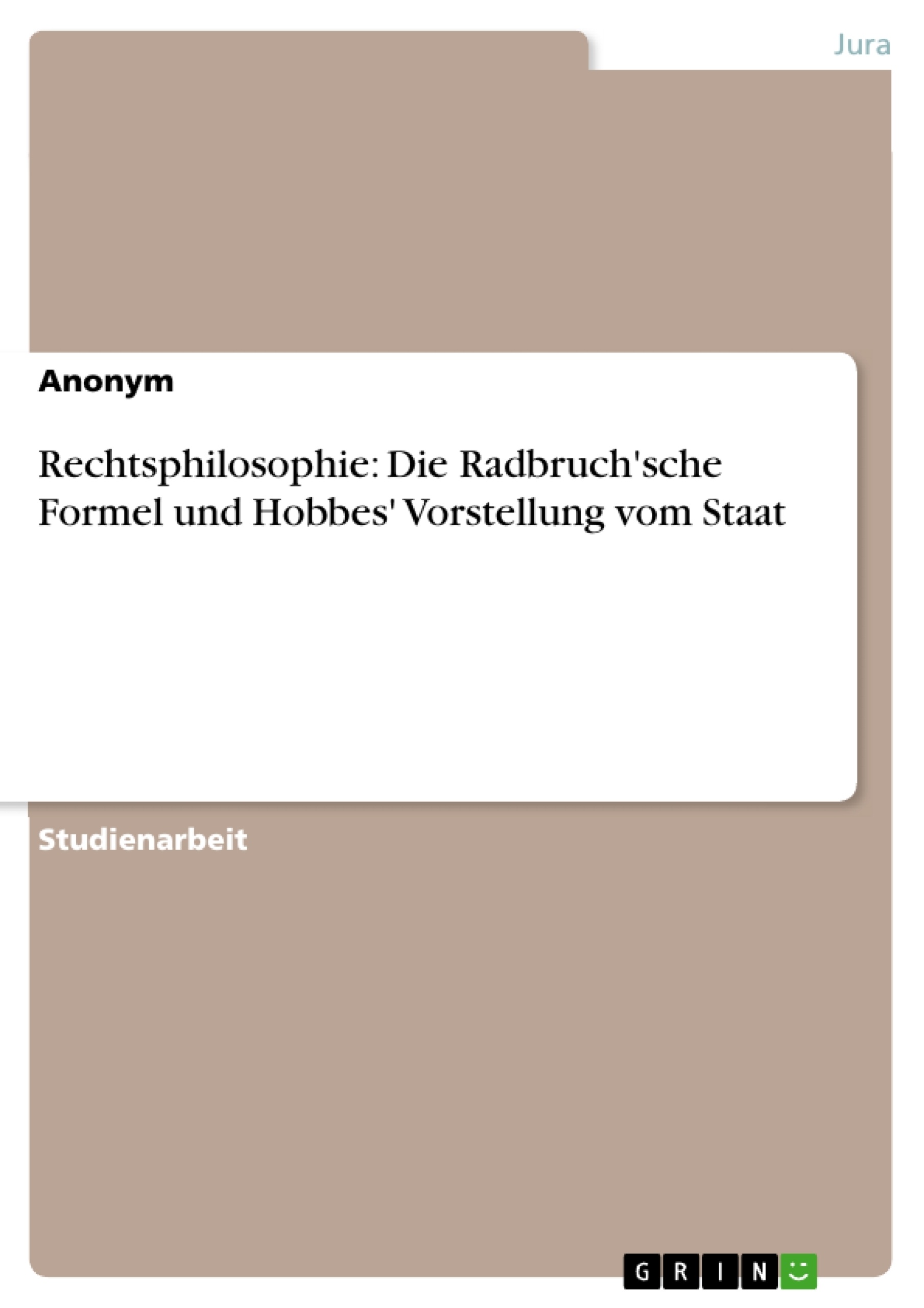In der Arbeit wird zuerst die Kernproblematik der Unterscheidung von Rechtspositivismus und Naturrecht anhand der Radbruch'schen Formel dargelegt.
Im zweiten Teil wird Thomas Hobbes' Entwurf vom Staat dargelegt und selbst dazu Stellung genommen.
Gustav Radbruch befasst sich in dem zu behandelnden Ausschnitt aus seinem Werk „Rechtsphilosophie“ mit der Problematik des Rechtspositivismus. Seine Beispiele wählt Radbruch dabei gezielt aus der Zeit des Dritten Reichs. Radbruch schrieb sein Buch kurz nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland. Das Deutschland seiner Zeit befand sich gerade in einer Phase der Aufarbeitung der vorangegangen 12 Jahre, in denen Adolf Hitler und seine Partei die NSDAP ein Terrorregime in Deutschland etabliert hatten. Die Regierung war durch das Ermächtigungsgesetz von 1933 mit legislativen Kompetenzen betraut worden. Diese Gesetze entsprachen oft nicht den gängigen Menschenrechten. Jedoch war es Soldaten und Juristen trotzdem geboten, sich an diese Gesetze zu halten und nach diesen zu urteilen. Beispielhaft führt Radbruch dazu den Fall von Puttfarken und Göttig an. Göttig hatte an einem Abort den Satz „Hitler ist ein Massenmörder und schuld am Kriege“ als Inschrift hinterlassen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Aufgabe: Kernproblematik der Unterscheidung von Positivismus/Naturrecht anhand des Textes von Gustav Radbruch („Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht“, SJZ 1 (1946), S. 105-108)
- I. Der historische Kontext
- II. Das positivistische Rechtsdenken
- III. Argumente Radbruchs gegen die positivistische Rechtswissenschaft
- IV. Überzeugungskraft von Radbruchs Werk
- 2. Aufgabe: Hobbes' Vorstellung vom Staat. Eigene Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Kernproblematik der Unterscheidung zwischen Rechtspositivismus und Naturrecht anhand des Textes von Gustav Radbruch. Sie untersucht den historischen Kontext, in dem Radbruchs Argumentation entstand, beleuchtet das positivistische Rechtsdenken und analysiert Radbruchs Kritik an der positivistischen Rechtswissenschaft. Zudem wird die Überzeugungskraft von Radbruchs Werk bewertet.
- Der historische Kontext und die Problematik des Rechtspositivismus im Dritten Reich
- Radbruchs Kritik an der extremen Auslegung des Rechtspositivismus
- Die Bedeutung von Gerechtigkeit und Naturrecht in der Rechtsanwendung
- Die Rolle von Gesetzen im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Gerechtigkeit
- Die Frage nach der Legitimität von Gesetzen, die gegen grundlegende moralische Prinzipien verstoßen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I beleuchtet den historischen Kontext, in dem Radbruch seine Kritik am Rechtspositivismus formulierte, und zeigt die Problematik des Rechtspositivismus während der NS-Herrschaft auf.
- Kapitel II präsentiert die Grundzüge des positivistischen Rechtsdenkens, welches die Gültigkeit des Gesetzes unabhängig von seiner moralischen Qualität betrachtet.
- Kapitel III analysiert Radbruchs Kritik an der positivistischen Rechtswissenschaft und zeigt die Gefahren einer unkritischen Anwendung des Rechtspositivismus auf.
- Kapitel IV bewertet die Überzeugungskraft von Radbruchs Werk und diskutiert die Bedeutung seiner Argumentation für die aktuelle Rechtsphilosophie.
Schlüsselwörter
Rechtspositivismus, Naturrecht, Gustav Radbruch, Gesetzliches Unrecht, Übergesetzliches Recht, Gerechtigkeit, Rechtsstaat, NS-Zeit, Menschenrechte, Rechtsunsicherheit, Legitimität, Rechtsanwendung, Moral, Philosophie des Rechts.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Radbruch'sche Formel?
Sie besagt, dass positives Gesetz auch dann Vorrang hat, wenn es ungerecht ist, es sei denn, der Widerspruch zur Gerechtigkeit ist so unerträglich, dass das Gesetz als "unrichtiges Recht" der Gerechtigkeit weichen muss.
In welchem historischen Kontext entstand Radbruchs Text?
Der Text entstand 1946 unmittelbar nach der NS-Diktatur, um das Problem des "gesetzlichen Unrechts" der Nationalsozialisten aufzuarbeiten.
Was ist der Unterschied zwischen Rechtspositivismus und Naturrecht?
Rechtspositivismus sieht Recht als das vom Gesetzgeber gesetzte Recht an, während Naturrecht davon ausgeht, dass es übergeordnete, moralische Rechtsprinzipien gibt.
Wie dachte Thomas Hobbes über den Staat?
Hobbes entwarf das Bild eines starken Staates (Leviathan), der die Sicherheit der Bürger garantiert, wobei er eine eher positivistische Sicht auf Gesetze vertrat.
Warum ist Radbruchs Kritik am Positivismus heute noch relevant?
Sie dient als Mahnung, dass Gesetze nicht blind befolgt werden dürfen, wenn sie elementare Menschenrechte verletzen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Rechtsphilosophie: Die Radbruch'sche Formel und Hobbes' Vorstellung vom Staat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1117558