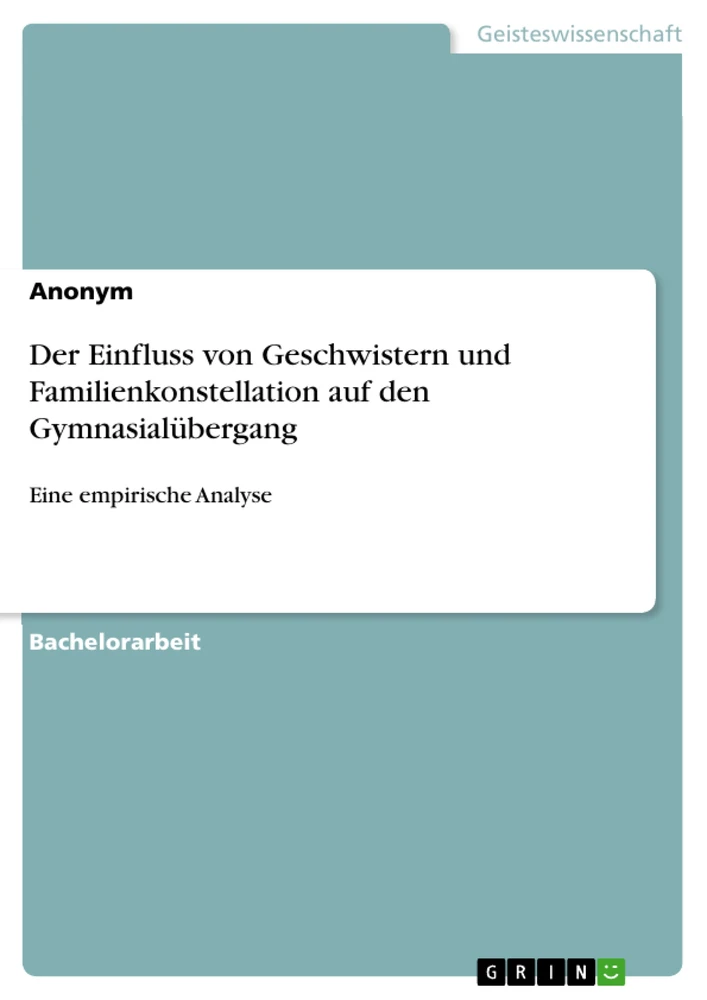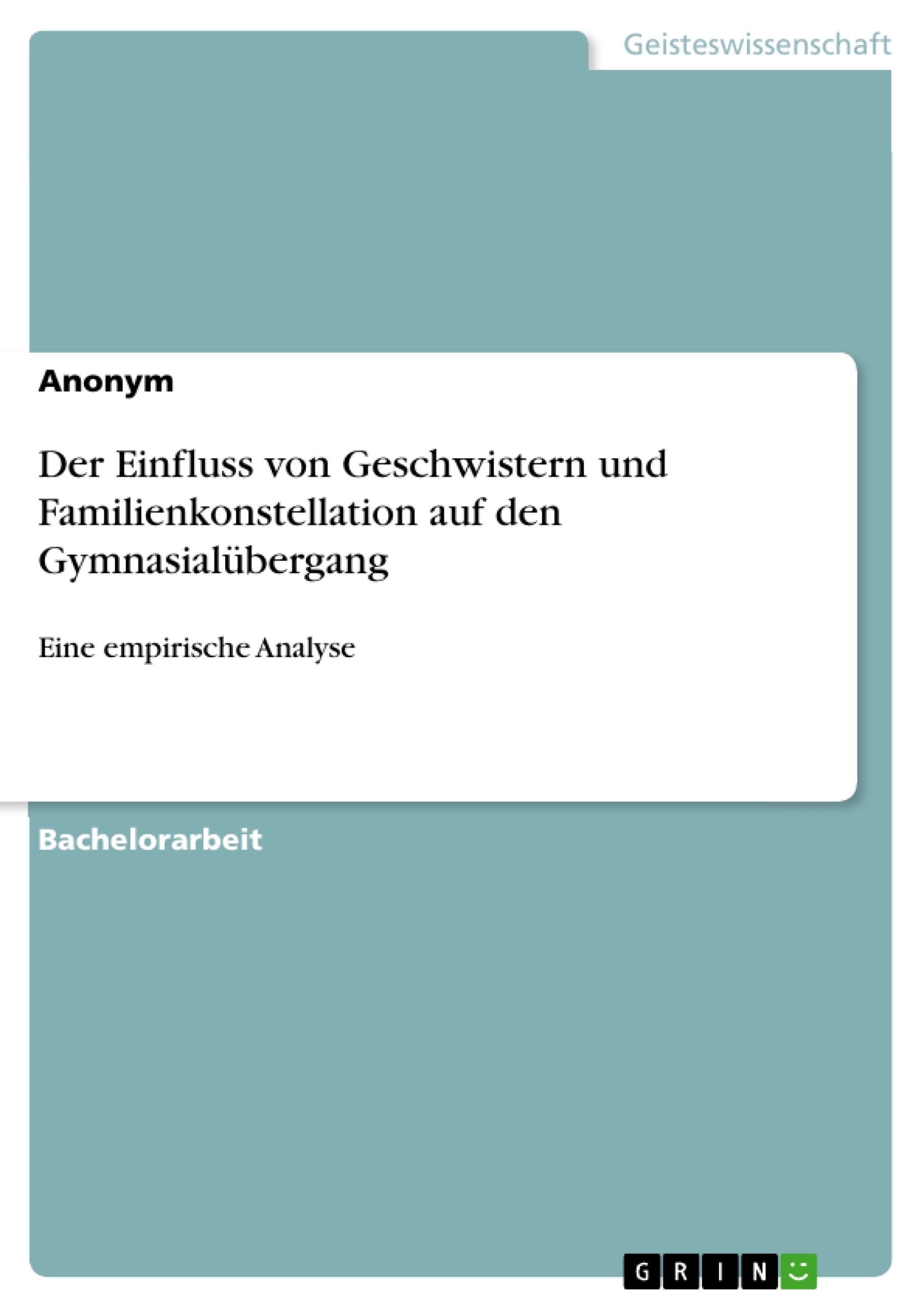Diese Arbeit untersucht mit Daten des Mikrozensus 2014 die Gymnasialübergangswahrscheinlichkeit zwischen drei Gruppen: Kinder mit älterem Geschwisterkind, Kinder ohne älteres, jedoch mit jüngerem Geschwisterkind und Einzelkinder. Es wird mittels linearer Wahrscheinlichkeitsmodelle geprüft, ob der Einfluss von Geschwistern mit der Familienform variiert. Darüber hinaus wird geprüft, ob sich der Einfluss von Geschwisterkindern je nach Tätigkeitsart der Mutter (Vollzeit-, Teilzeit-, Nichterwerbstätigkeit) ändert. Innerhalb der Gruppe von Kindern mit älteren Geschwistern wird darüber hinaus auf einen sich verändernden Einfluss geprüft, sollten sich diese hinsichtlich objektiver Merkmale wie Geschlecht und Alter ähneln. Die Ergebnisse zeigen, dass der negative Einfluss älterer Geschwister genau dann schwächer wird, wenn sie den jüngeren hinsichtlich objektiver Merkmale wie Alter und Geschlecht ähneln. Gehen ältere Geschwisterkinder selbst auf das Gymnasium, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für jüngere Kinder, auch ein Gymnasium zu besuchen, drastisch. Dass die Erwerbstätigkeit der Mutter die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, beeinflusst, konnte nicht nachgewiesen werden. Kombinierte Effekte aus dem Vorhandensein von Geschwisterkindern, Familienform und Erwerbstätigkeit der Mutter konnten ebenfalls nicht nachgewiesen werden.
Der Einfluss älterer Geschwisterkinder auf den Gymnasialübergang jüngerer Kinder der Familie variiert mit familienstrukturellen Merkmalen wie der Eltern- und Geschwisterkonstellation. Studien ergeben, dass ältere Geschwisterkinder in Familien mit zwei Elternteilen die Gymnasialübergänge ihrer jüngeren Geschwister negativ beeinflussen. Dieser Effekt kehrt sich in Alleinerziehendenhaushalten um.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Stand der empirischen Forschung
- 3 Theorie und Hypothesen
- 3.1 Sozialisationstheorie und Bildungsübergänge
- 3.2 Sozialisation in der Familie als soziales System
- 3.3 Ressourcentheorie
- 3.4 Funktionen und Bedeutung älterer Geschwister
- 4 Daten und Methode
- 4.1 Datengrundlage
- 4.2 Abhängige Variable
- 4.3 Unabhängige Variablen
- 4.4 Kontrollvariablen
- 4.5 Statistische Berechnungen
- 4.6 Kritische Betrachtung der Methode
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Erste bivariate Analyse: Häufigkeitstabelle
- 5.2 Zweite bivariate Analyse: Kreuztabelle
- 5.3 Ergebnisse der ersten Regression
- 5.4 Ergebnisse der zweiten Regression
- 6 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Geschwistern auf den Gymnasialübergang jüngerer Kinder, wobei die Familienstruktur als entscheidender Faktor berücksichtigt wird. Die Arbeit analysiert, ob der Einfluss von Geschwistern mit der Familienform (z.B. Ein-Eltern-Familie, Kernfamilie) und der Erwerbstätigkeit der Mutter variiert.
- Einfluss von Geschwistern auf Bildungsübergänge
- Familienform und Erwerbstätigkeit der Mutter als Einflussfaktoren
- Unterschiede zwischen dem Einfluss älterer und jüngerer Geschwister
- Vergleich zwischen Familien mit Geschwistern und Einzelkindern
- Soziologische Theorien und Bildungsverläufe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen Familienkonstellation und Bildungsübergängen von Kindern darlegt. Sie beleuchtet die zunehmende Pluralisierung von Elternkonstellationen und die Bedeutung von Geschwistern als Einflussfaktoren. Anschließend werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit erläutert, die sich auf Sozialisationstheorien, Familienstrukturen und Ressourcentheorien beziehen. Die Kapitel 4 und 5 beschreiben die Daten und Methoden der Untersuchung sowie die Ergebnisse der empirischen Analyse. Dabei werden verschiedene statistische Verfahren angewendet, um den Einfluss von Geschwistern auf den Gymnasialübergang unter Berücksichtigung der Familienstruktur zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Bildungsübergang, Gymnasialübergang, Familienform, Geschwisterkonstellation, Ein-Eltern-Familien, Kernfamilie, Erwerbstätigkeit, Sozialisationstheorie, Ressourcentheorie, empirische Analyse, lineare Wahrscheinlichkeitsmodelle, Mikrozensus.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen ältere Geschwister den Gymnasialübergang?
In Kernfamilien haben ältere Geschwister oft einen negativen Einfluss auf die Übergangswahrscheinlichkeit, während sich dieser Effekt in Alleinerziehendenhaushalten umkehren kann.
Was passiert, wenn das ältere Geschwisterkind bereits auf dem Gymnasium ist?
Besucht das ältere Kind ein Gymnasium, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für das jüngere Kind drastisch, ebenfalls diesen Bildungsweg einzuschlagen.
Spielt die Erwerbstätigkeit der Mutter eine Rolle?
In der vorliegenden Studie konnte kein signifikanter Einfluss der mütterlichen Erwerbstätigkeit auf die Gymnasialübergangswahrscheinlichkeit nachgewiesen werden.
Welchen Einfluss hat die Ähnlichkeit der Geschwister?
Der negative Einfluss älterer Geschwister wird schwächer, wenn sie dem jüngeren Kind in Merkmalen wie Alter und Geschlecht ähneln.
Welche Datengrundlage wurde für die Untersuchung genutzt?
Die Untersuchung basiert auf Daten des Mikrozensus 2014 und nutzt lineare Wahrscheinlichkeitsmodelle.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Der Einfluss von Geschwistern und Familienkonstellation auf den Gymnasialübergang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1117695