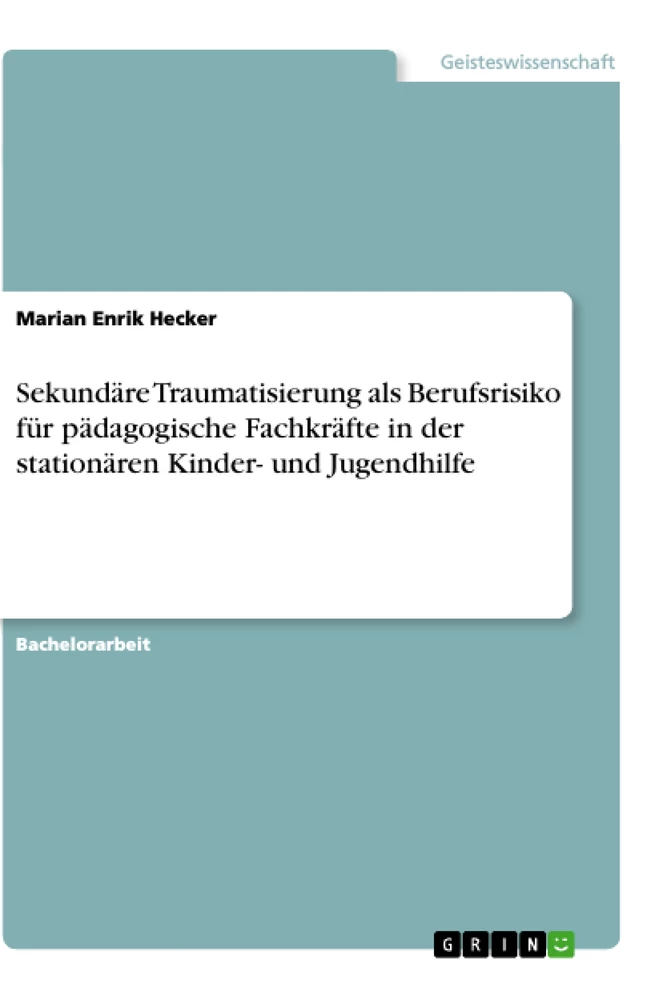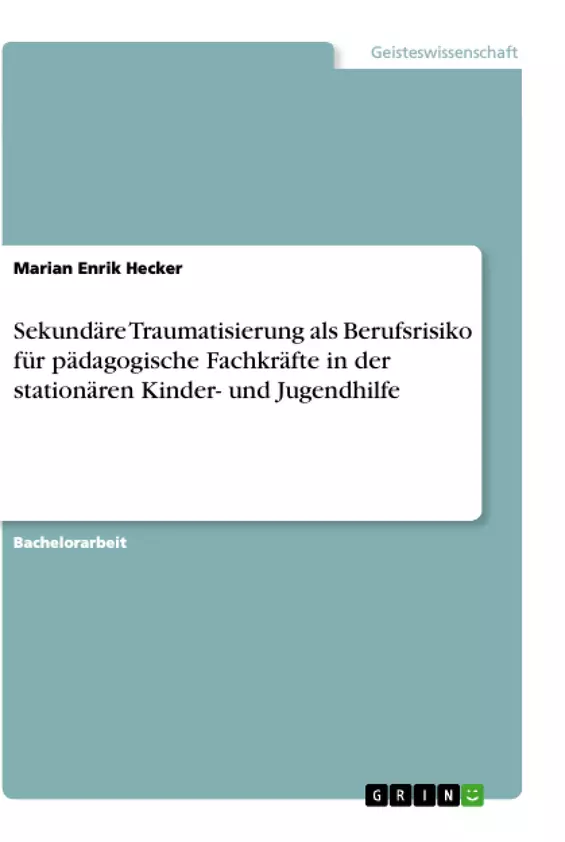Im Bereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe sind die pädagogischen Fachkräfte tagtäglich hohen Belastungen ausgesetzt. Durch die ständige Konfrontation mit den traumatischen Erlebnissen der Heimkinder erfahren die Pädagogen viel von deren Leid. Ein Großteil der Betroffenen trägt die Sorgen der Heimkinder mit nach Hause und entwickelt schließlich selbst Traumatisierungssymptome. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Sekundären Traumatisierung. Im fachlichen Diskurs erhält diese Problematik noch nicht die gebotene Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund widmet sich diese Forschungsarbeit folgenden Fragestellungen:
1. Inwiefern können die Arbeitsumstände im Feld der stationären Kinder- und Jugendhilfe die Entstehung einer Sekundären Traumatisierung beim pädagogischen Fachpersonal begünstigen?
2. Welche Maßnahmen können der Entstehung einer Sekundären Traumatisierung vorbeugen?
Zur Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellungen ist als Untersuchungsmethode eine ausführliche Literaturrecherche in unterschiedlichen Datenbanken und Bibliothekskatalogen sowie dem Internet durchgeführt worden.
In Bezug auf die erste Frage hat sich gezeigt, dass der ständige Umgang mit traumatisierten Kindern sowie ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen die Entstehung einer Sekundären Traumatisierung begünstigen. Identifizieren sich die Sozialarbeiterinnen zu sehr mit der Opferrolle der Heimkinder, dann verspüren sie deckungsgleich deren Gefühle der Angst und Hilflosigkeit. Man spricht in diesem Kontext auch von einer konkordanten Gegenübertragungsreaktion. Können diese Gegenübertragungsgefühle von der pädagogischen Fachkraft nicht bewältigt werden, dann kann dies zu einer Sekundären Traumatisierung führen. Um die Mitarbeiter vor einer solchen Belastungsstörung zu schützen, eignen sich diverse Maßnahmen. Die Leitungsebene steht in der Verantwortung, für schutzbringende Rahmenbedingungen zu sorgen. Auf der Teamebene stellen die gemeinsame Teilnahme an Fallberatungen und Supervisionen sowie eine unterstützende Teamkultur wesentliche Schutzfaktoren dar. Auf individueller Ebene eignen sich insbesondere die Selbstreflexion, die Aneignung von Sachkompetenz sowie die Anwendung von Methoden der Selbstfürsorge.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anlass und Ausgangssituation
- Forschungsleitende Fragen und gesellschaftliche Relevanz.
- Methodisches Vorgehen
- Aufbau der Arbeit......
- Traumatisierungen bei Kindern und Jugendlichen
- Was ist ein Trauma? - Traumadefinition
- Klassifikation von Traumata ......
- Traumatische Ereignisse in Kindheit und Adoleszenz.
- Traumafolgestörungen im Kindes- und Jugendalter.
- Traumatisierte Kinder und Jugendliche in der stationären Jugendhilfe..........\li>
- Gesetzliche Einordnung nach §34 und §35a SGB VIII.
- Die Problemlagen der jungen Menschen aus der stationären Jugendhilfe
- Beziehungsdynamiken zwischen traumatisierten Kindern und pädagogischen Fachkräften...\li>
- Bindungsorientierte Pädagogik als Voraussetzung für Übertragungsphänomene
- Die Rolle der Übertragung und Gegenübertragung in der Beziehungsgestaltung.....
- Sekundäre Traumatisierung bei psychosozialen Fachkräften
- Differenzierung zwischen Primärer und Sekundärer Traumatisierung..\li>
- Theoriemodelle zur Sekundären Traumatisierung..\li>
- Compassion Fatigue (C. R. Figley).
- Vicarious Traumatization (L. A. Pearlman).
- Neuropsychologisches Modell (J. Daniels)...
- Gegenüberstellung
- Abgrenzung zum Burnout-Syndrom .....
- Das Vorkommen Sekundärer Traumatisierung in der Kinder- und Jugendhilfe\li>
- Die Bedeutung der konkordanten Gegenübertragung auf die Entwicklung einer Sekundären Traumatisierung...\li>
- Prävalenzstudie zur Sekundären Traumatisierung in der Kinder- und Jugendhilfe ......
- Rahmenbedingungen und Methoden zum Schutz des pädagogischen Fachpersonals............
- Unterstützungsangebote auf Einrichtungs- und Leitungsebene
- Unterstützungsangebote auf Teamebene
- Methoden zur Entlastung auf persönlicher Ebene ……………………
- Zusammenfassung und Ausblick..\li>
- Beantwortung der Fragestellungen
- Forschungsausblick und Fazit........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema der sekundären Traumatisierung bei pädagogischen Fachkräften in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Sie analysiert die Entstehung und die Auswirkungen von sekundärer Traumatisierung im Kontext der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen.
- Die Arbeit beleuchtet die Definition und Klassifikation von Traumata sowie die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche.
- Sie untersucht die spezifischen Herausforderungen, denen pädagogische Fachkräfte in der stationären Jugendhilfe im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen gegenüberstehen.
- Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Theoriemodelle der sekundären Traumatisierung und untersucht deren Relevanz für die Praxis.
- Darüber hinaus werden Rahmenbedingungen und Methoden zum Schutz des pädagogischen Fachpersonals vorgestellt und diskutiert.
- Die Arbeit widmet sich der Abgrenzung der sekundären Traumatisierung zum Burnout-Syndrom.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, erläutert die Forschungsleitenden Fragen und die gesellschaftliche Relevanz sowie das methodische Vorgehen.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Thematik der Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen. Hier werden die Definition und Klassifikation von Traumata sowie die Auswirkungen traumatischer Ereignisse auf Kinder und Jugendliche behandelt.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf traumatisierte Kinder und Jugendliche in der stationären Jugendhilfe. Dabei werden die gesetzliche Einordnung, die Problemlagen der Kinder und Jugendlichen sowie die Beziehungsdynamiken zwischen den jungen Menschen und den pädagogischen Fachkräften beleuchtet.
Kapitel vier widmet sich der sekundären Traumatisierung bei psychosozialen Fachkräften. Hier wird die Differenzierung zwischen primärer und sekundärer Traumatisierung erläutert sowie verschiedene Theoriemodelle der sekundären Traumatisierung vorgestellt und verglichen.
Kapitel fünf befasst sich mit Rahmenbedingungen und Methoden zum Schutz des pädagogischen Fachpersonals. Es werden Unterstützungsangebote auf Einrichtungs-, Team- und persönlicher Ebene vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Trauma, Traumatisierung, sekundäre Traumatisierung, pädagogische Fachkräfte, stationäre Kinder- und Jugendhilfe, Bindungsorientierte Pädagogik, Übertragungsphänomene, Gegenübertragung, Compassion Fatigue, Vicarious Traumatization, Burnout-Syndrom, Prävalenzstudie.
- Quote paper
- Marian Enrik Hecker (Author), 2020, Sekundäre Traumatisierung als Berufsrisiko für pädagogische Fachkräfte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1118302