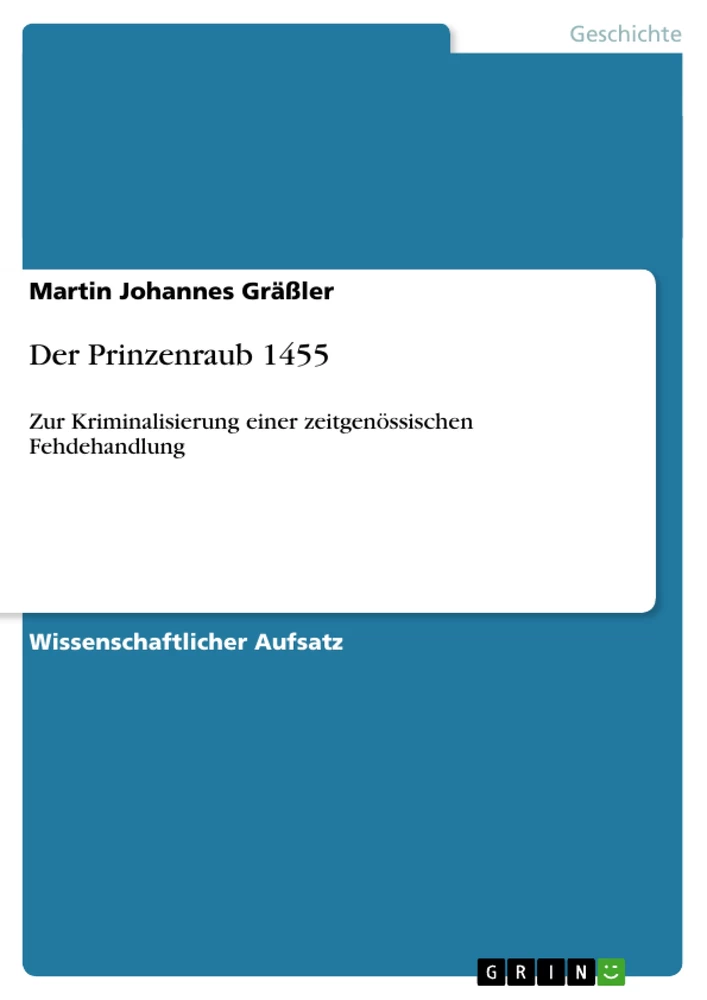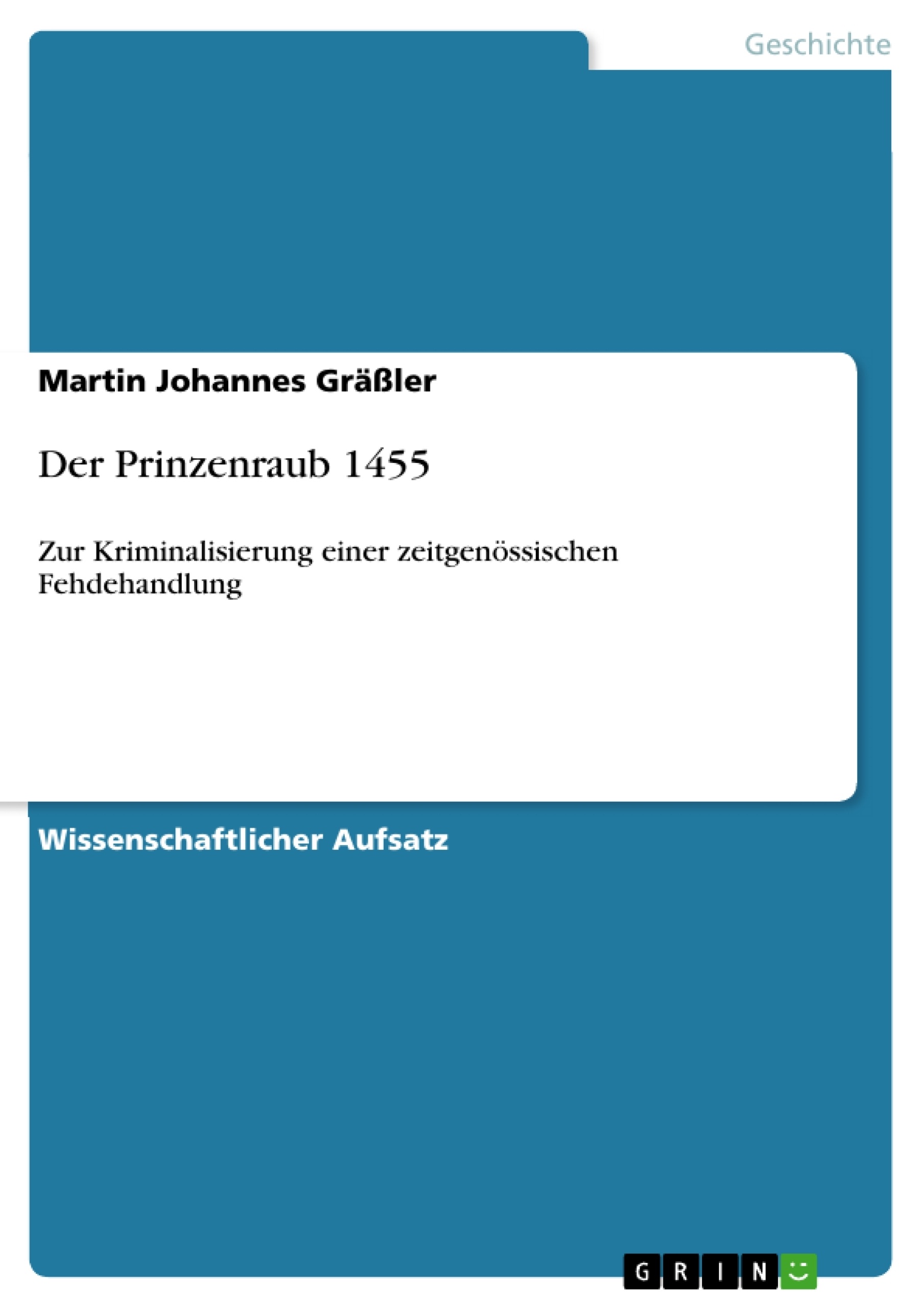Am 14. Juli des Jahres 1455 starb in Freiberg ein Mann unter dem Schwert des Henkers, dessen Tat bis heute Anlass für zahlreiche Kontroversen bietet und welche bereits die Zeitgenossen des Unglücklichen beschäftigte. Die Rede ist von Kunz von Kaufungen und seine Tat oder auch Untat war der berühmt gewordene „Altenburger Prinzenraub“ in der Nacht auf den 8. Juli 1455. Die vorliegende Arbeit möchte klären, ob und inwieweit die Tat des ehemals in kurfürstlichen Diensten stehenden Edelmannes von den damals in Geltung befindlichen Regeln der Fehdeführung abwich.
Inhaltsverzeichnis
1 Vorbemerkung
2 Die Motive und rechtliche Maßnahmen im Vorfeld der Fehde
2.1 Beweggründe
2.2 Versuche der rechtlichen Einigung
3 Der Prinzenraub und die üblichen Regeln der Fehdeführung
3.1 Fehdebrief
3.2 Fehdeführung
3.3 Kriminalsierung
4 Schlussbetrachtung
5 Quellen- und Literaturverzeichnis
5.1 Quellen
5.2 Literatur
1 Vorbemerkung
Am 14. Juli des Jahres 1455 starb in Freiberg ein Mann unter dem Schwert des Henkers, dessen Tat bis heute Anlass für zahlreiche Kontroversen bietet und welche bereits die Zeitgenossen des Unglücklichen beschäftigte. Die Rede ist von Kunz von Kaufungen[1] und seine Tat oder auch Untat war der berühmt gewordene „Altenburger Prinzenraub“ in der Nacht auf den 8. Juli 1455. Die vorliegende Arbeit möchte klären, ob und inwieweit die Tat des ehemals in kurfürstlichen Diensten stehenden Edelmannes von den damals in Geltung befindlichen Regeln der Fehdeführung abwich.
In den einzelnen Abschnitten der Arbeit wird deshalb zuerst die gebräuchliche Praxis der mitunter auch schriftlich fixierten Gewohnheiten beschrieben und anschließend mit den Ereignissen des „Prinzenraubes“ verglichen. Zu Beginn werden die üblichen Beweggründe benannt, die im späten Mittelalter zu einer Fehdeeröffnung führen konnten, wobei die Darlegung der Motive des Kunz von Kaufungen im anschließenden Vergleich erfolgt. Aber auch nach einem gegebenen Streitfall durfte nicht sofort eine offene Feindschaft erklärt werden. Vielmehr wurde zuerst eine friedliche Beilegung des Streitfalles über Gerichte oder Schiedsleute versucht. Erst mit dem Scheitern einer gütlichen Einigung konnte eine Fehde in adligen Kreisen als rechtens angesehen werden. Inwieweit sich der Entführer der beiden Prinzen im Vorfeld der Tat auf diese Versuche eingelassen hatte, wird an dieser Stelle diskutiert.
Mit dem Scheitern der friedlichen Konfliktbeilegung sollte eine förmliche Ankündigung der Feindschaft erfolgen, welche gewissen Ansprüchen in Form, Inhalt und Übergabe erfüllen musste. Der Fehdebrief schied die Fehde vom gesetzlosen Überfall und war für die juristische Bewertung der Tat von entscheidender Bedeutung. Es muss geklärt werden, ob die Fehdeeröffnung seitens des Kunz von Kauflingen gegen den sächsischen Kurfürsten in diesen Punkten ordnungsgemäß erfolgte. Aber auch in der Durchführung der Fehde gab es, wenngleich wenige und häufig missachtete, Regeln, die die schlimmsten Schäden gegenüber Land und Leuten begrenzen sollten. Verstieß der Entführer gegen diese Regel oder folgte er den üblichen Gepflogenheiten, welche in der Auseinandersetzung annehmbar waren. Da letztlich die Verurteilung erfolgte, ist es zudem aufschlussreich zu fragen, warum ein derart hartes Urteil gegenüber einem Adligen verhängt wurde. Welche Gründe waren neben den etwaigen Regelverstößen für die Verurteilung auschlaggebend und wie ist die Reaktion des Kurfürsten im Kontext der Zeit einzuordnen?
Die vorliegende Arbeit soll neben der gängigen Literatur die zahlreichen wissenschaftlichen Aufsätzen berücksichtigen, die im Rahmen eines äußerst bemerkenswerten Sammelbandes zum Thema „Prinzenraub“ erschienen sind.[2] Hier erfolgte erstmalig eine Einordnung der einzelnen Tat in den gesamten Kontext der Zeit. Neben gesellschaftlichen, juristischen und anderen Blickwinkeln wurden ebenfalls zahlreiche Quellentexte editiert, die das Verständnis für den berühmten „Altenburger Prinzenraub“ erweitern und beachtlich ergänzen dürften.
2 Die Motive und rechtliche Maßnahmen im Vorfeld der Fehde
2.1 Beweggründe
Die Fehde, welche hier als gewaltsame und durch Regeln beschränkte Form der Selbsthilfe verstanden werden soll,[3] war sowohl im Mittelalter als auch im Übergang zur Frühen Neuzeit ein häufig vorkommendes Mittel zur Durchsetzung von Interessen.[4] Dabei steht die Rechtmäßigkeit oder auch moralische Richtigkeit der verfolgten Sache nicht im Vordergrund, sondern lediglich die Einhaltung der üblichen Regeln zu Fehdeführung.[5] Eine rechtliche Unterscheidung zwischen Krieg und Fehde war im Mittelalter nicht vorhanden, genau sowenig wie die Ausweitung der Auseinandersetzung keine trennscharfe Unterscheidung zwischen beiden Begriffen zulässt.[6]
Dennoch gibt es immer wieder auftretende Motive, welche als Grund für einen Rechtsanspruch und schließlich die Eröffnung der Feindseligkeiten herhalten mussten. Besonders häufig tritt die Schadensfehde auf, bei welcher dem Fehdeansagenden ein Schaden zugefügt wurde, der nicht wiederhergestellt wurde. Diese Schädigung konnte von Diebstahl, Gefangennahme bis hin zur Tötung von Untertanen reichen. Fehden, welche aus Vertragsverletzungen herrührten, fallen ebenfalls unter die Form der rechten Fehde.[7] Hierbei war der Zweck der Befehdungen den Gegner zu Verhandlungen über den fraglichen Sachverhalt zu zwingen, um einen Ausgleich herbeizuführen.[8]
Von letztgenannter Form sind noch die unrechten oder auch mutwilligen Fehden abzugrenzen. Diese wurden aus Rache, politischen Zielen, Habgier oder auch aus Angst vor Verfolgung geführt,[9] wobei jeder erdenkliche Anlass als casus belli herhalten konnte.[10] Insbesondere wirtschaftliche Gründe waren für den niederen Adel immer wieder ausschlaggebend,[11] so dass ein großer Teil der Fehden eher organisierten Raubzügen glich.[12] Gleich ob rechtens oder nicht, dürfte diese theoretische Unterscheidung für die betroffenen Untertanen kaum eine Rolle gespielt haben, da sich die Mittel, welche Brandschatzen, Plünderung und eben auch Geiselnahme einschlossen, kaum unterschieden.[13]
Auch der Entführer der sächsischen Prinzen, Kunz von Kaufungen, hatte Motive für seine Tat, welche er stets als rechtmäßige Fehde in eigener Sache verstand. In den Jahren vorher unterstützte er den sächsischen Kurfürsten als Fehdehelfer in der ersten Phase des sächsischen Bruderkrieges zwischen 1446-1451. Dieser Dienst war für ihn bis zum Friedensschluss von Naumburg am 27. Januar 1451 ein sehr einträgliches Geschäft, brachte ihm Geld und eine eigene Burg samt zugehörigen Dörfern.[14] Selbst während des Waffenstillstandes im Jahre 1448 führte er die Feindseligkeiten nach eigenem Interesse fort, wobei er einen Wagenzug überfiel und ein beträchtliches Lösegeld für die später freigelassenen Geiseln erhielt.[15] Trotz dieser Taten unterschied er sich nicht von seinen Standesgenossen und auch wenn spätere Historiker in Kunz von Kaufungen einen „Raubritter“ sahen, war er vielmehr ein zeitgemäßer Adliger.[16] Er bestritt seinen Lebensunterhalt mittels seiner militärischen Fähigkeiten, welche als klug und kühn beschrieben werden.[17] Seine militärischen Aktionen vor dem Prinzenraub 1455 dürften folglich eher als Kriegsdienst, denn als wirkliche Fehdetätigkeit zur Durchsetzung eigener Interessen außerhalb von Verdienst gesehen werden.[18]
[...]
[1] Mittunter auch Kauffungen geschrieben.
[2] Emig, Joachim, u.a. (Hrsg.), Der Altenburger Prinzenraub 1455. Strukturen und Mentalitäten eines spätmittelalterlichen Konflikts, Beucha 2007.
[3] Reinle, Christine, Fehdeführung und Fehdebekämpfung am Ende des Mittelalters, in: Emig, Joachim, u.a. (Hrsg.), Der Altenburger Prinzenraub 1455. Strukturen und Mentalitäten eines spätmittelalterlichen Konflikts, Beucha 2007, S. 88.
[4] Thieme, André , Zum Fehdewesen in Mitteldeutschland. Grundlinien der Entwicklung im 15. und 16. Jahrhundert, in: Emig, Joachim, u.a. (Hrsg.), Der Altenburger Prinzenraub 1455. Strukturen und Mentalitäten eines spätmittelalterlichen Konflikts, Beucha 2007, S. 51f. Die Fehde in Mitteldeutschland war auch noch im 16. Jahrhundert stark präsent und ist Mittnichten ein rein mittelalterliches Phänomen.
[5] Müller-Tragin, Christoph, Die Fehde des Hans Kolhase. Fehderecht und Fehdepraxis zu Beginn der frühen Neuzeit in den Kurfürstentümern Sachsen und Brandenburg, Zürich 1997, S. 8.
[6] Thieme, Beucha 2007, S. 51f.
[7] Müller-Tragin, Zürich 1997, S. 16f.
[8] Reinle, Beucha 2007, S. 90.
[9] Müller-Tragin, Zürich 1997, S. 16f.
[10] Frank, Niklas, Raubritter. Reichtum aus dem Hinterhalt. Das erschröckliche und geheime Leben der Heckenreiter und Wegelagerer. Dem Andenken der adligen Halunken und ihrer gebeutelten Pfeffersäcke gewidmet, München 2002, S. 410.
[11] Sattler, Hans-Peter, Die Ritterschaft der Ortenau in der spätmittelalterlichen Wirtschaftskrise. Eine Untersuchung ritterlicher Vermögensverhältnisse im 14. Jahrhundert, Heidelberg 1962, S. 69. Im Fazit betont der Autor, dass negative Entwicklungen der gesamten Wirtschaft, den Ritteradel im Besondern trafen.
[12] Rösener, Werner, Zur Problematik des spätmittelalterlichen Raubrittertums, in: Maurer, Helmut (Hrsg.), Festschrift für Berent Schwineköper zu seinem siebzigsten Geburtstag, Sigmaringen 1982, S. 471f.
[13] Frank, München 2002, S. 409-411.
[14] Reinle, Beucha 2007, S. 92-96.
[15] Groß, Reiner, Der Prinzenraub. Eine Rekonstruktion des Geschehens, Emig, Joachim, u.a. (Hrsg.), Der Altenburger Prinzenraub 1455. Strukturen und Mentalitäten eines spätmittelalterlichen Konflikts, Beucha 2007, S. 222.
[16] Thieme, Beucha 2007, S. 77.
[17] Groß, Eberhard, Der sächsische Prinzenraub 1455, Schwarzenberg 2004, S. 2.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis listet folgende Abschnitte auf: Vorbemerkung, Die Motive und rechtliche Maßnahmen im Vorfeld der Fehde (einschließlich Beweggründe und Versuche der rechtlichen Einigung), Der Prinzenraub und die üblichen Regeln der Fehdeführung (einschließlich Fehdebrief, Fehdeführung und Kriminalisierung), Schlussbetrachtung, sowie Quellen- und Literaturverzeichnis.
Worum geht es in der Vorbemerkung?
Die Vorbemerkung thematisiert den "Altenburger Prinzenraub" von 1455 durch Kunz von Kaufungen und die Frage, ob dessen Tat von den damaligen Regeln der Fehdeführung abwich. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, beginnend mit den üblichen Beweggründen für eine Fehde im späten Mittelalter, den Versuchen einer friedlichen Einigung und der formellen Ankündigung der Feindschaft.
Welche Beweggründe konnten im späten Mittelalter zu einer Fehdeeröffnung führen?
Häufige Beweggründe waren Schadensfehden (z.B. Diebstahl, Gefangennahme, Tötung von Untertanen) und Fehden aufgrund von Vertragsverletzungen. Es gab auch "unrechte" Fehden aus Rache, politischen Zielen, Habgier oder Angst vor Verfolgung, oft motiviert durch wirtschaftliche Interessen.
Welche Rolle spielte Kunz von Kaufungen im sächsischen Bruderkrieg?
Kunz von Kaufungen unterstützte den sächsischen Kurfürsten als Fehdehelfer in der ersten Phase des sächsischen Bruderkrieges (1446-1451). Dieser Dienst war für ihn einträglich, brachte ihm Geld und Besitz. Auch nach dem Waffenstillstand führte er Feindseligkeiten fort.
Was wird unter "Fehde" verstanden?
Die Fehde wird als gewaltsame und durch Regeln beschränkte Form der Selbsthilfe zur Durchsetzung von Interessen verstanden.
Wie wurde zwischen Krieg und Fehde unterschieden?
Eine scharfe rechtliche Unterscheidung zwischen Krieg und Fehde war im Mittelalter nicht vorhanden.
Was ist eine Schadensfehde?
Eine Schadensfehde entsteht, wenn dem Fehdeansagenden ein Schaden zugefügt wurde, der nicht wiederhergestellt wurde.
Was sind "unrechte" oder "mutwillige" Fehden?
Diese wurden aus Rache, politischen Zielen, Habgier oder auch aus Angst vor Verfolgung geführt.
Welche wirtschaftlichen Gründe spielten eine Rolle bei Fehden?
Wirtschaftliche Gründe waren besonders für den niederen Adel oft ausschlaggebend, wobei viele Fehden organisierten Raubzügen ähnelten.
In welchen Rahmen wird die Arbeit gestellt?
Die vorliegende Arbeit berücksichtigt neben gängiger Literatur zahlreiche wissenschaftliche Aufsätze aus einem Sammelband zum Thema „Prinzenraub“.
- Quote paper
- cand. paed. Martin Johannes Gräßler (Author), 2008, Der Prinzenraub 1455, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111844