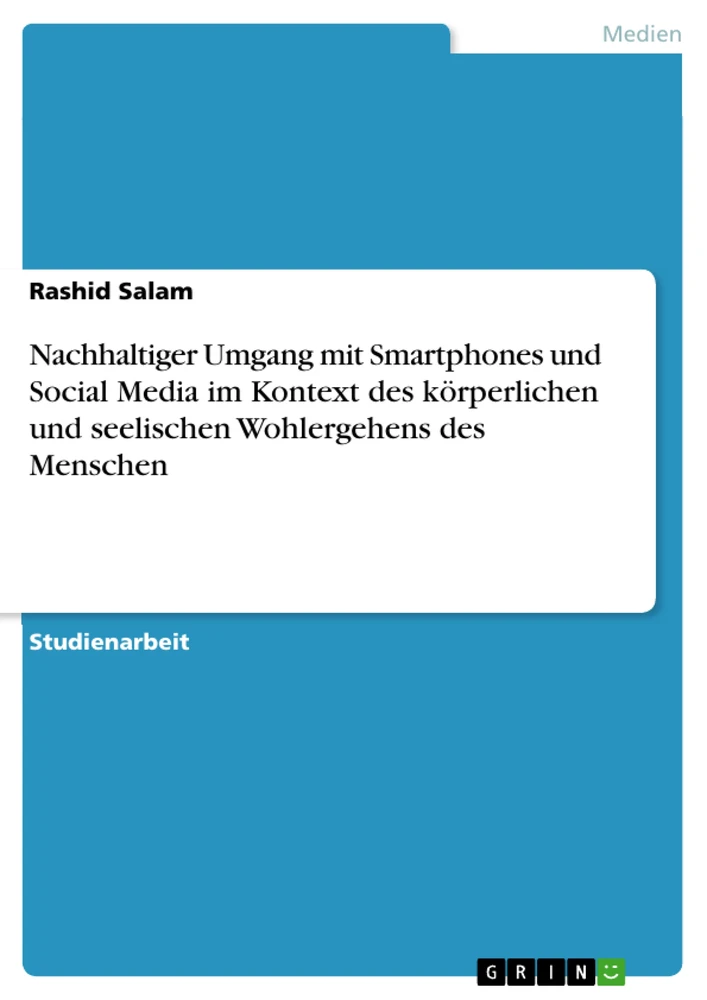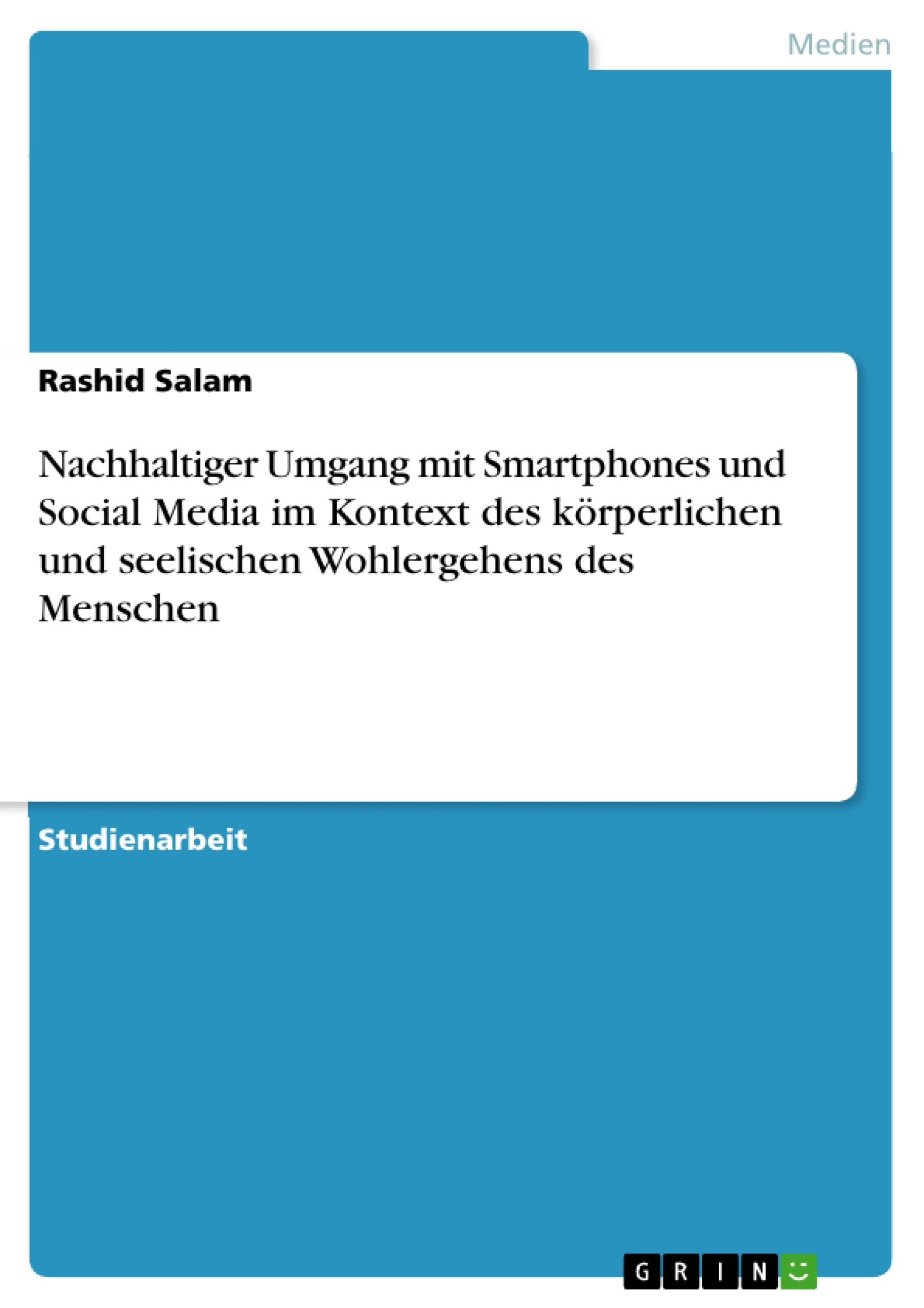Diese Arbeit widmet sich der Aufklärung über die gesundheitlichen Risiken der Smartphone- und Social-Media-Nutzung und liefert potenzielle Ansätze, die zu einer nachhaltigen Nutzung beitragen könnten. Das Thema ist folglich relevant im Rahmen der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und fällt unter das dritte Ziel "Gesundheit und Wohlergehen", das ein "gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern" soll.
Zu den Zielvorhaben zählen unter anderem die Reduktion der Opfer von Verkehrsunfällen und die Prävention von Substanzmissbrauch. Zum erstgenannten Punkt hat das Thema dieser Arbeit einen direkten Bezug, da die Smartphone-Nutzung im Straßenverkehr vermehrt zu Unfällen geführt hat. Auch die Prävention von Abhängigkeit – wenn auch nicht substanzgebunden – und anderen seelischen und körperlichen Leiden, wird in dieser Arbeit thematisiert.
Menschen nutzen Smartphones täglich für viele verschiedene Aufgaben. Sie sind oft das Erste was wir sehen, wenn wir aufwachen und das Letzte was wir sehen, wenn wir schlafen gehen. Die praktischen Universalgeräte haben allerdings nicht nur Vorteile, sondern bergen auch viele Risiken für Körper und Geist. Insbesondere die unaufgeklärte Nutzung von Social Media unter Kindern und Jugendlichen kann gravierende körperliche und seelische Folgen nach sich ziehen. Die Arbeit soll über die möglichen Risiken aufklären und liefert potenzielle Ansätze zur Vorbeugung bzw. nachhaltigen Nutzung von Smartphones und Social Media.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Smartphone- und Social-Media-Nutzung im Alltag
- 2.1 Seelische Auswirkungen
- 2.1.1 Minderwertigkeitskomplexe und Depressionen
- 2.1.2 Digitale Abhängigkeit
- 2.2 Körperliche Auswirkungen
- 2.2.1 Orthopädische Erkrankungen
- 2.2.2 Bewegungsmangel und Übergewicht
- 2.2.3 Kurzsichtigkeit
- 3. Nachhaltiger Umgang mit Smartphones und Social Media
- 3.1 Ansätze zur Reduktion negativer seelischer Auswirkungen
- 3.1.1 Bestimmen und Realisieren des riskanten Nutzverhaltens
- 3.1.2 Digitale Abstinenz: Einlegen von Auszeiten
- 3.1.3 Ändern des Nutzverhaltens
- 3.2 Ansätze zur Reduktion negativer körperlicher Auswirkungen
- 3.2.1 Mangel körperlicher Aktivität feststellen
- 3.2.2 Gamification von Bewegung und Sport 4.0
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den gesundheitlichen Risiken, die mit der Nutzung von Smartphones und Social Media einhergehen. Sie analysiert die Auswirkungen auf die seelische und körperliche Gesundheit und bietet potenzielle Ansätze für einen nachhaltigen Umgang mit diesen Technologien. Dabei stehen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen im Fokus, insbesondere das dritte Ziel "Gesundheit und Wohlergehen".
- Seelische Auswirkungen von Smartphone- und Social-Media-Nutzung, wie Minderwertigkeitskomplexe, Depressionen und digitale Abhängigkeit
- Körperliche Auswirkungen wie orthopädische Erkrankungen, Bewegungsmangel, Übergewicht und Kurzsichtigkeit
- Ansätze zur Reduktion negativer seelischer Auswirkungen durch Verhaltensänderungen und digitale Auszeiten
- Ansätze zur Reduktion negativer körperlicher Auswirkungen durch die Förderung von Bewegung und Sport
- Nachhaltige Nutzung von Smartphones und Social Media im Kontext des körperlichen und seelischen Wohlergehens
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Smartphone- und Social-Media-Nutzung ein und beleuchtet die steigende Nutzungsdauer sowie die damit verbundenen Herausforderungen für das individuelle Wohlbefinden. Kapitel 2 analysiert die seelischen und körperlichen Auswirkungen der exzessiven Mediennutzung. Hierbei werden Themen wie Minderwertigkeitskomplexe, Depressionen, digitale Abhängigkeit, orthopädische Erkrankungen, Bewegungsmangel und Kurzsichtigkeit behandelt. Kapitel 3 stellt verschiedene Ansätze für einen nachhaltigen Umgang mit Smartphones und Social Media vor, um die negativen Auswirkungen zu minimieren. Dazu gehören die Bestimmung des riskanten Nutzverhaltens, das Einlegen von digitalen Auszeiten, die Veränderung des Nutzverhaltens und die Förderung von Bewegung und Sport. Kapitel 4 fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Forschungsbedarfe.
Schlüsselwörter
Smartphone-Nutzung, Social-Media-Nutzung, seelische Gesundheit, körperliche Gesundheit, digitale Abhängigkeit, Nachhaltigkeitsziele, Bewegung, Sport, Gamification, Gesundheitsrisiken, Wohlbefinden, Medienkompetenz, digitale Auszeiten.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Bezug hat das Thema zu den UN-Nachhaltigkeitszielen?
Die Arbeit ordnet sich unter das dritte Ziel "Gesundheit und Wohlergehen" ein, das ein gesundes Leben für alle Menschen fördern und Risiken minimieren soll.
Welche seelischen Risiken birgt die Nutzung von Social Media?
Zu den untersuchten Risiken gehören Minderwertigkeitskomplexe, Depressionen und die Entwicklung einer digitalen Abhängigkeit.
Welche körperlichen Auswirkungen werden in der Arbeit genannt?
Thematisiert werden orthopädische Erkrankungen (z.B. durch Fehlhaltung), Bewegungsmangel, Übergewicht und die Zunahme von Kurzsichtigkeit.
Was versteht man unter 'digitaler Abstinenz'?
Es handelt sich um einen Lösungsansatz, bei dem bewusst Auszeiten von digitalen Geräten genommen werden, um die negativen seelischen Folgen zu reduzieren.
Wie kann 'Gamification' zu einer gesünderen Nutzung beitragen?
Gamification wird als Ansatz zur Förderung von Bewegung und Sport genutzt, um den durch Smartphone-Nutzung bedingten Bewegungsmangel spielerisch auszugleichen.
Warum ist das Thema für den Straßenverkehr relevant?
Die Arbeit weist darauf hin, dass Smartphone-Nutzung im Straßenverkehr vermehrt zu Unfällen führt, was ein direktes Gesundheitsrisiko darstellt.
- Quote paper
- Rashid Salam (Author), 2021, Nachhaltiger Umgang mit Smartphones und Social Media im Kontext des körperlichen und seelischen Wohlergehens des Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1118649